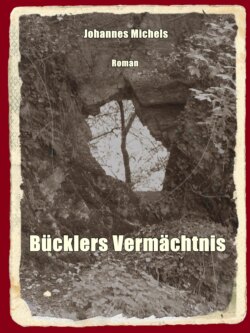Читать книгу Bücklers Vermächtnis - Johannes Michels - Страница 3
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Prolog
ОглавлениеIch weiß, daß ich unendlich viele, mehr oder weniger strafbare Verbrechen begangen habe: Nur meine äusserste Jugend, ein Zusammentreffen unglüklicher Umstände, die Unmöglichkeit, in welcher ich mich befunden habe, eine andere Lebensart wieder zu beginnen, meine lebhaft Reue und mein Benehmen als Räuber selbsten, endlich die offenherzige Angabe meiner Verbrechen und meiner Mitschuldigen, können meine Hoffnung auf die Gnade der Regierung aufrecht erhalten.
...
In dem aufrichtigen Geständniß meiner Verbrechen ersah ich das einzige Mittel, selbige in soweit es von mir abhieng, auszusöhnen, und die Uebel, welche ich der Gesellschaft zugefügt habe, zu verbessern; ich überlasse denjenigen, die mich urtheilen werden, zu erwägen, ob ich diese Verbindlichkeit, welche ich mir aufgelegt, erfüllt habe; und welches auch mein Schiksal seyn mag, ich werde mich ihm mit Standhaftigkeit unterziehen; nur zu unglüklich, wenn es mir nicht mehr erlaubt ist, der Gesellschaft durch rechtschaffende Handlungen Unterpfänder der Aufrichtigkeit meiner Reue geben zu können.
Johannes Bückler, genannt Schinderhannes
Mainz, 18. März 1803
Soonwald 1802
Frederic Foch hieb seine Fersen in die Flanken des Pferdes. Das Pferd war sichtlich erschöpft, aber er duldete dem Tier und sich keine Pause. Schwer schnaubend nahm der Hengst den Hang. Sein Fell glänzte vor Schweiß.
Als sie oben angekommen waren, straffte Foch die Zügel um das Pferd kurz anzuhalten. Er musste sich neu orientieren, denn dieser Wald, mit seinem undurchdringlichen Blätterwerk, ließ nur selten eine freie Sicht zu. Der Pfad auf dem er sich befand wand sich wie eine Schlange zwischen den Bäumen und dem Unterholz hindurch. Das ließ ihn nur mühsam voran kommen. Aber er wollte nicht die bequemere Hauptpassage durch diesen Wald wählen. Das wäre zu gefährlich.
Foch blickte in die Ferne. Er sah der untergehenden Sonne entgegen. In diese Richtung musste er reiten. Gen Westen. Nur weit weg vom Rhein und seinen Verfolgern.
So richtig konnte er noch gar nicht begreifen was geschehen war. Es war eine unüberlegte Handlung gewesen. Seine Gier hatte ihn in diese bedrohliche Lage gebracht und nun gab es keinen Weg zurück, wenn er denn nicht ins Zuchthaus, oder noch schlimmer, auf dem Schafott enden wollte.
Die Misere hatte schon begonnen als man ihn vor zwei Jahren in Nancy als Soldat in die französischen Armee rekrutierte.
Foch war ein einfacher junger Mann, geboren 1782 in einem Hinterhof in Nancy. Aufgezogen wurde er von seiner deutschen Mutter, die sich über Wasser hielt, in dem sie sich an Freier verkaufte. Der französische Vater war schon früh an Schwindsucht gestorben. Als Kind ging Foch betteln und stehlen um zu überleben. Später dann nahm er Gelegenheitsarbeiten an, wurde ein Tagelöhner, der das hart verdiente Geld abends in eine Schenke brachte und mit seinen Kumpanen vertrank. In ihrem Suff kamen sie auf manch dumme Gedanken und so ließen sie sich eines Abends, von jemandem der des Lesens und Schreibens mächtig war, ihre Namen auf die Schultern tätowieren. Ein anderes mal sprangen sie nackt, alkoholisiert und übermütig in die Meurthe. Oder sie lungerten in den schmalen Gassen Nancys herum und pöbelten die Leute an. Irgendwann zu dieser Zeit kam dann der Einberufungsbefehl. Levée en masse sei Dank. Foch hätte gut und gerne darauf verzichten können. Aber durch das 1798 in Kraft getretene Jourdan-Gesetz mussten sich alle unverheirateten Männer zwischen 18 und 25 Jahren registrieren lassen. Weiteres Kanonenfutter für weitere Kriege.
Foch hielt nichts von der Politik des Ersten Konsuls Napoleon Bonaparte. Für ihn war dieser nicht besser, als König Ludwig XVI. Ihm waren die Machtspielereien des kleinen Korsen zuwider. Viel wichtiger war Frederic Foch, dass er was zu beißen hatte. Und so zeigte sich die Armee anfänglich noch als Glücksgriff, denn hier gab es eine warme Mahlzeit pro Tag. Seine Dienste wurden geschätzt, da er zweisprachig aufgewachsen war und man ihn als Übersetzter in den annektierten Gebieten des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation einsetzen konnte. Sogar Sold fiel für ihn ab, auch wenn dieser mehr als dürftig war.
Aber die Kehrseite der Medaille zeigte sich sehr schnell. In der Schlacht bei Hohenlinden am 03. Dezember 1800 kam Foch zum ersten mal mit dem Feind in Berührung. Die französischen Truppen der Rheinarmee, einhunderttausend Soldaten an der Zahl, kämpften hier unter Befehl des General Jean-Victor Moreau, gegen die Alliierten aus Bayern und Österreich.
Nach diesem brutalen Gemetzel wachte Foch in der Nacht regelmäßig schweißgebadet auf, weil die Fratze des Krieges ihn in seinen Träumen verfolgte. Fallende Soldaten mit fehlenden Gliedmaßen, abgerissen von den Kanonenkugeln der feindlichen Truppen. Begleitet vom unheimlichen Rhythmus der Trommeln, der zum Angriff rief, vermischt mit dem Knallen der Mörser und Flinten und den Schreien der Verwundeten. Dazu kam der Pulvergestank, der einem fast den Atem raubte und unaufhörlich in den Augen brannte. Und er, Foch, mittendrin. Im Chaos gefangen, an seinem jämmerlichen Leben hängend. Besudelt mit Matsch, Blut und Urin. Er konnte von Glück reden, dass er diese Schlacht überlebt hatte. Tausende seiner Kameraden hatten dieses Glück nicht.
Nach dem Frieden von Lunéville am 09. Februar 1801 wurde Foch in der Departement-Hauptstadt Koblenz stationiert. Hier ging es etwas ruhiger zu.
Frankreich hatte seine Ostgrenze bis zum Rhein hin erweitert, was durch den Frieden von Lunéville anerkannt wurde. Die wichtigste Wasserstraße Mitteleuropas stellte jetzt die unmittelbare Grenze dar zwischen Frankreich und den jeweiligen Fürstentümern Deutschlands. Nun saßen sich die ehemaligen Feinde direkt gegenüber und beobachteten misstrauisch das Verhalten ihres verhassten Nachbarn.
Foch war froh, dass die Waffen endlich schwiegen. Zu sehr hing er an seinem Leben, als es aus Patriotismus herzugeben, von dem letztendlich er persönlich nichts hatte. Aber nicht nur der offene Kampf barg Gefahren in sich. Auch die Besatzung hielt Überraschungen bereit, die für Leib und Leben gefährlich werden konnten.
Über ein Jahr verbrachte er schon in der achttausend Einwohner zählenden Stadt. Morgens ging es zum Appell, danach zum Drill, oder zum Wachdienst. Seine freien Tage verbrachte er gerne in Tavernen, frönte dem Alkohol und dem Weibe.
An einem verregneten Apriltag im Jahre 1802, sollte sich sein Soldatenleben grundsätzlich verändern.
Foch war seit zwei Wochen einer Einheit zugeteilt, die sich 20 km vor den Toren Koblenz in einem Feldlager befand. Er war gerade dabei Latrinen vor dem Lager auszuheben, als er einen Trupp französischer Soldaten aufs Lager zureiten sah. Schon länger gingen Gerüchte im Lager umher, dass eine Abteilung direkt aus Paris auf dem Wege nach Koblenz sei. Mit Befehlen von Napoleon selbst für den Koblenzer Präfekten Adrien de Lezay-Marnesia. Normalerweise scherten Foch die Belange der Großen wenig. Er konzentrierte sich mehr auf sich selbst, aufs eigene Überleben. Aber hier und jetzt wo er mit einer Schaufel bewaffnet in einem Graben stand und der Regen ihn schon komplett durchnässt hatte, entstand eine seltsame Neugier in ihm als er die Abteilung Soldaten sah. War es der Instinkt vergangener Jahre, der ihn wachrüttelte, wenn es darum ging als Kind fette Beute zu machen, um zu überleben? Oder war es einfach die groteske Situation die dort vor ihm ablief?
Der Trupp bestand aus 20 Soldaten zu Pferd, die eine Kutsche flankierten und somit zum Mittelpunkt der Gruppe machten. Auf dem Bock saß ein junger Soldat niederen Ranges, der sichtlich erschöpft die Zügel hielt. Die Fenster der Kutsche waren durch Vorhänge zugezogen, so dass man keinen Einblick ins Innere hatte. Hinter der Kutsche befand sich ein Chef d’Escadron der sichtlich angespannt wirkte.
Foch kam es vor als ob dieser unmittelbar mit einem Angriff rechnete. Dennoch schien der Offizier sich immer mehr zu entspannen, je näher er dem Lager kam. Als der Trupp unmittelbar an Foch vorbeizog wurde der Vorhang des Kutschenfensters beiseite geschoben und ein Kopf lugte nach draußen, um wohl nachzusehen, ob man bald am Ziel sei. Foch fiel auf, dass es sich auch hier um einen jungen Soldaten handelte. Als der Chef d’Escadron den neugierigen Soldaten erblickte, wies er diesen durch ein schroffes Kommando an, den Kopf wieder einzuziehen und den Vorhang zu schließen. Foch sah deutlich die Nervosität im Gesicht des Chef d’Escadron. Dies war keine normale Depesche für den Präfekten. Das stand fest. Unter einem Vorwand meldete sich Foch bei seinem Korporal ab und folgte dem Trupp ins Lager, um zu sehen was geschehen würde.
Der Chef d’Escadron ließ direkt vor dem Zelt des Lagerkommandanten halten. Dann gab er weitere Befehle an seine Soldaten, die daraufhin absaßen und die Pferde versorgten. Auch die Kutsche wurde zu den Pferdeplätzen gebracht.
Der Chef d’Escadron saß ebenfalls ab, nahm seine zwei Satteltaschen vom Pferd, wuchtete sich diese über die Schultern und ging zum Zelt des Lagerkommandanten. Dann meldete er den Wachen seine Ankunft, die ihn sofort zum Kommandanten vorließen.
Mittlerweile hielt die Dämmerung Einzug. Vermischt mit dunklen Wolken und starken Regen, waren die Sichtverhältnisse stark gemindert. So stapfte Foch durch den aufgeweichten Boden bis kurz vors Zelt des Lagerkommandanten. Dann schlug er einen Haken, um von den Wachen nicht bemerkt zu werden und schlich sich so an die Zeltrückwand um zu lauschen. Der prasselnde Regen, der auf die Zeltplane fiel, schien dies fast unmöglich zu machen.
Aber dennoch konnte Foch die sonore Stimme des Lagerkommandanten Lefèvre hören.
»Es tut gut dich zu sehen, mein Freund La Fayette.«
»In der Tat«, entgegnete der Chef d’Escadron.
»Hier nimm platz«, hörte Foch den Lagerkommandanten sagen.
»Möchtest du einen Schluck Cognac zum aufwärmen?«
»Hört, hört. Echten Cognac in der tiefsten Provinz?«, scherzte La Fayette.
»Das sind die kleinen Vorteile, wenn man Commandant ist.«
Foch versuchte einen Blick ins Innere zu erhaschen, indem er sich die Verbindung zweier Zeltwände mit Lederriemen zu Nutze machte und den Schlitz zwischen ihnen ein wenig weitete. Nur soviel, um nicht entdeckt zu werden. Dann sah er ins Innere.
Das Zelt war für einen Lagerkommandanten eher spartanisch eingerichtet. Die Offiziere saßen an einem kleinen Schreibtisch, flankiert von der Trikolore. Landkarten lagen zusammengerollt auf einem kleinen Regal, was in der Ecke stand. Das Nachtlager konnte Foch durch den schmalen Schlitz nicht erkennen. Er vermutete es direkt vor sich hinter der Zeltplane.
Lefèvre stellte zwei Gläser auf den Schreibtisch. Dann öffnete er die Schreibtischtür und zog eine Flasche Cognac hervor. Stolz präsentierte er seinem Freund das edle Getränk, der es wohlwollend zur Kenntnis nahm. Der Lagerkommandant füllte die Gläser.
»Es ist lange her, dass wir so zusammengesessen haben«, sagte La Fayette und griff nach seinem Glas.
»Ja, über ein Jahr. Bei den Friedensverhandlungen in Lunéville«, erinnerte sich Lefèvre. Er nahm sein Glas und stieß mit La Fayette an. Genüsslich tranken sie einen Schluck.
Foch blickte neidisch auf ihr Tun. Nur allzu gerne hätte er den Cognac gekostet.
»Was ist eigentlich aus der Kleinen geworden, die du damals kennen gelernt hat?«
»Du meinst Josefine?«
»Ich meine die dralle Blondine mit dem üppigen Dekolleté.«
»Du meinst Josefine!«, stellte La Fayette amüsiert fest.
»Ja und?«
»Ich habe sie vor einem halben Jahr geheiratet.«
Lefèvre riss überrascht die Augen auf. »Ist es denn die Möglichkeit? Der größte Bettenhüpfer von ganz Paris hat sich einfangen lassen.«
»Irgendwann holt einen die Liebe halt ein.« La Fayette lehnte sich zurück und sah versonnen auf die goldbraune Flüssigkeit in seinem Glas.
»Aber der Liebe wegen muss man nicht gleich heiraten.«
La Fayette löste den Blick vom Glas und sah zu seinem Freund. »Dieses mal ist es etwas anderes. Es ist keine Liebelei. Ich möchte mit Josefine alt werden und Kinder haben. Am besten einen ganzen Stall voll.«
»Ich erkenne meinen alten Freund nicht wieder. Er ist sittsam geworden«, sagte Lefèvre in gespielt spöttischem Ton.
La Fayette musste lächeln. »Vielleicht.«
»Na, dann wünsche ich euch eine glückliche Zukunft. Santé.« Lefèvre hob sein Glas zum Gruß und trank.
La Fayette tat es ihm gleich. Dann wurde seine Miene ernst. »Ich brauche ein Nachtlager.«
»Wir haben zwar erst in ein paar Tagen mit euch gerechnet. Aber ich werde gleich veranlassen, dass Zelte für euch aufgestellt werden.« Der Lagerkommandant rief in Richtung Zeltausgang: »Wache.«
Ein Soldat trat ein und salutierte vor den Offizieren.
»Caporal, stellt Zelte auf für den Trupp aus Paris. Und ein gesondertes Zelt für den Chef d’Escadron, mit einer Wache davor.
»Jawohl, Commandant.« Der Soldat salutierte erneut, machte eine Kehrtwendung und verließ wieder das Zelt.
»Ich danke dir, mein Freund. Es war ein anstrengender Ritt von Paris bis hier her.« La Fayette löste den obersten Knopf seiner Uniformjacke. Ihm schien warm zu sein.
»Gab es Schwierigkeiten?«, wollte Lefèvre wissen.
»Nicht mit irgendwelchem Gesindel. Aber die Straßen hier sind für eine Kutsche alles andere als gut befahrbar.«
»Trotzdem wart ihr schnell unterwegs.«
»Napoleon möchte schnellst möglich seine Befehle in die Tat umgesetzt sehen. Da soll es nicht schon beim Überbringen der Depesche zu Verzögerungen kommen.«
»Nun, morgen wirst du den Präfekten erreichen. Coblence ist nicht mehr weit.« Dann deutete Lefèvre auf die Satteltaschen, die der Chef d’Escadron neben sich abgestellt hatte. »Aber wie ich sehe ist die Depesche nicht das einzige, das der Präfekt erwartet.«
La Fayette senkte die Stimme, als er antwortete: »Du hast recht und glaube mir eines, ich bin erleichtert wenn ich diese Taschen Adrien de Lezay-Marnesia übergeben habe.«
Lefèvre nickte verstehend. Dann begann er die Stirn zu runzeln. »Glaubst du es erfüllt seinen Zweck?«
La Fayette wischte sich eine Schweißperle von der Stirn. »Wir wissen doch beide, dass dieser Frieden nicht ewig halten wird. Und dann ist es besser gewappnet zu sein, nicht wahr? Informationen sind da das Wichtigste und die sind bekanntlich käuflich.« Zur Bekräftigung seiner Worte wies der Chef d´Escadron auf die in schwarzem Leder gehaltenen Satteltaschen.
Der Lagerkommandant nickte zustimmend. Dann veränderte sich seine Miene und er sah etwas angewidert auf die Bagage herab. »Ich hasse diese Ränkespiele.«
»Ich auch, aber der Erste Konsul befiehlt und wir gehorchen.«
Plötzlich schlug Lefèvre mit der Hand auf der Tisch. »Wie sieht es aus. Hast du schon etwas gegessen?«
»Dafür war noch keine Zeit.«
»Dann lass uns nachsehen, ob unser Koch noch etwas von seinem berühmten Eintopf übrig hat.« Lefèvre war aufgesprungen und kam um den Schreibtisch herum.
Auch La Fayette stand nun auf. Allerdings wirkte er etwas skeptisch. »Was meinst du mit berühmt?«
Der Lagerkommandant begann zu lachen. »Keine Angst, der Koch hasst keine streunenden Katzen.«
Nicht wirklich überzeugt von der Äußerung seines Freundes griff La Fayette dennoch nach den Satteltaschen und schulterte sie. Dann verließen die Offiziere weiter scherzend das Zelt des Lagerkommandanten.
Auch Foch löste sich von seinem Platz an der Zeltrückwand. Er kämpfte sich durch den immer noch fallenden Regen zurück zu den Latrinen, wo mittlerweile Laternen aufgestellt waren. Er meldete sich beim Korporal zurück und nahm die Arbeit wieder auf. Aber mit seinen Gedanken war er nicht beim Graben, sondern ganz wo anders. Auch später als er auf seiner Pritsche lag, ließen ihn die Gedanken an das Geschehene nicht los.
La Fayette schien auf einer bedeutenden Mission zu sein. So viel war sicher. Aber merkwürdig war es schon. Zwanzig Mann um eine Depesche zu transportieren. Der Soldat in der Kutsche, ein Chef d’Escadron, der für diese Truppenstärke einen zu hochdekorierten Rang besaß, dann die schweren Satteltaschen, die er unentwegt mit sich herum schleppte... All das ergab keinen Sinn, dachte Foch. Es sei denn..., sein Herz begann schneller zu schlagen, verstohlen sah er sich im Mannschaftszelt um, als ob jemand seine Gedanken erraten könnte. Aber um ihn herum war es ruhig. Die Soldaten lagen alle im Schlaf und ergaben sich ihren Träumen. Ein monotones Schnarchen lag in der Luft, das von ihrem Schlaf zeugte.
Es sei denn..., man berücksichtigte die Andeutungen La Fayettes. Dann machte plötzlich alles Sinn. In den Satteltaschen befand sich Geld oder Gold. Dies würde erklären warum die Taschen so schwer waren. Und weiter würde es erklären, warum sich ein Soldat in der Kutsche befand. Es war eine Finte. Sollte, aus welchen Gründen auch immer, dieser Transport nicht geheim bleiben und überfallen werden, so würden die vermeintlichen Räuber ihren Angriff auf die Kutsche konzentrieren. Der Chef d’Escadron hätte flüchten können. Plötzlich wurde Foch auch die Bedeutung des Kavallerieoffiziers klar. Diese Männer waren ausgezeichnete Reiter, mit ihrem Pferd fast verwachsen. Dass dieser sehr gut ausgebildete Offizier einer einfachen Räuberbande, die ohnehin ihre Beute in der Kutsche vermutete, leicht entkommen konnte stand außer Frage.
Fochs Mundwinkel umstrich ein Lächeln. So musste es sein. Aber warum sollte der Präfekt Adrien de Lezay-Marnesia dieses Geld bekommen? Foch erinnerte sich zurück, was La Fayette sagte: Wir wissen doch beide, dass dieser Frieden nicht ewig halten wird. Und dann ist es besser gewappnet zu sein, nicht wahr? Informationen sind da das Wichtigste und die sind bekanntlich käuflich.
Dafür brauchte der Präfekt das Geld, um Leute zu bestechen. Menschen, die wichtige Positionen in den Fürstentümern inne hatten, wie exempli gratia die Diener des Staates. Damit Frankreich wusste wie es auf der anderen Seite des Rheins aussah. Truppenbewegungen, Truppenstärke, wirtschaftliche Lage, Stimmung des Volkes, strategisch wichtige Punkte, all diese Informationen waren von enormer Bedeutung für Frankreich. Bedeutend deshalb, um Vorkehrungen treffen zu können, falls dieser Frieden zerbröckelte.
Foch gratulierte sich selbst zu seinem Scharfsinn. Aber was konnte er mit dieser Schlussfolgerung anfangen? Welchen Nutzen konnte er daraus ziehen? Fest stand, dass es eine ganze Menge Geld sein musste was sich in den Satteltaschen befand, höchst wahrscheinlich war es sogar Gold, wenn man bedachte wie schwer La Fayette daran trug. Die Menge würde mit Sicherheit ausreichen um ihm, Frederic Foch, ein sorgloses Leben zu bereiten. Der Gedanke soviel Geld sein Eigen nennen zu können gefiel ihm. Aber wie könnte er an dieses Geld heran kommen, fragte er sich. Schon morgen war es aus seiner Reichweite. So blieb nur die Nacht zum Handeln. La Fayette hatte die Satteltaschen bestimmt mit in sein Zelt genommen. Er würde sie wie seinen Augapfel hüten, dessen war sich Foch bewusst. Es war ein heikles Unterfangen sich ins Zelt zu schleichen und die Taschen zu stehlen. Dazu kam, dass das Zelt bewacht wurde. Und selbst wenn er es schaffen sollte unbemerkt mit den Taschen das Zelt zu verlassen, wie sollte es dann weitergehen? Foch war hin und her gerissen. Die Verlockung nach Reichtum kämpfte gegen die Angst entdeckt zu werden.
Er würde sich ein Pferd nehmen und gen Westen reiten, da ihm die Überquerung des Rheins zu gewagt erschien. Da er perfekt deutsch sprach, würde er unter der Bevölkerung keinen Verdacht erregen, er könnte untertauchen und dann einen neuen, ausgereifteren Plan schmieden, um weiter den Fängen der Armee zu entgehen. Je mehr er über das weitere Vorgehen nach erfolgreichem Diebstahl nachsann, umso größer wurde die Gewissheit, dass sein Vorhaben gelingen konnte.
Der Regen hatte nachgelassen, als Foch sich unter der Zeltwand nach draußen rollte. Nur noch vereinzelte Wolkenfetzen zogen vom Wind getrieben am Himmel entlang und der Vollmond lugte dann und wann zwischen ihnen hervor. Im Lager war es still.
Die Zelte als Schutz benutzend, schlich sich Foch zum Zelt des Chef d´Escadron. Er wusste genau wo es stand, denn es war das einzige neu aufgestellte Zelt, vor dem ein Soldat Wache schob. Zumindest sollte er dass. Aber der Wachsoldat kauerte neben dem verschlossenen Eingang auf dem Boden und war eingenickt.
Foch war erleichtert. Das würde die Sache vereinfachen. Darauf bedacht kein Geräusch zu erzeugen, schlich er sich von hinten ans Zelt. Er spürte wie seine Knie zu zittern begannen und sein Herz wie wild in der Brust hämmerte. Es war ein großes Risiko dem er sich da aussetzte und jetzt in diesem Augenblick bestand noch die Möglichkeit umzukehren. Ein innerer Kampf entbrannte noch einmal. Feigheit gegen Mut, Anstand gegen Gier, Vernunft gegen Torheit. Doch noch ehe dieser Kampf ausgefochten war, nahm Foch sein Messer aus der Tasche und durchschnitt die Lederriemen der Zeltwand und damit auch den Widerstreit seiner Gefühle und Gedanken. Geräuschlos zwängte er sich durch die Öffnung und verharrte in der Hocke. Die Dunkelheit im Zeltinnern ließ nichts erkennen und Foch wartete eine Weile, bis seine Augen sich an die Finsternis gewöhnt hatten. Langsam zeichneten sich Silhouetten ab und er erkannte genug um sich zurecht zu finden.
Schräg vor ihm lag der Chef d’Escadron auf einer Pritsche und schlief. Foch vernahm den regelmäßigen Atem des Offiziers. Sein Blick wanderte durch das Zelt und suchte nach den Taschen. Seine Augen flogen hastig von einer Ecke in die andere, ohne dass sie fündig wurden. Doch da, endlich, unter der Pritsche zeichneten sich schemenhaft die gesuchten Satteltaschen ab. Foch stöhnte innerlich auf. Er würde die Taschen nie unter der Pritsche hervorziehen können, ohne dass La Fayette erwachte. Langsam ließ sich Foch auf alle Viere herab und kroch weiter nach vorn zur Pritsche um die Lage besser einschätzen zu können. Er spürte wie seine Hosen an den Knien von dem aufgeweichten Boden durchnässt wurden, aber das war bedeutungslos. Foch war jetzt nur noch wenige Zentimeter von dem Feldbett entfernt. Er senkte seinen Kopf und erkannte nun ganz deutlich die Satteltaschen. Seine Einschätzung von vorhin bestätigte sich. Die Chance diese dort herauszuziehen, ohne dass der Chef d´Escadron erwachte, war äußerst gering. Aber um aufzugeben war es in Fochs Augen zu spät. Er war zu nah an seinem Ziel. Foch löste die Hände vom Boden und richtete sich auf. Er befand sich nun unmittelbar vor dem schlafenden Offizier. Auch jetzt vernahm er die Stimmen in seinem Innern, der Kampf schien sich aufs Neue zu entfachen. Und abermals nahm Foch das Messer, doch diesmal waren es keine Lederriemen die er durchschneiden wollte, sondern La Fayettes Kehle. Der Offizier lag auf der Seite und hatte ihm den Rücken zugewandt. Foch ergriff das volle, dunkle Haar des Soldaten und riss dessen Kopf brutal nach hinten, so dass die Kehle ungeschützt war. Seine Hand, die das Messer hielt, schnellte nach vorn. Foch vollzog einen kräftigen, tiefen Schnitt der sich vom einen Ohr bis zum anderen erstreckte. Sofort spritzte Blut aus den durchtrennten Halsschlagadern und schoss in einer gewaltigen Fontäne an die Zeltwand. Ein Röcheln entfuhr dem Offizier und in seinem Todeskampf begann er mit den Armen um sich zu schlagen, was Foch jedoch nicht gefährdete. Der Mann aus Nancy fixierte nun mit beiden Händen den sich windenden Körper des Opfers und wartete. Das Röcheln schwang um in ein Gurgeln, bedingt dadurch, dass sich das Blut in die eröffnete Luftröhre und somit in die Lunge ergoss. Seines Blutes beraubt ließen die verzweifelten Befreiungsversuche La Fayettes immer mehr nach, bis sein Körper schließlich in sich zusammenfiel und regungslos auf dem Feldbett verharrte. Foch wartete noch einen Augenblick, dann drehte er den Offizier auf den Rücken, um sich zu vergewissern, dass dieser tot war. Der stattgefundene Todeskampf stand La Fayette noch im Gesicht geschrieben und er starrte Foch mit weit aufgerissenen Augen an, als ob er nicht glauben könne, was soeben geschehen war. Fochs Herz raste. Schweiß tropfte ihm von der Stirn. Sein Atem ging schwer. Seine Augen flogen hinüber zum Zelteingang, in der Befürchtung die Wache könnte etwas bemerkt haben. Aber es schien nicht so. Draußen war alles still. Foch wischte sich das Blut von den Händen und den Schweiß aus dem Gesicht. Dann zog er leise die Satteltaschen unter der Pritsche hervor. Er musste einige Kraft aufwenden, denn wie vermutet, hatten sie ein großes Gewicht. Er öffnete eine und griff hinein. Es befanden sich Geldsäcke in ihnen. Foch griff nach einem und riss ihn auf. Zum Vorschein kamen Dukaten. Goldmünzen mit einem immens hohen Wert. Foch unterdrückte einen Freudenschrei und beförderte Münze und Sack wieder zurück in die Tasche. Dann schleppte er die Satteltaschen durch die aufgeschnittene Zeltplane nach draußen. Im Lager war es nach wie vor ruhig. Ohne weitere Zwischenfälle schleppte er die Taschen zur Pferdekoppel, sattelte ein Pferd und führte es erst an den Zügeln weit genug vom Lager fort, bevor er aufstieg und im Schutze der Nacht verschwand.
Zwei Tage und zwei Nächte war er nun bereits auf der Flucht. Bis man die Leiche La Fayettes am nächsten Morgen entdeckt haben würde, dürften etwa sechs Stunden vergangen sein. Das war zwar kein großer Vorsprung, aber die Soldaten wussten auch nicht wo sie nach ihm suchen sollten. Seine Spuren wurden durch den kurz nach seiner Flucht einsetzenden Regen verwischt. Somit konnte Foch davon ausgehen, dass man ihm nicht direkt auf den Fersen war und er von Stunde zu Stunde seinen Vorsprung vergrößern konnte. Allerdings hatte er bei der überhasteten Planung seines Verbrechens eines übersehen und das war die Kleidung. Er trug immer noch die Uniform der Französischen Rheinarmee und damit würde er bei der hiesigen Bevölkerung Argwohn erregen. Er brauchte dringend zivile Kleidung. Aber er konnte schlecht, so wie er aussah, in einen Ort reiten und sich etwas kaufen. Dazu kam, dass er, bis auf die Golddukaten, kein Geld besaß und es war einfach unmöglich mit diesen zum jetzigen Zeitpunkt zu bezahlen, ohne Aufsehen zu erregen. Nein, es musste eine andere Lösung geben. Und jetzt wo er schon einen Raubmord begangen hatte, würde er keine Hemmung haben weiterhin Moral und Anstand beiseite zu schieben.
Er könnte in ein einsam gelegenes Gehöft einbrechen und sich dort Kleidung stehlen, oder aber einen der vielen Landstreicher überwältigen und dessen Kleider an sich bringen.
Vorerst war er hier im Soonwald sicher. Über zwanzig tausend Hektar Wald umfasste das Gebiet. Neblige Wälder die sich auf dem quarz- und schieferhaltigen Boden zwischen dem Hauptkamm des Hunsrücks und dem Nahetal befanden. Teilweise undurchdringliches Dickicht, Moor- und Sumpflandschaften. Ein ideales Gebiet um sich zu verstecken.
Foch trieb sein Pferd weiter den schmalen Pfad entlang. Immer wieder schlugen ihm tiefhängende Äste ins Gesicht und zerschnitten ihm die Haut. Die Dämmerung hatte mittlerweile eingesetzt und die Lichtverhältnisse ließen ein Weiterreiten kaum noch zu. So suchte sich Foch eine große Eiche aus unter der er schlafen konnte. Nachdem er sein Pferd festgebunden hatte, legte er sich hin, doch sein knurrender Magen ließ ihn nur unruhig schlafen. Er hatte seit zwei Tagen nichts richtiges mehr gegessen, nur das was der Wald hergab. Beeren und Wurzeln.
Im Morgengrauen saß er schon wieder auf dem Pferd und ritt weiter Richtung Westen. Sein Plan in ein einsames Gehöft einzubrechen hatte sich immer mehr gefestigt. Er würde dort nicht nur die benötigte Kleidung finden, sondern auch etwas zu essen und zu trinken. Aber dafür musste er aus diesem Wald heraus.
Foch wollte sich einen Überblick verschaffen und trieb sein Pferd einen Berghang hinauf, um sich von dort oben zu orientieren. Der Weg ging steil nach oben und das Tier kämpfte mit dem Gewicht des Reiters und des Goldes. Das letzte Stück war so steil dass Foch abstieg und den Rest zu Fuß gehen musste. Oben angelangt band er das Pferd fest und sah sich um. Unter ihm lag der Soonwald. Und in jede Richtung in die er schaute erblickte er nichts anderes als Wald. In den Tälern stieg der Nebel auf, angezogen von der Sonne und eingerahmt von weiteren, geschwungenen Gebirgszügen.
Zum ersten Mal seit seiner Flucht überkam Foch die Angst. Angst davor, hier in diesem hölzernen Labyrinth gefangen zu sein. Tage und Nächte umher zu irren und so den mühsam erkämpften Vorsprung gegenüber seinen Verfolgern wieder zu verlieren. Fochs Blick schweifte nochmals über die Baumwipfel des Waldes. Irgendwo dort unten war sein Weg. Er würde ihn finden müssen, wenn er sein Leben nicht verlieren wollte. Er drehte sich um und ging zu seinem Pferd, das sich genüsslich über die Nadeln eines Baumes hermachte. Foch spürte wie ihm siedend heiß wurde. Im ersten Augenblick blieb er wie erstarrt stehen, als könne er nicht fassen, was er da sah. Dann ergriff ihn die Panik und er rannte zu seinem Pferd und zerrte es wie von Sinnen von der Eibe fort, an der es zu fressen begonnen hatte. Foch spürte seinen Herzschlag bis hinauf zum Hals. Er öffnete dem Fuchs das Maul, griff hinein und erwischte noch ein paar zermahlene Zweige mit giftigen Eibennadeln, die er angeekelt auf den Boden warf. Er hielt das Pferd immer noch am Zügel, sah entsetzt in dessen Augen und wartete. Binnen Minuten würde sich das Schicksal seinen Pferdes und somit auch seines entscheiden. Sein Blick wanderte nochmals zur Eibe. Warum war ihm der Baum eben nicht aufgefallen, dann hätte er das Pferd nie in die Nähe dieser Pflanze gebracht. Aber jetzt war es zu spät für solche Überlegungen. Jetzt half nur noch zu hoffen, dass der Gaul noch nicht zu viele Nadeln gefressen hatte. Foch wusste genau um die Gefährlichkeit, die die Eibe besaß. Das Gift in ihren Nadeln konnte Pferde innerhalb von Minuten zusammenbrechen und sterben lassen.
Foch fixierte mit den Augen wieder sein Pferd. Ärgerlich zerrte er etwas an den Zügeln, worauf das Tier begann den Kopf nach hinten zu werfen, um dem festen Griff zu entgehen.
»Halt still du blöder Gaul«, entfuhr es Foch zornig und er hielt das Pferd noch kürzer am Zügel, worauf dieses ungeduldig begann auf der Stelle zu trampeln. Dann beruhigte sich der Fuchs jedoch wieder und hielt endlich still. Foch beobachtete die Reaktionen des Pferdes. Nichts deutete auf eine Vergiftung hin, aber das war ja auch das tückische an der Eibe. Minutenlang standen sich Pferd und Reiter so gegenüber, ohne dass etwas passierte. Foch begann allmählich zu glauben, dass die Sache glimpflich ausging, als das Pferd ohne Vorwarnung in den Beinen einknickte und zu Boden fiel. Schnaubend riss der Fuchs den Kopf nach hinten, bevor der Körper zur Seite auf den mit Reif bedeckten Waldboden fiel. Sekunden später war das Tier tot.
Foch sah entsetzt auf den leblosen Körper hinab. Panik und Wut schwollen in ihm an und entluden sich in einem Schrei, der die Vögel in den Bäumen aufschrecken ließ. Dann schmiss er die Zügel, die er die ganze Zeit festgehalten hatte, voller Wucht auf den Kadaver. Er ließ sich auf die Knie fallen und spürte, wie die Verzweiflung seinen Zorn verdrängen wollte. Ohne Pferd kam er nicht weit. Und schon gar nicht mit den schweren Satteltaschen voller Gold.
Es war ein sonniger Frühlingsmorgen. Keine Wolke war am Himmel zu sehen. Die Bäume des Soonwaldes leuchteten in prächtigen Farben. Eine einzigartige Vielfalt zeigte sich in ihm. Birken, Kiefern, Erlen, Eichen, Hasel, Hainbuchen, Linden, Ulmen und Eiben. Dazu kamen in den wasserreichen Schluchten und Seitentälern Eschen und Ahorn. Unzählige Farnarten und Gräsersorten waren hier beheimatet und sind es auch heute noch. Auch die Fauna zeigte sich vielfältig. Rehwild, Schwarzwild, Rotwild und Hasen. Aber auch Wölfe, Füchse und Marder und viele Vogelarten. Unter diesen auch Raubvögel wie Steinadler, Habicht, Falken und Milane. Aber an jenem Morgen waren dies nicht die einzigen Räuber im unendlich erscheinenden Soonwald. Noch einer war in ihm unterwegs und er schien es noch nicht einmal eilig zu haben, obwohl er wusste, dass eine hohe Belohnung auf seine Ergreifung ausgesetzt war. Aber dieser Wald war für ihn wie ein schützendes Heim, er gab ihm Deckung und Nahrung. Und so ritt er im Schritt auf einem geheimen Pfad, den nur er und ein paar seiner Spießgesellen kannten. Johannes Bückler war unterwegs in den Taunus, wo er hoffte ein neues Leben beginnen zu können, denn er wollte dem Verbrechen entsagen. Er würde sich einen anderen Namen zulegen, Jakob Ofenloch, und hoffte so seinen Häschern zu entkommen. Er glaubte sich dort in Sicherheit weil die rechtsrheinischen Gebiete nicht von den französischen Behörden kontrolliert wurden. Schon öfter hatte er sich dort versteckt, wenn es hier zu brenzlig für ihn wurde und die Gendarmerie ihm zu nah an den Fersen hing.
Der Räuberhauptmann Bückler hatte eine eindrucksvolle, wenn auch zweifelhafte Karriere hinter sich. Geboren war er, als Kind armer Eltern, 1778 in Miehlen im Taunus. Sein Vater war Abdecker, wie auch dessen Vater. Und so erlernte auch Johannes Bückler diese scheußliche Tätigkeit. Die Abdecker, auch Schinder genannt, schlachteten Tiere aus, zogen ihnen das Fell oder die Haut ab und beseitigten die Tierkadaver. Bückler erinnerte sich nicht gern an diese Zeit zurück. Damals wurde der Grundstein für seine kriminelle Laufbahn gelegt. Von seinem damaligen Lehrmeister berechtigt wegen Diebstahls angezeigt, erhielt der junge Bückler auf dem Kirner Marktplatz eine öffentliche Prügelstrafe. Diese überaus harte Bestrafung, setzte dem damals sechzehnjährigen so zu, dass dadurch sein ganzes weiteres Leben beeinflusst wurde. Anstatt geläutert sein Dasein in eine anständige Bahn zu lenken, obsiegte der Trotz gegenüber der Obrigkeit. Dazu kamen die kostspieligen Ausschweifungen seines jungen Lebens, die finanziert werden wollten. Diebstahl, Raub und Erpressung wurden sein Handwerk. Auch vor Gewalt schreckte Bückler nicht zurück.
Für seine kriminelle Machenschaften waren ihm auch seine Intelligenz und seine Redegewandtheit von Nutzen. So schaffte er es ohne große Mühe zwielichtige Gestalten um sich zu scharren und eine schlagkräftige Räuberbande zu gründen. Sie überfielen Höfe und Mühlen. Auch reiche Kaufleute und die verhassten Franzosen blieben von Überfällen nicht verschont. Im Gegenteil, letztere erfuhren den ganzen Hass, den Bückler für sie übrig hatte. Er machte sie verantwortlich für das Leid, das die Bevölkerung hinnehmen musste. Arbeitslosigkeit, Hunger und Plünderungen. Aber auch ganz persönliche Ereignisse trugen dazu bei, dass sich sein Groll gegen die französische Besatzungsarmee richtete. So beging er auch Verbrechen gegen die französische Obrigkeit, was die Suche nach ihm nur noch verstärkte. Einige male schon war der Schinderhannes, so wie ihn das Volk mittlerweile nannte, in die Fänge der Justiz geraten. Aber immer wieder gelang es ihm aus seinem Gefängnis zu flüchten. Es schien keine Mauern zu geben die den Freiheitsdrang des Schinderhannes einzudämmen vermochten.
Aber nun zog sich die Schlinge der Gendarmerie immer enger zu. Dazu kam dass die anfängliche Sympathie und Hilfsbereitschaft der Bevölkerung gegenüber ihm schwand. Zu oft hatte er auch redliche, unschuldige Bürger überfallen und das Volk nahm dies nicht mehr hin. Es war an der Zeit dem Räuberleben zu entsagen. Hier und jetzt wollte er einen Schlussstrich ziehen. Aber wieder einmal sollte es anders kommen.
Bückler war gerade im Begriff den geheimen Pfad zu verlassen und auf eine Lichtung zu reiten, als er einen Schrei vernahm. Ohne Zweifel hatte kein Tier geschrien, sondern es war der Schrei eines Menschen. Bückler spähte zwischen den Bäumen hindurch in die Richtung aus welcher der Schrei gekommen war. Er gab seiner Neugier nach, wendete sein Pferd und ritt in diese Richtung weiter.
Noch immer kniete Foch vor dem Pferdekadaver und starrte diesen unverwandt an. Sein Kopf war leer, kein klarer Gedanke vermochte sich in ihm zu bilden. Foch war überwältigt von der Ausweglosigkeit seiner Situation. Wie sollte es weiter gehen? Er hatte keine Ahnung. Eher automatisch als überlegt, rappelte er sich auf und schleppte sich zu den Satteltaschen. Der schwere Pferdekörper lag auf einer von ihnen. Foch nahm erst die obere Tasche und legte sie beiseite, dann begann er seine Hand zwischen Pferdekörper und Boden zu schieben. Mühevoll tastete er sich nach vorn, bis er das harte Leder der Satteltasche spürte. Dann begann er an ihr zu zerren. Das Gewicht des Goldes und des Pferdes verlangten ihm sein gesamtes Kraftreservoir ab. Nur mühsam, Zentimeter um Zentimeter, brachte er die Tasche näher an sich heran. Der Schweiß stand ihm vor Anstrengung auf der Stirn und sein Atem ging immer schneller. Als er die Tasche zur Hälfte heraus gezogen hatte, verschnaufte er kurz und zerrte dann noch einmal kräftig an ihr. Die Tasche glitt plötzlich unter dem Pferd heraus und Foch verlor sein Gleichgewicht. Rittlings fiel er auf den noch feuchten Boden. Schwer atmend, aber zufrieden mit dem Ergebnis, rappelte er sich wieder auf, als er erschrocken zur Seite blickte. Dort stand ein Reiter. Ein junger Mann, etwa in seinem Alter. Auf dem Kopf trug er einen grünen Hut mit breiter Krempe. Er hatte braunes, mittellanges Haar, das nach hinten zu einem Zopf zusammengebunden war. Sein ovales Gesicht zierte ein Backenbart. Funkelnde blaue Augen beobachteten Foch ganz genau. Er trug eine schwarze Jacke und blaue, mit Leder aufgeschlagene Pantalons, die in braunen Lederstiefeln steckten. Hoch aufgerichtet saß er auf einem Rappen mit weißer Blesse. Eine ganze Weile standen sich Foch und Bückler so gegenüber.
Erst dann brach der Schinderhannes das Schweigen: »Was sucht Ihr auf dem nassen Waldboden, Soldat? Etwa Pilze?«
Foch fiel die heisere Stimme seines Gegenübers auf und auch der Sarkasmus, welcher in dessen Worten lag, blieb ihm nicht verborgen. Aber dann erhellten sich plötzlich Fochs Gedanken, als er begriff, dass dieser Reiter die Rettung für ihn bedeuten konnte. Dort vor ihm war ein Pferd und die so dringend benötigte zivile Kleidung. Er schätzte schnell die Größe des Reiters ab und kam zu Schluss, dass sie seiner in etwa entsprach. Jetzt hieß es geschickt vorzugehen.
»Mein Pferd ist, wie Ihr seht, verendet«, entgegnete Foch verbindlich und wies hinüber zu dem Kadaver. Er setzte eine traurige Mine auf um damit seine wahren Absichten zu kaschieren. Er bemerkte die Überraschung im Gesicht des Reiters, der wohl von einem französischen Soldaten keine in einem perfekten Deutsch gehaltene Antwort erwartet hatte.
Bückler drückte die Fersen in die Flanken seines Pferdes und ritt um den Kadaver herum, um ihn genauer in Augenschein zu nehmen. Danach richtete er seinen Blick wieder auf Foch. »Wie ist Euer Name, Soldat?«
»Henri Colbert«, log Foch ihn an.
»Was macht Ihr hier allein im Wald?«
Foch gefiel die Neugier des Reiters in keiner Weise. Er wusste immer noch nicht was er von diesem halten sollte.
»Ich wurde von meiner Einheit getrennt und irre seit vergangener Nacht durch diesen Wald. Könnt Ihr mir sagen wo ich mich befinde?« Foch beobachtete den Reiter ganz genau, doch in dessen Gesicht regte sich keine Miene. Es war schwer einzuschätzen, ob der Reiter den Ausführungen Fochs Glauben schenkte.
Bückler ignorierte die Frage Fochs und schlug einen schärferen Ton an. »Was ist in den Taschen?«
Foch setzte ein verlegenes Grinsen auf. »Nur Proviant!«
»Ihr tragt schwer an Eurem Proviant, Herr Colbert. Was habt Ihr denn darin? Ein Zentner Schweinshaxen?«
Der Reiter musste beobachtet haben, mit welcher Anstrengung er die Tasche unter dem Pferd hervorgezogen hatte. Fochs Herz begann schneller zu schlagen. Er fühlte wie Panik ihn zu übermannen drohte. »Seht doch selbst nach!«, forderte er den jungen Mann auf, in der Hoffnung ihn am Boden überwältigen zu können. Zu Fochs Unmut machte der Reiter keine Anstalten vom Pferd herabzusteigen.
»Euer Ton gefällt mir nicht, Soldat, ganz und gar nicht. Habt Ihr überhaupt einen Passierschein?«
Foch spürte, dass die Situation immer bedrohlicher wurde. Hielt er diesen Reiter vor wenigen Minuten noch für einen arglosen Reisenden, so war er sich jetzt nicht mehr so sicher. In seiner Not fiel ihm nichts besseres ein als zu fragen: »Von wem soll denn dieser Passierschein ausgestellt sein?«
Der Reiter verfiel in ein schallendes Gelächter, bevor er Foch antwortete. »Ich bin überrascht dass Ihr fragt, angesichts des Ortes an dem Ihr Euch befindet?«
Foch sah sich irritiert um.
»Ihr seit im Soonwald und hier stellt die Passierscheine Johannes durch den Wald aus.«
Fochs Knie wurden weich. Jetzt war er sich im Klaren mit wem er es zu tun hatte. Er war hier nicht auf einen kleinen Wegelagerer gestoßen, sondern auf den Räuberhauptmann Johannes Bückler, den alle nur den Schinderhannes nannten. Jeder französische Soldat kannte diesen Namen und seinen Steckbrief. Mit Johannes durch den Wald unterzeichnete der Schinderhannes für gewöhnlich seine Erpresserbriefe und Passierscheine. Foch wurde sich bewusst, dass sein Leben an einem seidenen Faden hing. Dieser Räuber würde ihn unter keinen Umständen laufen lassen und das hieß für Foch, er musste diesen Mann überwältigen.
»Also, Soldat, was ist in den Taschen?« In Bücklers Stimme lag Nachdruck.
Fochs Gehirn arbeitete auf Hochtouren. Wenn er den Inhalt der Taschen zeigte, würde Bückler ihn auf der Stelle töten und das Gold an sich nehmen. Besser war es, wenn Foch den Überraschungsmoment auf seiner Seite hatte. Ohne weiter darüber nachzudenken, sprang er nach vorn und versuchte an Bückler heranzukommen, um ihn vom Pferd zu ziehen. Der Rappe scheute leicht und eh sich Foch versah spürte er Bücklers Fußtritt in seinem Gesicht. Von der Wucht nach hinten gestoßen schlug er hart auf dem Waldboden, in der Nähe des Berghangs, auf. Blut spritze aus seiner gebrochenen Nase und er drückte instinktiv seine Hand auf sie.
Er sah hinauf zum Schinderhannes. Nur verschwommen nahm er diesen war. Als sein Blick wieder klarer wurde, sah er dass dieser eine Pistole in der Hand hielt, die er vermutlich unter seiner Jacke versteckt hatte. Foch erkannte deutlich den Hass im Gesicht des Räubers. Langsam rappelte er sich wieder hoch und hielt sich immer noch die schmerzende Nase. Sein Überlebenstrieb veranlasste ihn dazu durch einen schnellen Sprung zur Seite Bücklers Schussbahn zu entkommen, mit dem Versuch am Berghang zwischen den Bäumen Deckung zu finden. Foch hörte den Schuss krachen während er den Berghang hinunter rannte. Er spürte wie die Kugel ihn traf, stolperte und rollte noch einige Meter den Berghang hinab, bevor er mit dem Kopf an einen Stein schlug und regungslos liegen blieb.
Bückler drehte sein Pferd so, dass er eine gute Sicht auf den zwanzig Meter entfernt im Hang liegenden Soldaten hatte. Eine ganze Weile beobachtete er ihn von oben, achtete darauf, ob dieser irgendeine Regung zeigte. Erst als das nicht der Fall war und er ihn für tot hielt, steckte er die Pistole weg und wandte sich den Satteltaschen zu. Da Colbert, oder wie der Soldat auch immer geheißen hatte, die Taschen so vehement verteidigt hatte, war Bückler überzeugt auf etwas Kostbares zu stoßen. Dieser Narr, dachte er. Hätte er ihm die Taschen überlassen, hätte er dessen Leben vielleicht verschont. Bückler merkte dass es nicht leicht war auf dem Pfad der Tugend zu wandeln. Es hatte nicht allzu lange gedauert, bis er seinem Vorsatz ein neues Leben zu beginnen untreu geworden war. Aber es war auch zu verlockend gewesen einem allein umherziehenden französischen Soldaten das Fürchten zu lehren.
Als er eine der Taschen öffnete und dann die Dukaten zum Vorschein kamen, zitterten vor Aufregung seine Hände. Soviel Gold hatte er noch nie auf einem Haufen gesehen. Diese Dukaten würden ihm ein sorgloses Leben bereiten können, wie geschaffen für den Neuanfang, den er sich vorgenommen hatte.
Aber dann fragte er sich wo dieses Gold wohl herstammen möge. Dass es nicht dem Soldaten gehörte, war klar. Dieser schien es gestohlen zu haben. Aber von wem? Die hohe Summe um die es sich hier drehte ließ einen einfachen Diebstahl nicht wahrscheinlich sein. Da der Dieb Soldat war, sprach vieles dafür, dass das Gold auch aus Militär- oder aber Regierungsbeständen stammte. Dem Schinderhannes gefiel dieser Umstand ganz und gar nicht. Denn er konnte sich lebhaft vorstellen, dass eine ganze Kompanie in Aufruhr war, um das gestohlene Gold wiederzubeschaffen und den dreisten Dieb zur Strecke zu bringen. Bückler wusste um die heißen Kohlen auf denen er da saß. Es war sehr gefährlich mit diesem Gold unterwegs zu sein. Er würde es verstecken müssen, bis Gras über die Sache gewachsen war. Vielleicht ein paar Monate, vielleicht auch ein paar Jahre. Wichtig war nur, dass er mit diesem Gold nicht in Verbindung gebracht wurde. Er könnte, wie geplant als fahrender Händler Jakob Ofenloch im Taunus leben. Wenn die Zeit reif war, könnte er den Rhein wieder überschreiten und die Beute an sich bringen. Dieses Gold würde für ihn und seine Frau Julia reichen und sogar für ihr noch ungeborenes zweites Kind. Schmerzlich dachte er zurück an seine Erstgeborene, die bereits kurz nach der Geburt vor einem Jahr gestorben war. Dieses mal sollte alles gut gehen. Er freute sich schon jetzt auf das Lachen seines Kindes und wollte ihm ein unbeschwertes Leben bereiten. Das Kind sollte nicht unter solch schwierigen Bedingungen aufwachsen müssen wie er. Nein, dass wollte er ihm ersparen. Und da reifte in Johannes Bückler ein Plan, der seinen Nachkommen mitbedachte, wenn es denn das Schicksal wollte und er als Vater nicht mehr für ihn da sein konnte.
Er wusste, dass das was er vorhatte, einige Wochen in Anspruch nehmen würde und sich seine Flucht somit verzögerte. Aber in diesem Augenblick sah er ganz deutlich eine Zukunft vor sich die ihm gefiel und im hier und jetzt wollte er diese begründen. Zuerst musste er das Gold verstecken. Er durfte keine Zeit verlieren.
Bückler wuchtete die schweren Satteltaschen auf sein Pferd, stieg auf und ritt los. Er warf noch einmal einen Blick hinunter zu dem im Hang liegenden Soldaten. Dann verschwand er auf geheimem Pfad zwischen den unzähligen Bäumen des Soonwaldes.
Die Sonne hatte den Zenit bereits überschritten. Fliegen und andere Insekten machten sich mittlerweile über den Pferdekadaver her und es würde nur noch eine Frage der Zeit sein, bis größere Tiere sich seiner annahmen.
Ein leichte Brise war aufgekommen und entlockte Millionen von Blättern ein sattes Rauschen. Foch lag immer noch am Berghang zwischen den Bäumen. Aber er war nicht tot, wie Bückler vermutet hatte, sondern durch den Aufschlag auf den Stein bewusstlos.
Erst jetzt kam er langsam wieder zu sich. Ein leises Stöhnen entfuhr ihm. Vorsichtig bewegte er den Kopf. Foch verspürte solche Kopfschmerzen, dass er glaubte, sein Schädel müsste zerbersten. Er setzte sich langsam auf und hielt sich den pochenden Schädel. Erst als er sich so eine Weile erholt hatte, konnte er sich wieder auf die Geschehnisse konzentrieren. Anhand des Sonnenstandes erkannte er, dass seit der Konfrontation mit Bückler einige Zeit verstrichen sein musste. Er hatte unheimliches Glück gehabt. Auch wenn ihn sämtliche Knochen schmerzten, so hatte er sich bei dem Sturz doch nichts gebrochen. Noch mehr Glück hatte er, dass ihn Bücklers Kugel nur gestreift hatte. Er zog Jacke und Hemd aus und begutachtete seine linke Schulter. Direkt unterhalb seiner Tätowierung hatte die Kugel einen Fetzen Fleisch fortgerissen. Aber wichtige Strukturen schienen unverletzt, denn er konnte den Arm bewegen. Dennoch brannte es, als ob man ihm heißes Öl über den Arm geschüttet hätte. Mit schmerzverzerrtem Gesicht riss er einen Streifen seines Hemdes ab und verband die Wunde. Er würde sie später, sobald er Wasser fand, reinigen müssen. Dann stemmte sich Foch in die Höhe und kletterte den Hang nach oben. Als er sich wieder auf der Anhöhe befand schweifte sein Blick in die Ferne. Seine Gedanken waren beim Schinderhannes und dem Gold. Bei seinem Gold. Und er hatte nicht vor, dieses aufzugeben. Er würde Bückler finden und es ihm wieder abjagen, dass schwor er sich. So leicht gab Frederic Foch nicht auf.
Mainz 1803
Mainz, von den Franzosen Mayence genannt, war die Hauptstadt des Départements du Mont-Tonnerre, verwaltet unter dem damaligen Präfekten Jeanbon St. André. Die Stadt war im 17. Jahrhundert mehr und mehr zu einer Festung umgebaut worden. Relikte einer stürmischen Zeit, die teilweise bis heute erhalten geblieben sind. Eine Stadtmauer mit 22 Pforten, Toren und Türmen umrahmte zur Zeit der französischen Besatzung die Stadt. Davon wiesen Fünf zur Landseite und 17 zur Rheinseite, was davon zeugte wie wichtig der Fluss für die Bevölkerung und den Handel war. Unter anderem stand dort, nördlich der Zollpforte, direkt am Rheinufer gelegen, der sogenannte Holzturm, der bereits im 14. Jahrhundert erbaut worden war. Er erhielt seinen Namen, weil er unweit des Stapelplatzes für Holz errichtet worden war, welches damals per Schiff den Rhein hinab transportiert wurde.Zur Zeit der französischen Besatzung wurde der Holzturm als Gefängnis benutzt.
Johannes Bückler hockte auf der mit Stroh bedeckten hölzernen Pritsche und sah auf die Ketten, mit denen er an die Gefängnismauer des Holzturmes geschmiedet war. Er wirkte sichtlich erschöpft. Nicht nur aufgrund des harten Nachtlagers und des Eisenbeschlages, der ihm die Haut aufscheuerte, sondern auch wegen des langen Verhörs, dass sich von Juni 1802 bis in den März 1803 hingezogen hatte. In 54 Einzelsitzungen hatte er Rechenschaft ablegen müssen über seine Taten. Jegliche Kleinigkeit wollte Untersuchungsrichter Wilhelm Wernher und der Kommis-Greffiers Brellinger wissen, aber nach Golddukaten fragte ihn niemand. Und jetzt wartete der Schinderhannes auf seinen Prozess. Durch das freiwillige Geständnis seiner Verbrechen hoffte er auf eine mildere Strafe, nichtsahnend, dass auch auf Einbruch und Raub bei den Franzosen die Todesstrafe stand. Erst vor wenigen Wochen hatte er davon erfahren, dass die Wahrscheinlichkeit, zum Tode verurteilt zu werden, sehr groß war.
Bückler stemmte sich hoch und ging zum vergitterten Fenster, begleitet vom Rasseln der Ketten. Er sah nach draußen zum Rhein auf dem Kähne ihre Fracht beförderten. Und schmerzlich stellte er fest, dass er sich auf der falschen Rheinseite befand. Wie geplant hatte er im Mai letzten Jahres das linksrheinische Gebiet verlassen und war so dem Zugriff der französischen Behörden entgangen. Er gab sich als fahrender Händler aus und durchstreifte so Taunus, Westerwald und Lahntal. Als er dann von einer kurtrierischen Patrouille verhaftet wurde, weil er sich nicht ausweisen konnte, ließ er sich, um der Untersuchungshaft zu entgehen, bei der deutsch kaiserlichen Armee unter falschem Namen als Soldat anwerben. Hier wurde er jedoch von einem früheren Spießgesellen erkannt und verraten. Wiederum verhaftet überführte man ihn nach Frankfurt zum Verhör. Der Schinderhannes bat darum nicht den Franzosen ausgeliefert zu werden. Aber die kaiserliche Militär-Direktion und die Reichsstadt Frankfurt übergaben Johannes Bückler am 16. Juni 1802 dennoch den Franzosen.
Er war nicht der einzige Angeklagte. 67 weitere potentielle Diebe, Räuber und Mörder waren vorgeladen. Darunter auch seine Frau Julia, die er liebevoll Julchen nannte. Sie war ebenfalls im Holzturm inhaftiert und hatte dort am 1. Oktober 1802 des Schinderhannes’ Sohn, Franz-Wilhelm, zur Welt gebracht. Trotz der Gefängnismauern um ihn herum war es der glücklichste Tag im Leben des Johannes Bückler. Ab und an durften das Julchen und sein Sohn ihn unter Aufsicht besuchen und dann wurde dieser hartgesottene Räuber, der vor keiner Gräueltat zurückschreckte, lammfromm.
Wehmütig dachte er an seine kleine Familie, als er so am Fenster stand. Tränen stiegen ihm in die Augen und ließen den Rhein und die Kähne auf ihm verschwimmen. Er wandte sich ab und ging zurück zu seinem Lager. Eine abgegriffene Bibel lag dort und er strich mit Bedacht über den verschlissenen Einband. Er erinnerte sich zurück an den sonnigen Morgen im Soonwald, an dem er sich geschworen hatte, einen neuen Weg einzuschlagen. Eine bessere Zukunft für sich und seine Familie herzurichten. Er hatte alle Vorkehrungen dafür getroffen. Das Gold lag bereit. Nun galt es, sein Wissen, sein Erbe an seine Familie weiterzugeben.
Um die Bibel hatte er den Gefängniskaplan gebeten, der sich den Häftlingen annahm. Bückler benötigte sie nicht, weil er tief gläubig gewesen wäre, obwohl er dies dem Kaplan vorgaukelte. Nein, er brauchte sie für andere Zwecke. Sie sollte ihm als Sprachrohr dienen.
Während des Verhörs, als sich der Richter und der Kommis-Greffiers unterhielten, war es ihm bereits gelungen einen Crayon - einen Schreibstift - an sich zu bringen. So war er jetzt in der Lage seinem Sohn eine versteckte Botschaft zu hinterlassen. Er würde sie mit Vorsicht verfassen müssen.
Bückler legte sich auf die harte Pritsche und starrte zur Decke. In seinem Kopf formulierte er die Sätze, nachdem er mit dem Text zufrieden war, setzte er sich auf, zückte den Crayon und begann die Botschaft zu verfassen.
Am nächsten Morgen wurde er durch das Zurückschieben der Zellentürriegel aus seinem Schlaf gerissen. Geschäftig wirkend trat der Wächter ein, gefolgt vom Kommis-Greffiers Brellinger. Bückler, der sich langsam von der Pritsche erhob, zeigte sich erstaunt über solch hohen Besuch. Brellinger verzichtete auf irgendwelche Begrüßungsformeln und kam gleich zur Sache: »Citoyen Jean Buckler vernehmt hiermit, dass Euer Prozess morgen früh beginnen wird.«
Der Schinderhannes machte einen gefassten Eindruck.
»Man wird Euch morgen früh zum Gerichtsgebäude bringen«, fuhr Brellinger fort. »Dort werdet Ihr Euch für Eure Schandtaten verantworten! Der Kontakt zu Eurer Frau und Eurem Sohn, bleibt von nun an versagt!«
Bückler spürte einen Stich in seinen Eingeweiden, als hätte ihm jemand einen Dolch in sie gerammt. Seine Knie wurden weich, sein Herz raste. Verzweifelt ging er einen Schritt auf Brellinger zu, der sich irritiert umsah. Die Wache stellte sich Bückler umgehend in den Weg.
»Kommis-Greffiers, dies ist die schlimmste Strafe, die ich erhalten kann. Noch schlimmer als der Tod. So bitt ich Euch nur um eines. Lasst mich zumindest Abschied nehmen. Von meiner geliebten Frau und meinem Sohn.«
Brellinger, ein kleiner, graubärtiger Mann, der selbst vier Kinder hatte, wusste sehr wohl um die Härte dieser Anordnung. Aber er hatte keinen Einfluss darauf. Richter Wernher hatte dies persönlich angeordnet. Andererseits konnte Bückler Frau und Kind heute ja schon gesehen haben, dachte Brellinger. Aber die Wachen wüssten um die Wahrheit. Der Kommis-Greffiers schätze ab in wie weit ein heutiger Kontakt zwischen Bückler und seiner Frau für ihn Nachteile haben könnte. Er kam zum Schluss, dass es für ihn zu gefährlich war hier selbstständig, ohne Befugnis einen weiteren Kontakt zu erlauben.
»Es steht nicht in meiner Macht, Citoyen Buckler.«
»In wessen dann, Kommis-Greffiers?« Verzweiflung sprach aus Bücklers Stimme.
»Nur der Richter selbst kann Eurer Bitte entsprechen,« Brellinger stockte für einen Augenblick, »oder es lassen.«
»Nun, dann fleh ich Euch an, Kommis-Greffiers, tragt meine Bitte dem Richter vor.«
Brellinger dachte eine Augenblick darüber nach. Was würde schon dagegen sprechen wenn er dem Richter Bücklers Bittgesuch unterbreitete? »Nun gut, ich werde sehen was ich tun kann.« Dann verließ Brellinger und die Wache die Gefängniszelle, die Tür wurde zugeschlagen und die Riegel wieder vorgeschoben.
Der Schinderhannes war wieder allein, stand in der Mitte seiner Zelle und sah sich dem Wohlwollen eines Mannes ausgesetzt, der ihn ganz sicher auf dem Schafott sehen wollte.
Den ganzen Morgen und den frühen Nachmittag, zermarterte sich Bückler den Kopf, ob er denn seine Frau und sein Kind noch einmal vor dem Prozess sehen würde. Nicht nur der Zuneigung wegen, die er für beide empfand, sondern auch wegen seinem Erbe. Denn er wusste nicht, ob nach dem Prozess sich eine Gelegenheit ergeben würde, um seine Informationen Julchen zukommen zu lassen. So waren Julias momentane Besuche die ideale Möglichkeit um Informationen weiterzugeben. Und nun, so kurz vorm Ziel, sah sich Bückler seiner Möglichkeit beraubt. Er stand vor dem Zellenfenster und sah hinaus auf den trüben Oktobertag. Graue Wolken zogen am Himmel entlang und ließen einen leichten Nieselregen zu Boden fallen. Trübe Aussichten, dachte er, dort draußen wie hier drinnen.
Dann plötzlich wurden die Riegel der Zellentür zurückgeschoben und die Wache trat ein.
»Ihr habt zehn Minuten.«
Julchen und sein Sohn Franz-Wilhelm traten ein.
Erleichtert sah er zu den beiden, ging auf sie zu und nahm sie in die Arme. Tränen stiegen in ihm hoch, als er sie an sich drückte. »Ich freue mich, euch beide zu sehen. Ich dacht schon, es bliebe mir verwehrt.«
Julchen löste sich aus der Umarmung und gab Franz-Wilhelm seinem Vater, der ihn auf den Arm nahm. Dann setzten sie sich auf Bücklers Pritsche, genau beobachtet von der Wache.
»Der Kommis-Greffiers, teilte mir mit, dass ich dich während des Prozesses nicht sehen dürfe. Heute wäre auf Richters Gnaden hin, die letzte Gelegenheit.« Verstohlen sah sie hinüber zur Wache, die aufmerksam das Gespräch verfolgte.
Dann hat der Herr Brellinger Wort gehalten und beim Richter diesen Besuch noch erwirkt, dachte Bückler. Er strich seinem Sohn durchs Haar, der ungeachtet dessen das Gesicht seines Vater abtastete. Augen, Nase, Mund. Bückler begann zu lächeln. »Ganz schön vorwitzig, mein Kleiner.«
»Sollen wir deinem Vater einmal zeigen, was du gelernt hast?«, schaltete sich Julchen ein. Sie nahm Franz-Wilhelm, ging mit ihm ans andere Ende der Zelle und stellte ihn auf den Boden. »Na, Franz dann geh zu deinem Papa.« Der Junge begann sich in Bewegung zu setzen. Noch waren seine Schritte ungelenk und es fiel ihm schwer Balance zu halten, aber er schaffte es ohne Fallen, den Weg bis in die ausgebreiteten Arme seines Vaters zurückzulegen. In Bücklers Gesicht lag große Freude. Stolz drückte er Franz-Wilhelm an sich, dann wandte er sich wieder an Julchen. »Komm Frau setz dich zu mir. Ich habe euch beiden etwas zu sagen.«
Julchen nahm wieder neben ihrem Mann platz und dieser ergriff ihre Hand. Aus den Augenwinkeln heraus beobachtete er den Wächter. Dieser ließ die drei nicht aus den Augen. Wie schon bei den Besuchen zuvor, achtete er ganz genau auf das was sie taten und noch mehr auf das was sie sprachen. Es stand außer Frage, dass der Wächter Anweisung hatte, jegliche verdächtige Unterredung zu melden. Und plötzlich kam es Bückler in den Sinn, dass dieses Besuchsverbot, bewusst so kurzfristig anberaumt worden war. Vielleicht sollte es dazu dienen ihn unter Druck zu setzen, um so eventuell noch etwas zu erfahren. Umso wichtiger war es jetzt auf der Hut zu sein mit dem was er sagte. »Ich wäre so gerne die ganze Zeit bei euch, aber wie es scheint, bleibt mir dies verwehrt.«
Julchen drückte seine Hand. »Es werden bessere Zeiten kommen, ganz bestimmt. Auch die Jahre im Gefängnis werden wir überstehen.«
Der Schinderhannes wirkte nachdenklich, sein Blick ging in die Leere des Raums. »Ich glaube nicht, dass ich eine Gefängnisstrafe erhalte.«
Seine Frau sah ihn entsetzt an. »Was soll das heißen, Johannes?«
Bückler blickte ihr in die Augen. »Ich glaube nicht, dass mir ein Leben mit euch vergönnt ist. Hier in dieser Stadt wird es enden.«
Julchen griff sich mit der freien Hand an die Brust. Tränen schossen ihr in die Augen. »Wie kannst Du so etwas nur sagen«, schluchzte sie hervor.
»Sehen wir der Wahrheit ins Gesicht.« Bückler strich seiner Frau durchs Haar.
Tränen liefen ihr über die Wangen. »Sag das nicht. Du bist nicht der Richter, du weißt nicht wie er entscheidet.«
Der Schinderhannes wischte ihr sanft die Tränen aus dem Gesicht. »Wir müssen auch für diesen Fall gewappnet sein.«
Julchen sah den dringlichen Blick ihres Mannes. Auch den nur leicht veränderten Tonfall seiner Stimme, bemerkte sie sofort.
»Wichtig ist mir, Julia, dass du und unser Sohn von nun an ein redliches und glückliches Leben führen. In den letzten Tagen wurde mir bewusst, dass Gott uns dabei helfen kann.«
Julchen war sich nun ganz sicher, dass Johannes ihr etwas wichtiges mitzuteilen hatte. Denn er verwendete sonst nie ihren vollständigen Namen. Ihr war aber auch klar, dass er ihr, wegen der großen Ohren des Wächters, nur versteckt etwas mitteilen konnte.
Bückler griff hinter sich und zog die alte Bibel hervor.
Innerlich war er gänzlich aufgewühlt. Er hoffte, dass der Wächter nicht die wahre Bedeutung der Situation erkannte.
»Ich habe viel in dieser Bibel gelesen, sie gab mir Trost und Hoffnung. Ich möchte, dass du meine geliebte Frau und besonders unser Sohn, diese Bibel immer wieder studiert, damit ihr begreift, was wirklich wichtig ist im Leben.«
Mit diesen Worten drückte der Schinderhannes seiner Frau die Heilige Schrift in die Hand und er hoffte inständig, dass der Wächter nicht einschritt und die Übergabe verbieten würde.
Etwas verstört blickte ihn Julchen an. War ihr Mann auf einmal doch noch gläubig geworden? War das es, was er versuchte ihr mitzuteilen? Den Glauben an Gott?
Der Wächter machte zwei Schritte auf die beiden zu. »Das genügt jetzt, die Zeit ist um! Gebt mir die Bibel!«
Der Schinderhannes schreckte auf, war denn alles um sonst gewesen? Er beobachtete den Wächter ganz genau, ohne es sich anmerken zu lassen.
Dieser streckte die Hand nach der Bibel aus, die Julchen festhielt. Zögerlich stand Julchen auf und reichte sie dem Wachmann. Dieser nahm sie an sich und blätterte sie oberflächlich durch. Er suchte nach Schriftstücken oder Mitteilungen die hinein geschrieben waren. Als er aber nichts dergleichen fand gab er Julchen die Bibel zurück.
Bückler atmete erleichtert auf. Wie in Trance nahm Julchen die Bibel wieder entgegen, nahm Franz-Wilhelm auf den Arm und sah zu ihrem Mann. Wortlos sahen sie sich in die Augen und nahmen Abschied voneinander. Der Wächter ergriff Julchens Arm und zog sie zum Ausgang, ihr Blick ruhte weiter auf ihrem Mann.
»In der Bibel liegt die Zukunft, vergiss das nicht«, rief Bückler ihr nach.
Sie drückte ihren Sohn noch fester an sich. Dann schloss sich die Zellentür zwischen ihnen.
Unwirsch befahl der Wächter, sie möge voran zu ihrer Zelle gehen. Widerstandslos kam sie der Aufforderung nach, mit ihren Gedanken bei den Worten ihres Mannes. In der Bibel liegt die Zukunft. Unbewusst verstärkte sich ihr Griff um das Buch.
Am 24. Oktober 1803 begann die Verhandlung im Akademiesaal des ehemaligen kurfürstlichen Schlosses zu Mainz. Den Vorsitz hatte der Präsident des Mainzer Kriminalgerichts, Andreas Georg Friedrich Rebmann. 68 Angeklagten wurde der Prozess gemacht. 173 Zeugen lud der Staatsanwalt vor, neun Verteidiger nochmals 260 Zeugen. Allein das Verlesen der 72-seitigen Anklageschrift, in deutsch und französisch, dauerte anderthalb Tage. Tausende Gäste strömten aus ganz Europa nach Mainz, um dem Gericht beizuwohnen. Dazu wurden 500 Eintrittskarten verkauft, deren Preis täglich stieg.
Am 19. November 1803 zog sich das Tribunal zur Beratung zurück und verkündete einen Tag später das Urteil. Zwanzig Angeklagte wurden aus Mangel an Beweisen freigesprochen, weitere achtundzwanzig erwarteten Kerkerketten oder Zuchthaus. Die Todesstrafe erhielten nochmals zwanzig Angeklagte, darunter Johannes Bückler, genannt der Schinderhannes.
Am 21. November 1803, an einem trüben, nebligen Herbsttag, fuhren fünf Leiterwagen mit den Delinquenten zum Richtplatz vor den Toren Mainz. Bewacht wurden die Todgeweihten von einem Kommando Gendarmen und einer Infanterieabteilung. 15000 Zuschauer waren zu dem grausamen Schauspiel erschienen und als nun die Gruppe auf dem Richtplatz eintraf, begleitet von einem Trommelwirbel, hörte man die Rufe: »Sie kommen, sie kommen!« Dann wurde es still.
Der Schinderhannes sprang als Erster von dem Wagen und betrat das leicht erhöhte Schafott auf dem eine rot angestrichene Guillotine thronte. Dann schnallte man Bückler aufs Brett, schob ihn unter das Beil, dieses sauste hernieder und trennte seinen Kopf vom Rumpf. Ein dumpfes Raunen unterbrach die gespenstische Stille auf dem Platz. Dann richtete man die anderen, wobei nach einigen Köpfungen das blutige, achtzig Pfund schwere Fallbeil zu dampfen begann.
Teils erschrocken, teils belustigt wohnten die Leute der Hinrichtung bei. Besonders ein Schaulustiger beobachtete aufmerksam das blutige Treiben: Frederic Foch.
Mainz 1805
Julia Blasius hatte auf dem Marktplatz eingekauft und war auf dem Rückweg zum Haus ihres Herrn. Es war ein sonniger Samstagmorgen und die Stadt zeigte sich sehr betriebsam. Menschen säumten die Gassen, Fuhrwerke und Kutschen quälten sich über die mit Pflastersteinen ausgelegten Straßen.
Händler hatten ihre Stände aufgestellt und priesen ihre Ware an. Die Luft war angereichert mit angenehmen Gerüchen von Kräutern, Früchten, gebratenem Fleisch und geräuchertem Fisch, aber auch mit dem Gestank von Schweinen und Ziegen und anderem Getier, das zum Verkauf feil geboten wurde. Zusammen mit den Exkrementen die die Zugpferde und Ochsen auf die Straßen fallen ließen ergab sich eine herbe Mischung, der nicht jede Nase stand zu halten vermochte.
Julchen bog in eine Seitengasse ab und ging so der Menschenmenge aus dem Wege. Sie war noch nicht allzu lange wieder in Mainz. Dieser Ort barg für sie keine gute Erinnerung. So wurde ihr Mann doch hier verurteilt und geköpft und sie im gleichen Prozess zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt. Sie hatte es Johannes Bückler zu verdanken, dass sie so gnädig davon gekommen war. Immer wieder hatte dieser während der Gerichtsverhandlung beteuert, dass sie unschuldig sei und er sie verführt habe.
Dies hatte wohl Eindruck beim Tribunal hinterlassen. Aber sie selbst wusste, dass der Schinderhannes sie nicht zu verführen brauchte. Julchen war als zweite Tochter eines Musikanten in Weierbach, einem kleinen Ort bei Idar-Oberstein, geboren und aufgewachsen. Als Bänkelsängerin und Geigenspielerin trat sie zusammen mit ihrem Vater und ihrer Schwester auf Märkten und bei Kirchweihen auf. An Ostern 1800 sah sie den Schinderhannes zum ersten mal. Wenig später gaben die beiden sich ein heimliches Stelldichein, verliebten sich ineinander und Julchen folgte ihrem Schwarm aus freien Stücken. Sie war ein attraktives, temperamentvolles junges Ding, das wenig Skrupel kannte, wenn es darum ging ihrem Geliebten beim Rauben zur Hand zu gehen. Und so konnte sie mit dem Urteil mehr als Zufrieden sein.
Nach der Hinrichtung ihres Mannes wurde ihr Sohn Franz-Wilhelm an einen Pflegevater übergeben. Dem Mainzer Zollwächter Johannes Weiß. Danach trat sie ihre Haftstrafe im Korrektionshaus in Gent an. Sie erinnerte sich nicht gerne an die Zeit in der Besserungsanstalt zurück.
Zusammengesperrt mit anderen gesunkenen Individuen und liederlichen Dirnen musste sie unter strenger Aufsicht harte Arbeit verrichten. Der Umgang der Häftlinge untereinander war sehr rau und öfter als einmal kam es vor, dass sie Blessuren aus irgendwelchen Streitereien davontrug.
Sie war froh, als sie die Zeit im Korrektionshaus hinter sich gebracht hatte. Der Pflegevater ihres Sohnes stellte sie dann als Dienstmädchen ein. Dies war ein Glück für Julchen, so konnte sie doch bei ihrem Sohn sein.
Als Julchen um eine Ecke bog, stieß sie plötzlich mit einem jungen Mann zusammen. Der Korb entglitt ihr und landete samt Inhalt auf dem Trottoir.
»Verzeiht bitte meine Unachtsamkeit.« Der junge Mann begab sich in die Hocke und sammelte die Lebensmittel auf und beförderte sie in den Korb zurück. Mit einem Lächeln auf den Lippen kam er wieder nach oben, und reichte Julchen den Korb. »Ich bitte nochmals um Verzeihung.«
Der Mann war mittelgroß, von attraktivem, gepflegtem Aussehen. Seiner Kleidung nach zu urteilen, war er niedrigen Standes, sowie auch Julchen. Aber Manieren schien er trotzdem zu haben, dachte sie amüsiert.
»Es ist ja alles noch heil.« Sie durchforstete den Inhalt des Korbes.
»Auch bei Ihnen junge Dame? Es wäre mir ein Gräuel wenn ich Ihrer Schönheit geschadet hätte.«
Julchen sah verlegen zu dem so galanten Fremden empor. Lange war es her, dass sie solche Schmeicheleien vernommen hatte. Aber es gefiel ihr gut. So machten diese den Wert ihrer Selbst doch größer. Sie lächelte den gutaussehenden Burschen an. »Auch ich bin unversehrt. Aber danke der Nachfrage.« Sie war im Begriff weiterzugehen, aber der Mann stellte sich ihr in den Weg.
»Junge Dame, darf ich erfahren, wer Ihr seid und wo Ihr wohnt?«
Julchen blieb stehen, sie war verblüfft wie ungeniert der Mann ihr entgegentrat. »Warum wollt Ihr das wissen, mein Herr?«
»Nun, ich würde mein Missgeschick gern wieder gut machen, indem ich Euch zu einem Mahl einlade.« Der Fremde lächelte sie freundlich an.
Julchen wusste nicht genau wie sie reagieren sollte. »Ich kenne noch nicht einmal Euren Namen.«
Der Mann trat einen Schritt zurück und verbeugte sich vornehm. »Dem kann abgeholfen werden, ich heiße Kaspar Bender.«
»Ich heiße Julia Blasius«, entgegnete Julchen.
»Und sagt mir das Fräulein Julia auch noch wo es wohnt?«, fragte der Fremde unverblümt.
»Im Hause des Zollwächters Johannes Weiß.«
»Ich würde Euch gerne meine Aufwartung machen, wenn Ihr es erlaubt.«
Julchen fühlte sich durch soviel Engagement Benders mehr als geschmeichelt. Sie konnte sich durchaus ein Wiedersehen mit diesem höflichen jungen Mann vorstellen. »Nun, gut der Herr. Wenn Ihr mich so drängt«, sagte sie in gespielter Weise, »dann kommt morgen zum Dienstboteneingang von Johannes Weiß’ Haus. Ihr wisst wo das ist?«
Julchen sah deutlich die Freude von Kaspar Bender. »Ja, das weiß ich«, sagte dieser knapp.
»Am besten zur achten Stunde am Abend«, ergänzte Julchen.
»Ich werde pünktlich sein«, entgegnete Bender.
Sie lächelte ihm herzlich zu, verabschiedete sich und setzte ihren Heimweg fort.
Bender sah ihr nach, bis sie hinter einer Häuserreihe verschwunden war. Dann verzog sich sein Mund zu einem breiten Grinsen. Zwei Jahre, dachte er, wartete er nun schon auf diese Gelegenheit. Endlich hatte sie sich ergeben. Er wusste genau wen er eben vor sich hatte. Seit einigen Tagen beobachtete er sie schon und er gratulierte sich selbst zu seiner Beharrlichkeit und seinem Instinkt. Von Anfang an hatte er vermutet, dass Bücklers Frau nach ihrer Gefängnisstrafe wieder hier auftauchen würde, um in der Nähe ihres Sohnes zu sein. Und jetzt, durch die Begegnung mit ihr, hatte er einen Fuß in der Tür. Von nun an war er seinem Ziel einen großen Schritt näher gekommen. Er konnte sich nicht vorstellen, dass der Schinderhannes sein Geheimnis um das Gold mit ins Grab genommen hatte. Sie würde es kennen, dessen war er sich sicher und er würde es erfahren. Kaspar Bender alias Frederic Foch sah immer noch auf die Häuser hinter denen Julchen verschwunden war und er grinste immer noch.