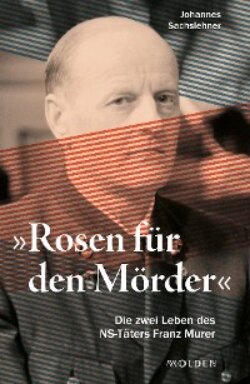Читать книгу "Rosen für den Mörder" - Johannes Sachslehner - Страница 14
Berauben, erpressen, vernichten
ОглавлениеDie erste Aufgabe des Gebietskommissariats: Es muss sich seinen Platz im Reigen der einzelnen NS-Dienststellen erkämpfen. Da ist einmal die Wehrmachtsfeldkommandantur, Gestapo, SD und Sicherheitspolizei (Sipo) haben sich ebenfalls bereits in der Stadt eingenistet, später kommt auch noch eine SS- und Polizeistandortkommandantur dazu, die von dem aus Preußisch Stargard stammenden SS- und Polizeiführer Lucian Wysocki (1899–1964) geleitet wird. Und es gibt eine intakte litauische Stadtverwaltung mit dem litauischen Bürgermeister Karolis Dabulevičius an der Spitze, die zum unmittelbaren Ansprechpartner oder besser „Befehlsempfänger“ wird. Parallel zum Gebietskommissariat Wilna-Stadt wird das Gebietskommissariat Wilna-Land eingerichtet, dem der SA- und spätere SS-Angehörige Horst Wulff (1907–1945), ein ehemaliger Hotelkaufmann, als Gebietskommissar vorsteht.
Die Arbeitsrichtlinien und Verordnungen von Rosenbergs Ministerium für die Zivilverwaltung in den Reichskommissariaten Ostland und Ukraine ergehen schließlich am 3. September 1941, zusammengefasst in einer Dokumentensammlung, die als Braune Mappe bekannt geworden ist. Die Aufgabe des Gebietskommissars wird darin folgendermaßen definiert: „Der Gebietskommissar leitet als untere Verwaltungsbehörde im Kreisgebiet die gesamte Verwaltung nach den Weisungen des Generalkommissars und der übergeordneten Dienststellen. Bei ihm liegt daher das Schwergewicht der gesamten Verwaltung.“ Und in den „Arbeitsrichtlinien“ für die Zivilverwalter heißt es: „Die erste Aufgabe der Verwaltung in den besetzten Ostgebieten ist, die Interessen des Reiches zu vertreten. Dieser oberste Grundsatz ist bei allen Maßnahmen und Überlegungen voranzustellen. Zwar sollen die besetzten Gebiete in späterer Zukunft in dieser oder jener noch zu bestimmenden Form ihr Eigenleben führen können. Sie bleiben jedoch Teile des großdeutschen Lebensraumes und sind stets unter diesem Leitgedanken zu regieren.“ (Zitiert nach Franz Albert Heinen, Gottlos, schamlos, gewissenlos.)
Breiten Raum nehmen in diesen „Arbeitsrichtlinien“ von Rosenbergs Ostministerium die „Richtlinien für die Behandlung der Judenfrage“ ein, die systematisch die weitere Isolierung und umfassende Entrechtung der jüdischen Bevölkerung einfordern. Ein „etwaiges Vorgehen der örtlichen Zivilbevölkerung gegen die Juden“, so ein wichtiger Punkt, sei nicht zu hindern, gerne überlässt man das Morden wie in Kaunas litauischen Faschisten und Totschlägern. Ein „erstes Hauptziel der deutschen Maßnahmen“ müsse es sein, das „Judentum streng von der übrigen Bevölkerung abzusondern“, die „Überführung in ein Ghetto“ sei daher anzustreben, das Judentum müsse „Zug um Zug“ aus dem öffentlichen Leben ausgeschieden werden. Bereits mit einer Verordnung vom 16. August 1941 hat Rosenberg die Zwangsarbeit für alle Juden vom vollendeten 14. bis zum vollendeten 60. Lebensjahr eingeführt, nun folgen weitere Schikanen: Juden sollen nur mehr schwere körperliche Hilfsarbeiten leisten und ansonsten „aus dem Wirtschaftsleben ausgeschieden“ werden. Das flache Land sei von den Juden zu „säubern“, das Verlassen der Ghettos in den Städten sei ihnen zu verbieten, es sei ihnen „nur so viel an Nahrungsmitteln zu überlassen, wie die übrige Bevölkerung entbehren kann, jedoch nicht mehr, als zur notdürftigen Ernährung der Insassen der Ghettos ausreicht“. Die „arbeitsfähigen Juden“ seien nach „Maßgabe des Arbeitsbedarfs“ zur Zwangsarbeit heranzuziehen, die Vergütung habe dabei „nicht der Arbeitsleistung zu entsprechen, sondern nur der Bestreitung des notdürftigen Lebensunterhaltes“ zu dienen. Das hermetisch abgeschlossene Ghetto müsse seine „inneren Verhältnisse“ in Selbstverwaltung regeln, das Gebietskommissariat habe darüber die Aufsicht – ein klarer Arbeitsauftrag für Hingst und Murer, dem sie auch auf Punkt und Beistrich nachkommen wollen: „Konzentration, Kennzeichnung, Enteignung und Ausbeutung“ der Juden von Wilna sind ihr Ziel, ein „gestaffeltes System von Ausbeutung, Terror und Kontrolle“, das dafür sorgt, dass diese „tagtäglich im Schatten des Todes“ leben. (Wolfgang Benz, Einsatz im Reichskommissariat Ostland.) Dass sie damit der Endlösung der Judenfrage, der flächendeckenden „Vernichtung“ von jüdischen Männern, Frauen und Kindern, zuarbeiten, scheint die beiden „Goldfasane“ nicht weiter zu stören, ja, sie unterstützen die Mordkommandos mit entsprechenden Maßnahmen. Sie haben zwar nicht das Recht zu töten oder töten zu lassen – sie nehmen es sich jedoch einfach. Die jüdische Bevölkerung untersteht dem Gebietskommissariat in allen zivilen Belangen, Polizei, SD und Gestapo sind für „Sicherheitsbelange“ zuständig, was immer auch das heißen mag – gemeinsam sorgt man für Terror und Tod.
Auftakt zum Holocaust: Angehörige des Litauischen Selbstschutzes treiben Juden aus ihren Häusern, Juli 1941.
Auftakt zu den antijüdischen Maßnahmen bildet eine erste „Bekanntmachung“, die vom Gebietskommissariat am 2. August 1941 veröffentlicht wird. Die Vernichtung beginnt mit der Erfassung der jüdischen Bevölkerung und ihrer Stigmatisierung: Bei Aufruf durch den Bürgermeister haben sich alle Einwohner „zwecks Registrierung“ zu melden. Alle Juden und Jüdinnen, die das 10. Lebensjahr überschritten haben, sind „mit sofortiger Wirkung verpflichtet, auf der rechten Brustseite und am Rücken einen – mindestens 10 cm breiten – weißen Streifen mit dem gelben Zionsstern oder einen 10 cm großen gelben Fleck zu tragen. Diese Armbinden bzw. Flecke haben sich die Juden und Jüdinnen selbst zu verschaffen und mit dem entsprechenden Kennzeichen zu versehen.“ Mit einer Reihe weiterer Schikanen wird die jüdische Bevölkerung systematisch ihrer Menschenwürde beraubt: Juden dürfen von nun an die Gehsteige nicht mehr benutzen, verboten sind ihnen ebenso Promenaden und öffentliche Parkanlagen sowie Strände. Verboten ist ihnen ab sofort auch die Benützung aller öffentlichen Verkehrsmittel und von Taxis, die Betreiber öffentlicher Verkehrsmittel müssen dafür sorgen, dass in ihren Fahrzeugen gut sichtbar ein Schild „Nur für Nichtjuden“ angebracht ist. Später wird auch „das Grüßen seitens der Juden und Jüdinnen“ ausdrücklich verboten, „Zuwiderhandlungen“ werden natürlich streng bestraft.
Wenige Tage später verschärft das Gebietskommissariat diese Bestimmungen und nennt 17 „Prinzipialstraßen“, die von nun an von Juden nicht mehr betreten werden dürfen. Als der Judenrat daraufhin am 18. August interveniert, lässt sich Murer zu einer Sonderregelung bewegen: 5 Mitgliedern des Judenrates soll das Betreten dieser „Prinzipialstraßen“ gestattet sein, weiters auch zwei „Courieren“, um den Dienstbetrieb aufrechtzuerhalten. Der Referent für jüdische Angelegenheiten im Landkreis Vilnius, zu diesem Zeitpunkt noch ein Herr Jonas Čiuberkis, wird von ihm gebeten, entsprechende Ausweise „mit den Namen der Juden“ auszuarbeiten. (LCVA, R-643, ap. 3, b. 300, BL. 50)
Von Anfang an, so hat man den Eindruck, ist es Murer, der das Heft in die Hand nimmt. Vor Gericht wird er später treuherzig beteuern, nur für das Landwirtschaftsreferat zuständig gewesen zu sein, in seiner im Alter verfassten autobiografischen Notiz räumt er ein, dass er die „Landwirtschaft im Stadtbereich“ nur „nebenbei“ zu betreuen hatte, damit verknüpft wäre gewesen, „die Ablieferungspflichten einzuführen, das Verwaltungsstrafrecht bei Preisüberwachung und Schleichhandel auszuüben und die Preisüberwachungsstelle zu übernehmen. Weiters die Kraftfahrzeug-Zulassung und den Kraftfahrzeugpark zu organisieren“ – all das in Zusammenarbeit mit der litauischen Stadtverwaltung. Seine Hauptaufgabe als Stabsleiter und Adjutant Hingsts liegt aber von Anfang an in der Auseinandersetzung mit „Judenangelegenheiten“ und da will er es den Juden gleich einmal so richtig zeigen:
Am 6. August 1941 lädt Franz Murer – angeblich auf Befehl von Hingst und SS- und Polizeiführer Lucian Wysocki – Mitglieder des Judenrats zu einem Gespräch ein, es kommen Eliezer Kruk, Abraham Zajdsznur und Shaul Pietuchowski. Das Treffen findet jedoch nicht in den Büroräumen des Gebietskommissariats statt, sondern in einem Haus in einer nahe gelegenen Gasse. Murer überrascht die drei Männer mit einer schockierenden Forderung: Am nächsten Tag, dem 7. August, müssten ihm die Juden fünf Millionen Rubel (= 500.000 Reichsmark) „Bußgeld“ übergeben. Um neun Uhr morgens, so Murer weiter, solle ihm die Deputation des Judenrats die ersten zwei Millionen überbringen, im Laufe des Tages dann die weiteren Millionen. Und dann eine deutliche Drohung: Sollten ihm die zwei Millionen nicht am nächsten Morgen übergeben werden, so hätten sich um zehn Uhr alle anderen Mitglieder des Judenrats bei ihm einzufinden, um die Leichen ihrer Kollegen abzuholen.
Die drei Männer kehren in den Judenrat zurück, Panik macht sich breit, als sie von Murers Forderung berichten. Wie soll man so schnell so viel Geld auftreiben? Auf den Straßen dürfe man sich bis sechs Uhr abends aufhalten, zahlreiche Straßen sind für Juden überhaupt gesperrt. Schließlich ist es, wie Herman Kruk in seinem Tagebuch berichtet, der greise Arzt Dr. Jakob Wygodzki, der seine Stimme erhebt: Für Verzweiflung sei keine Zeit, man müsse sofort mit dem Sammeln des Geldes beginnen.
Die Nachricht von Murers Bußgeld-Forderung verbreitet sich rasch. Spontan werden Komitees gebildet, die einzelne Straßen und Stadtteile übernehmen, man beginnt mit dem Einsammeln von Geld, Gold und diversen Wertgegenständen. Um sechs Uhr abends hat man 667.000 Rubel, ein Pfund Gold, Uhren und Diamanten beisammen. Viele Juden glauben, dass sie mit ihrer „Spende“ ihr Leben erkauft haben. Andere wieder hoffen, dass die Tributzahlung dazu beitragen könne, etwas über das Schicksal ihrer verschleppten Angehörigen zu erfahren.
In ihrem Tagebuch schildert Mascha Rolnikaite die Verzweiflung dieses Tages – der 14-Jährigen hat man gesagt, dass die Deutschen am nächsten Morgen mit der Tötung aller Juden beginnen werden, sollte die geforderte Summe nicht abgeliefert werden. Ihre Mutter hat „alles Geld bis auf den letzten Groschen zusammengesucht“ und dem Judenrat gebracht, sie selbst glaubt sich schon verloren: „Ich stehe am Fenster, sehe hinaus und weine: Der Gedanke, dass ich morgen sterben muss, ist furchtbar. Bis vor kurzem bin ich doch noch in die Schule gegangen, bin durch die Schulflure gelaufen, habe an der Tafel gestanden, und plötzlich heißt es – stirb!“ (Zitiert nach Mascha Rolnikaite, Ich muss erzählen.)
Adjutant Franz Murer ist gnädig: Er gestattet den Mitgliedern des Judenrats das Betreten von 17 „Prinzipalstraßen“ (LCVA, R-643, ap 3, b 300, Bl. 50).
Am Morgen des 7. August, pünktlich um 9 Uhr, stehen Kruk, Zajdsznur und Pietuchowski wieder vor Murer. Er geht mit ihnen in den Keller des Hauses, zählt das mitgebrachte Geld und fragt dann, wo denn der Rest sei. Die drei Männer erklären ihm, dass noch gesammelt werde. Murer schickt daraufhin Abraham Zajdsznur zurück zum Judenrat, die beiden anderen werden festgenommen. Die Order, die Zajdsznur zu überbringen hat: Alle Mitglieder des Judenrats müssten sofort vor Murer erscheinen und den ganzen Betrag mitbringen.
Der Judenrat kommt denn auch vollzählig, allerdings ohne Geld. Dr. Wygodzki wagt sich mit der Bitte vor, die Frist für die Aufbringung des gesamten Betrags auf zehn Tage zu erstrecken. Murers Antwort, so berichtet Grigorij Schur, ist ein Wutschrei: „Verdammter alter Jude!“ – er befiehlt Wygodzki zu schweigen. Einen ähnlichen Fluch bekommt auch die Ärztin Dr. Cholemowa zu hören, als sie für Wygodzki in die Bresche springen will und auf die knappe Frist verweist: „Du Hure, sei still, bevor ich meine Geduld verliere!“ (Zitiert nach Mendel Balberyszski, Stronger than Iron.) Murer, der die ganze Zeit über mit seiner Peitsche herumfuchtelt, lässt zwei Judenrat-Mitglieder festnehmen und erklärt den anderen, dass auch sie dieses Schicksal erleiden würden, sollte der fehlende Betrag nicht endlich aufgebracht werden. Sollte dies aber der Fall sein, würde er sie „wie Hunde“ erschießen lassen (Mendel Balberyszski). Dann nimmt er den Koffer mit dem Geld und den Wertgegenständen und verlässt das Haus.
Wenige Stunden später besucht der mit Jakob Wygodzki befreundete Pharmazeut Mendel Balberyszski den alten Herrn, der sich über die Vorgangsweise Murers nicht beruhigen kann. In seinem Augenzeugenbericht Stronger than Iron erzählt Balberyszski: „‚Du weißt‘, sagte er zu mir, ‚ich bin ein Mann, der nicht leicht einzuschüchtern ist. Ich kenne die Deutschen nicht erst seit heute. Aber was meine Augen bei diesem Treffen gesehen und meine Ohren gehört haben, hätte ich mir nie vorstellen können. Sich einer Dame gegenüber, einer Frau Doktor, so vulgärer Ausdrücke zu bedienen, seine unflätige, arrogante Sprache mir gegenüber und das ständige Herumfuchteln mit der Peitsche vor meinen Augen deuten auf eine tragische Zukunft. Von diesen beiden (= Hingst und Murer, Anm. J. S.) können wir nichts erwarten. Das Geld muss gesammelt werden. Wir können nur hoffen, dass das Geld die Bestie beruhigen wird … zumindest für einige Zeit.‘“ (Übersetzung: J. S.)
Die Judenräte beraten inzwischen über die weitere Vorgangsweise und beschließen, eine Abordnung von drei Leuten zu Gebietskommissar Hingst zu schicken, um die festgenommenen Kameraden wieder freizubekommen. Vor dem Gebietskommissariat stoßen die drei neuerlich auf Murer, der sich nun etwas umgänglicher zeigt – von einer Übergabe des gesamten Betrags noch an diesem Tag ist keine Rede mehr, er verlangt jedoch, dass in den nächsten Tagen weiter gesammelt wird, die Erlöse sollen jeweils auf der Bank deponiert werden. Um 13 Uhr werden auch die festgenommenen Mitglieder des Judenrats freigelassen. Auch Mascha Rolnikaite kann aufatmen: „Wir werden also am Leben bleiben!“, notiert sie in ihrem Tagebuch.
Die Sammelaktion dauert noch einige Tage an, schließlich sind es 1,490.000 Rubel, 33 Pfund Gold und 189 Uhren, die Murer übergeben werden, für die Wertgegenstände gibt es keine Empfangsbestätigungen – all das nährt den Verdacht, dass die von Murer eingetriebene „Kontributionszahlung“ keinen offiziellen Charakter hatte, sondern eine „private“ Aktion von ihm, Hingst und Polizeichef Wysocki war, möglicherweise dazu vorgesehen, einen Teil des jüdischen Geldes in die eigenen Taschen zu lenken. Indizien dafür sind, wie schon Yitzhak Arad in seinem Buch Ghetto in Flames vermutet, die eher versteckten Treffpunkte und die Tatsache, dass Murer das Geld selbst eintreibt und offenbar keine weiteren deutschen Beamten zur Seite stehen hat. Dazu existiert eine interessante Zeugenaussage: Im Verfahren gegen Angehörige des Einsatzkommandos 3 berichtet 1971 eine Frau Frances Penny, geborene Papierbuch, die im Gestapogebäude gearbeitet und den Haushalt von SS-Oberscharführer Horst Schweinberger besorgt hat, dass sie im Gebäude „mehrere Kisten, voll mit Gold, Schmuck und dergleichen,“ gesehen habe (zitiert nach Dieckmann, Deutsche Besatzungspolitik). Reichskommissar Hinrich Lohse sanktioniert jedenfalls am 21. August nachträglich alle Aktionen zur Beraubung der Juden, bereits zuvor, am 9. August, teilt Bronius Draugelis, der Kreischef für Vilnius-Stadt und Vilnius-Land, den Polizeiführern mit, dass die eingetriebenen Gelder auf eine staatliche Bank eingezahlt werden müssen, der jeweilige Gebietskommissar verfüge über die beschlagnahmten Gold- und Wertsachen. Lässt Lucian Wysocki diese Kisten in das Gebietskommissariat bringen oder „verwaltet“ er sie selbst? In diesem Fall hat er dazu nur wenig Zeit, denn am 11. August 1941 wird er von Himmler zum SS- und Polizei-Standortführer für den Generalbezirk Litauen mit Dienstort Kowno ernannt und muss Wilna verlassen.
Bestärkt durch den Erlass des Reichskommissariats, versucht Murer der jüdischen Bevölkerung Wilnas auch noch die letzten Wertsachen abzupressen. Am 22. August weist er Petras Buragas, den Nachfolger von Jonas Čiuberkis als litauischem „Beauftragten für Judenangelegenheiten“, an, dass der Judenrat innerhalb einer Woche alle Bargeld-, Gold- und Silberbestände „anmelden“ müsse, das gelte auch für alle in jüdischem Besitz befindlichen Warenlager (LCVA, R-643-3-4152, Bl. 128). Am 3. September 1941 verfügt das Gebietskommissariat schließlich, dass Bargeld, Wertpapiere, Aktien, Schuldverschreibungen, Wechsel, Sparbücher, Wertsachen und diverse Warenvorräte in den litauischen Polizeirevieren abgegeben werden müssen. Behalten dürfen die Juden einen Betrag bis maximal 300 Rubel. Nach bewährtem Muster werden die Leiter der einzelnen Polizeireviere in die Pflicht genommen: Sie sind für die „erfolgreiche“ Durchführung der Aktion verantwortlich. All jenen, die Informationen über Judenvermögen verschweigen und dem Gebietskommissariat vorenthalten, droht mit Bekanntmachung vom 23. Oktober 1941 die Todesstrafe.
Jakob Wygodzki (1856–1941), seit zwanzig Jahren die Stimme der Juden Wilnas, wird am 24. August verhaftet. Obwohl er schwer krank ist, bringt man ihn ins Gefängnis, ein Versuch, über die litauische Zivilverwaltung seine Befreiung zu erreichen, scheitert, auch sein junger Freund Mendel Balberyszski kann nichts für ihn tun. Der 85-Jährige stirbt nach wenigen Tagen Haft im Lukiškes-Gefängnis – nach anderer Darstellung wird er ermordet. Sein Tod ist ein schwerer Schlag für den Judenrat: Mit Jakob Wygodzki, ehemals Minister für jüdische Angelegenheiten der Republik Litauen, verliert man die herausragende Persönlichkeit dieser Tage, einen Mann, der durch seine Integrität und Haltung in der Auseinandersetzung mit den Nazis zum Vorbild geworden ist.
Vor Gericht in Graz 1963 wird Murer die von ihm mit so viel Elan betriebene Beraubung der jüdischen Bevölkerung beharrlich leugnen. 15 Jahr zuvor, in den Verhören durch den sowjetischen Untersuchungsrichter in Mai und Juni 1948 in Wilna, ist seine Erinnerung noch bedeutend besser – er räumt im Verhör ein, dass er an der Eintreibung der „Kontribution“, die man über die Juden verhängt habe, beteiligt gewesen sei: „Die Wilnaer Juden mussten eine Million Rubel oder Reichsmark zahlen, ich kann mich an die Währung nicht mehr erinnern. Sie hatten die Summe in drei Raten innerhalb von ein, zwei Tagen zu zahlen.“ Das Geld wäre als adäquates Angebot für eine Garantie gedacht gewesen: Die Juden sollten dadurch davon abgehalten werden, etwas gegen die Deutschen zu unternehmen. Die Idee zur Kontribution sei allerdings von SS- und Polizeiführer Lucian Wysocki gekommen, er habe vorgeschlagen, die erzielte Summe in die Kasse des Gebietskommissariats einzuzahlen. Zum vorgegebenen Zeitpunkt hätten die Juden „500 bis 600.000 Rubel und 15 kg Gold “ abgeliefert, aber das sei zu wenig gewesen. Auf Weisung des Gebietskommissars habe er jedoch diesen Betrag akzeptiert und in die Kasse des Hauses eingezahlt.
Die Namen von SS-Standartenführer Karl Jäger, Gebietskommissar Hans Christian Hingst und seinem Stabsleiter Franz Murer sind in der jüdischen Bevölkerung Wilnas inzwischen bekannt, auch in der Familie des Buchhalters Mosche Anolik in der Pohulankastraße werden sie aufmerksam registriert. Vater Mosche ist dafür, die „Befehle“ der Deutschen zu befolgen, da man ohnehin keine Wahl habe und ihnen keinen Vorwand geben dürfe, gegen die Juden vorzugehen. Die beiden Söhne sind kämpferischer – so erinnert sich der 15-jährige Benjamin Anolik, genannt „Benja“, später an ein Gespräch mit seinem älteren Bruder Nissan, in der Familie kurz „Nisja“ gerufen: „‚Wir werden uns diese Namen merken‘, sagte Nisja, ‚wir werden später mit ihnen abrechnen!‘ – ‚Hoffentlich‘, sagte ich, ‚hoffentlich werden wir das erleben!‘ – ‚Siehst du, Benja, manche Namen sind kein Zufall: Ein ‚Jäger‘ jagt, und ‚Murer‘ hört sich wie Mörder an!‘“ (Zitiert nach Benjamin Anolik, Lauf zum Tor mein Sohn.)