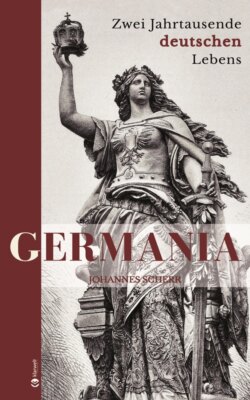Читать книгу Germania - Johannes Scherr - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2. Heidnisch-germanisches Land und Volk.
Оглавлениеus der Wurzel kaukasischer Menschenrasse wuchs der Riesenstamm der arischen Nationenfamilie empor. Dieser Stamm trieb den gewaltigen germanischen Ast, welcher seinerseits in zwei ungleich mächtige Zweige sich spaltete: Nordgermanen (Skandinaven) und Südgermanen (Deutsche). Diese, unser Volk, lassen schon in ältester Zeit, wie noch heute, deutlich wahrnehmen, dass die Gegensätze und Widersprüche der Menschennatur auch in den Völkernaturen wiederkehren. Denn, wenn es keinem Zweifel untersteht, dass in unseren Vorfahren ein tiefes Gefühl nationaler Zusammengehörigkeit lebte, so wurde dadurch die Tatsache nicht aufgehoben oder auch nur gemindert, dass die Deutschen, soweit geschichtliche Kunde zurückreicht, niemals eine Gesamtmasse gebildet, niemals den Einheitsstaat gekannt haben. Die Grundursache hiervon mag in dem starken Persönlichkeitstrieb der Germanen gesucht werden, in jenem stolzen Aufsichgestelltseinwollen, welches allerdings alle Tugenden der Mannhaftigkeit zeitigen kann, aber auch die Fehler des Eigendünkels und der Rechthaberei. So wie jedoch der deutsche Individualismus einmal war, musste diesem Volkscharakterzug die politische Form des Föderalismus am besten entsprechen.
Die nationale Persönlichkeit hatte sich, so zu sagen, schon von uraltersher in Stämmepersönlichkeiten zerlegt und diese traten, wann die Not es erforderte, als Gleiche mit Gleichen zu gemeinsamen Zwecken in Bündnisse, deren Zeitdauer die Umstände bestimmten. Nationale Bindemittel waren nur das Bewusstsein gemeinsamer Herstammung, dann die obzwar schon frühzeitig mundartlich auseinandergefaltete Muttersprache und endlich die gemeinsame religiöse Grundanschauung.
Aus dieser stammte auch die älteste, entschieden mythisch gefärbte Einteilung des deutschen Volkes, von der wir wissen. Durch den Römer Tacitus nämlich, bei welchem zu lesen steht: „In alten Liedern, ihren einzigen Urkunden und Jahrbüchern, verherrlichen die Germanen den Gott Thuisto, der Erde Sprößling, und seinen Sohn Mannus als ihres Volkes Stammväter und Stifter. Dem Mannus aber teilen sie drei Söhne zu, nach welchen die zunächst dem Meere wohnenden Germanen den Namen Ingävonen, die in der Mitte den Namen Herminonen und die übrigen den Namen Istävonen empfangen haben sollen.“
Diese Dreiteilung muss sich jedoch rasch vervielfältigt haben. Tacitus selbst macht noch weitere Stämme namhaft und schon früher, zu Cäsars Zeiten, traten andere hervor, die später wieder von anderen abgelöst wurden. Von alten Volksbünden, zu welchen sich verschiedene Stämme vereinigten, kennen wir den in Cäsars Tagen mächtigen Suebenbund, sowie den etwas später durch Armin gestifteten niederdeutschen Cheruskerbund und den diesem durch Marbod entgegengestellten oberdeutschen Markomannenbund. Oberdeutsch und Niederdeutsch — dieser Unterschied trat schon frühzeitig und gegensätzlich genug hervor und er besteht ja noch jetzt als der Gegensatz von Süd- und Norddeutschland. Das Alter der Sueben als des oberdeutschen und das der Sachsen als des niederdeutschen Hauptstammes reicht weit hinauf. Gegen die Zeit der Völkerwanderung hin und rascher und bunter noch während des Gewoges derselben verschoben sich die Verhältnisse der germanischen Stämme gar mannigfaltig. Alte Namen verschwanden, neue kamen auf. Im Verlaufe der ungeheuren Umwälzung, welche das weströmische Reich in Trümmer warf und das stolze Wort: „Die Welt gehört den Germanen!“ für eine Weile zur Wahrheit machte, sind namentlich die Stämme der Goten, der Heruler, der Vandalen, der Langobarden, der Burgunder, der Alemannen und der Franken in den geschichtlichen Vordergrund getreten.
Unser Vaterland ist weit davon entfernt, eine geologische Einheit darzustellen. Ja der außerordentlich großen Mannigfaltigkeit seiner Bodengestaltung waren die vielfältigen Unterschiede vorgebildet, welche die deutschen Bevölkerungen in physischer und moralischer Beziehung schon in alter Zeit aufwiesen, wie das noch heute geschieht. Allerdings bewegten und bewegen sich diese Verschiedenheiten innerhalb des Rahmens der Nationalität, aber innerhalb dieses Rahmens sind sie auffallend genug. Man denke sich, wie sich heute der Friese zum Tiroler der Baier zum Pommer, der Rheinländer zum Steirer, der Märker zum Schwaden, der Thüringer zum Holsten stellt, und man wird sich vom Verhalten der alten Sachsenstämme Niederdeutschlands zu den altalemannischen Oberdeutschlands eine ungefähre Vorstellung bilden können. Oder man halte den landschaftlichen Charakter Süddeutschlands, Mitteldeutschlands und Norddeutschlands zusammen und man wird unschwer verstehen, dass sich den territorialen und klimatischen Abweichungen dieser Gebiete voneinander gemäß auch die Fassung und Führung des Daseins, Empfindungsweise, Sitte und Recht verschiedenartig gestalten mussten. Ein Blick auf die geologische Karte von Deutschland genügt, um zu begreifen, dass unsere Vorfahren sich nicht zu einer staatlichen Einheit entwickeln konnten, sondern in eine Vielheit von Staaten und Stämmen auseinanderfallen mussten. Die Nationaleinheit der Deutschen ist nicht das Werk der Natur, sondern das der Kultur. Die deutsche Bildung hat den Gedanken dieser Einheit geschöpft und die deutsche Bildung war und ist es auch, welche diesen Gedanken verwirklicht oder wenigstens zu verwirklichen entschieden angefangen hat. Das bezeugt unwidersprechlich welche hohe sittliche Kraft und Macht diesem Gedanken innewohnen muss.
Die Römer, mit ihren von dem lachenden Anblick der italischen und römisch-gallischen Landschaften, dieser von einer gütigen Natur so reich gesegneten Fluren, dieser mit allen Schätzen der Zivilisation prangenden Städte verwöhnten Augen, blickten nur mit einer Art von Schauder auf Germanien als auf ein Land, dessen Erde und Himmel gegen die Bewohner gleich erbarmungslos sich erwiesen. Der Verfasser der „Germania“ meinte sogar, die Germanen müssten wohl Erdentsprossene (Autochthonen) sein, denn wie hätte es Menschen einfallen können, aus einem andern Lande in dieses „von Wäldern und Sümpfen starrende“ einzuwandern? Nur einen Römer, den älteren Plinius, hat eine flüchtige Ahnung von dem poetischen Zauber germanischer Urwaldsherrlichkeit angewandelt, während früher schon Julius Cäsar das, was über die Menge und die Gewaltigkeit deutscher Waldtiere zu seinen Ohren gedrungen war, in seinen Schilderungen vom germanischen Elenn und Renn so ins Märchenhafte steigerte, dass man ihm zufolge glauben müsste, mammutartiges, elefantengestaltiges Wild sei in den altdeutschen Forsten von unseren Ahnen gejagt worden. So karg, wild und unwirtlich, wie die Römer wähnten, sah es aber denn doch in Germanien nicht aus. Allerdings im Vergleiche mit Italien und einem großen Teil von Gallien musste es als eine Wildnis erscheinen. Denn der weitaus größte Teil der Bodenfläche war mit Wäldern und Sümpfen bedeckt und auf dieser düsteren Eintönigkeit der Landschaft lastete den größten Teil des Jahres hindurch ein nebelgrauer, regen- oder schneeschwerer Frosthimmel. Wenn man nun aber erwägt, welche Masse von streitbaren Männern und Jünglingen Germanien zur Zeit der Völkerwanderung ausschüttete, so muss man schließen, dass die Bewohnerzahl des Landes schon zur Zeit des Tacitus eine beträchtliche gewesen sei. Eine so zahlreiche Bevölkerung vermochte von dem Reichtum an Wildbrät und Geflügel, wie die Wälder und Sümpfe, und an Fischen, wie die Seeküsten und Ströme sie boten, nicht zu leben, sondern musste in schon bedeutendem Maße Ackerbau und Viehzucht zur Hilfe nehmen. Das war dann auch geschehen und wir wissen, dass unter den ackerbauenden Händen unserer Urväter besonders Gerste und Hafer gerieten, dass sie in milderen Gegenden, namentlich am Rhein, Kirschen- und Apfelbäume pflanzten, dass sie dem Wießwachse Sorge zuwandten und dass auf ihren Weiden zahlreiche Herden von Rindern, Kühen und Schafen grasten. Neben diesen Nutztieren werden auch Schweine, Ziegen und Gänse erwähnt. Winterfütterung mit Heu war bräuchlich. Als Zugtiere spannte man vor die zwei-und vierräderigen Karten Ochsen oder Stuten, während die Hengste als Reittiere dienten. Hund und Katze waren altherkömmliche Hausgenossen. Butterung und Käserei wurden fleißig geübt. Der Flachsbau ward der Kleiderbereitung wegen mit Sorgfalt betrieben. Harten, Spaten, rohgefügte Pflüge und Eggenmachten das Feldgeräte aus. Ob schon Dünger in Anwendung gekommen, ist zweifelhaft, und entschieden wird bestritten dass die Germanen bereits die sogenannte Dreifelderwirtschaft gekannt hätten. Wohl mit Fug, denn allen auf uns gekommenen Zeugnissen zufolge überwog in der Landwirtschaft unserer germanischen Vorfahren die Fleischproduktion die Getreidebeschaffung weit, was sich ja mit dem vorzugsweise auf letztere abzielenden Dreifeldersystem nicht vertragen hätte.
Wie die Erscheinung der germanischen „Barbaren“, der Anblick dieser waldfrischen, von Gesundheit und Kraft strotzenden Gestalten auf die Römer wirkte, ist schon berührt worden. Schrecken erregend, Neid und wohl auch böse Zukunftsahnung. Da Tacitus die „Unvermischtheit“ der Germanen ausdrücklich betont, so mag es auch glaubhaft erscheinen, wenn er von der germanischen Körperbeschaffenheit als von einer typischen spricht. Als Charaktermerkmale derselben kommen bei ihm und anderen Römern vor der hohe und schlanke Wuchs mit knappem Unterleib, das trotzige Blau- oder Grauauge, das rötlichblonde — nicht brand- oder fuchsrote — Haupt- und Barthaar, die helle Hautfarbe und das Wangenrot. Frost und Hunger lehrten dieses Volk sein Land und Klima ertragen, Sonnenhitze dagegen und Durst auszuhalten war es wenig geeignet. Der deutsche Durst scheint so recht ein germanischer Urdurst zu sein, denn unbändige Trunksucht und eine damit häufig verbundene zügellose Spielwut werden frühzeitig als Nationalhafter tadelnd erwähnt. Nichts kam der germanischen Waghalsigkeit gleich, vor nichts schrak die germanische Kühnheit zurück und keiner Probe versagte sich der germanische mut. Dem Ungestüm des germanischen Angriffs war schwer zu widerstehen und jener vom römischen Dichter Lukanus gekennzeichnete deutsche Kampfzorn („teutonicus furor“), welcher bei den Skandinaven zur „Berserkerwut“ verwilderte, machte selbst tapfere Gegner zittern. Ein lug und trugloses Volk nennt Tacitus unsere Ahnen. Mit einem starken Selbstgefühl verbanden sie ein tiefreligiöses Bewusstsein der menschlichen Unzulänglichkeit und Bedürftigkeit. Offen, wahrhaft, worttreu und gastfrei, ließen sie in- ihrer Fröhlichkeit das sehen, was die nur den Deutschen eigenen Worte „Gemüt“ und „Gemütlichkeit“ ausdrücken. Dem Mute der Männer entsprach die Keuschheit der Frauen, der Unverdorbenheit der Jünglinge die jungfräuliche Zucht der Mädchen.
Unzucht und Ehebruch zählten zu den schwersten Verbrechen. Dieses von staunenden und wohl auch etwas schönfärbenden Fremden entworfene Lichtgemälde der waldursprünglichen Tugenden unseres Volkes hat aber schon zur Völkerwanderungszeit bedenkliche Trübungen erlitten. Die Wirkungen der Bekanntschaft mit den Anschauungen und Genüssen römischer Verbildung und Verderbtheit waren eingetreten: die barbarische Gesundheit der Germanen hatte den Giften einer raffinierten Kultur nicht völlig standzuhalten vermocht.
Die teutonische Roheit war geblieben, aber sie hatte sich die römische Lasterschminke aufgelegt und die Gier nach Genuss stand der Kraft zum Genießen nicht nach.
Ja Altdeutschland ist von einer Freiheit im neuzeitlichen Wortsinne gar keine Rede gewesen. Unser heutiger Freiheitsbegriff ist ja überhaupt eine Errungenschaft der modernen Kultur. Er ist auf die Vorstellung von Menschenrechten basiert. Solche aber kannten die Germanen nicht, sondern nur Ständerechte. Das ganze Volk schied sich streng in zwei große Stände oder Kasten: Freie und Unfreie, Herren und Knechte. Diese Scheidung war uralt und wahrscheinlich aus der arischen Urheimat mit nach Europagebracht. Daraufhin weist die Tatsache, dass wie nach indischer so auch nach germanischer Anschauung — diese ist im „Rigsmal“ der Edda mythologisch gestaltet — die schroffe Scheidung in erbliche Große und Geringe, in Gebietende und Gehorchende ein unmittelbarer Ausfluss des göttlichen Willens war. Aber der Unterschied ist, dass in Indien die ständische Einrichtung zum bleibenden Kastenwesen versteinerte, während sie in Deutschland schon zur Zeit der Völkerwanderung in ruhelosen fluss kam, in eine Regung und Bewegung, welche die kastenartige Erstarrung verhinderte und die zwischen Freien und Unfreien gesetzten Grenzmarken vielfach verrückte.
Deutscher Urwald.
Der ursprüngliche Stand der Freien oder Berechtigten hatte sich in zwei Unterarten gegliedert: die adeligen Freien und die gemeinen Freien. Die Adalinge (Edelinge, Urfreien, Semperfreien, nobiles) sind ursprünglich wohl nichts anderes gewesen als große Grundbesitzer, welche vermöge ihres Reichtums an Land und Vieh im Stande waren, eine zahlreiche Dienstmannschaft zu ernähren, und ihr „Allod“ (Freigut) nach dem Rechte der Erstgeburt vererbten. Die Bedeutung des Wortes „Adel“ selbst ist strittig. Den einen zufolge bedeutet es Geschlecht, nämlich edles, d. i. reiches und demnach einflussreiches, vornehmes Geschlecht, eine Familie, in welcher sich der Besitz von Land und Leuten von langher vererbt hat; den andern zufolge wäre das Wort Adal gleichbedeutend mit Odal und dieses zurückzuführen auf Od, d. i. Gut, so dass ein Odaling, ein Edelmann schlichtweg einen Gutsbesitzerbedeutete. Die Gemeinfreien (tiberi oder ingenui) scheinen sich durch Begabung, Verdienst oder Glück allmälig aus der Unfreiheit und Rechtlosigkeit zur Freiheit und Berechtigung emporgearbeitet zu haben, wozu der Waffendienst in den Gefolgschaften der großen Adalinge die besten Gelegenheiten bieten mochte.
Beide Stände, die Ur- und die Gemeinfreien, haben sicherlich mannigfaltige, geschichtlich gar nicht genau nachzuweisende Wandelungen und Schicksalsläufe durchgemacht, bis später aus jenen der sogenannte hohe und aus diesen der sogenannte niedere Adel hervorging. Was den Stand der Unfreien angeht, auswelchem im Vorschritt des Mittelalters die Masse des freien Städtebürgertums und weit später erst die Masse der freien Bauerschaft sich entwickelte, so zerfiel derselbe zur heidnischen Zeit ebenfalls in zwei Unterarten: Liteur (liti, Hörige) und Schalke (servi, Sklaven). Die Hörigen saßen auf Grundstücken, welche ihnen ihre Herren zur Bebauung und Nutznießung überließen gegen bestimmte Dienstleistung und Abgaben. Ein solches von Hörigen bebautes Gut hies Feod (feudum) und das urzeitliche Verhältnis zwischen Grundbesitzern und Hörigen wurde die Basis, auf welcher sich die Sozialpolitik des Mittelalters, das Feudalwesen, aufbaute. Die Hörigen hatten es, so hart ihr Los war, doch entschieden besser als die eigentlichen Sklaven und zwar darum, weil sie nur zugleich mit dem Acker, aus welchem sie angesiedelt waren, verkauft werden durften und weil ihnen die Möglichkeit, etwas zu erwerben und damit aus der Knechtschaft—sich loszukaufen, nicht verschlossen war. Die Schalke dagegen, ursprünglich wohl lauter Kriegsgefangene, waren Sklaven im härtesten Sinne des Wortes, durchaus rechtlos, ein Tauschmittel, eine Ware, strafloser misshandlung und Tötung durch ihre Besitzer preisgegeben. Rechtsfähig und im Besitze des öffentlichen Rechtsschutzes waren überhaupt nur Freie, in deren Kreis ein freigewordener Lite erst im dritten Geschlechte wirklich eintrat. Nur Freie konnten Richter, Kläger oder Zeugen sein. Nur Freie konnten priesterliche Handlungen verrichten. Nur ihnen stand selbstverständlich das Recht der Waffenführung zu. Nur sie hatten in der Landsgemeinde Wort und Stimme. Ein „Volk“ im politischen Sinne gab es demnach in Altgermanien nicht, sondern nur eine mühselig frohnende Masse, auf deren breiter Grundlage das bevorrechtete Dasein einer Minderzahl von größeren und kleineren Herren sich erhob, welche Krieg, Jagd und etwa das Mitraten und Mittaten in öffentlichen Sachen für die einzigen eines freien Deutschen würdigen Beschäftigungen ansahen.
Hart und herb, wie das Verhältnis von Herr und Knecht, war auch das Verhältnis von Mann und Weib, wenigstens was die rechtliche Seite betraf. Denn von rechtswegen war dieses Verhältnis auf die einfache Formel gebracht: Herr und Magd. Die sehr verschiedene Wertung der beiden Geschlechtererhellt schon daraus, dass ein neugeborenes weibliches Kind auszusetzen und verkommen zu lassen so ziemlich für nichts geachtet wurde.
Veleda, die Prophetin der Brukterer.
Noch zur fränkisch-merowingischen Zeit stritten sich auf einer Kirchenversammlung die Priester über die Frage herum, ob die Weiber auch Menschen wären. Durchgehends war im germanischen Altertum dem Manne vor dem Weibe, dem Sohne vor der Mutter, dem Bruder vor der Schwester Vorzug und Vorteil eingeräumt. Kein Weib besaß rechtlich die „Selbmundia“, d. i. die freie Verfügung über die eigene Person oder über einen Besitz. Weder Mädchen noch Frau vermochte einen rechtsgültigen Akt zu vollziehen, vor Gericht eine Klage zu erheben, noch gegen eine solche sich zu verteidigen. Denn überall bedurfte das Weib eines Vertreters, Fürsprechers, Vormundes, Vogtes. Die Gattin war vom Gatten, die Witwe vom Sohne, die vaterlose Tochter vom Bruder bevormundet und bevogtet. Auch das Erbrecht der Frauen war da, wo überhaupt vorhanden, ein sehr beschränktes: regelrecht fiel beim Tode des Hausvaters das ganze Erbe den Söhnen zu und gingen die Witwe und die Töchter leer aus.
Trotz alledem muss in das Verhältnis von Mann und Weib in Germanien schon frühzeitig ein idealischer Zug eingegangen sein. Das Zeugnis des Tacitus, welcher von der germanischen Ehe mit hoher Achtung spricht, tritt hierfür ein, obzwar das Gewicht dieses Zeugnisses auch an dieser Stelle abgeschwächt wird durch die offenbare Absicht des Römers, mittels Schönmalerei germanischer Sittenreinheit seinen verdorbenen Landsleuten eine Strafpredigt zu halten. Die Sitte hat wohl den starren Rechtsbann kräftig durchbrochen und dein Weibe eine bessere Stellung verschafft, als das Gesetz demselben einräumen wollte. Die Sitte aber, beziehungsweise auch die Unsitte, wird ja allzeit und überall zumeist durch die Frauengemacht, und was schöne und kluge Weiber im Guten und im Bösen vermögen, steht auf gar vielen Blättern des Weltgeschichtebuches zu lesen. Wie sich, was das Verhältnis von Mann und Weib angeht in Germanien die Sitte schon frühzeitig zum Edleren gewendet habe, wird bezeugt durch die Tatsache, dass bei der großen Mehrzahl der deutschen Stämme Einweibschaft die Regel, Mehrweiberei die Ausnahme war. dass aber nur die Einweibschaft eine rechte Ehe und dass nur eine solche wiederum eine gesunde Familienhaftigkeit begründet, ist allbekannt. Nicht minder, dass die Familie die Grundlage jeder rechtlichen Gemeinschaft unter den Menschen war und ist und demnach auf ihr, nicht auf einem Märchending von sogenannten „Urvertrag“, alle Staatsbildungen ruhen.
Weiterhin spricht dafür, dass die sittliche Wertung des Weibes schon frühzeitig eine höhere gewesen sei als die rechtliche, jene unnachsichtliche Strenge, womit die Strafgesetze der germanischen Stämme jede Schädigung oder gar die Vergewaltigung weiblicher Scham und Zucht ahndeten. Endlich müssen wir annehmen, dass unsere Urältertmütter über alle die ihnen gesetzten rechtlichen Schranken hinweg eine einflussreiche Stellung in der Familie gewonnen und von dieser aus auch auf die öffentlichen Angelegenheiten einzuwirken gewusst haben. Denn eine solche Einwirkung fand tatsächlich statt. Zunächst in der Form weiblichen Priestertums, auf welches der berühmte Satz des Tacitus: „Die germanischen Völkerschaften glauben, dass den Frauen etwas Heiliges und Vorschauendes innwohne; darum achten sie des Rates und beherzigen sie die Aussprüche derselben“ — vornehmlich zu beziehen ist. Die zwischen der Rechtlosigkeit der germanischen Frau und dieser altgermanischen Frauenverehrung klaffende Kluft bleibt freilich unüberbrückt und wir müssen eben auch diesen Widerspruch hinnehmen wie so viele andere, von welchen die Geschichte des Menschen und der Gesellschaft voll ist. Schon bei den Kimbrern sind wir germanischen Priesterinnen begegnet. Cäsar sodann weiß uns bei Gelegenheit seines Zusammenstoßes mit Ariovist von weissagenden Frauen der Deutschen zu erzählen. Weiterhin wird in der „Germania“ eine Aurinia (Aliruna?)als eine von ihren Landsleuten hochverehrte Schicksalsverkünderin genannt. Zu noch höherem Ruf und Ansehen gelangte zur Zeit der Kämpfe des Civilis gegen die Römer am Niederrhein eine Jungfrau-Prophetin vom Stamme der Brukterer, Veleda geheißen. Weitumher erteilte sie Winke, Weissagungen und Befehle und fand Gehorsam. Wie eine Schicksalslenkerin erschien sie. Siegesbeute legte man ihr zu Füßen; Waffen, Adler, gefangene römische Offiziere, sogar ein eroberter römischer Kriegskahn, die prätorische Trireme, wurden ihr als Geschenke zugesandt. „Doch von Angesicht die Veleda zu sehen“ — erzählt Tacitus in seinen Historien –„war nicht gestattet. Man verwehrte es, damit die Ehrfurcht um so größer wäre. - Die Prophetin stand auf einem hohen Turme und ein Auserwählter ihrer Sippe vermitteln Fragen und Antworten wie ein Götterbote . . .“
Altgermanische Hochzeitsfeierlichkeit.
Zweifelsohne sind im alten Deutschland sämtliche Freie zugleich Grundbesitzer gewesen. Auf Bauernhöfen lebten sie mit Weib und Kind und Gesinde. Diese Höfe, je nach der größeren oder geringeren Hablichkeit der Besitzer an Umfang verschieden, bestanden entweder als „Einzechten“ oder aber warengruppenweise zu Weilern oder Dörfern vereinigt. Städte gab es in Germanien nur da, wo römische Standlager und Handelsfaktoreien allmälig zu solchen sich entwickelt hatten. Die Germanen ihrerseits hielten es für unmannhaft und verweichlichend, innerhalb von Städtemauern zu leben. Einzechten hatten ihren Grund und Boden als geschlossenes „Heimwesen“ — welches Wort in der deutschen Schweiz noch heute bräuchlich — rings um das Haus her liegen. Eine Anzahl von solchen Heimwesen bildete eine Gemeinde, welcher zu gemeinsamem Nießbrauch auch Weiden und Wälder eigen waren („Allmeind“). Bestand eine Gemeinde nicht aus Einzelhöfen, sondern in geschlossener Dorfgestalt, so teilte sie ihr Flurgelände der verschiedenen Bodenbeschaffenheit wegen in verschiedene Gebreite, so dass der Grundbesitz eines Dörflers nicht geschlossen, sondern zerstreut lag. Gemeinsame Wälder und Weiden besaß die Dorfgemeinde natürlich ebenfalls. Diese Daseinsweise deutscher Bauerschaft, der freien nämlich, ist aus der heidnischen Zeit in die christliche herübergekommen und hat sich in ihren Grundzügen bis auf den heutigen Tag erhalten. Welche Wechsel und Wandel dagegen müssen mit dem germanischen Großbauer vor sich gegangen sein, bis er zum mittelalterlichen Lehnsherrn und aus diesem zum modernen „Souverän“ geworden.
Armin entführt Thusnelda.
Die Ansicht, welche ein altdeutsches Haus und Heim darbot, müssen wir uns jedenfalls nach den verschiedenen Gegenden verschieden denken. Die Unterschiede, welche z. B. noch heute statthaben zwischen Bauernhöfen in Westphalen und in der Steiermark, zwischen märkischen und bernischen Gehöften, zwischenschwäbischen und mecklenburgischen Dörfern, haben sich sicherlich schon in den Tagen unserer Vorfahren bemerkbar gemacht. Indessen gewisse nationale Merkmale müssen die altdeutschen heimwesen doch wohl mit einander gemeingehabt haben, und wenn wir die leider nur sehr dürftigen Angaben, welche aus uns gekommen sind, zusammenhalten, so ergeben sie diese Summe. Das germanische Wohnhaus war halb in, halb über der Erde gebaut. Der unterirdische Raum mochte zum Winteraufenthalte dienen, wurde aber auch sommerlang als Webkammer von den Frauen benützt. Die Wände des Hauses bestanden aus Fachwerk oder waren auch wohl aus Baumstämmen ausgeblockt. Die Dachbedeckung bestand aus Schilf oder Stroh und wurde zur Winterszeit mittels einer Lage von Dünger verdichtet- Das Übertünchen der Hauswände mit einer hellfarbigen und glänzenden Lehmart war schon frühzeitig üblich. Von Fenstern oder Schornsteinen keine Spur. Außer dem Wohnhause, dessen Inneres wir uns als in verschiedene Gelasse geteilt denken dürfen, war ein Vorratsspeicher und der Viehstall vorhanden. Diese beiden Räumlichkeiten waren entweder dem Wohnhause angebaut oder standen demselben abgesondert gegenüber. Keinem größeren Gehöfte fehlte wohl das „Ausgedinghäuschen“ („Altenteil“, „Ähnistübli“), in welchen Raum der alt und bresthaft gewordene Bauer nach Übergabe des Hofes an seinen Erstgeborenen sich zurückzog.
Auch ein Schuppen oder Gaden zur Aufbewahrung des Ackergerätes, des Pferdegeschirres und der Karren, sowie ein Verschlag zum Brauen des Bieres gingen einem richtig ausgestatteten Heim nicht ab. Den ganzen Raum, aus welchem diese sämtlichen Gebäulichkeiten standen, umgab eine Einzäunung, welche jenach der Bedeutung des Hauses mit sichernden Vorrichtungen verstärkt war, so dass sie den Wohnsitzen großer Adalinge sehen ein gewisses burgartiges Aussehen verlieh. An die stattlichen Burgpfalzen mittelalterlicher Dynasten darf dabei freilich nicht gedacht werden.
In sein also beschaffenes heimwesen führte der freie Mann - und nur dieser konnte eine rechte Ehe schließen - seine nach den Geboten der Standesgleichheit in der Familie eines Gleichfreien gekürte und - gekaufte Gattin. Denn das germanische Freien war ein Kaufen in der ganzen Prosa des Wortes. Schon sprachlich wurde die Frau als Ware, als Sache gestempelt durch den sächlichen Artikel (das Weib, nicht die Weib). Der Mann musste sie kaufen und konnte sie darum auch verkaufen, eine Barbarei, welche keineswegs nur eine Redensart, sondern ein Brauch war, der sich am längsten bei den Angelsachsen in England erhalten hat. Noch im Jahre 844 hat zu Nottingham auf dem Marktplatz ein Eheherr von Engländer seine Frau um einen Schilling losgeschlagen. Verbindungen zwischen Freien und Unfreien, da und dort sogar zwischenadeligen und gemeinen Freien, galten für sträfliche missheiraten. Nahm ein Freier eine Hörige oder eine Freie einen Knecht, so sanken sie mitsamt ihren Kindern selber in den Stand der Knechtschaft hinab. Bei den Sachsen stand sogar aus jeder nicht standesgleichen Ehe der Tod. Mit Eingebung des Ehebundes eilten unsere Vorfahren nicht allzu sehr. Für das richtige Ehealter sahen sie beim Manne die Zeit vom zwanzigsten bis zum fünfzigsten, beim Weibe vom achtzehnten bis zum vierzigsten Jahre an. Der Hochzeit ging die Verlobung voran oder auch nicht. Hatte der Heiratslustige oder ein Beauftragter desselben eine passende „Partie“ gefunden, so tat er dem Vater oder dem Vormund des Mädchens zu wissen, welchen Kaufpreis er zu zahlen gewillt wäre. Wurde man des Handels einig, so entrichtete der Käufer entweder den festgesetzten Preis sofort und erhielt die Gekaufte als rechtmäßig mit ihm Vermählte ausgehändigt oder aber wurden das Kaufgeschäft und die Kaufsumme nur vorläufig vereinbart und das war eine bloße Verlobung des Paares, während die Vollziehung der Ehe, d. h. die Entrichtung des festgesetzten Kaufpreises, erst später stattfand. Rinder, Pferde, Waffen waren die Münze, womit unsere Ahnen ihre Frauen den Familien derselben abkauften.
Heimfahrt von der Hochzeit.
Häusliche Szene.
Zur Zelt der Völkerwanderung sodann gab es auch Geldansätze, welche zeigen, dass die Weiberware doch hoch im Preise stand, namentlich wenn man berücksichtigt, wie außerordentlich viel höher denn heute der Geldwert damals war. Bei den Alemannen galt ein heiratsfähiges Mädchen bis aus vierhundert Schillinge, also mehr als tausend Mark. Das Heiraten war mithin in Germanien keine Romantik, sondern ein Geschäft und nur mittels Kaufes geschlossene Linien waren gesetzliche. Allein wie mächtig Sitte, Gesetz und Gewohnheit sein mögen, es gibt und gab allzeit noch ein Mächtigeres: das Menschenherz mit seinen Gefühlen und Leidenschaften. Darum ist uns denn schon aus ältester deutscher Geschichte ein richtiger Liebesroman wohlbezeugt, welcher dartut, dass doch nicht immer die Frauen gekauft und Ehebündnisse nur als Kaufgeschäfte behandelt wurden. Der Held dieses Romans ist kein geringerer Mann als der „Befreier“ Armin, welcher seine edle Gattin Thusnelda, während sie bereits einem Andern verlobt war, ihrem Vater Segest nicht abgekauft, sondern entführt hat. Übel freilich ist dieser Ehebund später ausgeschlagen. Armin, Thusnelda und ihr Sohn Thumelikus, alle drei sind sie einem tragischen Geschicke verfallen und so haben Gesetz und Sitte schließlich doch recht behalten.
Auf der Bärenjagd.
Die germanische Hochzeit ging nicht ohne Feierlichkeit vor sich. Nachdem in Gegenwart von Zeugen aus der beiderseitigen Sippe der Kaufpreis erlegt war, wurde dem Bräutigam die Braut gegenübergestellt. Das Haar, welches sie bislang freiwallend getragen, war ihr aufgebunden und unter eine Haube gesteckt(woher unser „Unter die Haube kommen“ stattheiraten) zum Zeichen, dass es mit ihrer Mädchenfreiheit nunmehr zu Ende. Ihren Gürtel zierte ein Schlüsselbund, denn sie sollte verwalten, was ihr Gatte Verschließbares besaß. Ein Jüngling, dessen Rolle in der des Brautführers bei schwäbischen Bauernhochzeiten jetzt noch fortlebt, stand ihr zur Seite, ein blankes Schwert haltend, welches sodann der Vater oder Vormund dem Bräutigam darreichte weil dieser von Stand an ebenso der Beschützer wie der Herr von des Weibes Leben sein sollte. Hierauf steckte der Bräutigam einen Ring an die linke Hand der Braut und zog ihr Schuhe an, jenes zum Zeichen, dass sie stets eingedenk fein sollte, wie sie gekauft worden sei — Metallringe waren ja das älteste Tauschmittel, die älteste Münze der Germanen — dieses, dass fortan all ihr Wandel in den Willen ihres Mannes gebunden und geschnürt sei. Wenn ein Rückschluss von den nordgermanischen Hochzeitbräuchen auf die deutschen gestattet ist — und er ist ja wohl gestattet —so fehlte der Vermählung auch die religiöse Weihe nicht. Denn zum Schlusse der feierlichen Handlung wurde der Braut ein Hammer in den Schoß gelegt. Den Hammer aber führte als Waffe der Blitz- und Donnergott Donar und also sollte der Braut bedeutet werden, dass der rächende Blitz des Gottes auf die Brecherin der ehelichen Treue fallen möchte. In reicheren Häusern währte der darauf folgende Hochzeitschmaus tagelang. Dann wurde die Braut mit allem, was Eltern, Geschwister und Sippen ihr an Hausrat, Kleidern und Schmucksachen zur Ausstattung mitgaben, auf einen Wagen gesetzt und in fröhlichem Zuge zur Behausung des Bräutigams gebracht.
„Das Weib war das gekaufte Eigentum des Mannes, seine Sache. Er konnte sie hudeln wie eine Sklavin, schlagen, verkaufen, auch ungestraft töten, wenn er sie für treulos erachtete. Die überwiesene Ehebrecherin verfiel barbarisch-harten Strafen. Da wurde sie splitternackt durch die ganze Gemeinde gepeitscht, dort im Sumpf erstickt, anderwärts gehangen, niedergehauen oder verbrannt. Auf der Hausfrau lastete großenteils die Sorge für den Haushalt, wozu namentlich auch die Beschaffung der Kleider für den ganzen Hausstand gehörte. Schafwolle, Flachs und Tierfelle lieferten die Stoffe der Gewandung.
Ein wollener Leibrock und darüber ein je nach der Jahreszeit leichter oder schwerer Pelzmantel, das waren langehin die einzigen männlichen Kleidungsstücke; denn Wams und Beinkleider sind erst später aufgekommenen. Den Kopf trugen die Männer gewöhnlich unbedeckt, im Kriege aber setzten sie Helme auf, welche entweder aus den Schädeln germanischer Waldtiere gefertigt oder in der Form solchen Schädeln nachgeahmt waren. Körperpflege und Schmuckliebe waren nicht unbekannt, auch den Männern nicht. Der Hausherr liebte weit in den Tag hinein zu schlafen. Aufgestanden, wusch er sich, nahm ein Bad und widmete der Ordnung von Haar und Bart, als den Zeichen seiner Freimannheit, große Sorgfalt.
Auch Haarverschönerungsmittel konnten unsere Herren Altvorderen bereits, besonders eine Art Seife, womit der Natur nachgeholfen wurde, wenn diese das dem Edeling und Freiling wohlanständige Goldblond nicht in der richtigen Färbung hervorgebracht hatte. War der Anzug des Hausherrn mittels Anlegung seines Schmuckes, d. h. seiner Halskette, seiner Arm- und Fingerringe vollendet, so wurde für des Leibes anderweitige Notdurft mittels Einnahme eines reichlichen Frühmahls bedächtig gesorgt. Dies getan, nahm der Mann seine Waffen zur Hand und ging an seine Geschäfte, selbstverständlich an die eines Freien. War also kein Krieg, germanischer Männer Hauptgeschäft, so ging’s zur Jagd in den Wald oder auch wohl zur Beaufsichtigung der frohnenden Hörigen und Knechte aufs Feld. Die Hausfrau gebot derweil daheim den im Haus, Speicher und Stall schaffenden Mägden, überall selber mit Hand anlegend, die Spindel drehend, das Weberschifflein fliegen lassend, mit Schere und Nabel hantierend. dass auch die Frauen nicht weniger auf Reinlichkeit und Pflege des Körpers hielten als die Männer, ist selbstverständlich. Ihre Tracht war einfach und sittsam, doch verstanden auch sie schon den Gebrauch von Putz und Schmuck, liebten Ringe, Ketten und Spangen und wussten ihre Kleidersäume mit roten Borten oder auch mit Pelzwerk zu verzieren. Das linnene Hemd, welches sie trugen, fiel bis auf die Knöchel herab, ließ aber Arme, Nacken und den oberen Teil der Brust frei. Dies war innerhalb des Hauses das einzige Gewand der Germanin. Außerhalb trug sie über dem Hemde einen mantelartigen Überwurf, welcher von hinten angetan wurde und dessen Zipfelenden vor der Brust mittels einer Spange befestigt waren. Nicht lange jedoch stand es an, bis sich zwischen Hemd und Mantel noch ein drittes, weibliches Kleidungsstück einfügte, eine beärmelte Tunika, welche bis zu den Knien herabreichte und über den Hüften enggegürtet war, so dass sie die Körperformen hervorhob.
Einer Hauptsorge der heutigen Hausfrauen scheinen unsere Ältermütter ganz ledig gewesen zu sein, denn für Küche und Keller. Speise und Trank mussten sie nicht aufkommen. Wenigstens in keinem Haushalte, wo es nicht ganz an dienendem Gesinde fehlte. In jedem einigermaßen wohleingerichteten Hause lag weder der Frau noch den Mägden, sondern Knechten die Besorgung des Küchenwesens ob. Wir brauchen uns auch die Beköstigung keineswegs als allzu hinterwälderisch zu deuten. Unsere Vorfahren wussten in ihrer Art schon ganz gut, was gut, besser und am besten zu essen und zu trinken sei, obzwar Speise und Trank noch den Charakter der Einfachheit trugen. Sie waren ja im Besitze verschiedener Getreidearten, sie bereiteten Brot aus Hafer- und Gerstenmehlteig, hatten Wildbrät und Fische, zogen aber allem übrigen Fleische das der Schweine und der Pferde vor, aßen Eier, hatten Rüben, Rettige, Sauerampfer und andere Gemüsekräuter, auch Milch, Butter, Käse, Honig und tranken reichlich, überreichlich Bier, Met und an den Grenzen der römischen Ansiedelungen auch den auf dem Wege des Tauschhandelsgewonnenen Wein. Das Hauptgewürze der altdeutschen Küche war natürlich das Salz, welches man zuwegebrachte, indem man die Sole über glühende Eichenholzkohlen goss und also entwässerte.
Der germanische Haushalt musste so ziemlich alle Lebensbedürfnisse selber aufbringen, deren Befriedigung später das Handwerk und der Handel übernahmen. Ärmere Hausväter ließen sich noch herbei, den Schmied, den Zimmermann, den Maurer zu machen, reichere hatten unter ihren Leibeigenen und
Sklaven solche, welche die Arbeit des Zimmermanns, Maurers, Schmiedes, Bäckers, Schusters und Töpfers verrichteten. Jeder rechte Haushalt hatte auch seine eigene Müllerin, d. h. eine besondere Magd, welche die Handmühle trieb. Es konnte aber nicht ausbleiben, dass aus solcher häuslichen Gewerblichkeit allmälig eine öffentliche hervorging und dass sich neben dem Landbau das Handwerk mehr und mehr eine eigene Lebensstellung errang. Das geehrteste, auch eines Freien für würdig erachtete Gewerke war das eines Fertigers von Waffen und Schmuck. Ein tüchtiger Waffen- oder Goldschmied stand bei seinen Volksgenossen in hoher Achtung und Gunst und in der Sagenwelt genoß so ein Künstler, Wieland der Schmied, halbgöttlichen Ansehens. In den Gesetzbüchern der Germanen aus und unmittelbar nach der Völkerwanderungszeit ist schon von hörigen Handwerkern die Rede, welche zum Nutzen ihrer Herren für Andere arbeiteten. Hiermit hob das deutsche Handwerk als Beruf und Stand an.
Auch ohne Handel und Verkehr lässt sich eine Gemeinschaft von Menschen, welche einmal aus der Wildheit in die Zivilisation herübergetreten ist, nicht denken. Schon frühzeitig musste in Germanien ein primitiver Binnenhandel existiren, denn es gab ja allerlei zu tauschen, zu kaufen und zu verkaufen, Äcker, Weiden, Wälder, Vieh, Waffen, Schmuck, Sklaven, Weiber („ein Weib kaufen“ für heiraten zu sagen, war noch im späteren Mittelalter gebräuchlich). Uralte Rechtsbräuche, die jetzt noch nachklingen, haben solchen Warenumsatz begleitet. So wurde die Übertragung eines Grundstückes von dem Verkäufer an den Käufer durch die Überreichung eines Rasenstückes oder einer Erdscholle symbolisiert. Die Kaufpreisewurden freilich nicht in Geld entrichtet, weil die Germanen keins besaßen. Tauschmittel an der Stelle des Geldes waren demnach Waffen, Schmucksachen und am häufigsten Vieh. In diesem, in Rindern, Kühen, Pferden, wurden auch anfänglich die gerichtlichen Strafansätze entrichtet, bevor als Zahlungsmittel das Geld aufkam. Den Übergang zu diesem bildeten die Hals- und Armringe aus Edelmetall, welche eine so beliebte Schmucksache waren, zum Lieblingsgeschenk dienten und bald auch an Zahlungsstatt gingen, ganz oder auch in Stücke zerhauen, so dass solche Ringstücke zur Scheidemünze gedient haben mögen. Das Ringegold dürften unsere Ahnen zunächst aus den goldführenden Strömen ihres Landes gewonnen haben, insbesondere aus dem Rhein. Allerdings wird des Rheingoldes erst vom 5. Jahrhundert an gedacht, aber auf ein viel höheres Alter desselben weist bedeutsam der Mythus vom Nibelungenhort hin.
Wo einmal Kulturbedürfnisse sich regen, ist der Handel schnell bei der Hand, denselben genug zu tun und sie zugleich zu mehren und zu steigern. Römische und gallische Händler zögerten also nicht, von den Grenzen Germaniens im Süden und Westen her die begehrten Stoffe und Fabrikate einzuführen und dieselben gegen Landesprodukte umzutauschen. Was für Gewinnprozente dabei abfielen, kann man sich leicht vorstellen. In der kaiserlichen Zeit Roms wurde dieser Handelsverkehr immer lebhafter. Erz, Eisen, Silber, Gold, Wein, Kleiderstoffe und Schmucksachenwurden eingeführt, Zuckerrüben, Gänsefedern, Laugenseife, Pelze, Felle, Pferde, Sklaven und germanisches Haar — rotblonde Zöpfe und Perücken waren ja den römischen Modedamen unentbehrlich — gingen nach Italien und Gallien. Römisches Geld wurde hierbei das mehr und mehr gangbare Tauschmittel. Die Deutschen gewöhnten sich so sehr daran, dass sie die Geldprägung noch lange für ein ausschließlich römisch-kaiserliches Recht ansahen. Erst die Frankenkönige befreiten sich völlig von dieser Vorstellung und münzten Geld auf eigene Hand und mit ihrem eigenen Bilde. Der wichtigste germanische Ausfuhrartikel war schon frühzeitig der von den Ostseeküstenkommende Bernstein, welcher in Rom massenhaft zum Putz und Schmuck verbraucht wurde. Auch mit Griechenland brachte dieser Handelsartikel die Germanen in Berührung, wobei die griechisch-phokäische Pflanzstadt Massilia (Marseille) die Vermittlerin machte. Aus diesem Wege, d. h. auf dem Wege des Verkehrs germanischer und griechischer Händler soll auch, wie nicht unwahrscheinlich ist, zuerst der Gebrauch der Schrift nach Deutschland gekommen sein, sodass der germanischen Runenschrift das griechische (dorisch-äolische)Alphabet zu Grunde läge. Und noch anderweitig erwies der Handel seine zivilisatorische Kraft, indem er die Starrheit des germanischen Krautjunkertums brechen half. Da nämlich der Handelsbetrieb einerseits zum voraus eine gewisse Wohlhabenheit erforderte und anderseits einen kühn wagenden mut und eine wehrsfähige Hand, so konnte er nur Sache der Freien sein und erschien selbst für Adalinge nicht unziemlich. mussten doch Kauffahrten geradezu für Kriegsfahrten gelten angesichts von allen den Gefahren und Bedrohungen, welchen zum Trotze die Ausfuhrwaren in die Fremde zu bringen und die Einfuhrwaren aus dieser zu holen waren. Die Handelschaft musste aber in zahlreiche Wechselbezüge zu den aufkommenden Gewerken treten, wie auf der andern Seite mit der grundbesitzenden Aristokratie in Geschäftsverbindung bleiben und aus alledem ergab sich, dass der Handel ein wirksamer Sänftiger der schroffen Ständeunterschiede wurde. Endlich ist auch noch ein Wort darüber zu sagen, dass unsere Ahnen nicht allein Landhandel, sondern auch schon Seehandel getrieben haben. Selbstverständlich war dieser Sache der Anwohner der Nord-und Ostsee, welche an die Stelle des urzeitlichen Baumschiffes oder Schiffbaums im Verlaufe der sechs ersten Jahrhunderte christlicher Zeitrechnung nach und nach das galeerenartige Ruderschiff zu setzen und dasselbe auch mit Segelwerk auszustatten gelernt hatten. Man suchte die Schiffsgestalt dieser oder jener Tiergestalt anzuähneln, bezeichnete Schiffsteile als Haupt, Hals und Schnabel, verzierte den Bug mit Pferde- oder sogenannten Drachenköpfen und nannte das Schiff selber Drache oder Roß. Die „Meerdrachen“ der skandinavischen „Wikinger“ waren in Sage und Geschichte eine gefürchtete Erscheinung. Überhaupt verschwand in alter Zeit die Grenzlinie zwischen Seehandel und Seeraub häufig genug, allzu häufig. Doch für die alte Seetüchtigkeit der Germanen zeugt, dass sie ohne Kompass in fremde Meeresich hinauswagten, dass sie Island, Grönland und — fünfhundert Jahre vor Kolon — Amerika („Vinland“) auffanden ….
Nun aber ist es an der Zeit, dass wir uns wiederum zum Familienleben unserer Vorfahren zurückwenden.
Wir sahen, wie der germanische Hausherr seine Gattin als ein gekauftes Eigentum in sein Heimwesen führte. An ihr wird es gelegen sein, sich aus der „Sache“ des Mannes zu seiner Lebensgefährtin zu machen und den unumschränkten Gebiet zu einem vertrauenden und liebevollen Gatten herab- oder vielmehr hinaufzuzähmen. Kinder sind sicherlich wie überall und allzeit auch in Altdeutschland ein festes Bandzwischen den Eltern gewesen. Germanische Ehefrauen mögen aber ihrer ersten Entbindung nicht ohne Bangen entgegengesehen haben, denn es hing durchaus von dem Manne ab, das Kind anzuerkennen und leben zu lassen oder nicht. War ein Kind zur Welt geboren, so brachte es die Wehmutter dem Vater und legte es ihm unter der neben dem Herde aufragenden „Firstful“ seines Hauses zu Füßen. Anerkannte er es als Bein von seinem Beine und als Fleisch von seinem Fleische, so hob er es mit eigener Hand vom Boden auf oder ließ es durch die Wehmutter aufheben — (woher diese „Hevanna“, Hebamme hieß).Weigerte er sich der Aufhebung, so war damit die Verstoßung des Kindes erklärt und ward es ausgesetzt. Einmal aufgehoben, war das Kind seines Lebens sicher. Auch musste der Vater das Neugeborene aufheben oder aufheben lassen, so demselben schon irgend etwas Nährendes zuteil geworden, und wäre es nur ein Tropfen Milch oder Honig gewesen.
Altgermanisches Gastmahl.
Freilich das Recht, sein eigen Kind später zu verkaufen, war mit alle diesem dem Vater nicht bestritten. Dem Anerkennungsakte folgte eine Art von Taufe, indem das Neugeborene in frisches Wasser getaucht und durch einen zu diesem Zwecke bestellten Verwandten benamst wurde. Dieser Namengeber war auch gehalten, dem Täufling ein Geschenk zu geben, und ein Festschmaus beschloss die ganze Feierlichkeit.
Die Namensgebung haben unsere Ahnen für eine wichtige, gleichsam den Lebensgang des Benannten vorbedeutende Sache angesehen und sie sind demnach hierbei nicht so ganz sinn- und geschmacklos verfahren, wie ihre Nachfahren zu thun pflegen. Wie die altdeutschen Ortsnamen, so waren auch die Personennamen sinnvoll und kennzeichnend. Zuvörderst solche, welche auf den urzeitlich naturwüchsigen Verkehr zwischen Mensch und Thier hinweisen und wobei noch in Betracht kam, dass in germanischen Augen manches Thier etwas Heiliges hatte, weil religiöse Mythen von der Erscheinung der Götter in dieser oder jener Tiergestalt zu wählen wussten. Von solchen Tieren, als da waren Aar, Bär, Eber, Rabe, Schlange („lint“,)Schwein und Wolf, lauten die männlichen Namen Arno, Arnulf, Berno, Beringard, Berinhard, Beroald, Ebur, Eberhard, Edurwin, Eburgund, Eburtrud, Eburhilt, Raginald, Ragenhart, Regino, Wolfgar, Wolfgang, Wulftla, und die weiblichen Aranhilt, Aralind, Berilind, Eburhilt, Eburgund, Ragauberga, Ragamberta, Godalind, Theudelind, Swanaburg, Swanahild, Wolfburga, Wolfgunt, Wolfrun, Wulfhilt. Das religiöse Gefühl der Germanen liebte es, eine ganze Reihe von männlichen und weiblichen Namen an das uralte, nur dem Germanentum eigene Wort „Gott“ zu knüpfen. So Godo, Godebald, Godafrid, Gotahard, Godomar, Goda, Gotberga, Gotatrud.
Germanische Mütterlichkeit.
Oder in Anknüpfung an die Bezeichnung der Götter als „Ansen“ (nord. Asen, sächsisch Os) lauteten männliche und weibliche Namen Anso, Ansbald, Osmund, Oswald, Ansa, Ansberta, Osmundis. Die Vorstellung von den Elben (Zwergen) und Thursen (Hünen, Riesen) klingt an in den Namen Albo, Alfhard, Albuin, Albagund, Albigard, Hunibald, Hunimund, Hunila, Hunrada, Thurismund, Thusnelda. Eine Menge von Männer- und Frauennamen bezeugen laut die Kriegslust und Kampffreude unserer Vorfahren und erscheinen daher die alten Worte „Bad“, „Gund“, „Hild“, „Hadu“, „Wig“, „Isan“ (Eisen), „Ger“, „Brünne“ — lauter Ausdrücke für Krieg, Schlacht und Waffen —in mancherlei Zusammensetzungen: Baddo, Batuhelm, Badila, Baduhilt, Gundobad, Gundebaud, Aldagund, Chunigund, Hadubrand, Hadufrid, Hadamund, Hadaberga, Hathumot, Hildibrand, Hilduls, Hildiburg, Hildigard, Hildigund, Wigo, Wigand, Wighelm, Wigharta, Wigilinda, Isangrim, Isanhard, Isanbirga, Isanhilt, Bruno, Brunihild, Sigibert, Sigifrid, Sigiteud, Sigilind. In den Zusammensetzungen mit „Adal“, „Thiuda“ und „Liut“ (Adel und Volk) prägt sich der Stolz auf Abstammung und Volksgenossenschaft aus: Adalbert, Adalheid, Theodo, Theudofrid, Thiothelm, Theuda, Theutberta, Theutila, Lindo, Liudiger, Liudulf, Liuda, Liudiska, Liutberga. Zu den ältesten deutschen Frauennamen-werden mit Grund gezählt solche, welche wie Bertha (die Glänzende), Heidr (die Fröhliche), Liba (die Lebendige), Swinda (die Geschwinde) und Skonea (die Schöne) leibliche und seelische Eigenschaften bezeichnen.
Erziehung der Knaben.
Mit einem Schmause, sahen wir, wurde die germanische Taufhandlung beschlossen und im Schmausenwaren überhaupt unsere Vorfahren start. Jedes fröhliche, aber auch jedes traurige Vorkommnis gab ihnen zum zechen Veranlassung: die Geburt eines Kindes, die Wehrhaftmachung eines Sohnes, die Verheiratung der Tochter, der Tod eines Familiengliedes. Denn auch die Sitte oder Unsitte des „Leichentrunkes“ darf sich eines hohen Alters rühmen. Sodann war ja auch die Gastfreiheitmit dazu da, Gelegenheit zu Zechgelagen zu schaffen. Diese währten häufig bis die eigenen Vorräte aufgezehrt waren, in welchem Falle Wirth und Gast mitsammen zu einem Nachbar gingen, um bei und mit diesem weiterzuschmausen. Solche Zecherei hatte nicht selten den völligen Ruin einer glücklichen Familie zur Folge. Denn im Rausche das Würfelspiel bis zur Wut zu treiben, nach einander Fahr habe und Vieh, Haus und Heim, Weib und Kind und endlich die eigene Person zum Einsatze zu machen und nach dem letzten Unglückswurf in die Knechtschaft zu wandern, war gar nicht ungewöhnlich. Ja reichen Häusern, in den Gasthallen der Adalinge machten sich die Festmahle stattlich genug. Aber nur die Männer bankettierten, je zwei und zwei an einem Tische sitzend, während die Hausfrau — selbst Königinnen durften sich dessen nicht entschlagen — mit ihren Töchtern die Gäste bediente, das Auftragen der Speisen ordnete und die silberbeschlagenen Hörnerder Urochsen, welche als Pokale dienten, eigenhändig füllte und von Tisch zu Tisch umherbot. Wenn nicht der Spielteufel in der Halle umging, hatten die Festgenossen ein edleres Ergötzen. Harfner und Sänger waren da, rührten das „Lustholz“ (die Harfe) und sagten und sangen von Göttern und Helden, von der Weltschöpfung, vom Wodan und Donar, vom Thuisto und Mannus und vom Befreier Armin. So meldet uns Tacitus und im ältesten germanischen Heldengedicht, im „Beowulf“ heißt es: „Ja der Halle war da
Harfenklang, des Sängers lautes Singen; es sagte der Wissende der Menschen Ursprung in alten Zeiten“ - und an einer andern Stelle: „Da war Sang und Klang im Sale vereinigt; das Lustholz ward gerührt, das Lied gesungen.“ Zum Klang und Sang gesellte sich in der Festhalle auch das älteste deutsche Turnspiel, der Schwerttanz, vom Verfasser der Germania als das einzige bei den Germanen heimische Schauspiel genannt. „Nackte Jünglinge — so erzählt er — welchen das eine Lustbarkeit ist, tummeln sich zwischen drohend aufgerichteten Speerspitzen und Schwertklingen tanzend umher. Übung rief Fertigkeit, Fertigkeit Anmut hervor, doch nicht zum Erwerb oder um Lohn; denn des kecken Scherzes einzige Belohnung ist die Kurzweil der Zuschauer.“
Die Kinderzucht war selbstverständlich vorwiegend Sache der Mütter, unter deren Leitung die Töchter bis zu ihrer Verheiratung der Haushaltsgeschäfte sich annehmen. Wir dürfen auch glauben, dass alles, was etwa für die Gemütsbildung der Jugend geschah, von mütterlicher Seite kam. Wie noch heute die deutsche Mutter die ersten Keime religiöser und sittlicher Vorstellungen in ihren Kindern pflanzt und pflegt, so hat gewiss auch die germanische den ihrigen die uralten Weisen von den Volksgöttern und Volkshelden vorgesungen und ihre Knaben Mannhaftigkeit und ihre Mädchen Sittsamkeit gelehrt. Der heranwachsende Sohn wurde sodann vom Vater in den Rechten und Pflichten seines Standes, in der Waffenführung, im Rennen und Reiten, im Jagen und Schlagen unterwiesen. So vorbereitet, wurde der Jüngling in versammelter Landsgemeinde entweder durch den Häuptling oder durch den Vater oder durch den Vormund mittels feierlicher Überreichung von Schild und Speer für wehrhaft erklärt. Bislang war er nur ein Glied des Hauses gewesen, mit seiner Wehrhaftmachung wurde er ein Glied des Gemeinwesens. Er konnte jetzt mitraten und mittaten, namentlich im Kriege, in den Besitz des Vollbürgertums brachte ihn jedoch erst eigener Grundbesitz. Freie Geburt, Wehrfähigkeit und Grundbesitz verliehen mitsammen politische Rechte.
Aber wie war es mit der „Landsgemeinde“, wie überhaupt mit dem altdeutschen Staat? . . . Soweit unser Wissen zurückreicht, finden wir bei unseren Vorfahren zweierlei Staatsformen vor: die Monarchie und die aristokratische Republik. Beim ersten geschichtlichen Auftreten der Germanen werden die Heerführer der Teutonen und Kimbrer von den Römern als Könige bezeichnet und es untersteht keinem Zweifel, dass der Ursprung des germanischen Königtums in die mathische Urzeit hinaufreicht. In der historischen Zeit, insbesondere zur Zeit des Turnus, war aber diese Staatsform vor der sogenannten freigemeindlichen, in Wahrheit aristokratisch-republikanischen mehr zurückgetreten, um dann zur Zeit der Völkerwanderung zu neuer und überwiegender Geltung zu gelangen. Der aristokratisch-republikanischen Gemeinwesen waren in Germanien sehr viele und, was Umfang und Macht angeht, sehr vielerlei. Das Werden und Wachsen derselben war ein organisches. Die Familie wuchs zur Markgenossenschaft, diese zur Hundertschaft, diese zur Gaugenossenschaft und diese zur Stammgemeinschaft. Solcher Gliederung entsprach dann der Organismus politischer Schaltung und Waltung:— Dorfgemeinde, Kreisgemeinde, Gaugemeinde, Landsgemeinde.
Kampf gegen die Römer.
Bei diesen Versammlungen war, nach ihrer Machtvollkommenheit abgestuft, die Regierung der Mark, der Hundertschaft, des Gau’s und des Landes, die Entscheidung über Frieden und Krieg, die Wahl des Heerführers, die Wahrung des Rechtsfriedens und die Sühnung des gebrochenen, also Verwaltung des Privat-und des Strafrechtes, die Bestellung der Richterbank, die Erwählung der Gemeindevorsteher, der Gaugrafen, der Landesfürsten. Die verschiedenen Gemeinden traten zu regelmäßig wiederkehrenden oder auch außerordentlichen Versammlungen im Freien auf der bei einem heiligen Baum oder bei einer heiligen Quelle gelegenen „Malstatt“ zusammen, wobei den Priestern die Eröffnung der Verhandlungen und die Handhabung der Ordnung oblag. Eine Rede des Vorstehers — bei Landsgemeinden also des Fürsten — leitete die Abwickelung der auf der Tagesordnung stehenden Verwaltungs-, Kriegs- und Rechtsgeschäfte ein. Die Beratung war frei, jeder wehr- und rechtsfähige Gemeinde- oder Landsasse, d.h. jeder Freie, konnte seine Meinung geltend machen. missfallen wurde durch Gemurre, Beifall durch das Zusammenschlagen von Schild und Speer kundgegeben. Von solchen Versammlungen, in welchen die Souveränität des Gemeinwillens allerdings formal zum Ausdruck kam, darf man sich aber kein allzu idealisches Bild machen. Sachlich waren sie zumeist nur eine Formalität, — ganz so, wie das noch heute die urkantönlichen Landsgemeinden der Schweiz sind, bei welchen das „souveräne“ Volk zumeist nur beschließt und abmacht, was die Magnaten vorher unter sich beredet und ausgemacht haben. Selbstverständlich sind hier nur die allgemeinen Grundzüge einer Gemeinde- und Staatsverfassung gegeben, welche bei den einzelnen Stämmen im Einzelnen sehr abweichend gemodelt war. Zur Völkerwanderungszeit drängte, wie schon erwähnt worden, das Königtum die Adelsrepublik in den Hintergrund. Wann die großen Stämme der Goten, der Vandalen, der Burgunden, der Langobarden, der Franken in die Geschichte eintraten, geschah das unter der Führung von Königen. Aber das waren, wohlverstanden, Wahlkönige, in der Volksgemeinde gekürt und auf den Schild erhoben, in Zeiten und unter Umständen, wo einem Stamme die straffeinheitliche Lenkung, insbesondere auf der Heerfahrt nottat. Es mag sich daher dieses Königtum zu einem guten Teil aus der altherkömmlichen Einrichtung der kriegerischen Gefolgschaften herausgebildet haben, welche ihre gewählten Herzoge, falls diese Verdienst und Erfolg hatten, mit höheren Ehren schmückten. Doch ist noch beizufügen, dass das germanische Wahlkönigtum sich frühzeitig in ein Erbkönigtum zu wandeln wusste, schon darum, weil man die Krone mit Vorliebe solchen Familien zuwandte, die im Rufe göttlicher Herkunft standen und demnach für die Blüte des Adels galten.
Kriegerischen Ursprungs also war das deutsche Königtum, wie ja überhaupt der germanische Staat auf Wehr und Waffen gestellt gewesen ist. Die Bewaffnung selbst ist erst während der Völkerwanderung vom waldursprünglich Einfachen zum Reicheren und Vielgestaltigeren vorgeschritten. Dann mal gesellten sich zu der Schutzwaffe des Schildes noch die zwei weiteren Helm und Harnisch und zu der älteren Angriffswaffe, dem Speer („Framea“, Pfriem?), die neueren, Schwert, Dolch und Streitaxt. Der„Ger“ scheint eine von der Franken verschiedene schwere Wurfwaffe gewesen zu sein. Der Gebrauch von Bogen und Pfeil ist nicht deutlich nachzuweisen und bestimmt wissen wir, dass Vandalen und Goten diese Waffen nicht kannten. Von germanischer Kriegskunst ist nicht zu reden, denn sie bestand nur in ungestümen Ansturm und todverachtendem Ausharren. Dem Heerführer die Treue zu halten bis in den Tod, war germanische Sitte. In Harfte von je hundert Mann waren die Heere geteilt. In Keilrotten geordnet, unter Anstimmung des „Barditus“(wörtlich Schildlied, weil die Krieger es, um den Schall zu verstärken, in die Höhlung des Schildes hineinschrieen) gingen sie in die Schlacht. Die Hauptstärke der Germanen war der Fußkampf, doch haben sie auch den Gebrauch der Reitereigekannt und geübt, obzwar mit Verachtung des Sattels. Frühzeitig wurden Reitergeschwadern auch Fußstreiter beigegeben, welche beim Vorstürmen der Reiter sich an den Mähnen der Pferde festhielten, um mit diesen gleichen Schritt halten zu können. Feigheit, Fahnenflucht, Einbuße des Schildes galten für Kapitalverbrechen.
Kriemhild verlangt die Bahrprobe.
Was Verfehlungen und Verbrechen überhaupt betrifft, so haben unsere Vorfahren von Uralters her unterschieden zwischen solchen, welche dem Gemeinwesen, und solchen, welche den Einzelnen Schaden brachten. Jene, also Landesverrat und Fahnenflucht, konnten nur durch den Tod des Schuldigen gesühnt werden, diese dagegen mittels Gutmachung, d. h. der Schädiger war gehalten, den Einem oder Einer an Ehre, Gut, Leib und Leben zugefügten Schaden dem oder der Beschädigten, beziehungsweise ihren Rechtsnachfolgern zu vergüten mittels des sogenannten „Wergeldes“, dessen Anlässe je nach der Schwere des Schadenshöher oder niedriger waren und das in Ermangelung baren Geldes auch in Vieh oder Fahr habe entrichtet werden konnte. Diese Rechtssatzung, die Sühnung der Schuld mittels Geldes, ist ein nach unserem Gefühle freilich roher erster Versuch gewesen, den Verheerungen, welche der urzeitliche Brauch der Blutrache in dem Gemeindewesen anrichtete, Einhalt zu tun. Aus diesem Brauche war das urgermanische Faust- und Felderecht entsprungen. Der unbedachtsame Mörder, der vorsätzliche Totschläger brach mittels seiner Tat den Frieden mit der Sippschaft des Getöteten. Dieser lag die Pflicht ob, den ihr gegenüber „friedlos“ gewordenen Täter zur Rechenschaft zu ziehen. Zu diesem Ende griff sie, falls der Schädiger nicht bei Zeiten zur Entrichtung der gesetzlichen Wergeldbuße sich bereit erklärte, zum Faust- und Fehderecht, d. h. sie erhob unter Beihilfe ihrer Freunde Fehde gegen den Übeltäter, um mit seinem Blut den Rechtsfriedensbruch zu sühnen . . . Das Rechtsbewusstsein unserer Vorfahren ging in seinen Erscheinungsformen, wie auch in denen der Rechtschöpfung und Rechtsprechung, unter den einzelnen Stämmen mehr oder weniger weit auseinander, wie denn auch je nach der politischen Verfassung hier die Landsgemeinde, dort der König für die Quelle des Rechtsfriedens und des Rechtsschutzes galt. Doch bei aller Verschiedenheit im Einzelnen waren auch auf diesem Gebiete wieder gewisse nationale Vorstellungen und Formen im Ganzen durchgreifend und obherrschend. Zunächst dem Landesverrat und der Fahnenflucht war Mord das schwerste Verbrechen. Dann folgten die „durch Fang, Schwang, Griff und Hand“ verübten Gewalttätigkeiten, unterwelchen Frauenraub und Notzucht obenan standen. Es ist ein schöner Zug in diesem alten Rechte gewesen, das es sogar leichte Verunglimpfungen weiblicher Ehre und Scham mittels Worten oder Handlungen schwerahndete. Unter den Verbrechen gegen das Eigentum war der Feld-•und Viehdiebstahl das verrufenste, wobei sehr fein zwischen Tagdieb und Nachtdieb zu Ungunsten des letzteren unterschieden wurde. Etwas gewinnend Humanes lag in den Bestimmungen, dass Wanderer ungestraft von den Feldfrüchten an ihrem Wege nehmen durften, um Hunger und Durst zu stillen, und dass schwangere Frauen, wenn sie ein besonderes Gelüste nach einem fremden Gegenstand empfunden, denselben ebenfalls ungestraft sich aneignen mochten . . . Rechtheischung und Rechtsprechung waren mit religiösen Branchen umgeben und wurzelten beide in religiösen Anschauungen. Das Verfahren war öffentlich und mündlich. Die Gerichtsstätten warenwohl dieselben Malen oder Matten, wo auch die Gemeinde- und Landesversammlungen stattfanden. Rings um die „Malstadt“ ging der „Ring“, an dessen Schranken das Volk stand. „Ding“ hieß der Rechtshandel. Daher die alte Redensart: „Zu Ding und Ring gehen“. Aus dem rechtsfähigen Teile des Volkes, also aus den Freien und durch diese wurden die Rechtsfinder („Rachinburgen“, „Sachibarone“, später „Schöffen“) gewählt, welche unter dem Vorsitze des „Gerefa“ (Grafen, früher „Tunginus“) den Wahrspruch fanden und füllten. Die Prozedur war der Anklageprozeß, denn „wo kein Ankläger, da kein Richter“. Aber weit verbreiteter Grundsatz war, der Ankläger habe nicht die Schuld des Angeklagten, sondern dieser vielmehr seine Unschuld zu beweisen. Hauptbeweismittel war der Eid. Der Bezichtigte musste sich mittels des Eides reinigen; allein sein Wort war nicht genügend, er musste sich umsehen nach „Eideshelfern“, d. h. nach Freunden, welche mit ihrem Worte bezeugten, dass sie der Versicherung seiner Schuldlosigkeit glaubten. Sie halfen ihm also bei seinem Eide, indem sie seine Glaubwürdigkeit bekräftigten. Falls dann aber der Ankläger weder dem Eide des Angeklagten, noch dem Worte der Eidhelfer desselben traute, so konnte er, um die Anklage aufrechtzuerhalten, ein Gottesurteil (althochdeutsch „Urteili“, angelsächsisch „Ordal“, wovon das lateinische ordalium) anrufen, womit der Wahrspruch über Schuld oder Unschuld der Gottheit selbst anheimgegeben werden sollte. Die Form der Gottesurteilschöpfung war entweder der Zweikampf zwischen Ankläger und Angeklagten oder die Feuer- oder Wasserprobe. Die älteste Erwähnung der „Kesselprobe“, wobei der Angeklagte, sich zu reinigen, einen Ring aus siedendem Wasserherauslangen musste, ohne sich die Hand zu verbrühen, steht im salfränkischen Gesetzbuch. Zweifelsohne reicht aber der Gottesurteilsbrauch in die arische Urzeit hinauf, denn wir finden ihn ja auch im alten Indien. Im Mittelalter hat dann dieser Rechtsbrauch eine vielfältige Ausgestaltung erfahren. Mit zu den Gottesurteilen gehörte sicherlich auch in uralter Zeit schon das „Bahrrecht“, welchem gemäß bei einer Mordklage der Angeklagte unter Betheurung seiner Unschuld zu dem Gemordeten herantreten und dessen Wundmale berühren musste. Fingen diese hierbei wieder zu fließen an, so war der Beweis der Schuld, wenn nicht, der Beweis der Unschuld des Bezichtigten geleistet. An einer berühmten Stelle des Nibelungenliedes, welche trotz ihrer christlichen Übermalung gewiss weit in das germanische Heidentum hinaufgreift, heißt es: „Schmiede hieß man beschaffen eilends einen Sarg, einen Sarg von Silber und Gold, beschlagen mit Spangen von gutem Stahl, und da die Nacht vergangen, ließ die edle Frau Kriemhild ihren viellieben Mann Sigfred zum Münster tragen und weinend gingen alle ihre Freunde mit ihr. Da sie zum Münster gelangten, läuteten die Glocken und laut wurde der Gesang der Pfaffen. Da kam auch der König Gunther herbei mit seinen Mannen und es kam auch der grimme Hagen, der besser ferngeblieben. Sprach Gunther: „Liebe Schwester, weh deines Leibes! Ledig sollten wir sein so großen Schadens! Fürwahr, wir müssen allzeit Sigfrieds Tod beklagen." Gab da zur Antwort das jammerhafte Weib: „Mitnichten müsst ihr das! Wär' euch leid die Sache, würde sie nicht geschehen sein.“ Sie legten sich aufs leugnen.
Der Herthasee.
Da wiederum die Witib: „Wer unschuldig, kann es kundtun. Er mag nur als bald hier vor all’ den Leuten zu der Bahre gehen. So mag die Wahrheit offenbar werden.“ Das ist ein groß Wunder, welches oft sich wirkt: wenn der Mörder hertritt zu dem Ermordeten, so bluten diesem die Wunden. Solches geschah auch jetzt. Denn da Hagen zu dem Toten herging, fingen dessen Wunden stark zu fließen an. Da hub sich noch stärkerer Wehruf denn zuvor."
Wie in allem und jedem, anerkannten also unsere Ahnen auch in Sachen des Rechtes als oberste Instanz die Gottheit. Sie waren ein frommes Volk, insofern das Gefühl der Abhängigkeit des Menschen von den Naturgewalten sie sehen in der Kindheit ihres Volksdaseins mit Ehrfurcht vor dem Weltgeheimnis erfüllt hatte und zu erfüllen fortfuhr. Ihre Denker und Dichter — beider Tätigkeit war im urzeitlichen Priestertum vereinigt — hatten eine Lösung dieses Geheimnisses in der Form religiösen Vorstellens, Fühlens und Glaubens versucht, wie denn ja alle die alten Naturreligionen solche Lösungsversuche gewesen sind, und es darf mit Bestimmtheit angenommen werden, dass zur Zeit, als das germanische Heidentum in Deutschland durch das Christentum überwältigt wurde, die Religion unserer Vorfahren in Dogma und Kult zu einem nicht geringen Grade von Entwickelung gelangt war. Uns Deutschen ist aber nicht jene Schicksalgunst zu Teil geworden, welche den Nordgermanen das Kleinod ihrer „Edda“ gegeben und in dieser ihnen die Religion ihrer und unserer gemeinsamen Altvorderen als systematisiertes Ganzes überliefert hat. Auf uns Deutsche sind von dem religiösen Fühlen, Vorstellen und Thunder Südgermanen nur Bruchstücke gekommen, welche mühseligst zusammenzusuchen es des riesigen Forscherfleißes eines Jakob Grimmbedurfte („Deutsche Mythologie“). Dabei galt es namentlich auch, diese Überlieferungen von der schiefen Gestaltung und falschen Färbung zu reinigen, welche sie überall angenommen hatten, wo sie durch griechisch-römische Berichte vermittelt worden waren.
Von der indogermanischen Weltanschauung, d. h. von den Gegensätzen Licht und Finsternis, Tag und Nacht, Feuerwärme und Eiskälte, ging die germanische Religion aus und zwar mit Hinzunahme des weiteren Gegensatzes: Himmel und Erde. Dieser Dualismus freundlicher und feindlicher Lebensmächte der Dualismus einer zeugenden und schaffenden, einer empfangenden und gebührenden Wesenheit anderseits hat auch bei den Germanen, wie bei anderen alten Völkern die vielgötterliche Auseinanderfaltung des Gottesbewusstseins bedingt und bestimmt, sobald dieses von der Stufe dunkeln Ahnens zu der hellen Vorstellens vorgeschritten war. Allerdings begegnet uns schon in den ältesten deutschen Mundarten, von denen wir wissen, das Wort „Gott“ (gotisch Guth, althochd. Kot, alts. God, mittelhochd. Got), allein das Vorhandensein desselben beweist nicht etwa einen ursprünglichen Eingottglauben (Monotheismus) unserer Vorfahren, sondern nur allenfalls, dass diese das Wort „Gott“ gerade so gemeint und gebraucht haben, wie wir das Abstraktum „Gottheit“ meinen und brauchen. Die Germanen waren Polytheisten und im Verlaufe der Zeit gelangte ihre Vielgötterei zu einer Zwölfzahl von großen Göttern, welche sich wohl in Skandinavien, nicht aber in Deutschland vollständig nachweisen lässt. Ja der von Tacitus in der „Germania“ namhaft gemachten Göttertrias Merkur, Herkules und Mars dürfen wir wohl unsern Wodan, Donar und Zio erkennen. Wodan (Wuotan, Wuodan, Guodan, Woden, Wode, zurückzuführen auf die sanskritische Wurzel budh oder vudh, d. i. wachsein, bewussttsein, erkennen, wissen) wurde als der höchste Gott verehrt, als der germanische Zeus oder Jupiter. In ihm ist die alldurchdringende und allbelebende Weltkraft verpersönlicht. Er ist der Himmel, welcher sich schützend über der Erde wölbt, er ist die Sonne, welche jene erhellt, erwärmt und befruchtet, er ist der reinigende Sturm, er ist der gestaltende Allgeist. An ihn, als den Erreger der den Winter verjagenden, das neue Wachstum des Feldsegens ankündigenden Frühlingsstürme, knüpft sich noch jetzt im Volke die Vorstellung vom wütenden Heer oder von der wilden Jagd. Um wie viel lebhafter aber muss diese Vorstellung in unseren heidnischen Ahnen gewesen sein! In dem Getose der nächtlichen Orkane, welche die Frühlingstagundnachtgleiche zu bringen pflegt, hörten sie das Getümmel und Gehetze von Wodans Jagdzug, das Schnauben und Wiehern der Rasse, das Hundegebell, das Peitschengeknall und die Jägerschreie Halloh, Hohn, Hoto! Zunächst der wilden Meute reitet Gott Wodan, der Einäugige, denn die Sonne war ja sein Auge, auf seinem weißen Pferde.
Deutsche Dichter-Sänger.
Er hat seinen breitkrempigen Schlapphut auf, schwingt seinen Speer Gunguir und auf jeder seiner Schultern sitzt einer der beiden Raben, die ihm - Symbole seiner Allwissenheit — alles zuflüstern, was in der Weltvorgeht. Ein langes Gefolge von Göttern und Göttinnen, von Walhallagenossen und Wallüren reitet hinterdrein, buntgestaltig, phantastisch und wirrsälig wie ein Walpurgisnachttraum, und im Zuge darf auch der große Widersacher der Götter und doch ihr stäter Gesell und Begleiter nicht fehlen, der schlimme Lohyo oder Loko, die Verpersönlichung des Dunkeln und Bösen, der Widergott, Astergatt, von dessen Namen sich freilich in Deutschland nur dürftige Spuren auffinden lassen, der aber in den zahllosen Teufelssagen Zeugnisse hinterließ, wie angelegentlich sich bereits unsere heidnischen Ahnen mit ihm beschäftigt habenmüssen. So fährt die wilde Jagd Wodans in den Lüften über die Lande, gespenstig, schreckhaft, aber auch belebend und segenspendend wie ein Frühlingssturm. „Der Wode jagt“ sagen die Bauern nach heute in Pommern und Mecklenburg. „Wuatan jagit,“ machten unsere Ahnen flüstern, wann nächtlicher Weile des Gottes Sturmhorn erscholl, und mit ihrer Furcht und Scheu mischte sich das Hoffen, dass die traurige Zeit eines nordischen Winters endlich zu Ende ginge.
Mit der großen Göttin Erde (Nerthus, Nirdu) zeugt Wodan ein zahlreiches Geschlecht von göttlichen Söhnen und Töchtern: den Donnergott Donar, den Kriegsgott Zio, den Friedensgott Fro, den Rechtsgott Paltar, den Jagdgott Vol, den Meergatt Ali. die Liebesgöttin Frouwa — von welcher unser Wort Frau kommt —die Ehegöttin Holda, die Arbeitsgöttin Peratha, die Herdgöttin Hluodana, die Frühlingsgöttin Ostara, die Erntegöttin Bolla. Die genannten Götter geben sich schon beim ersten Anblick als Ausflüsse der kosmischen und sittlichen Substanz Wodans, gerade wie in den Göttinnen die Wesenheit der großen Lebensmutter Erde sich auseinanderlegt. Als unterirdische Kehrseite dieser Lebensmutter mochte ursprünglich die Vorstellung von der schaurigen Unterweltsgöttin Hellia gefasst sein, deren persönlicher Begriff in der christlichen Zeit in den örtlichen der Hölle sich wandelte. Zu ihr hinunter, zur Hellia, glaubten unsere Vorfahren, fuhren die am Siechtum oder Alter Gestorbenen, während die im Kampfe Gefallenen von Wodans Totenwählerinnen, den Walküren, zur Walhalla, zum Festsaal der Helden, emporgeleitet wurden. Fraglos ist demnach, dass die heidnischen Germanen den größten Trost des Menschengeschlechtes, die Vorstellung von einem „Jenseits“ und von der Fortdauer der Seele nach dem Tode des Leibes, kannten und glaubten, dass ihnen auch der Schicksalsgedanke, die Idee einer hoch über allem thronenden und waltenden physischen und moralischen Notwendigkeit nicht fremde gewesen; wird dadurch wahrscheinlich, dass im germanisch-skandinavischen Glaubenssystem die Schicksalsidee in den Gestalten der Normen mythologisiert war. Endlich ist noch anzumerken, dass, wie durch alle Naturreligonen, so auch durch die germanische ein stark pantheistischer Hauch ging. Aus diesem Gefühl einer Durchgöttlichung, eines Durchgeistigtseins der Natur heraus hat dann die Vollsphantasie ihre noch heute im deutschen Märchen fortlebenden Vorstellungen von Riesen (Dursen, Hünen) und Zwergen (Elbe, Wichte), von allerhand freundlich gewillten oder neidisch gesinnten Haus-, Wald- und Wassergeistern geschöpft. Auch der Begriff des Glückes gestaltete sich unseren Ahnen zu einem persönlichen und noch im späteren Mittelalter wurde „Frau Sälde“ häufig genannt und angerufen.
Die Stätten des Gottesdienstes waren Haine oder Tempel, diese jedenfalls von sehr einfacher Holzbauart. Auch auf Berghöhen, bei reichen Quellen, an rauschenden Wasserfällen, am Gestade einsamer Seen, unter durch Mächtigkeit und Schönheit vorragenden Bäumen — man denke nur an. die „Donarseiche“ bei Geismar — wurde den Göttern mit Gebeten und Opfern gedient. Es gab auch Götterbilder, Idole, früher aus Holz geschnitzte, später aus Metall gegossene. Das berühmteste Idol in Germanien war die bei Heresburg in Westphalen aufgerichtete Irminsäule, welche der Gewaltbekehrer Karl zertrümmern ließ. Anfänglich mochte jeder Hausrat der Priester seiner Familie gewesen sein. Später, bei vielseitiger Gestaltung des Kultus, gab es einen Priester- und Priesterinnen-Stand, aber niemals gab es eine erbliche Priesterkaste. Haupthandlungen des Gottesdienstes waren das Gebet, das Opfer und die Orakeleinholung. Beim Beten wandten unsere Vorfahren das Antlitz gen Norden, um dem Blicke der Götter zu begegnen, welche man sich vom Norden nach Süden schauend dachte. Unser neuhochdeutsches Wort opfern ist bekanntlich lateinischen Ursprungs (offerre), in Altdeutschland sagte man dafür „blotan“ und so war schon mit dem Worte der Begriff einer Blutdarbringung gegeben. Man opferte den Göttern zum Dank oder auch zur Sühne Rinder, Widder, Eber, Ferkel, Böcke und Pferde. Die Schädel der letzteren wurden an die Baumstämme der heiligen Haine genagelt. Aber die Altäre der germanischen Götter wurden auch, kein Zweifel ist gestattet, mit Menschenblut genäßt. Die Menschenopferung bei den Semnonen, Cheruskern, den Hermunduren bezeugt Tacitus mit Bestimmtheit. Nicht weniger glaubwürdig sind anderweitige alte Zeugnisse, welche solchen schrecklichen Glaubenseifer bei den Goten, Sachsen, Franken, Thüringern und Friesen feststellen. Doch hat das Menschenopfer bei den skandinavischen Germanen länger gewährt als bei den deutschen. Das Jahresfest der großen Erdgöttin, der Nerthus (Hertha), welches Tacitus beschrieben hat, schloss mit Opferung der sämtlichen Sklaven, welche bei dem als Geheimkultbehandelten heiligen Dienste mit Handangelegt hatten. Reichliches Opferblut floß bei den großen Festen unserer Ahnen, namentlich zur Zeit der Wintersonnenwende und der Sommersonnenwende. Die erste, das in allen germanischen Landen mit großem Jubel begangene Julfest, feierte die Wiedergeburt des Sonnengottes. Die christlichen Priester haben dann daraus die Weihnacht gemacht, wie sie aus dem heidnischen, der germanischen Göttin Ostara zu Ehren gefeierten Frühlingsfest das christliche Osterfest machten. Mit der Darbringung von Gebeten und Opfernverband sich bei den religiösen, von dem tiefen Naturgefühl der germanischen Rasse zeugenden Festen unserer Vorfahren das Anzünden von gewaltigen Feuern aus Bergspitzen und am Saume der Götterhaine. Diese „Funken“ symbolisierten die in der Sonne und in der Feuerflamme waltende Gottheit. Auch galt ihr Lohen und Wabern für schutzkräftig gegenüber den bösen Zaubergewalten. Auf die heiligen Höhen, durch die heiligen Heine, um die heiligen Feuer her wallten die Festprozessionen, bei welchen allerhand Mummenschanz üblich war, beispielsweise beim Frühlingsfest das dramatisch dargestellte Einsargen und Begraben des Winters, wie es in süddeutschen Dörfern zur Fastnachtzeit noch jetzt vorkommt. Eine ausgiebige Schmauserei beschloss die Götterfeste und diesen festlichen Gelagen war der hübsche Brauch des „Minnetrinkens“ eigen. Den Göttern wurde feierlich zugetrunken, Minne getrunken und daran hielten unsere Ahnen so fest, dass sie, zum Christentum bekehrt, dem „Herrn Christus“ oder der „Jungfrau Maria“ Minne zutranken, wie früher dem Donat oder der Freia. Orakel erteilten den Ratfragenden die Priester und Priesterinnen, indem sie den Flug und Schrei gewisser Vögel ausdeuteten oder auch das Wiehern der Weißen, in den Tempelhainen eigens zum Zwecke der Orakelgebung gepflegten Rosse. Eine dritte Art der Schicksalsbefragung war diese. Auf die abgebrochenen Zweige einer Buche wurden Zeichen geritzt und diese Buchenstäbe auf die Erde geworfen, wie der Zufall es wollte; dann wurden sie wieder aufgelesen und in eine gewisse Ordnung gebracht, worauf der Zeichendeuter bekanntgab, was die geritzten „Runen“ raunten. Von diesem religiösen Brauche stammt unsere Bezeichnung der Schriftzeichen (Buchstaben). Neben den Künsten der Orakelei haben germanische Priester und Priesterinnen auch die Künste der Besprechung und Beschwörung geübt, wie ja zwei auf uns gekommene heidnische Exorzismusformeln (die sogenannten merseburger Zaubersprüche) dartun.
Die altdeutschen Götterlieder sind verschollen. Aber wie fest das heidnische Gottesbewusstsein der Altvorderen im Volksgemüte haftete, bezeugen, von so vielem anderem in Sitte und Brauch abgesehen, noch heute die Benennungen der Mehrzahl unserer Wochentage. Sonn-Tag und Mond-Tag erinnern an „den uralt-arischen Gestirn- und Feuerdienst, in der deutschen Schweiz ist der Dienstag noch jetzt ganz deutlich („Ziestig“) nach dem Gotte Zio benannt, der angelsächsisch-englische Wednesday (Mittwoch) ist Wodanstag. Unser Donnerstag ist Donars, unser Freitag Freia’s Tag. Kein Zweifel, dass an den Tagen und Festender Götter die ältesten deutschen Dichter-Sänger („Steopas“, „Stope“, „Stofe“, vom Tätigkeitsworts keapan, schaffen) die Göttermythen vor den Fürsten und dem Volke „sangen und sagten“, d. h. unter Begleitung der Harfe und der Zither rezitativisch vortragen. Und neben dem Götterlied entfloß dem Munde dieser alten, gern gehörten und vielgeehrten Pfleger deutscher Liederkunst auch der Heldensang. Vom Teub und Mannus und vom Befreier Armin sangen und sagten sie. Das wissen wir und darum dürfen wir auch lediglich vermuten, dass die Grundtöne unserer später, im Mittelalter, dichterisch entwickelten Heldensageschon in Germanien und die ganze Völkerwanderungszeit hindurch erklungen seien; also die Lieder vom Helden Sigfrid und von der Walküre Brunhild, vom gewonnenen und verlorenen Nibelungenhort und von Kriemhilds Rache, vom alten Hildebrand und vom jungen Hadebrand, vom aquitanischen Walther und von der schönen Hildgund; nicht weniger auch vom Wolf Isengrimm und vom Fuchs Reinhart, denn gerade aus unserer Tiersage weht der uralte Waldgeruch ursprünglicher Poesie, welche sich bei uns in Germanien, wie droben in Skandinavien, der eigenartig-germanischen Form des Liedstabes oder Stabreims bediente. Ob irgendwas von dieser ältesten deutschen Dichtung schon in vorchristlicher Zeit schriftlich aufgezeichnet worden sei, ist sehr zweifelhaft; dass aber davon — den angelsächsischen Beowulf beiseite gelassen — nur Nachklänge auf uns gekommen, ist leider gewiss. Solche Nachklänge machen sich mittelbar vernehmbar in der lateinisch geschriebenen Gotenchronik des Jordanis aus dem sechsten und in der Langobardenchronik des Warusrid aus dem achten Jahrhundert, in den ältesten Bearbeitungen der Tiersage und im latinisierten Waltharilied aus dem zehnten Jahrhundert, unmittelbar dagegen in einem althochdeutschen Bruchstück des Hildebrandliedes. Den ungetrübtesten und deutlichsten Einblick in germanisch-heidnisches Heldenleben und Dichterschaffen gewährt aber das Lied vom Beowulf, welches die Angelsachsen aus ihren Sitzen an der Niederelbe wohl schon fertig mit nach Britannien genommen haben. Hier atmet die wilde Großheit einer Zeit, wo die Germanen aus der mythischen Dämmerung geschichtelosen Daseins auf die Grenzmarke historischen Lebens herüberzutreten begannen. Die gesamte dichterische Hinterlassenschaft unserer heidnischen Vorfahren hat dann neue Lebensformen gewonnen in den deutsch-nationalen Sagenkreisen des Mittelalters . . .
Wir sind jetzt auf unserer Wanderung durch das Dasein der Vorfahren in heidnischer Zeit da angelangt, wo alles menschliche Sein und Wandern endet: — am Grabe. Von der schlussscene des germanischen Lebensdrama’s ist also noch zu reden, von der Bestattung. Den Gräbersünden, sowie den Überlieferungen in Lied, Sage und Geschichte zufolge muss dieselbe von seiten unserer Ahnen als eine nicht unwichtige Verrichtung angesehen und behandelt worden sein, wie ja die Sorge für die Toten jedem einmal in den Kreis der Kultur eingetretenen Volke zusteht. Bei den meisten germanischen Stämmen ist der Brauch der Feuerbestattung entweder nachgewiesen oder wenigstens mit Sicherheit zu vermuten. Wenn dem Tacitus zu glauben, so haben unsere Altvorderen ihre Toten durchweg verbrannt und mit diesen ihre Waffen und Rosse. Die Asche und die Gebeine, soweit das Feuer diese nicht verzehrt hatte, wurden begraben und über den Grabstätten Rasenhügel erhöht. Auch gibt der römische Historiker noch einen Umstand an, welcher zeigt, wie streng der Ständeunterschied noch im Tode festgehalten worden ist. Denn zum Verbrennen der Adeligen und Freien waren gewisse Holzarten vorbehalten und es mag also angenommen werden, dass diese auf von Eichen- und Buchenholz, die Unfreien aus von Fichten- und Föhrenholz geschichteten Scheiterhaufen verbrannt wurden. Aber nicht nur seine Rosse folgten dem germanischen Todten ins Feuer, sondern so tat in ältester Zeit auch sein Weib. Wie bis in unsere Tage herab die indische Witwe dem Gatten nachstarb, so vordem auch die germanische, und hat sich dieser Brauch in Skandinavien viel länger erhalten als in Deutschland. Die Göttermythe und Heldensage wissen davon zu melden. Jenerzufolge wird die Göttin Nanna mit ihrem getöteten Gatten, dein Gotte Baldur, verbrannt. In den Sigurdsliedern der Edda, welche die älteste auf uns gekommene Fassung der Nibelungensage enthalten, ist gesungen, wie die Walküre Brunhild sich tötet, um ihrem Verlobten Sigurd nachzusterben, und wie sie sterbend die Schichtung und Ausschmückung des gemeinsamen Scheiterhaufens anordnet, wobei nicht zu vergessen, dass acht Knechte und fünf Mägde ihr in den Tod folgen sollten.
Germanen auf der Wanderung.
Diese Art von Totenopfer konnte nur den Sinn haben, dass Held und Heldin im Jenseits nicht ohne dienendes Gefolge wären. Im Beowulfsliede wird die Anordnung zur Feuerbestattung des alten Königs also beschrieben:
„Da errichteten rasch die Recken Geatlands
Ihm zur Feuerburg einen festen Bau,
Mit Helmen umhangen und Heerschilden,
Mit blanken Brunnen, wie er geboten hatte;
In die Mitte legten den erlauchten König
Die harmvollen Helden, den lieben Herrn“ —
und im Gegensatze zu solcher königlich-prächtigen Feuerbestattung aus dem Sagenbereiche ist die Kunde von einer königlich-eigenartigen Erdbestattung aus dem Bereiche der Geschichte auf uns gekommen. Jordanis nämlich erzählt in seiner Gotenchronik, dass die Krieger Marichs nach in Kalabrien erfolgtem Tode des gewaltigen Heerkönigs den Busentostrom beiseite leiteten, in dem Strombett ein tiefes Grab höhlten, darin den Toten mit Roß und Waffen und Kleinodien beisetzten, die Grabstätte zudeckten und dann den fluss wieder darüber leiteten. Noch eine sehr eigentümliche und hochpoetische Art von Totenbestattung ist bei den Germanen, welche ihre Sitze an der See hatten, bräuchlich gewesen, wie ebenfalls im Beowulfsliede zu lesen und wie auch die Edda in der Schilderung von Baldurs Leichenbegängnis kundmacht. Der Tote ward im vollen Waffenschmuck an Bord eines „Meerdrachen“ gebracht und in sitzender Stellung mit dem Rücken an den Mast gelehnt. Rings um ihn häufte man, was von Besitz ihm der liebste im Leben gewesen. Dann zog man das Segel auf, setzte das Schiff in Brand und ließ es in die Wogen hinaustreiben. So ritt der Recke auf feuerschnaubendem Rosse zur Walhalle Wodans.