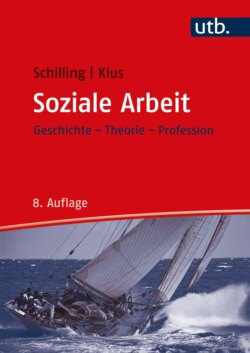Читать книгу Soziale Arbeit - Johannes Schilling - Страница 8
Оглавление1 Sozialarbeit – Geschichte der Armenpflege und Armenfürsorge / Wohlfahrtspflege
Abbildung 2: Geschichtliche Wurzeln der Sozialarbeit
1.1 Urkategorie der Armenpflege und Fürsorge: Armut und Hilfe
1. Praxis-Situation: Problem – Hilfe
Frau Stark, 36 Jahre alt, ist alleinerziehende Mutter ihrer beiden Töchter von acht und zehn Jahren. Sie arbeitet als Verkäuferin in einer Bäckerei. Mit ihrem Verdienst kann sie ihre Familie mehr schlecht als recht ernähren. Sie und ihre beiden Töchter müssen auf vieles verzichten. In den Urlaub zu fahren oder ins Kino zu gehen, ist für sie Luxus, den sie sich nicht leisten können. Frau Starks Bekannte raten ihr, sich finanzielle Unterstützung vom Jobcenter zu holen. Das sei ihr gutes Recht. Frau Stark lehnt dies jedoch energisch ab. Sie kommt schon alleine zurecht. Sie braucht das Jobcenter nicht. Die wollen einen ja nur ausfragen, kontrollieren und am Ende hat man das Gefühl, versagt zu haben und deshalb Hilfe zu brauchen. Sie ist stolz, dass sie es mit ihren Kindern so gut alleine schafft. Sie buckelt nicht vor anderen, schon gar nicht vor Leuten vom Jobcenter.
Wie ist Ihre Meinung? Was würden Sie Frau Stark raten?
Zu den Grundkonstanten der Armenpflege und Fürsorge zählen die beiden Begriffe Armut und Hilfe.
Hilfe, eine Urkategorie
„Hilfe ist eine Urkategorie des menschlichen Handelns überhaupt, ein Begriff, der nicht weiter zurückzuführen ist, außer auf den des gesellschaftlichen Handelns überhaupt … Hilfe ist eine gesellschaftliche Kategorie. Ihr Begriff bezeichnet ein Verhalten im menschlichen Zusammenleben.“ (Scherpner 1962, 122)
„Hilfsbedürftig und damit Gegenstand der fürsorgerischen Hilfe sind also diejenigen Gemeinschaftsmitglieder, die aus irgendwelchen Gründen den Anforderungen der Gemeinschaft gegenüber versagen, die nicht imstande sind, den Platz im Gemeinschaftsleben zu behaupten, an den sie gestellt sind, und die daher in der Gefahr sind, aus der Gemeinschaft herauszufallen.“ (Scherpner 1962, 138)
„Mir geht es gut. Ich komme sehr gut alleine klar.“ Wer so argumentiert, dem muss man einerseits Selbstbewusstsein und entsprechende Kompetenz bescheinigen. Andererseits kann man auch Bedenken haben. Kommt man im Leben immer alleine zurecht, muss man nicht mitunter auch Hilfe in Anspruch nehmen? Wie ist Ihre Meinung?
Die Urgeschichte der Menschheit (Phylogenese) zeigt, dass Menschen die Hilfe ihrer Gruppe, Familie, ihres Clans oder Stammes brauchten, um zu überleben. Und die Ontogenese eines Menschen belegt, dass ein Baby, Kleinkind, Kind ohne die Hilfe seiner Eltern bzw. Erwachsener und der sozialen Umwelt nicht existieren kann.
Somit ist (gegenseitige) Hilfe eine natur- und lebensnotwendige Kategorie der Menschheit.
Hilfe als Handlungsform
Führt man diesen Gedanken weiter auf unsere Zeit, so kann man Hilfe verstehen als Handlungsform des Beratens, Bildens und Unterstützens. Hilfe wird dabei vor allem als Kommunikation verstanden, durch die Ressourcen unterschiedlicher Art zur Lebensführung und Lebensbewältigung entdeckt, transferiert oder mobilisiert werden. Hilfe in diesem Sinne ist als Grundprozess der Sozialen Arbeit anzusehen. Dieser Prozess der Hilfe basiert auf zwei Grundpfeilern: Subjekten, die der Hilfe bedürfen und Institutionen, Professionellen, die helfen wollen. Damit schließt Hilfe auch automatisch Kontrolle mit ein, ist doppeltes Mandat (Schefold 2012, 1126). Hilfe und Kontrolle sind zwei Seiten des gleichen Sachverhaltes.
Armut
Armut begleitet die Menschheit von Beginn an und begegnet uns in unterschiedlichen Formen. Weitgehend wurde Armut jedoch innerfamiliär versucht aufzufangen, d. h. die Großfamilie, das „ganze Haus“, die Verwandtschaft, die Zunft etc. war verantwortlich, wenn jemand in Not geriet. Armut wurde als Problem der sozialen (Klein-)Gruppe verstanden und es wurde darauf entsprechend reagiert. Die Hilfe und Unterstützung durch die sozialen Primärverbände (Familie, Verwandtschaft, Nachbarschaft) sind typische Hilfeformen einer agrarischen Gesellschaft. In den bäuerlichen Großfamilien und überschaubaren Dorfgemeinschaften half man sich gegenseitig.
öffentliche Armenfürsorge
Erst seit dem Zeitpunkt, als die sozialen Primärverbände die Armut aufgrund von Kriegen, Krankheit etc. nicht mehr intern beheben konnten und die Armut „öffentlich“, bzw. zur sozialen Problemlage wurde, gab es Armenpflegemaßnahmen durch die sich entwickelnden Städte und Kommunen als eigenständige Hilfsangebote, d. h. die Familien- und Nachbarschaftshilfe wurde zunehmend durch ein öffentlich-hoheitliches Leistungs- aber auch Kontrollsystem abgelöst.
Diese neu entstandene öffentliche Armenpflege, die nach und nach zur öffentlichen „Fürsorge“, dann Wohlfahrtspflege wurde, lässt sich nach Inhalt und Zielgruppe unterscheiden:
■ Erwachsenen-Fürsorge: Bei „Unangepasstheit“ an die materiellen Lebensbedingungen, wirtschaftlichem Versagen, materieller Not wurde Hilfe angeboten.
■ Kinder-Fürsorge: Bei Unzulänglichkeiten gegenüber der moralischen Ordnung, Verwahrlosung wurde Hilfe angeboten und man begann ab dem Ende des 19. Jahrhunderts von Jugendfürsorge zu sprechen.
Unter Verwahrlosung verstand der Frankfurter Fürsorgetheoretiker und Hochschullehrer Hans Scherpner (1898–1959) „jedes individuelle Versagen gegenüber den moralischen Anforderungen, das aus einem Mangel an Erziehung und Bewahrung, aus dem ‚Wahr-los-Sein‘ hervorgeht.“ (Scherpner 1962, 138)
Grundtypen der Hilfsbedürftigkeit
Die beiden Grundtypen der Hilfsbedürftigkeit stehen zwar in Wechselbeziehung, dennoch kann man sie deutlich voneinander unterscheiden: Unter Armut wurde in ihrer typischen Ausprägung ein Notstand des Erwachsenen, unter Verwahrlosung dagegen eine typische Erscheinung jugendlicher Hilfsbedürftigkeit verstanden.
Diese Unterscheidung von Scherpner in „Armut“ und „Verwahrlosung“ begründet die Aufteilung in Erwachsenen-Fürsorge und Kinder- (bzw. Jugend-)Fürsorge. In dieser unterschiedlichen Form der Armut bzw. Hilfe liegt nun auch die Entstehungsgeschichte von Sozialarbeit und Sozialpädagogik. Erwachsenen-Fürsorge ist das, was wir z. T. mit Sozialarbeit und Kinder-(Jugend-) Fürsorge das, was wir z. T. mit Sozialpädagogik bezeichnen würden (Abbildung 3).
Abbildung 3: Entstehungsgeschichte
Hilfe als Urkategorie menschlichen Handelns hat viele Facetten und nicht jede Hilfe ist Fürsorge. Scherpner bezeichnet im Unterschied zu anderen Hilfeformen die „fürsorgerische Hilfe“ als eine Form, aus der im Verlauf der Zeit die Hilfseinrichtungen planmäßiger Art hervorgegangen sind, die wir herkömmlich als „Fürsorge“ bezeichnen.
Als Ergebnis dieser Differenzierung gelangt Scherpner zu folgender Umschreibung von Fürsorge:
Fürsorge
„Unter Fürsorge verstehen wir organisierte Hilfeleistungen der Gesellschaft an einzelne ihrer Glieder, die in der Gefahr stehen, sich aus dem Gemeinschafts- und Gesellschaftsgefüge, aus ihrer Ordnung und ihrem Leben herauszulösen und ihr zu entgleiten. Konkreter gesagt: die Fürsorge versucht Menschen, die den Anforderungen des Gemeinschafts- und Gesellschaftslebens – sei es in wirtschaftlicher, sei es in moralischer Hinsicht – nicht genügen können, zu stützen und zu halten, oder, wenn es sein muss, sie an anderer geeigneter Stelle einzugliedern, damit sie aus eigener Kraft am Leben des Ganzen wieder sinnvoll teilnehmen können.“ (Scherpner 1966, 10)
öffentliche Hilfeorganisation
Aus den beiden Grundkategorien Hilfe und Armut folgt logischerweise die Herausbildung von sozialen Organisationen. Dies bedeutete, in dem Maße, wie gegenseitige Hilfe die Kapazitäten der sozialen Primärverbände überstieg, wurden öffentliche Hilfeorganisationen notwendig und es entstand die öffentliche Armenpflege bzw. -Fürsorge (Abbildung 4).
Abbildung 4: Grundmodell
Im Laufe der Berufsgeschichte gab es nun im Hinblick auf gesellschaftliche Transformationsprozesse unterschiedliche theoretische Erklärungsmodelle. Im Folgenden soll die Berufsgeschichte der Sozialarbeit/Sozial- pädagogik anhand theoretischer Modelle zu den Kategorien Armut – Hilfe – Öffentliche Fürsorge und ihrem Verhältnis zueinander näher skizziert werden.
Entstehung und Ausgangspunkt von Sozialarbeit/Sozialpädagogik/Sozialer Arbeit ist die Tatsache, dass die (Groß-)Familie, das ‚ganze Haus‘, die Verwandtschaft, die Zunft, das Dorf etc. nicht mehr eigenständig Arme versorgen und Armut verhindern konnten und deshalb öffentliche Armenpflege bzw. -Fürsorge notwendig wurde.
Die Entwicklung der (Erwachsenen-)Armenpflege ist überwiegend die Geschichte der Sozialarbeit und die Geschichte der Kinder- (bzw. Jugend-)Fürsorge überwiegend die Geschichte der Sozialpädagogik. Sie hatte die Aufgabe, Kinder durch Erziehung vor Verwahrlosung zu schützen. Findel- und Waisenhäuser übernahmen die Versorgung derjenigen Kinder, für die keine Familie aufkam. Beide haben aber dieselben Wurzeln in den gesellschaftlichen Wandlungsprozessen und Armenpflegestrukturen des frühen 16. Jahrhunderts.
1.2 Armenfürsorge für Erwachsene im Mittelalter (um 12.–13. Jh.) und zu Beginn der Neuzeit (14.–16. Jh.)
1.2.1 Thomas von Aquin (1224–1274)
„Es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht als ein Reicher in das Himmelreich.“ (Neues Testament Mt. 19, 24) Die Reichen im Mittelalter hatten offensichtlich ein Problem. Was würden Sie den Reichen raten, zu tun?
erste Theorie über Armut
Im hohen Mittelalter gehörte die Kölner Universität zu den führenden Universitäten Europas. Hier lehrten bedeutende Theologen und Philosophen wie z. B. Albertus Magnus und Thomas von Aquin. Thomas von Aquin wäre, versuchte man ihn in unsere Zeit zu versetzen, ein klassischer Angehöriger der sog. „Apo“ (Außerparlamentarische Oppositionsbewegung der gesellschaftskritischen 1968er Studentengeneration), ein Aussteiger, und trotz übler Verleumdungen und Drohungen seitens der damaligen katholischen Kirche (Engelke et al. 2014, 43) nimmt seine Theorie (die thomistische Almosenlehre) innerhalb der christlichen Lehre eine herausragende Stellung ein. Sie beeinflusste in außerordentlicher Weise das abendländische theologische und soziale Denken. Die Almosenlehre des Thomas von Aquin kann man als erste Theorie über Armut verstehen. In ihr behandelt er Themen der Sozialen Arbeit, wie z. B. Armut, Almosen, Gerechtigkeit, Barmherzigkeit, Nächstenliebe, Arbeitspflicht, Lebensunterhalt. Ausgangspunkt seiner Überlegungen ist die Gesellschaftsordnung.
Almosenlehre
Die Almosenlehre des Thomas von Aquin umfasst folgende Vorstellungen:
1. Gesellschaftsordnung: Das Gemeinwohl steht vor dem Wohl des Individuums, der Einzelne hat sich der Gemeinschaft unterzuordnen. Dies entspricht der göttlichen Ordnung. Sie spiegelt sich in der Ständeordnung des Mittelalters wider:
■ geistlicher Stand (oberster Stand)
■ weltlicher Stand (Herrschaft)
■ bürgerlicher Stand
■ armer Stand (Besitzlose)
■ bedürftiger Stand (Witwen, Waisen, Krüppel, Kranke)
Außerhalb dieser Ordnung stehen die Ehrlosen (öffentliche Sünder wie Diebe, Ehebrecher, Mörder). Diese natürliche und soziale Ordnung ist ursprünglich von Gott gewollt. Armut war hiernach Ausdruck einer ewigen Ordnung, ein notwendiger Stand.
2. Arbeit: Der Mensch definiert sich durch seine Hinordnung auf das Jenseits; das eigentliche Leben beginnt nach dem Tod. Deshalb geht es im Leben des Menschen auch primär um die Verherrlichung Gottes und um das Seelenheil. Die Arbeit ist in diesem Zusammenhang sekundär, sie dient dem Erwerb des Lebensunterhalts. Allerdings entspricht es einem natürlichen Gesetz, dass der Mensch für seinen Lebensunterhalt sorgen muss, es ist zugleich ein göttliches Gebot. Aus dieser Überlegung heraus begründet Thomas von Aquin eine Verpflichtung zur Arbeit für diejenigen, die nicht eigenen Besitz haben und davon leben können.
3. Armut und Betteln: Für den Aquinaten erhält Armut und Betteln vom Evangelium her seine Bedeutung.
Almosen
Die Notleidenden haben in der mittelalterlichen Gesellschaftsordnung einen unentbehrlichen Platz. Sie sind für die reichen „Sünder“ wichtig. Arme bieten den Reichen Gelegenheit zu verdienstlichem Tun, zum Almosengeben. Das Almosen war neben Beten und Fasten eine Möglichkeit der ‚satisfactio‘, der Genugtuung für begangene Sünden, zudem war es unbedingte religiöse Pflicht eines jeden Christen (Marburger 1979, 48). Das Almosen ist verankert im Bußsakrament. Durch Beten, Fasten und Bußetun konnte der Sünder/die Sünderin Genugtuung erreichen. Durch das Bußsakrament wurde der Sünder/die Sünderin auf die Notwendigkeit des Almosengebens verwiesen. Hierin lag die Ausdehnung der Liebestätigkeit jener Zeit. Im Mittelpunkt steht allerdings nicht der/die EmpfängerIn der Gaben, sondern der/die GeberIn. Not und Elend werden religiös-ethisch gesehen und nicht ökonomisch-gesellschaftlich. Deshalb gab es auch keinen Grund zur Änderung der Gesellschaftsordnung oder zur Abschaffung der Armut. Der Umfang der zu gebenden Almosen richtete sich nicht nach der Notlage des Armen, sondern nach der Lebenssituation des Spenders. Es geht nicht um die Beseitigung der Armut, sondern um die Erhaltung des Armen in seinem Stand der Reichen wegen.
Geiler von Kaysersberg (1445–1510)
In Straßburg entwickelte der Münsterprediger Geiler von Kaysersberg (1445–1510) die Almosenlehre des Thomas von Aquin dahingehend weiter, dass die weltliche Obrigkeit, vor allem die Städte, das Recht und die Pflicht zur Versorgung und Kontrolle der Armen hätten. Kaysersberg ist damit einer der Begründer der neueren Fürsorge, die im Spätmittelalter ihren Ausgangspunkt hat. Zur neuen Sichtweise auf Armut und Betteln haben wirtschaftliche, religiöse und gesellschaftliche Entwicklungen beigetragen. Durch sie trat eine Veränderung der Wahrnehmung und auch Bewertung des Bettelns ein. Betteln wurde verboten.
Nach christlicher Auffassung, entscheidend geprägt von Thomas von Aquin, galten die Armen als ein eigener gesellschaftlicher Stand. Er wurde um der Reichen willen erhalten, damit diese sich durch Almosengeben den „Himmel verdienen“ konnten. An eine Abschaffung des Standes der Armen war nicht gedacht. Eine Änderung dieser Sichtweise nahm erstmals Geiler von Kaysersberg vor.
1.2.2 Martin Luther (1483–1546)
Martin Luther widerspricht der Lehre, man könne sich den Himmel verdienen. Wie ist Ihre Meinung?
Gottes Gnade
Der Theologe Martin Luther stellte sich gegen die Auffassung des ehemaligen Bischofs von Karthago und Kirchenlehrers Caecilius Cyprianus (200–258), der bereits im 2. Jahrhundert die Meinung vertreten hatte, man könne sich den Himmel durch Almosengeben und Kauf von Ablässen „verdienen“ und dadurch seine Sünden tilgen. Luther beruft sich vor allem auf die Bibelstelle im dritten Kapitel des Paulusbriefes an die Römer: „Wo bleibt nun das Rühmen? Es ist ausgeschlossen. Durch welches Gesetz? Durch das der Werke? Nein, durch das Gesetz des Glaubens, denn wir sind überzeugt, daß der Mensch durch den Glauben gerechtfertigt wird, unabhängig von Gesetzeswerken.“ (Röm 3, 27 f.). Nicht durch Werke, also auch nicht durch Werke des Almosengebens, können die Wohlhabenden nach Luthers Auffassung durch das Nadelöhr ins Himmelreich gelangen. Sondern er lehrte, dass man sich den Himmel nicht verdienen, sondern nur durch den Glauben und die Gnade Gottes gerettet werden könne.
1.2.3 John Calvin (1509–1564)
gottgefälliges Arbeiten
Die calvinistische Arbeitsmoral veränderte ebenfalls die Beurteilung des Bettlertums. Statt der thomistischen Almosenlehre galt jetzt der Satz des Apostel Paulus: „Wer nicht arbeiten will, soll auch nicht essen“. Nach der Auffassung des Anhängers von Luthers Lehre John Calvin ist nicht jeder Mensch von Gott erwählt. Er nahm an, dass Erfolg im irdischen Leben ein Zeichen der besonderen Erwähltheit sei und somit bereits das Unterpfand ewiger Bestimmung darstelle (Buchkremer 1982, 34). Die Arbeit sei somit Gott wohlgefällig, betteln aber eine Verletzung der Nächstenliebe. Armut wurde als selbstverschuldet angesehen und geächtet. Man trachtete danach, durch harten Zwang die sündigen Müßiggänger zu bessern, bis „ihre Hände so viel zu tun und ihre Körper so viel zu ertragen gelernt haben, daß ihnen Arbeit und Lernen leichter erscheinen als Müßiggang.“ (Scherpner 1966, 43) Denn „Müßiggang ist aller Laster Anfang“.
1.2.4 Humanismus
Der Humanismus (vetreten v. a. durch Erasmus von Rotterdam 1466–1536, Thomas Morus 1477–1535 und Juan Luis Vives 1492–1540) war in erster Linie eine religiöse und bildungsmäßige Reformbewegung, eine „katholische Reformation“ vor der eigentlichen Reformation Luthers. Der Humanismus hielt an wesentlichen Aussagen der katholischen Kirchenlehre fest, wollte die Kirche jedoch von dem „wirren Geschnörkel scholastischer Spitzfindigkeiten“ des Mittelalters befreien und sie mit Bezug auf die alten Texte der antiken Philosophen in ihrer praktischen Einfachheit wieder allen zugänglich machen. Bezüglich der Soziallehre des Humanismus verlangte z. B. Thomas Morus in seiner „Utopia“ die Arbeitspflicht für alle Arbeitsfähigen.
Bettel- bzw. Armenverordnung
Als Beleg für die praktische Umsetzung dieser neuen Sichtweise können die Bettel- bzw. Armenverordnungen genannt werden. In den ersten städtischen Armenordnungen der Stadt Nürnberg (1370/1478/1522) geht es um die frühesten Versuche, der Armut vorbeugend zu begegnen. Bettelnden Eltern sollten die Kinder weggenommen und diesen dann durch die Obrigkeit Dienst- und Arbeitsplätze vermittelt werden. Durch vorbeugende Maßnahmen wollte man Kindern beibringen, durch Arbeit ihr Brot zu verdienen. Nach und nach wurden alle BettlerInnen in Armenverzeichnissen erfasst. Eigens dafür eingesetzte Armenpfleger sollten den Kindern Arbeit in den handwerklichen Berufen vermitteln. Wer von den Erwachsenen die Erlaubnis zum Betteln erhalten hatte, musste ein sichtbares Armenabzeichen tragen. Das Almosengeben sollte mit dem Beginn der frühen Neuzeit und der entstehenden (protestantischen) Arbeitsethik nach und nach nur noch als letzte Möglichkeit angesehen werden, Armen zu helfen.
1.2.5 Juan Luis Vives (1492–1540)
Aus welchem Jahrhundert könnten folgende Überlegungen stammen? „Jeder Mensch soll arbeiten. Wer keine Arbeit hat, soll einen Arbeitsplatz vermittelt bekommen (Arbeitsbeschaffungsmaßnahme). Es soll sich dabei um einen Beruf handeln, den man früher gelernt oder an dem man Freude hat.
Jeder Betrieb soll Arbeitslose aufnehmen. Bei öffentlicher Vergabe von Aufträgen soll die Stadt diejenigen Betriebe berücksichtigen, die Arbeitslose eingestellt haben. Wer sich von den Arbeitslosen selbständig macht, soll durch Aufträge der öffentlichen Haushalte unterstützt werden.”
Diese Überlegungen klingen sehr modern und zeitgemäß. Sie wurden jedoch bereits im 16. Jahrhundert von dem Humanisten Juan Luis Vives entwickelt, um damit der Armut seiner Zeit zu begegnen.
Unterstützung der Armen
Vives (geboren in Spanien, Studium in Valencia und Paris, Lehre in Löwen und Oxford) war der in Deutschland in Vergessenheit geratene, dritte große Humanist neben Erasmus und Morus. Der Gelehrte Vives hat sich besonders auf den Gebieten der Philosophie, Philologie und Pädagogik hervorgetan. Für die Geschichte der Sozialen Arbeit ist er von größter historischer Bedeutung, weil er 1526 mit seiner „de subventione pauperum“ (Die Unterstützung der Armen) die erste neuzeitliche Armenpflegetheorie vorgelegt hat. In ihr hat sich die gesamte Opposition der beginnenden Neuzeit gegen die armenpflegerischen und pädagogischen Missbräuche des späten Mittelalters gebündelt (Engelke et al. 2014, 65 f.; Zeller 2006). Sein Humanismus, der auch von Einflüssen der jüdisch-biblischen Sozialethik durchzogen ist, hat für die Entwicklung der Armenpflege in der Neuzeit ganz entscheidende Impulse gegeben und ist in vielen Punkten immer noch hochaktuell. Vives hat ein System der Armenfürsorge entwickelt, in dem alle Bereiche der Armenpflege von der materiellen Unterstützung bis zur bildungsmäßigen Förderung von Kindern/Jugendlichen in einem einheitlichen Sinnzusammenhang stehen. Die Not in seiner Zeit bewegte ihn, sich mit dieser auseinanderzusetzen. Er analysierte die Lage der städtischen Armen und entwarf eine Theorie, wie man ihnen helfen könnte.Vives geht in seinem Theoriekonzept von vier Grundsätzen aus:
Arbeit, ein Wert an sich
1. Arbeitspflicht für Arme: Vives war der Überzeugung, dass der Mensch eine natürliche Veranlagung zur körperlichen und geistigen Aktivität hat. Arbeit war mit der „protestantischen Arbeitsethik“ ein Wert an sich geworden. Deshalb forderte er eine Hingabe an die Arbeit um der Arbeit willen. Nicht mehr, weil sie als göttliches Gebot verordnet, nicht mehr, weil sie als Mittel zur Erfüllung wertvoller Zwecke notwendig sei, sondern weil sie dem Menschen seiner Anlage entsprechend an und für sich ein erstrebenswertes Gut vermittelt, kann man vom Menschen erwarten und verlangen, dass er seinen Kräften entsprechend arbeitet (Scherpner 1962, 91). Daher lehnte Vives auch das Betteln als Broterwerb ab. Betteln sollte möglichst ganz abgeschafft werden. Der Humanist Vives lehnte die mittelalterliche Glorifizierung der Armen und Armut ab und wandte sich ersten säkularen Prinzipien eines neuen Armenpflegewesens und frühneuzeitlicher Sozialpolitik zu (Zeller 2006, 156–212).
2. Versorgung der Armen mit Arbeit: Die Arbeitsvermittlung wird bei Vives zum wichtigsten Mittel der Unterstützung der Armen. Der erste Schritt der Vermittlung ist die Prüfung der Arbeitsfähigkeit. Die begutachtende Instanz soll ein Arzt sein. Da es bei der Vermittlung arbeitsfähiger Armer um eine möglichst dauerhafte Aufhebung der Armut geht, sollten die Betroffenen in einen Beruf vermittelt werden, den sie früher erlernt hatten. Falls Handwerksmeister die Vermittlung von Armen ablehnen sollten, schlug Vives vor, dass durch Anordnung der städtischen Verwaltungen den einzelnen Handwerksmeistern eine bestimmte Anzahl von Armen zugewiesen werden soll, die selber keine Arbeitsstelle finden konnten. Die wirtschaftlichen Schwierigkeiten einer solchen Zwangslösung will Vives dadurch beseitigen, dass der Rat der Stadt alle öffentlichen Aufträge außer an die zur Selbständigkeit gelangten Armen auch an die Handwerksmeister vergeben soll, die Arme und Lehrlinge aufgenommen hatten (Scherpner 1962, 96). Wer trotz aller Anreize als arbeitsfähiger Armer nicht arbeiten will, für den sieht Vives strenge arbeitserzieherische Maßnahmen vor, wobei er aber ungeachtet dessen die Würde des Armen nicht verletzt sehen wollte.
3. Individualisierungsprinzip in der Armenpflege: Dieses System der Armenversorgung setzt eine Untersuchung der besonderen Notlage des einzelnen Armen voraus. Alle Armen sind sorgfältig in ein Armenverzeichnis einzutragen. In diesem soll festgehalten werden: die spezielle Notlage der Armen, die Art ihres früheren Lebensunterhalts, der Anlass der Verarmung, ihre Lebensart, ihre Moral. Die Entscheidung über die Arbeitsfähigkeit liegt bei einem Arzt. Vives System will Rücksicht auf den ganzen notleidenden Menschen nehmen, damit ihm eine gerechte Hilfe zuteil wird. Umfang, Art und Dauer der Unterstützung soll ganz individuell ausgerichtet sein. Sie orientiert sich an den geistigen, leiblichen und materiellen Bedürfnissen eines Menschen.
4. Erziehungsprinzip in der Armenpflege: Die Hilfeleistung enthält nach Vives grundsätzlich einen erzieherischen Charakter, der den vornehmsten Aspekt der Unterstützung darstellt. Vives fordert eine allgemeine Institution der Erziehungsaufsicht auch für Erwachsene. Mit der Armenpflege will er nicht mehr bloß die Armen aus ihrer Notlage befreien und damit eine Gefährdung des gesellschaftlichen Lebens beseitigen. Armenfürsorge strebt zugleich auch die moralische Förderung des Einzelnen, seine Erziehung zum guten Bürger an. Die fortschrittlichen Ideen dieses Voraufklärers und Humanisten kann in einem Zehn-Punkte-Sozialprogramm zusammengefasst werden.
Zehn-Punkte-Sozialprogramm aus der frühen Neuzeit von Juan Luis Vives 1526
■ Anlegen von Verzeichnissen zur Erfassung und individualisierenden Bedürftigkeitsprüfung
■ Ausweisung ortsfremder Bettler
■ Erziehung der Arbeitsfähigen zur Arbeit
■ Rückführung und Arbeitsvermittlung in alte Berufszweige
■ Arbeitsvermittlung für Ungelernte und Jugendliche
■ Bevorzugung von Handwerksmeistern, die Arbeitsplätze schaffen, bei öffentlichen Aufträgen
■ Durchsetzung des Arbeitszwangs für Arbeitsverweigerer
■ Versorgung von nicht mehr Arbeitsfähigen
■ Versorgung und Erziehung von Findelkindern
■ Ausarbeitung von Finanzierungsplänen
(aus: Zeller 2006, 187)
Die Almosenlehre von Thomas von Aquin erfährt durch den Humanismus und Calvinismus grundlegende Veränderungen. Arbeit wurde zu einer Gottespflicht und Betteln sollte verboten werden.
Nach Juan Luis Vives sollte den arbeitsfähigen Armen Arbeit vermittelt werden. Jeder Arbeitslose wurde als Einzelfall behandelt, um eine gerechte Hilfe zu gewährleisten. Durch die Hilfeleistung wollte man auch die Armen zu „guten Bürgern“ erziehen. Unter einem „guten Bürger“ verstand der Humanist Vives einen Menschen, der sich auch für die Belange des Gemeinwohls engagiert.
1.2.6 Nürnberger Bettel- und Armenordnungen (1370)
Bettelordnung
Die Maßnahmen gegen das Betteln wurden mit dem ausklingenden Mittelalter immer strenger gehandhabt. Es wurden Bettelzeichen verteilt, die deutlich sichtbar an der Kleidung getragen werden mussten. Außerdem war Betteln zunehmend nur noch an den kirchlichen Feiertagen erlaubt. Wer an anderen Tagen angetroffen wurde, durfte die Stadt einen Monat lang nicht mehr betreten. Die erste städtische „Bettelordnung“ mit Bettelverboten und der Einführung erster Bettelabzeichen für einheimische Bettler wurde 1370 in Nürnberg erlassen.
In der zweiten Nürnberger Bettelordnung von 1478 versuchte man die Wurzeln der Armut direkter anzugehen. Dies bedeutete, dass Kinder nicht mehr aufgezogen werden sollten, bis sie selbst ihren Lebensunterhalt erbetteln konnten, sondern das entscheidend Neue war, dass die Kinder der Armen lernen sollten, sich ohne Almosen, nur durch ihre eigene Arbeit zu unterhalten. Von der Obrigkeit wurde den Kindern ein Arbeitsplatz vermittelt. Durch diese vorbeugende Maßnahme wollte man erreichen, dass die Kinder nicht mehr bettelten, sondern ihr Brot durch Arbeit verdienen lernten.
Die ordnungspolitischen strengen Maßnahmen mussten durch die örtliche Polizei oder auch durch die manchmal als „Knechte“ bezeichneten Armenpfleger durchgeführt werden. Bei den städtischen Unterschichten hatte man bereits seit dem Spätmittelalter begonnen, zwischen der „primären Armut“ als unterste Grenze des Existenzminimums und der „sekundären Armut“ als Grenze zu unterscheiden, unterhalb derer eine „standesgemäße“ Lebensführung nicht mehr möglich war. Die Differenzierung zwischen „arm“ und „bedürftig“ war für die städtische Armenpflege wichtig, weil davon die Kategorisierung abhing, ob jemand als „Armer“ zur Arbeit gezwungen werden konnte oder zu den tatsächlich „Bedürftigen“ gerechnet werden musste. Krankheit, Arbeitsunfähigkeit, äußere Faktoren wie z. B. Missernten, Ernährungskrisen, Kriegskatastrophen und Seuchen zogen zwangsläufig Verarmung und Bedürftigkeit nach sich.
3. Nürnberger Armenverordnung
1522 erließ wiederum die Nürnberger Stadtverwaltung einen dritten ordnungspolitischen Maßnahmenkatalog, der jetzt aber nicht mehr „Bettel“- sondern „Armenordnung“ genannt und auch von anderen Städten übernommen wurde. Diese Armenordnung wurde in ganz Europa führend. Danach wurde zunächst das Betteln vor Kirchen verboten. Zwei oder drei Personen hatten für die Bedürftigen auszusagen, dass diese wirklich in Not waren. Und die Bettelzeichen trennten „ortsansässige“ von „nicht ortsansässigen“ Bettlern. Über diese Maßnahmen steckte die Obrigkeit einen engen Handlungsrahmen für die Bettler ab und kontrollierte auch deren moralischen Lebenswandel. Bei Hausbesuchen sollten nun auch genau Alter, Gesundheitszustand, Wohnbedingungen und Familiensituation festgehalten werden, um die Arbeitsfähigkeit zu überprüfen und danach unberechtigte Ansprüche ablehnen oder gewähren zu können. Der folgende Auszug stammt aus der Nürnberger Armenordnung von 1522:
„Vor der Durchführung dieses Almosens werden die Knechte mehr als einmal durch die ganze Stadt (…) gegangen sein und alle Bürger und Bürgerinnen, die des Almosens bedürftig sind, sorgfältig verzeichnet haben; sie verzeichnen auch, wieviel jeder öffentlich auftretende Bettler mit seiner wöchentlichen Bettelei einsammelt, auch wieviel Kinder ein jeder dieser Bettler hat, welches Alter und welche Ausbildung die Eltern und Kinder haben, und ob diese Kinder zum Teil gar in der Lage sind, mit Dienstleistung und ihrer Hände Arbeit ihr Brot zu erwerben und die Unterhaltung ihrer Eltern zu übernehmen; diese werden auch besonders deshalb schriftlich erfaßt, um ihnen durch die Pfleger und ihre Helfer in den Handwerken oder sonstwo Anstellungen zu verschaffen, damit sie mit Arbeit aufwachsen und mit der Zeit ohne Almosen auskommen können. Dazu haben sich die genannten vier Knechte bei den umwohnenden Nachbarn dieser Bettler und Armen zu erkundigen und sorgfältig zu notieren, was für einen guten oder schlechten Leumund diese Armen besaßen und noch besitzen, (…).“ (Sachße/Tennstedt 1980, 68 f.)
Die Höhe der Unterstützung richtete sich nach dem jeweiligen Personenstand. Wenn das Almosen wegen „unchristlichem“ Lebenswandel oder anderer Defizite verweigert werden musste, wirkten die Armenpfleger erzieherisch darauf hin, dass die Bedürftigen wieder auf die „rechte Bahn“ kamen. In der Nürnberger Armenordnung sind sogar schon Vorformen von Evaluation zu erkennen. So berichteten Armenpfleger beispielsweise, dass sie bei Hausbesuchen Erfolge feststellen konnten, wenn ehemalige Bettler und Müßiggänger wieder in ihren alten Handwerksberufen tätig waren und auch deren Kinder das Betteln aufgegeben hatten. Von einem beruflich „korrekt“ arbeitenden Armenpfleger erwartete die Stadtverwaltung ebenso den sorgfältigen Umgang mit öffentlichen Geldern (Zeller 2006, 133–139).
Konzept der Nürnberger Armenordnung von 1522 zur Durchsetzung der Bettelverbote
– Anstellung von Armenpflegern
– Gemeinsame Beratungen
– Hausbesuche/Bedürftigkeitsüberprüfung
– Verteilung von Bettelabzeichen
– Feststellung der Arbeitsfähigkeit bzw. -unfähigkeit
– Arbeitsbeschaffung
– Aktenführung
– Kassenverwaltung
– Genaue Festlegung der Höhe der Unterstützung
– Erziehungsmaßnahmen
– Besorgen von Arzneien
– Überprüfungen der geleisteten Maßnahmen
(Zeller 2006, 140)
1.3 Erwachsenenfürsorge im Zeitalter der Industrialisierung (18.–19. Jh.)
1.3.1 Industrielle Entwicklung – Pauperismus
Die rapide Umgestaltung Deutschlands zu einer Industriegesellschaft nach der Reichsgründung von 1871 hatte weitreichende soziale Folgen. Können Sie sich vorstellen, um welche es sich handelt?
Mit zunehmend sozialpolitisch ausgerichteten Konzepten und den im 19. Jahrhundert hinzukommenden neuhumanistischen Bildungs- und Erziehungsidealen auch für die unteren Schichten sowie im Zuge der Verweltlichung der Armenpflege wurde der alte polizeiliche Armenpflegebegriff schließlich immer mehr von dem Begriff Armenfürsorge, noch später Wohlfahrtspflege abgelöst. So wurden Sozialpolitisierung, Sozialdisziplinierung und im 19. Jahrhundert durch die Entstehung von freien Wohlfahrtsverbänden auch Konfessionalisierung wesentliche Meilensteine des Armen- und Fürsorgewesens in die europäische Moderne.
Der Pauperismus ist keine Folge der Industrialisierung, sondern bereits früher durch folgende Entwicklung entstanden: Mit der Bauernbefreiung (1807–1811) und der Einführung der Gewerbefreiheit (1810/11) wird den abhängigen Bevölkerungsschichten erstmals die Möglichkeit zu ungehinderter Familiengründung gegeben, was bei gleichzeitiger Abnahme der Sterblichkeit als Folge hygienischer Maßnahmen zu einem erheblichen Geburtenüberschuss und damit zu einer Überbevölkerung führte. Überbevölkerung und große Geldknappheit des Staates führten zu einem Mangel an Arbeitsplätzen und zu einer bis dahin nie gekannten Massenverarmung. Das bedeutete, dass nicht die Industrialisierung, sondern gerade ihre Verzögerung bei gleichzeitiger Überbevölkerung zum Pauperismus oder zur Verarmung ganzer Bevölkerungsschichten führte. Mit der Entstehung der Industriezentren kam es zu einer Binnenwanderung unbekannten Ausmaßes.
Seit etwa 1820 verläuft die industrielle Revolution in einem rasanten Tempo. Die rapide Umgestaltung Deutschlands zu einer Industriegesellschaft nach der Reichsgründung (1871) hatte weitreichende soziale Folgen. Gab es zu Beginn des Jahrhunderts etwa 300.000 Fabrikarbeiter, so waren es 1872 bereits sechs Millionen und um 1900 sogar zwölf Millionen.
sozioökonomischer Strukturwandel
Sachße und Tennstedt belegen den sozioökonomischen Strukturwandel dieses Jahrhunderts mit empirischen Daten:
1. Um 1750 lebten in Deutschland um 16–18 Millionen Einwohner, um 1900 waren es 56 Millionen.
2. Um 1800 lebte der größte Teil der Bevölkerung auf dem Lande. Von den 1016 Städten waren 998 noch typische Ackerbürgerstädte, d. h. Einwohner, die von landwirtschaftlichen Betrieben lebten. 1910 hatten 66 % der Bevölkerung ihren Wohnsitz in der Stadt (Sachße/Tennstedt 1980, 179–180).
3. „Die Anteile der Beschäftigten innerhalb der einzelnen Wirtschaftssektoren verschoben sich entscheidend vom primären Sektor (Landwirtschaft, Gartenbau, Forstwirtschaft, Fischerei) zum sekundären Sektor (Industrie, Handwerk, Verlag, Bergbau, …) und tertiären Sektor (Dienstleistung, Handel, Verkehr, Banken, …). 1800 waren von 10,5 Mio. Beschäftigten 62 v. H. im primären, 21 v. H. im sekundären und 17 v. H. im tertiären Wirtschaftssektor beschäftigt, 1914 waren von 31,3 Mio. Beschäftigten 34 v. H. im primären Sektor, 38 v. H. im sekundären und 28 v. H. im tertiären Sektor beschäftigt.“ (Sachße/Tennstedt 1980, 179 f.)
Die städtischen Ballungszentren boten ein Bild der Armut, des Elends und der Verwahrlosung. Industrie und Markt brachten nicht Harmonie und Wohlstand, sondern spalteten die Gesellschaft.
Das Bevölkerungswachstum war für den Übergang vom agrarisch-handwerklichen zum kapitalistisch-industriellen Wirtschaftssystem, für die Wandlungen im Bereich von Armut und Armenwesen deshalb von entscheidender Bedeutung, weil zunächst die Bevölkerung schneller wuchs als die Wirtschaft (Sachße/Tennstedt 1980, 181).
Einstellung zu den Armen
Bezüglich der Armenfürsorge handelte der Staat weniger im Interesse der Armen, als vielmehr in seinem eigenen Interesse. Die Einstellung zu den Armen fassen Christoph Sachße und Florian Tennstedt in drei Punkten zusammen:
1. Die Armen hatten keinen Rechtsanspruch auf Unterstützung. Die Unterstützung galt mehr im Sinne Polizeirecht vor Fürsorgerecht. Es ging um die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, um Gefahrenabwehr.
2. Die Armen, d. h. wer öffentliche Hilfe in Anspruch nahm, war von der Mitwirkung an den drei Gewalten des konstitutionellen Rechtsstaates (Legislative, Exekutive, Judikative) ausgeschlossen.
3. Neben diesen allgemeinen diskriminierenden Beschränkungen der Armen konnten die einzelnen Staaten des Deutschen Reiches weitere, ergänzende Eingriffe vornehmen. So durften z. B. in Bayern Ordnungskräfte die Wohnung der Armen jederzeit betreten, in Sachsen über Tun und Lassen im häuslichen Leben Rechenschaft fordern (Sachße/Tennstedt 1980, 212 f.). Arme mussten die ihnen zugewiesene Arbeit verrichten, im Weigerungsfall wurden Arbeitsscheu unterstellt und Haftstrafen verhängt.
Bettelvögte, Armenpfleger
Interessant ist aus heutiger Sicht, dass bis zu Beginn des 20. Jahrhundert die Versorgung wie auch die Disziplinierung und Kontrolle Hilfsbedürftiger durch öffentliche Armenverwaltungen nicht von Frauen, sondern ausschließlich von Bürgern mit Wahlrecht, also nur von ehrenamtlich tätigen Männern durchgeführt werden durften. In der Regel waren es ausgediente Soldaten oder Polizeidiener, welchen die Verteilung von Almosen übertragen wurde. Sie erhielten für ihre Tätigkeit etwa ab dem letzten Drittel des 19. Jahrhunderts von den Kommunen eine – mal mehr, mal weniger hohe – Aufwandsentschädigung. Man bezeichnete diese Tätigkeit regional unterschiedlich: Armen- und Bettelvögte, Gassendiener, Almosenknechte, Almosenpfleger, Kostendiener, Polizeidiener, Polizeisoldaten, Revierdeputierte, Armeninspektoren oder Armenpfleger. Ehrenwerte Bürger konnten nur dann ehrenamtlich in der Armenfürsorge tätig werden, wenn sie Mitglied eines städtischen Rates waren. Die Armenfürsorge galt dann als bürgerliches Ehrenamt.
1.3.2 Elberfelder Quartiersystem (1867)
Was halten Sie von folgendem Vorschlag, die Armenpflege in Quartieren bzw. Bezirken zu organisieren?
1. Man teilte eine Stadt in Bezirke auf und diese wiederum in Quartiere.
2. Jedem Bezirk stand ein ehrenamtlicher Vorsteher und jedem Quartier ein ehrenamtlicher Pfleger vor.
3. Jeder Pfleger hatte 2–4 Arme zu betreuen.
4. Den Armen sollte durch Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen geholfen werden.
Frage: Worin sehen Sie Chancen und Probleme bei dieser Form der Neuorganisation der Armenpflege?
Elberfeld (heute: Duisburg) war eine große Industriestadt. Um 1800 hatte sie etwa 12.000 Einwohner, 1852 bereits 50.364 und 1885 schon 106.492. Elberfeld gehörte damit zu den am raschesten wachsenden Fabrikstädten Deutschlands (Landwehr/Baron 1995, 22–26). Das Elberfelder System, von Daniel von der Heydt, Gustav Schieper und David Peters (Armenordnung vom 9. Juli 1852) konzipiert, war zu seiner Zeit das wirksamste und fand in weiten Teilen Deutschlands wie auch im Ausland große Anerkennung und Nachfolger. Es galt bis ins 21. Jahrhundert als Vorbild für die Organisation der Armenpflege. Ziel war es, die zu Armenzwecken verfügbaren Mittel mit größtmöglicher Sparsamkeit einzusetzen. Sachße und Tennstedt fassen die Grundsätze der Organisation und die materiellen Ziele in vier Punkten zusammen:
1. „Ehrenamtliche Arbeit in der öffentlichen Wohlfahrtspflege: Die verantwortliche Armenbehörde stellte eine große Anzahl freiwilliger Helfer und Helferinnen in ihren Dienst, die die Armen aufzusuchen, zu kontrollieren und nach Maßgabe ihres Befundes Unterstützung zu beantragen hatten;
2. Individualisierung der öffentlichen Wohlfahrtspflege: Keinem Armenpfleger sollten mehr als vier Familien oder alleinstehende Arme unterstellt werden, damit gründlich geprüft und kontrolliert werden konnte;
3. Dezentralisierung der öffentlichen Wohlfahrtspflege: Die Armenpfleger sollten nicht als ausführende Organe im Dienste der Stadtverwaltung tätig sein, sondern in den Bezirksversammlungen selbständig Unterstützung beschließen; die Armenverwaltung regelte die Tätigkeit der Pfleger durch genaue Instruktion;
4. Vermeidung von Dauerleistungen: Jede Unterstützung sollte möglichst nur auf 14 Tage bewilligt werden.“ (Sachße/Tennstedt 1980, 215 f.)
Bezirke und Quartiere
Um diese Ziele zu erreichen, war die Stadt Elberfeld in Bezirke eingeteilt, die wiederum in Quartiere unterteilt waren. Jedem Bezirk stand ein ehrenamtlicher Vorsteher, jedem Quartier ein ehrenamtlicher Pfleger vor. Die 60 Quartiere waren so organisiert, dass jeder Pfleger nur 2–4 Fälle pro Hausbesuch und nach vorgedrucktem Fragebogen zu bearbeiten hatte (Hering/Münchmeier 2014, 30–31). Es entstanden die ersten allgemeinen Richtlinien (Vorläufer heutiger Sozial- und Fürsorgegesetze), die von der Verwaltung festgelegt wurden. Die Armenpfleger hatten diese Richtlinien dann in die Praxis umzusetzen (Belardi 1980, 40). Es ging bei diesen Überlegungen nicht darum, die Ursachen der Armut zu ergründen und sie zu bekämpfen, sondern Menschen aus der Armut zu befreien.
Die Wahl der Armenpfleger erfolgte auf Vorschlag der Kirchen. Die Armenpfleger waren im Hauptberuf Handwerker oder Industrielle. Bei der Armenpflege handelte es sich um ein Ehrenamt, das jeder Bürger für drei Jahre übernehmen musste (Kühn 1994, 5 f.).
Die Industriearbeiterschaft hat sich an der bürgerlichen Armenpflege nur in geringem Umfang beteiligt, weil sie das System als ein Instrument der bürgerlichen Gesellschaft ansah, das die soziale Ungleichheit und ihre Folgen nur verschleierte und grundlegende soziale Reformen verhinderte.
Das Elberfelder System verfolgte seine Ziele v. a. durch zwei Methoden:
■ Arbeitsbeschaffung: Die Stadt Elberfeld versuchte Arbeiter zu vermitteln, indem sie den heimischen Unternehmern Aufträge erteilte. Wo dies nicht ausreichte, ordnete die Stadt eigene Tätigkeiten an (Straßenbau, Eisenbahnbau usw.).
■ Arbeitsanweisungen: Nach dem Motto „Arbeit ist besser als Almosen“ mussten Hilfsbedürftige jede ihnen zugewiesene Arbeit annehmen. Sollte eine Arbeitsvermittlung nicht so schnell gelingen, bekam der Hilfsbedürftige eine Unterstützung. Diese war aber so knapp bemessen, dass er den Antrieb zur Arbeitsaufnahme nicht verlieren würde.
Das Elberfelder System war bezüglich des Abbaus der „Armenlast“ sehr erfolgreich. Die Zahl der Armen in der Stadt Elberfeld sank von etwa 4.000 auf 1.460 (über 50 %). Die Bettelei nahm rapide ab. Ähnliches wurde auch von anderen Städten gemeldet (Bremen, Krefeld, Leipzig, Dresden, Gotha u. a.), die das Elberfelder System übernommen hatten (Kühn 1994, 6).
1.3.3 Straßburger Quartiersystem (1905)
Die rasante ökonomische Entwicklung und die in ihrem Gefolge sich immer dramatischer stellende soziale Frage überholte die im Elberfelder System angelegten Möglichkeiten der Wohlfahrtspflege. Bei den – gegen Ende des 19. Jahrhundert – erreichten Größen der Industriestädte musste das Quartiersystem versagen. Die hohe Mobilität der potenziellen Erwerbsbevölkerung und der verelendenden Schichten machten eine ehrenamtliche und individualisierende Wohlfahrtspflege unmöglich (Erler 2012, 68). 1905 entwarf der Straßburger Rudolf Schwander in seiner berühmten Denkschrift das Straßburger System, das einen wesentlichen Schritt in Richtung einer modernen Sozialpolitik darstellte. Ähnlich wie im Elberfelder System wurde auch in Straßburg das gesamte Stadtgebiet in Bezirke eingeteilt, eine weitere Quartiereinteilung aber entfiel. In einigen Punkten wurde das Elberfelder System entscheidend reformiert.
1. Es wurden hauptamtliche Berufsarmenpfleger eingesetzt.
2. Man wich von der Dezentralisierung ab und führte die Kompetenzen im Armenamt zusammen.
3. Eine klare Arbeitsteilung zwischen beruflichen und ehrenamtlichen Kräften wurde vorgenommen. „Die beruflichen Kräfte waren für die polizeilich-administrativen Aufgaben zuständig, die ehrenamtlichen dagegen für die pädagogische Beratung und Betreuung der Unterstützung.“ (Sachße/Tennstedt 1988, 26)
4. Die Armenpflege wurde in einen Innen- und Außendienst aufgeteilt. Dabei wurden die Entscheidungsbefugnisse auf die Innenbeamten der zentralisierten Armenverwaltung übertragen. Die Armenpflege vor Ort (Außendienst) wurde ab 1893/1899 allmählich durch in speziellen Kursen ausgebildete sozial engagierte Frauen ersetzt.
Durch die Verlagerung der Entscheidungsbefugnisse vom Außen- auf den Innendienst und den Einsatz von Berufsbeamten verlor das Fürsorgesystem seinen früheren Charakter. Und die Einteilung in Innen- und Außendienst wurde erst 1970 abgeschafft (Kühn 1994, 7). Mit dieser Neuregelung begann die moderne Sozialpolitik. Das klassische Prinzip der Bürokratie wurde auf die Bearbeitung der Armenfrage angewandt. Die Hilfesuchenden sollten nicht mehr auf Willkür und Wohlwollen ehrenamtlicher Armenpfleger angewiesen sein. Sondern sie trafen stattdessen auf ein – an zunehmend verrechtlichte Prinzipien gebundenes und für die Allgemeinheit zuständiges – öffentliches Fürsorgesystem (Hammerschmidt 2012, 851–861).
1.3.4 Sozialgesetzgebung Otto von Bismarcks (1815–1898)
Bismarck ging es in seiner berühmt gewordenen Sozialpolitik um zwei Fragenkomplexe:
1. Wie kann man verhindern, dass die parteipolitisch organisierte Arbeiterschaft die bestehende Gesellschaft umstürzt?
2. Wie kann man die Staatskasse von den hohen Kosten der Armenfürsorge entlasten?
Die Gefahren, die Bismarck in dem Zusammenschluss des „Allgemeinen Arbeitervereins“ (gegründet 1863 von Ferdinand Lasalle) mit der „Sozialdemokratischen Arbeiterpartei“ (gegründet 1869 von August Bebel) im Jahre 1875 in Gotha sieht, soll das Sozialistengesetz von 1878 bannen. Es verbot die Parteiorganisation und alle sozialpolitischen Vereine. Zur Bekämpfung der Not und der sozialistischen Gefahr wurde eine Reihe von Arbeiterversicherungsgesetzen erlassen, die später (1911) in der Reichsversicherungsordnung (RVO) zusammengestellt wurden. Die RVO ist seitdem das grundlegende Gesetz für die Sozialversicherung in Deutschland; sie wurde schrittweise in das neue Sozialgesetzbuch (SGB) integriert.
Zu den Bismarckschen Sozialgesetzen zählen:
1883 Einführung der Krankenversicherung
1884 Einführung der Unfallversicherung
1889 Einführung der Alters- und Invalidenversicherung
Vor- und Gegenleistung
Das Kernstück der Sozialgesetzgebung liegt auf der Verknüpfung des Versicherungszwanges mit einem Rechtsanspruch auf Unterstützung. Bei der Versicherung gilt das Prinzip der Vorleistung und Gegenleistung. Anstelle öffentlicher oder privater Armenfürsorge tritt jetzt das Recht auf Versorgung, das der Arbeiter durch seine Beitragszahlung erwirbt. Es ging Bismarck darum, dass die Arbeiter den Staat als eine wohltätige Einrichtung kennen lernten. Er dachte die Arbeiterklasse durch die Sozialgesetze für die gegebene gesellschaftliche Ordnung zu gewinnen oder wenigstens in sie einzubinden (Wendt 1985, 183).
zwei Hilfsprinzipien
Durch die Arbeiterversicherung hat Bismarck verhindert, dass die Arbeiter der öffentlichen Armenpflege zur Last fielen. Nur die Armen, die keinen Versicherungsschutz besaßen, hatten auch keinen Rechtsanspruch auf Unterstützung. Sie erhielten Hilfe nach dem Bedarfsprinzip. Somit gab es zwei Hilfsprinzipien: 1. die generelle Hilfe der Sozialpolitik und 2. die sich individuell orientierende Armenfürsorge.
Subsidiaritätsprinzip
Bis 1918 verstand sich der Staat als liberaler Rechtsstaat, der möglichst nicht in die sozialen und ökonomischen Prozesse eingreifen wollte, sondern nur für rechtliche Rahmenbedingungen zu sorgen hatte. Nach dem Subsidiaritätsprinzip überließ er die konkrete Ausgestaltung der Sozialfürsorge den privaten – meist kirchlichen – Wohlfahrtsorganisationen.
Von der Armenpflege zur Armenfürsorge
Armenpflege wurde im 19. und beginnenden 20. Jahrhundert nach dem Elberfelder bzw. Straßburger System durch kommunale Verwaltungen organisiert. Zuerst kümmerten sich ehrenamtliche, dann hauptberuflich tätige Armenpfleger um die Hilfsbedürftigen und versuchten vor allem durch Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen der Armut zu begegnen. Durch die Sozialgesetzgebung von Bismarck entstanden zwei neue Hilfsstrukturen: die staatliche Sozialpolitik und neben der privaten auch die öffentliche Armenfürsorge.
1.4 Wohlfahrtspflege für Erwachsene im 20. Jahrhundert
1.4.1 Kaiserreich und Weimarer Republik (bis 1933)
Nach der Entlassung Bismarcks durch Kaiser Wilhelm II. wurden in die Reform der Sozialpolitik viele Erwartungen gesteckt, doch sie blieb aus. Lediglich die Reichsversicherungsordnung wurde 1911 rechtlich neu organisiert. Ein Ausbau der kommunalen Armenversorgung fand statt. So wurden eigenständige Ämter organisiert, z. B.: Gesundheitsamt, Kinder- und Jugendwohlfahrtsamt, Arbeitsamt und Wohnungsamt.
Erster Weltkrieg
Der Erste Weltkrieg bedeutete einen zentralen Einschnitt in die Entwicklung der Fürsorge in Deutschland. Dies vor allem in zwei Bereichen:
■ Versorgung der Familien, deren Ernährer in den Krieg eingezogen waren. Sie wurden durch eine Familienunterstützung und Wochenhilfe aus der Kriegsfürsorge unterstützt.
■ Versorgung durch Kriegsbeschädigten- und Kriegshinterbliebenenfürsorge von 1919/1920. Damit veränderte sich die Zielgruppe der Fürsorge entscheidend.
Kriegsfürsorge, Kriegswohlfahrtspflege
Man musste nun zwischen Armenfürsorge und Kriegswohlfahrtspflege unterscheiden. Wer Kriegsfürsorge erhielt, brauchte nicht die Voraussetzungen einer Armenhilfe zu erfüllen. Die zum Militärdienst eingezogenen Männer hinterließen in der Regel Familien ohne angemessenen Unterhalt. Damit erweiterte sich der Kreis der Unterstützungsberechtigten. Der Kriegshinterbliebenenfürsorge sollte jedoch im Gegensatz zur Armenfürsorge nichts Diskriminierendes anhaften. Im Gegenteil, der Begriff „Fürsorge“ erhielt eine Veredelung der Klangfarbe durch die Kriegswohlfahrtspflege: Es galten besondere Maßstäbe, die dem Opfer, das die Kriegsteilnehmer dem Vaterland gebracht hatten, Rechnung tragen sollten. Begrifflich und sachlich wurde deutlich zwischen „Kriegsfürsorge“ und „Kriegswohlfahrtspflege“ unterschieden. Der Unterschied zwischen diesen beiden Einrichtungen bestand darin, dass Erstere einen versorgungsähnlichen Charakter hatte und Letztere eine freiwillige Unterstützungsleistung darstellte. Im Lauf des Krieges wurde eine Reihe von sozialpolitischen Forderungen der Gewerkschaften und der Sozialdemokratie verwirklicht: Anerkennung der Gewerkschaften, Koalitionsfreiheit, Tarifvertragswesen, Schlichtungswesen. Die Organisation des Arbeitsmarktes wurde als Staatsaufgabe anerkannt, Arbeitsnachweis und Erwerbswesenunterstützung wurden eingerichtet, der Mieterschutz und eine Wohnungspolitik des Reiches aufgebaut. Insofern erwies sich der Krieg als Schrittmacher der Sozialpolitik (Sachße/Tennstedt 1988, 64).
Weimarer Republik
Nach dem Ersten Weltkrieg sollte der neue Volksstaat (Ausrufung der Republik am 9.11.1918) nicht mehr bloß ein Rechtsstaat sein, sondern ein Staat, dessen BürgerInnen Gleichheit vor dem Gesetz erhielten und dem es um die Volkswohlfahrt als Sozialpolitik ging. Man wollte nicht zu dem alten System der Armenpflege zurückkehren, sondern der Staat übernahm mit der 1919 erlassenen Verfassung die Zuständigkeit für die Regelung der gesamten Sozialpolitik und insbesondere der Fürsorge.
neue Sozialgesetze
Die Gesetzesinitiative der Nachkriegszeit ging zunächst vom Reichsarbeitsministerium aus, mit spezifischen Sonderfürsorgen für die verschiedenen Gruppen der Opfer von Krieg und Inflation. Es wurden eine Reihe von Gesetzen erlassen, z. B.:
■ Kriegsopferversorgung für Kriegshinterbliebene und Kriegsbeschädigte
■ Sozial- und Kleinrenten für Inflationsopfer
■ Regelung für den Erwerbslosen in der „Verordnung über Erwerbslosenfürsorge“ von 1918, Neuregelung 1923
■ Kinder- und Jugendfürsorge – „Reichsjugendwohlfahrtsgesetz“ (RJWG) 1922/1924
■ Regelungen der sozialen Hygiene und Gesundheitsfürsorge mit der Zielvorgabe der Prophylaxe und Früherkennung und Ausgestaltung der Wohnungsfürsorge – „Reichsfürsorgepflichtverordnung“ (RVO) 1924/25
Wohlfahrtspflege
Die Entwicklung der Wohlfahrtspflege in der Weimarer Zeit ist durch zwei Merkmale gekennzeichnet:
1. Zentralisierung der Wohlfahrtspflege, das Reich übernahm zunehmend die Aufgaben.
2. Statusanhebung der Fürsorgeempfänger, durch den Krieg wurden auch viele aus den gehobenen Schichten zu Empfängern von Unterstützung.
Jugend-, Wohlfahrts-, Gesundheitsamt
1918 entstand das Preußische Ministerium für Volkswohlfahrt als erste zentralisierende Ausführungs- und Verwaltungsbehörde der Länder auf dem Gebiet der Fürsorge. 1924 wurde die „Reichsverordnung über die Fürsorgepflicht“ erlassen, in der die Grundprinzipien der Fürsorge geregelt wurden. Diese Reichsverordnung fasste die Einzelregelungen zusammen und übertrug sie einem einheitlichen Träger. Die Armenhäuser wurden umbenannt in Fürsorge- bzw. Wohlfahrtsämter. Es wurden die klassischen Ämter geschaffen: Jugendamt, Wohlfahrtsamt und Gesundheitsamt.
fünf Entwicklungslinien
Die Reihe der Gesetzgebung schloss 1927 mit dem Gesetz der Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung. Nach Sachße und Tennstedt lassen sich fünf Entwicklungslinien der Wohlfahrtspflegeentwicklung erkennen:
1. Öffnung der Wohlfahrtspflege zur Mitte der Gesellschaft hin, eine neue Definition von Armut wurde notwendig; in der Notgemeinschaft des Krieges verloren die bisherigen Kriterien ihre Gültigkeit.
2. Konflikte zwischen Reich und Gemeinden. Das Reich wurde zur zentralstaatlichen Steuerungsinstanz in der Wohlfahrtspflege.
3. Duale Strukturen der Wohlfahrtspflege. Es entstand das für Deutschland charakteristische duale System der Wohlfahrtspflege, d. h. die Regelung des Verhältnisses öffentlicher und freier Wohlfahrtspflege nach dem Subsidiaritätsprinzip.
4. Politisierung der Wohlfahrtspflege. Über die Ausgestaltung des Wohlfahrtsstaates stritten sich die demokratischen Parteien mit je unterschiedlichen Positionen.
5. Wohlfahrtspflege und Arbeitsmarkt. Das Problem der Arbeitslosigkeit spielte in der Fürsorge eine große Rolle. Der Erfolg der Maßnahmen und Leistungen hing entschieden vom Funktionieren des Arbeitsmarktes ab (Sachße/Tennstedt 1988, 213–217).
Anzumerken ist noch, dass 1923 der Begriff „Armenpflege“ durch den der „Wohlfahrtspflege“ ersetzt wurde.
Der Prozess der Vergesellschaftung der Fürsorge unterscheidet sich deutlich von den vorausgegangenen Strukturmustern der Armut und Hilfe. Es war nach und nach etwas qualitativ Neues entstanden. Die alte polizeiliche Armenpflege, dann Fürsorge und Wohlfahrtspflege, sollte im 20. Jahrhundert schließlich die heutige Soziale Arbeit werden.
Wohlfahrtspflege statt Armenpflege
Die soziale Gesetzgebung der Bismarckschen Zeit war eine Arbeitergesetzgebung, die Sozialversicherung eine Arbeiterversicherung. In der Wohlfahrtspflege ging es nun darum, sich gegen diese Sozialpolitik des Staates abzugrenzen und nach der eigenen Legitimation zu fragen. In den zahlreichen theoretischen Bemühungen dieser Zeit geht es um eine begriffliche Klärung und Abgrenzung der beiden großen Arbeitsgebiete, der Sozialpolitik und der Wohlfahrtspflege der freien Verbände. Man suchte nach den wesensgemäßen Unterschieden. Das entscheidend Neue entwickelte sich aus der Sicht des Menschenbildes. Die alte Armen- und Wohlfahrtspflege berücksichtigte nur den „halben Menschen“, d. h. die äußere Seite der menschlichen Not: Nahrung, Kleidung, Obdach, Moral und Bildung. Der neue Prozess der Fürsorge richtete sich zunehmend auf die zweite, die innere Seite des Menschen, auf seine innere Natur. Armut wird begleitet von einem Armutsbewusstsein, einem seelischen Erleiden der Armut. Nicht die Armut als solche, sondern das Erleben der Armut wird zum Gegenstand der Fürsorge. Die alte Erziehung ging z. B. von den Schwierigkeiten aus, die das Kind machte, die neue von denen, die das Kind hatte.
neues Armutsbewusstsein
Die Verschiebung auf die Innenseite des Menschen besagt jedoch nicht, dass man der materiellen Not keine Beachtung schenkte, es fand vielmehr eine Umwertung hin zum ganzen Menschen statt.
„Erst als durch den Ausbau der Versicherungsanstalten für die gleichsam ‚normalen‘ Existenzrisiken von Krankheit, Invalidität, Verwaisung, Alter und Tod unabhängig vom Einzelfall und vom einzelnen Helferwillen ein prinzipielles Recht auf Hilfe institutionalisiert wurde, erhielt die Fürsorge die Möglichkeit einer prinzipiellen Abgrenzung von der Sozialpolitik wie sie durch den Rückgang auf das innere Leiden und die innere Not gefördert wurde: für die Bearbeitung der normalen Existenzrisiken, die ohne soziale Sicherung zur Armut führen, ist die Sozialpolitik zuständig; für die Bearbeitung der inneren Erlebnisweisen, die entweder zur Verarmung und Verwahrlosung führen oder deren Folge sind, qualifiziert sich eine pädagogisch orientierte Fürsorge.“ (Münchmeier 1981, 93)
1.4.2 Alice Salomon (1872–1948)
Alice Salomon hat mit ihrem umfangreichen wissenschaftlichen Werk und mit ihrem persönlichen Engagement die Soziale Arbeit als professionellen Berufszweig in Deutschland wie kaum jemand sonst beeinflusst. Zugleich gab sie für Praxis, Theorie und Ausbildung in der Sozialen Arbeit wegweisende Impulse, die im Professionalisierungsprozess der Sozialen Arbeit als Berufszweig bis heute ihre Spuren hinterlassen haben (vgl. Landwehr/Baron 1983; Wieler 1983/1987; Müller, C. W. 1985; Engelke et al. 2014; Feustel 1997/2000/2004; Kuhlmann 2000/2007). Sie ist die Pionierin der Sozialen Arbeit als gesellschaftliche Reformbewegung. Und sie gilt als Gründerin des sozialen Frauenberufes und Repräsentantin der Frauenbewegung. Ziel von Salomon war es, eine Einbindung der bürgerlichen Mädchen und Frauen in die soziale Hilfearbeit zu ermöglichen, um sie qualifiziert auf die verantwortungsvolle Tätigkeit in der Sozialen Arbeit vorzubereiten und sie gleichzeitig an gesellschaftlichen Reformen zu beteiligen.
Leitgedanke
Leitmotiv war die Erkenntnis, dass aus Lernenden Lehrende und Erziehende werden würden, um ihren Teil der Verantwortung für die Leistung der Gesamtheit zu übernehmen (Braches-Chyrek 2013, 213–246). Ausgangspunkt ihrer Überlegungen ist der Entwicklungsstand einer modernen Gesellschaft. Je entwickelter und vielseitiger die Kultur einer Gesellschaft ist, so Salomon, desto weniger werden alle seine Mitglieder imstande sein, mit den herrschenden Ideen, Vorstellungen und Anforderungen Schritt zu halten; desto größer wird die Zahl derer, die sich nicht anpassen können; desto geringer werden die Möglichkeiten natürlicher, familienhafter, nachbarschaftlicher Hilfe und Förderung.
In der Industriegesellschaft entsteht andauernd Not durch Ursachen, auf die der Einzelne kaum Einfluss hat, die durch gesellschaftliche Umstände bedingt sind. Die Not kann viele Gesichter haben: wirtschaftliche, geistig-sittliche, gesundheitliche und im einzelnen Menschen liegende Ursachen. Um Hilfe zu gewähren, sind Wohlfahrt und Wohlfahrtspflege notwendig. Wohlfahrt und Volkswohlfahrt werden durch politische Maßnahmen angestrebt.
Unter Wohlfahrtspflege versteht Salomon „die planmäßige Förderung der Wohlfahrt von Bevölkerungsgruppen in Bezug auf solche Bedürfnisse, die sie nicht selbst auf dem Weg der Wirtschaft befriedigen können, und für die auch nicht deren Familien oder der Staat durch allgemeine öffentliche Leistungen sorgt“ (Salomon zitiert nach Engelke et al. 2014, 244).
Ziele
Ziel der Wohlfahrtspflege ist die bestmögliche Entwicklung der ganzen Persönlichkeit durch bewusste Anpassung des Menschen an seine Umwelt, aber auch umgekehrt, Anpassung der Umwelt an die besonderen Bedürfnisse und Kräfte des betreffenden Menschen (Engelke et al. 2014, 247).
Salomon geht es darum, dass die Wohlfahrtspflege – etwas moderner ausgedrückt –:
1. die vorhandenen Kräfte der KlientInnen nach Möglichkeit fördert und entwickelt,
2. die vorhandenen Ressourcen erhält und schützt, der Entstehung sozialer Problemlagen möglichst präventiv begegnet,
3. zufrieden stellende Lebenssituationen nach Möglichkeit mit wiederherstellen hilft, die sozialen und individuellen Probleme gemeinsam mit den KlientInnen bearbeitet,
4. wo Veränderungen nicht mehr möglich sind, eine Grundversorgung anbietet und sicherstellt.
Um diese Ziele zu erreichen, war für die Sozialreformerin Alice Salomon die Grundlage allen Helfens die Erstellung von sozialen Diagnosen. „Soziale Diagnose“ nennt sie deshalb auch ihr 1926 erschienenes erstes Lehrbuch für die Fürsorgeausbildung in Deutschland. Es ist somit das erste Fachbuch für die Profession überhaupt geworden. In sozialen Diagnosen sollen im Gegensatz zu medizinischen Diagnosen alle wichtigen psychosozialen Daten mit den KlientInnen zusammen erhoben werden.
Phasenmodell
Weiterhin entwickelte sie ein Phasenmodell professionellen Helfens, das sechs Schritte vorsieht:
■ Erkundigungen einziehen,
■ Ressourcenermittlung in der Lebenswelt,
■ stellvertretende Deutung,
■ Hilfeplan erstellen,
■ Interventionen,
■ Evaluation (Stimmer 2012, 273).
erste Soziale Frauenschule 1908
Entscheidend für diese Aufgaben der Wohlfahrtspflege waren für Salomon dafür ausgebildete soziale Fachkräfte. 1908 gründete Salomon im Berliner Pestalozzi-Fröbelhaus schließlich die erste zweijährige, überkonfessionelle Soziale Frauenschule in Deutschland und wurde bis 1927 deren erste Direktorin. Sie war aber nicht nur die Gründerin der ersten Ausbildungsstätte, sondern ab 1925 auch der ersten Weiterbildungsinstitution für die Fürsorgerinnen der „Deutschen Akademie für Soziale und Pädagogische Frauenarbeit“. 1929 gründete sie auch das wegweisende „Internationale Komitee Sozialer Frauenschulen“.
Das entscheidend Neue in der Wohlfahrtspflege war die Aufteilung in zwei öffentliche Funktionsbereiche: Sozialpolitik, die zuständig war für die „äußere“, materielle Not des Menschen und die Wohlfahrtspflege, die für die „innere“ Seite, die Not der Ansprechpartner war. Man ging nicht mehr davon aus, welche Schwierigkeiten eine Person machte, sondern welche sie hatte.
Alice Salomon hatte diese Überlegungen wissenschaftlich zusammengefasst und 1908 die erste zweijährige, überkonfessionelle „Soziale Frauenschule“ in Berlin und 1925 die „Deutsche Akademie für Soziale und Pädagogische Frauenarbeit“ als erste Fortbildungsinstitution für die Fürsorgerinnen gegründet. Sie ist mit dem „Internationalen Komitee Sozialer Frauenschulen“ dann auch die ersten Schritte hin zu einer Internationalisierung der Sozialen Arbeit gegangen.
1.5 Volkspflege im Nationalsozialismus (1933–1945)
NS-Volkswohlfahrt
Zum Ende der Weimarer Republik waren in Deutschland Millionen Menschen ohne Arbeit, mit den katastrophalen Folgen gesellschaftlicher Verelendung, die sich auch verheerend auf die Sozialpolitik und das Fürsorgesystem auswirkten. Die Stoßrichtung der einsetzenden Sozialpolitik der nationalsozialistischen Parteidiktatur zielte zunächst auf die Einrichtung von Arbeitsbeschaffungsprogrammen und der schrittweisen politischen Gleichschaltung, bzw. auch der Zerschlagung der öffentlichen und privaten Fürsorgestrukturen der Republik. Zu den ersten organisatorischen Schritten der nationalsozialistischen Wohlfahrtspflege gehörte bereits 1932 die Gründung einer eigenen Wohlfahrtsorganisation, die „Nationalsozialistische Volkswohlfahrt“ (NSV). Das gesamte Wohlfahrtswesen aus der Weimarer Republik wurde über einen enthumanisierenden „Paradigmenwechsel“ nach und nach von der NSV übernommen. Dies bedeutete, dass die „Für“Sorge durch staatlich organisierte „erb- und rassenbiologische“ Maßnahmenkataloge zur „Volks“Pflege, d. h. zur „Erb- und Rassenpflege“ wurde. Den kirchlichen Wohlfahrtsverbänden blieb lediglich die Sorge für die so genannten „Minderwertigen“ (Kriminelle, Obdachlose, Arbeitsscheue, Erbkranke, Anstaltsinsassen aller Art) (Mason 1977; Kramer 1983; Baron 1983/86; Vorländer 1988; Zeller 1994).
Die nationalsozialistische Volkswohlfahrt (NSV) verfolgte drei Hauptziele:
Ziele
1. Reduzierung von öffentlicher (materieller) Fürsorge: Die Fürsorge während der Weimarer Zeit sei zu großzügig gewesen und die Unterhaltsmittel falsch verteilt worden. Vorsorge müsse in den Vordergrund treten. Die „unwirtschaftliche“ Fürsorge für die „sozial Untüchtigen“ wurde radikal gekürzt.
2. Orientierung der Fürsorge am „Volksganzen“: Die Orientierung am Einzelschicksal wurde zugunsten einer Orientierung am „Volksganzen“ aufgegeben. Die „Befürsorgung minderwertiger“ Menschen wurde ganz aufgehoben. Die nationalsozialistische Volkswohlfahrt betreute nur aus ihrer Sicht förderungswürdige so genannte „erbgesunde und wertvolle“ Familien. Die Klientel der NSV wurden eingeteilt in „förderungsunwürdige“ und „förderungswürdige“ Menschen.
3. Schutz vor so genanntem „Kranken-Erbstrom“: Durch gezielte Maßnahmen, wie ab 1933 die Zwangssterilisierung und ab 1939 die Ermordung hilfloser behinderter Menschen, sollte die abendländische Kultur bzw. die „arische Rasse des deutschen Volkes“ künftig vor „ungesundem Erbgut“ und „kranken Erbströmen“ geschützt werden. Um diese Ziele zu erreichen, führte man zunächst nur wenige Gesetzesänderungen durch. Die aus der Weimarer Republik stammenden Gesetze mussten lediglich restriktiv ausgelegt werden. Dazu reichte eine entsprechende Personalpolitik. Dann änderten die Nationalsozialisten aber nach und nach die Sozialgesetzgebung bzw. gaben neue Verwaltungserlasse heraus, die aber häufig schon im vorauseilenden Gehorsam durch die Sozialverwaltungen befolgt wurden (Gruner 2002).
neue Ethik
Man muss festhalten, dass die in der Sozialen Arbeit (Volkspflege) Tätigen an der Umsetzung der Politik der Entartung und der Durchsetzung der dazu gehörenden neuen Ethik von der ungleichen Wertigkeit der Menschen in vielfältigen Formen beteiligt waren. Sie haben in der großen Mehrzahl das neue Konzept der ausgrenzenden Volkspflege mitgetragen (Kuhlmann 2012, 88, 92).
Man kann zusammenfassend sagen, dass die Entwicklung der Sozialen Arbeit nach der Machtübernahme Hitlers 1933 durch einen dramatischen und enthumanisierenden Paradigmenwechsel bestimmt wurde und dass man nach dem Kriegsende dort wieder ansetzen musste, wo man vor 1933 aufgehört hatte.
1.6 Nach dem Zweiten Weltkrieg: Bundesrepublik Deutschland (seit 1945)
Der Wiederaufbau des sozialen Netzes nach dem Zweiten Weltkrieg verknüpfte zwei Linien:
Neubeginn
1. Die sozialen Fachkräfte versuchten wieder dort anzusetzen, wo der Entwicklungsprozess der Fürsorge bzw. der Sozialen Arbeit als Ausbildungssystem und Profession durch den Nationalsozialismus auf dramatische und enthumanisierende Weise unterbrochen worden war. So hielt man in der 1949 entstandenen Bundesrepublik zunächst noch einige Jahre am bestehenden System der Weimarer Republik der Sozialversicherungen und Renten grundsätzlich fest. Es gab vorerst auch keinen Anlass zur Veränderung, zumal die Westalliierten das deutsche System der Sozialversicherung allgemein als fortschrittlich und vorbildlich ansahen. Im Wesentlichen galten die gesetzlichen Grundlagen der Weimarer Republik weiter.
2. Durch die Beeinflussung der Westalliierten wurde der Wiederaufbau der Sozialen Arbeit nach dem Muster des Sozialwesens in England und den USA geprägt. Man übernahm, zunächst recht unkritisch, die so genannten modernen „klassischen Methoden: Casework/Einzelhilfe, Groupwork/Gruppenarbeit und Community Work/Gemeinwesenarbeit.
Mit einer Reihe von gesetzlichen Grundlagen versuchte die damalige Bundesregierung die Probleme der Nachkriegszeit in den Griff zu bekommen. Hier sollen nur zwei exemplarisch genannt werden:
JWG (1961)
■ Jugendwohlfahrtsgesetz (JWG) von 1961 mit verschiedenen Neufassungen bis zur Neuformulierung im „Kinder- und Jugendhilfegesetz“ (KJHG) von 1991
BSHG (1961)
■ Das Bundessozialhilfegesetz (BSHG) von 1961/62 und Vorläufer unseres heutigen neuen Sozialgesetzbuches (SGB). Das Gesetz sollte dazu beitragen:
- ein menschenwürdiges Dasein für alle BürgerInnen zu sichern,
- gleiche Voraussetzungen für die freie Entfaltung der Persönlichkeit zu schaffen,
- die Familien zu schützen und zu fördern,
- den Erwerb des Lebensunterhaltes durch eine frei gewählte Tätigkeit zu ermöglichen und
- besondere Belastungen des Lebens, auch durch Hilfe zur Selbsthilfe, abzuwenden oder auszugleichen.
Nach dem BSHG hat jede/r BürgerIn einen Rechtsanspruch auf Sozialhilfe. Das Gesetz verfolgt den Zweck, der/dem Hilfebedürftigen bei eigener Mitwirkung einen gegebenenfalls einklagbaren Zugang zu einem Leben der Selbstbestimmung zu schaffen, damit sie/er und ihre/seine Familie ein menschenwürdiges Dasein führen können. Das BSHG führte neue Begriffe ein: aus Fürsorge wurde Sozialhilfe, aus Jugendfürsorge und Jugendwohlfahrtspflege wurde Jugendhilfe, aus Wohlfahrtspflege als Sammelbegriff wurde die Bezeichnung Soziale Arbeit (Hering/Münchmeier 2014, 114).
1.7 Armut und Hilfe in der bundesrepublikanischen Sozialarbeit
1.7.1 Armut
Würden Sie der Formulierung zustimmen: „Wenn man von Armut spricht, meint man stets materielle Armut.“ Oder würden Sie Armut anders umschreiben?
Wenn man von Armut spricht, sollte man nicht nur an materielle Armut, sondern auch an andere gesellschaftliche Formen der Armut denken.
Im Folgenden soll nach dem Verständnis der Armut gefragt werden. Das Verständnis von Armut hat sich im Laufe der Geschichte gewandelt. Armut ist ein relativer, gesellschaftlicher Tatbestand.
Armut heute
„Was aber heißt relativ. Relativ ist z. B. das jeweilige Einkommen im Verhältnis zum durchschnittlichen Verdienst eines Erwerbstätigen; relativ sind die, für die Festsetzung des „Mindestbedarfs“ erforderlichen, Konsumtionsmittel im Verhältnis zum durchschnittlichen Wert der Ware Arbeitskraft; relativ ist die Kaufkraft der Menschen mit Bezug auf die Teuerungsrate der zum Lebensunterhalt erforderlichen Konsumtionsmittel; relativ ist schließlich auch die Wahrnehmung von Ansprüchen im Verhältnis zu den disponiblen Sozialleistungen. Relativ ist individuelle Armut somit im Vergleich zur Gesamtheit gesellschaftlich verteilter Konsummöglichkeiten, zu Umfang und Qualität der gesellschaftlich verteilten Geld-, Dienst- und Sachleistungen. Armut ist mithin nicht bloß ein Problem ökonomischer Mangel- und Abhängigkeitssituationen. Sondern Armut ist immer gleichzeitig ein Problem ökonomischer sowie auch sozialer Ungleichheit, damit also als relativ anzusehen.“ (Zander 1987, 138)
Paradigmenwechsel
Man kann von einem sozialpolitischen Paradigmenwechsel sprechen, einer feststellbaren qualitativen Veränderung von Erscheinungsformen der Armut. Nicht mehr nur der materielle Aspekt, sondern immer gleichzeitig auch der psycho-soziale Aspekt von Armut steht im Blickpunkt. Damit beschränkt sich Soziale Arbeit nicht mehr nur auf bestimmte Gruppen, Schichten und Einkommensverhältnisse, sondern auf alle Menschen. Diese Entwicklung wurde eingeleitet mit der Übernahme der materiellen Lebensversicherung durch sozialpolitische Maßnahmen und Institutionen. Dadurch nehmen Notstände und Lernprobleme im Ganzen keineswegs ab, sondern sie verlagern sich von materiellen auf psycho-soziale Notstände bzw. Problemlagen und Bedürfnisse.
psycho-soziale Armut
Man kann sagen, dass die relative Bedeutung wirtschaftlicher Notstände – stellt man einen genügend langen Zeitraum in Rechnung – tendenziell abgenommen, während die Bedeutung psycho-sozialer Probleme zugenommen hat. Die Suche nach einem akzeptierten und subjektiv zufriedenstellenden Lebensstil und einer Lebensqualität wird zu einem zunehmend relevanten Problem. Es geht um die grundlegende Frage, ob unsere postmodernen Gesellschaften einem Wertwandel oder Werteverlust unterliegen. Dieser Perspektivwandel zur psycho-sozialen Lebenshilfe übersieht nicht, dass es in Deutschland eine ‚neue Armut‘ gibt, dass etwa ein Drittel der Bevölkerung mit wachsender Tendenz v. a. auch bei Kindern/Jugendlichen, alten Menschen und Langzeitarbeitslosen als (materiell) arm zu bezeichnen ist.
Wenn man von Armut spricht, etwa in Bezug auf Familien, muss zwischen verschiedenen Aspekten unterschieden werden: liegt relative oder absolute Armut vor? Handelt es sich um Familien in einer armutsnahen Lebenssituation bzw. so genannte Familien in prekären Lebenslagen?
Armutsgefährdung
„Der aktuellen statistischen Bemessung von Armut liegt europaweit ein Verständnis von relativer Armut zugrunde, d. h. Armut wird definiert in Bezug zum Wohlstand der jeweiligen Gesellschaft. Der zentrale Begriff ist hier die Armutsgefährdungsquote: In Deutschland belief sich der Schwellenwert für Armutsgefährdung im Jahr 2009 für eine alleinlebende Person auf 11.278 Euro im Jahr, was einer Quote von etwa 15,6 % der Gesamtbevölkerung entspricht.“ (Uhlendorff et al. 2013, 75)
Die Armutsgefährdungs- bzw. Armutsrisikoquote liegt in Deutschland seit 2005 etwa auf dem gleichen Niveau, stagniert also trotz einer guten wirtschaftlichen Entwicklung in den letzten Jahren. Im Jahr 2015 lag sie bei 15,4 % der Bevölkerung, wobei allerdings relativ große regionale Unterschiede bestehen. Die Armutsrisikoquote ist in erster Linie ein Maß der Einkommensungleichheit. Sie misst den Anteil der Personen, deren bedarfsgewichtetes Nettoeinkommen weniger als 60 % des mittleren Äquivalenzeinkommens beträgt. Dabei bleiben die Wirkungen von Sach- und Dienstleistungen unbeachtet, und zwar auch dann, wenn sie das Leben betroffener Personen nachhaltig verbessern (Bundesministerium für Arbeit und Soziales 2017, VI–VII).
prekäre Lebenslage
„Der Begriff prekäre Lebenslage ist weiter gefasst und geht über die Beschreibung einer aktuellen ökonomischen Notlage einer Familie hinaus. Im Vergleich zur Gesamtbevölkerung sind auch hier die Teilhabechancen der Familien in prekären Lebenslagen eingeschränkt, obwohl Familien über ein Einkommen verfügen. In diesem Zusammenhang wird auch von Einkommensarmut gesprochen. Zu dieser Gruppe zählt auch die in Europa wachsende Zahl der sogenannten Niedriglohnbeschäftigten, die trotz Vollzeittätigkeit kaum in der Lage sind, für sich und ihre Familien ein Einkommen zu erzielen, das ein Leben oberhalb der Armutsgefährdungsquote ermöglicht (AWO 2010). Neben den Niedriglohnbeschäftigten sind v. a. Ein-Eltern-Haushalte, Familien mit drei oder mehr Kindern sowie Familien mit Migrationshintergrund betroffen.“ (Uhlendorff et al. 2013, 76)
„Soziale Ungleichheit verkörpert sich zwar nicht mehr so kollektiv wie früher in Gruppen und Milieus. Sie scheint in der Struktur abgewandelt zu sein. Soziale Benachteiligung äußert sich heute weniger als kollektive soziale Deklassierung, sondern eher als soziale Nichtberücksichtigung von Gruppen im gesellschaftlichen Entwicklungsprozeß. Nichts anderes bedeutet die Formel von der Zweidrittelgesellschaft: Auf zwei Drittel der Gesellschaft richtet sich die Politik von Wachstum und Prosperität, das andere Drittel ist an dieser Entwicklung nicht beteiligt, wenn auch leidlich sozial versorgt. Zum modernen Sozialstaat ist also soziale Benachteiligung weniger über die traditionellen Muster sozialer Deklassierung und Randgruppenexistenz begreifbar, sondern eher über das Bild des Ausgeschlossenseins von der gesellschaftlichen Entwicklungsperspektive. Dazu kommt, daß die moderne Konsumgesellschaft Armut verschleiert. Auch die Armen können bei uns konsumieren, auch wenn es nur Billigware ist. Die Konsumgesellschaft suggeriert ökonomische und soziale Teilhabe. Die Menschen tun das ihre dazu, um ihre Armut und soziale Benachteiligung zu verbergen, sie fürchten noch mehr soziale Isolierung, haben Angst, den Anschluß endgültig zu verpassen, wollen zeigen, daß sie dabei sind. Und dies läuft wiederum über demonstratives Konsumverhalten.“ (Böhnisch 1992b, 121)
1.7.2 Soziale Hilfe
2. Praxis-Situation: Privates Problem – Soziales Problem
Familie Müller, ein Ehepaar mit zwei kleinen Kindern, hat, was wohl ganz normal ist, hin und wieder Kommunikationsprobleme, Erziehungsprobleme oder auch Eheprobleme. Welche Familie hat das nicht? Aber wann werden diese privaten Probleme zu sozialen Problemen? Zeigen Sie das am Beispiel der Familie Müller auf.
Will man die gegenwärtige Strukturierung des sozialen Systems in Deutschland verstehen, geht man von Artikel 20 des Grundgesetzes aus: „Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat.“ Bei der Strukturierung des Sozialwesens wird davon ausgegangen, dass jeder erwachsene Staatsbürger, jede Staatsbürgerin die Möglichkeit hat und darauf verwiesen ist, den Lebensunterhalt für sich und die Familie durch abhängige oder selbständige Arbeit zu verdienen. Bei Ausnahmen von dieser Regel besteht der Anspruch auf entsprechende Sozialleistungen einschließlich sozialer und erzieherischer Hilfen, wie es in § 1 des Allgemeinen Teils des Sozialgesetzbuches (SGB) heißt.
Die Grundsicherung für Arbeitssuchende umfasst nach § 1 Abs. 3 SGB II Leistungen
1. zur Beendigung oder Verringerung der Hilfebedürftigkeit, insbesondere durch Eingliederung in Arbeit, und
2. zur Sicherung des Lebensunterhaltes.
Die Sozialhilfe in der Bundesrepublik Deutschland umfasst nach § 8 SGB XII folgende Hilfen:
1. Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII),
2. Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII),
3. Hilfen zur Gesundheit (§§ 47 bis 52 SGB XII),
4. Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (§§ 53 bis 60 SGB XII),
5. Hilfe zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII),
6. Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SGB XII),
7. Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70 bis 74 SGB XII)
sowie die jeweils gebotene Beratung und Unterstützung.
Hilfe, zentrales Strukturmerkmal
Es besteht weitgehend Konsens darüber, dass es in der Sozialen Arbeit im Wesentlichen um Hilfe(leistungen) geht. Hilfe ist das zentrale Strukturmerkmal der Profession Soziale Arbeit. Dabei muss man allerdings feststellen, dass sich der Hilfebegriff bei sich verändernden gesellschaftlichen Strukturen ebenfalls verändert hat. Er ist durch historische Entwicklungen zu einem komplexen Begriff geworden. Im Folgenden soll dieser komplexe Begriff ‚Hilfe‘ einer detaillierteren Betrachtung unterzogen werden.
Unter Hilfe versteht man ein öffentliches soziales Handeln, als Sorge für diejenigen Menschen in einer Gesellschaft, die während bestimmter Lebensphasen und/oder in bestimmten individuellen und sozialen Lebenslagen ihre Angelegenheiten nicht selbst und auch nicht mit Unterstützung der Menschen ihres unmittelbaren Lebensumfeldes regeln können. Die Beantwortung der Fragen
■ Wem wird geholfen? (Auswahl derjenigen, die Hilfe bekommen sollen)
■ Wann wird geholfen? (Anerkennung bestimmter Bedürfnisse)
■ Warum wird geholfen? (Motive der Hilfeleistung)
■ Wie wird geholfen? (Art und Weise des jeweiligen Vorgehens)
wird beeinflusst durch das in einer Gesellschaft geltende Menschenbild und der Vorstellung vom menschlichen Zusammenleben bzw. dem gesellschaftlichen Wertesystem. Um soziale Hilfe gewährleisten zu können, kann man aus geschichtlicher Sichtweise drei Formen unterscheiden:
■ Privat-lebensweltliche Form der Hilfe: Diese Form nimmt tendenziell immer mehr ab. Man kann davon ausgehen, dass privat geleistete, „barmherzige Liebesdienste“ endgültig zu verabschieden sind.
■ Sozialpolitik: Sie wird bestimmt durch Geldleistungen unter sozialrechtlichen Vorgaben und Begrenzungen.
■ Personenbezogene soziale Dienste: Soziale Arbeit und öffentliche Erziehung sind notwendig gewordene Institutionen, die Hilfeleistungen der privat-lebensweltlichen Form immer mehr übernehmen (Rauschenbach/Gängler 1992, 46).
Der Begriff soziale, d. h. öffentliche Hilfe ist heute vielfach vorbelastet (Schefold 2002, 875–881), z. B. dadurch, dass es für Menschen in manchen Fällen offenbar peinlich ist, Hilfsangebote anzunehmen. Man signalisiert durch das Ersuchen von Hilfe, dass man in einem bestimmten Bereich versagt hat, Probleme nicht selbständig bewältigen kann.
soziale Hilfe
Wer soziale Hilfe annimmt, muss über seine Probleme sprechen, sich und seine Lebenslage offen darlegen, möglichst nichts verschweigen. Alles wird sehr genau notiert und zu den Akten gelegt. Man wird zu einem Fall. Gegen solche Voraussetzungen des Hilfsangebotes wehrt man sich. Man versucht auch so zurechtzukommen. Über private Probleme möchte man nicht sprechen.
Ein weiterer Makel von Hilfe besteht darin, dass häufig diejenigen, die Hilfe benötigen, als „a-normal“ bezeichnet werden, weil sie nicht in der Lage zu sein scheinen, ihr Leben selbständig zu planen und zu gestalten. Dabei übersieht man, dass jeder Mensch viel Hilfe braucht und auch ständig in Anspruch nimmt, z. B. die Hilfe des Arztes, der Krankenkasse, Autowerkstatt, Versicherung, des Rechtsanwaltes, eines Verkäufers, des Polizisten, Pfarrers usw. Hilfe in Anspruch zu nehmen, ist normal. Wir brauchen in unserem ganzen Leben ständig Hilfe. Jeder Mensch ist bezüglich der Entwicklung seiner Persönlichkeit auf die Hilfe Anderer angewiesen.
Aus diesem Grunde sollte man den Begriff „soziale Hilfe“ differenzieren:
1. primäre Hilfe: Eigentliche Inanspruchnahme von Hilfeleistungen. Sie dient der ganzheitlichen Entfaltung der Persönlichkeit.
2. sekundäre Hilfe: Ersuchen von Hilfeleistungen im Vorfeld eines Problems. Beim Lösen und Bewältigen von Problemen bedarf es kompetenter Beratung, Hilfe und Unterstützung.
3. tertiäre Hilfe: Ersuchen von Hilfeleistungen im Nachhinein. Probleme eskalieren, entwickeln eine Eigendynamik, schaffen Situationen, die man ohne fremde Hilfe nicht mehr lösen kann.
Vielfach versteht man Hilfe Sozialer Arbeit immer noch als tertiäre Hilfe, d. h. als Maßnahmen, die dann zum Zuge kommen, wenn bereits Probleme bestehen. Dieses Verständnis hat sich jedoch inzwischen insofern geändert, als Soziale Arbeit primär im präventiven Bereich angesiedelt ist, d. h. primäre und sekundäre Hilfe leistet. Soziale Hilfe im Sinne von Orientierungshilfe braucht nicht nur derjenige, der von der Norm abweicht, sondern jeder, der Werte und Normen erfüllen will.
Abbildung 5: Hilfe-Modell
Man kann die Hilfesysteme in vier Grundtypen zusammenfassen (Abbildung 5): Anleitung, Beratung, Begleitung und quasi therapeutische oder Therapie vorbereitende Funktionen. Der Wunsch der Hilfesuchenden zielt auf die Zunahme von Bewältigungsstrategien und auch auf entsprechende Entscheidungskriterien für den adäquateren Umgang mit Problemlagen. Die zweite Achse zielt auf die Potentiale der helfenden Profession ab. Die unterstützenden sozialen Fachkräfte stellen Strukturen und den Aufbau von Vertrauensbeziehungen zur Verfügung (Konvergenz). Divergenz meint hingegen, dass die sozialen Fachkräfte ihre Strukturen analog bzw. gleichsam als Katalysatoren einsetzen. Dadurch werden bei den Hilfesuchenden eigene Prozesse anregt, um die Entstehung von Abhängigkeiten zu vermeiden (Ludewig 1992, 122–124).
1.8 Zusammenfassung
Erwachsenen-Fürsorge hat im Laufe der Geschichte viele Namen gehabt: bis 1900 Armenpflege oder Armenfürsorge, 1900–1918 Soziale Fürsorge, nach 1918 Wohlfahrtspflege, nach 1945 Fürsorge, seit 1960 Sozialarbeit, etwa seit den 1990er Jahren Soziale Arbeit. Es ging dabei um die materielle Hilfe für Erwachsene. Im nächsten Kapitel soll es um die Jugendfürsorge, die Geschichte der Sozialpädagogik gehen.
Sozialarbeit und Sozialpädagogik hatten im Mittelalter und zu Beginn der frühen Neuzeit noch die gleichen geschichtlichen Wurzeln. Denn im Mittelalter unterschied man noch nicht zwischen Hilfe für Erwachsene und Kinder bzw. Jugendliche. Seit der frühen Neuzeit konzentrierte man sich jedoch zunehmend gesondert auf Kinder und Jugendliche und versuchte sie vorbeugend vor Verwahrlosung zu schützen.
Diese beiden Linien, Erwachsenen- und Jugend-Fürsorge, haben sich eine Zeit lang auseinander entwickelt. Jeweils eigene Hilfe-Modelle wurden entworfen. Nach dem Zweiten Weltkrieg haben sie sich dann zunächst allmählich, mittlerweile jedoch wieder soweit aufeinanderzubewegt (sie konvergieren), dass man zwar immer noch vielfach von Sozialarbeit/Sozialpädagogik, aber zunehmend nur noch von Sozialer Arbeit spricht, in der beide historische Entwicklungslinien zusammengeflossen sind (Abbildung 6). Wie diese Entwicklung verlaufen ist, werden die weiteren Kapitel näher beleuchten.
Abbildung 6: Hilfeleistungen
Lösungsvorschlag zur 1. Praxis-Situation: Problem – Hilfe
Vielleicht kann man Frau Stark folgendermaßen helfen:
Zuerst könnte man ihr bestätigen, dass sie stolz auf sich sein kann. Wie gut sie ihre Familie organisiert hat und dass sie zu Recht unabhängig bleiben möchte. Als zweites könnte man ihr aufzeigen, dass sie nicht versagt hat. Hilfe in Anspruch zu nehmen, ist kein Eingeständnis, dass man die anstehenden Aufgaben nicht auch alleine meistern kann. Hilfe in Anspruch zu nehmen, ist keine Schande und kein Zeichen von Schwäche oder Versagen. Nach Hilfe zu bitten, gehört zu unserem Alltag, begleitet uns ständig. Ich bitte die Schuhverkäuferin oder den Versicherungsfachmann um Rat, frage in einer fremden Stadt einen Passanten nach einer Straße, suche im Internet nach Informationen über ein Medikament oder ein Krankheitsbild. Umso komplizierter unsere Gesellschaft wird, desto mehr benötige ich Informationen, d. h. Hilfe. Alle diese Beispiele sollen aufzeigen: Hilfe ist eine Urkategorie, sie gehört zum menschlichen Leben.
Drittens könnte man bei Frau Stark nachfragen, ob sie sich aus eigener Erfahrung oder nur vom Hörensagen ein Bild vom Jobcenter gemacht hat. Frau Stark sollte vermittelt werden, dass es am besten ist, wenn sie sich ein eigenes Urteil über das Jobcenter bildet. Vielleicht sind die MitarbeiterInnen des Jobcenters ja doch sehr kompetent, können zuhören und sind ehrlich bemüht, Hilfe anzubieten. Absagen könnte Frau Stark dann ja immer noch. Ihr kann deutlich gemacht werden, dass sie über ihr Leben selbstverständlich selbst entscheidet.
Diese aufgeführten Überlegungen helfen Frau Stark vielleicht. Eventuell haben Sie aber auch völlig andere Gedanken und würden das Gespräch ganz anders gestalten. Ein Richtig oder Falsch gibt es in der Beratung nicht. Wichtig ist, Frau Stark zu helfen, die Entscheidung zu finden und zu treffen, die für sie die nützlichste ist und die ihr Selbstbewusstsein stärkt.
Lösungsvorschlag zur 2. Praxis-Situation: Privates Problem – Soziales Problem
Solange Familie Müller ihre Probleme selbst zu lösen versucht, oder ihr Familienangehörige, Verwandte, FreundInnen oder NachbarInnen dabei helfen, bleiben es zunächst private Probleme. Ein soziales Problem liegt erst dann vor, wenn die Situation eine Form annimmt, die öffentlich bzw. gesellschaftlich als veränderungsbedürftig angesehen wird und hierfür entsprechende Hilfeangebote eingerichtet werden. Dies könnte z. B. bei Erziehungsproblemen der Fall sein, die Gewalt in der Familie nach sich ziehen. In diesem Fall könnte Familie Müller öffentliche Hilfe in Anspruch nehmen, z. B. zum Jugendamt gehen oder eine Beratungseinrichtung aufsuchen, um sich professionell helfen zu lassen. Wie die Hilfe bei sozialen Problemen konkret gestaltet wird, kommt darauf an, ob es sich um Hilfe im primären, sekundären oder tertiären Bereich handelt.
Hering, S., Münchmeier, R. (2014): Geschichte der Sozialen Arbeit. Eine Einführung. 5., überarb. Aufl. Beltz Juventa, Weinheim
Müller, C. W. (2013): Wie Helfen zum Beruf wurde. Eine Methodengeschichte der Sozialen Arbeit. 6. Aufl. Beltz Juventa, Weinheim
Niemeyer, C. (2010): Klassiker der Sozialpädagogik. 3., aktual. Aufl. Beltz Juventa, Weinheim
Zeller, S. (2006): Juan Luis Vives (1492–1540). (Wieder)Entdeckung eines Europäers, Humanisten und Sozialreformers jüdischer Herkunft im Schatten der spanischen Inquisition. Lambertus, Freiburg
1. Warum sollten sich SozialarbeiterInnen/SozialpädagogInnen mit der Geschichte ihres Berufsbildes beschäftigen?
2. Was besagt die Kernaussage: Hilfe ist eine Urkategorie des menschlichen Handelns?
3. Was war der Grund für die Entstehung der öffentlichen Fürsorge?
4. Wodurch unterscheidet sich die Erwachsenen-Fürsorge von der Jugend-Fürsorge?
5. Welche Einstellung hatten die Menschen im Mittelalter zum Betteln?
6. Wie bewertet Martin Luther das Betteln?
7. Welche zentralen Aussagen enthält das Modell der Armenpflege von Juan Luis Vives?
8. Worum ging es den Nürnberger Bettel- und Armenordnungen?
9. Worin unterscheidet sich das Straßburger System vom Elberfelder System?
10. Was beinhalten die Bismarckschen Sozialgesetze?
11. Welche Veränderung erfuhr die Fürsorge im Ersten Weltkrieg?
12. Wie wurde in der Weimarer Republik die Fürsorge/Wohlfahrtspflege geregelt?
13. Worum ging es Alice Salomon in ihrem theoretischen Modell?
14. Worin bestand im Nationalsozialismus der „Paradigmenwechsel“ der Wohlfahrtspflege?
15. Wie wird Armut definiert?
16. Was versteht man unter Armutsgefährdungsquote?
17. Durch welche gesetzlichen Grundlagen versuchte man nach dem zweiten Weltkrieg, die Probleme der Armut in den Griff zu bekommen?
18. Inwiefern hat sich der Begriff „Armut“ verändert?
19. Inwiefern hat sich der Begriff „Hilfe“ verändert?
20. Was versteht man unter primärer, sekundärer und tertiärer Hilfe?