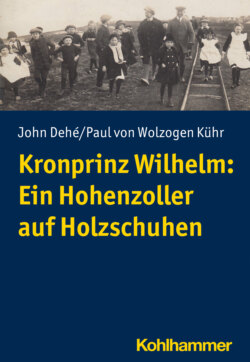Читать книгу Kronprinz Wilhelm: Ein Hohenzoller auf Holzschuhen - John Dehé - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление
Vorwort
Paul Moeyes
Es war eine besondere Woche, diese zweite Novemberwoche 1918. Mehr als vier Jahre lang hatten die Niederlande es geschafft, sich aus dem Ersten Weltkrieg herauszuhalten – aber in der zweiten Novemberwoche schien alles schief zu gehen. Der Revolutionsgeist erfasste das ganze Land. Der sozialistische Führer Pieter Jelles Troelstra erklärte, die russische Arbeiterrevolution sei nun von Deutschland auf die Niederlande übergesprungen, und forderte die Regierung auf, ihm die Macht zu übertragen, um Blutvergießen zu vermeiden. Inmitten dieser innerstaatlichen Unruhen traten – im wahrsten Sinne des Wortes – auch zwei ausländische ›Problemfälle‹ auf. Am frühen Morgen des 10. November floh der deutsche Kaiser Wilhelm II. über die niederländische Grenze. Deutschland war im Begriff, den Krieg zu verlieren, und der ehemalige Oberste Kriegsherr suchte vor dem Hintergrund der Novemberrevolution und immer lauter erhobenen Forderungen nach seiner Abdankung nach einem sicheren Hafen in den neutralen Niederlanden. Am folgenden Tag beendete der Waffenstillstand den Ersten Weltkrieg. Einen weiteren Tag später, am Dienstagmorgen, dem 12. November, kam auch Kronprinz Wilhelm, der Sohn des Kaisers, in die Niederlande. »Er sah fröhlich und glücklich aus wie ein Ertrinkender, der gerade aus dem Wasser gerettet wurde«,1 berichtete der Tilburgsche Courant.
Die niederländische Regierung hingegen war über die Ankunft von Vater und Sohn Hohenzollern alles andere als erfreut. Der Kaiser und Kronprinz waren seit vier Jahren das Ziel alliierter Propaganda und wurden als Kriegsverbrecher und skrupellose Mörder gebrandmarkt. Die Niederlande würden sich international nicht beliebt machen, wenn sie diesen »Volksfeinden« Unterschlupf gewähren würden. Nach sorgfältiger Prüfung entschied man jedoch, dass die Niederlande nicht von der völkerrechtlichen Position abweichen dürften, die sie in den Kriegsjahren eingenommen hatten: Kriegsflüchtlinge wurden ohne Rücksicht auf die Person aufgenommen.
Die internationale Presse widmete dem Thema große Aufmerksamkeit. Die wildesten Gerüchte kursierten. In Frankreich wurde behauptet, der Kaiser würde genau wie einst Napoleon auf die Insel St. Helena verbannt. Die Franzosen fühlten sich in ihrer nationalen Ehre zutiefst gekränkt: »Das wollen wir nicht. Wir haben diese Schande nicht verdient; der gefallene Kaiser hat kein Recht, mit dem anderen, unserem, verglichen zu werden«,2 schrieb eine empörte französische Zeitung. Die niederländische Regierung entschied, dass der Ex-Kaiser und sein Sohn so bald wie möglich aus der Öffentlichkeit verschwinden sollten, auf dass sich das internationale Interesse schnell lege. Am 11. November wurde Wilhelm II. in das abgelegene Schloss Amerongen geschickt. Anfangs sollte er nur drei Tage als Gast des Grafen Bentinck und seiner Familie bleiben; am Ende waren es anderthalb Jahre, die er dort verbrachte.
Kronprinz Wilhelm war auf seiner »eigenen St. Helena« untergebracht: der Insel Wieringen. Eine andere Welt würde sich für den 36-jährigen Prinzen öffnen, der sein Leben in Luxus und Wohlstand verbracht hatte: »Wenn es die Absicht gewesen war, für den Wohnsitz des ehemaligen Kronprinzen einen völlig trostlosen, vom Rest der Welt abgeschiedenen Ort zu wählen, dann hat man mit der Insel Wieringen sicherlich eine gute Wahl getroffen«, berichtete der Nieuwe Tilburgsche Courant mit offensichtlicher Zustimmung.3 Es war sicherlich Absicht, dass die niederländische Regierung dem Kronprinzen keinen luxuriösen Wohnsitz zuwies. Die kritische in- und ausländische Presse sollte mit eigenen Augen sehen, dass der Prinz sein Exil statt im Luxus in den bescheidenen Verhältnissen der Insel Wieringen verbringen musste. Tatsächlich war das Pfarrhaus – auf Niederländisch Pastorie genannt –, in dem er untergebracht war, so dürftig eingerichtet, dass Wilhelm erst ein gewöhnliches Bad nehmen konnte, nachdem er eine Badewanne vom Festland hatte bringen lassen. Die Badewanne ist in einem Cartoon des niederländischen Künstlers Johan Braakensiek vom November 1918 zu sehen ( Abb. 28).
Dieses Buch erzählt die Geschichte des kulturellen Konflikts zwischen dem dekadenten deutschen Kronprinzen und den einfachen Fischern. Es zeichnet ein Bild der Lebensumstände, der Ausbildung und der Charakterbildung eines jungen Mannes, der glaubte, er sei dazu bestimmt, Kaiser von Deutschland zu werden. Es beschreibt seine Aktivitäten und Erfahrungen während des Ersten Weltkriegs und die Aufzeichnungen, die er davon in seinen Erinnerungen gemacht hat. Vor allem aber zeichnet es ein eindrucksvolles Bild von seinem Exil auf Wieringen: wie er sich bemühte, sich bei der Bevölkerung beliebt zu machen, und wie ihm dieses Vorhaben zumindest teilweise gelungen ist. Teilweise, denn Wilhelm pflegte einen recht extravaganten Lebensstil, der von Zeit zu Zeit direkt mit niederländischen Normen und Werten kollidierte und sogar in Den Haag Emotionen weckte: »Das ist ein feiner Herr! Er lässt sogar Frauen nach Wieringen kommen. Im deutschen Hauptquartier muss es bei ihm immer ein Schweinestall gewesen sein«,4 schrieb der katholische Arbeitsminister P. J. M. Aalberse – zweifellos kopfschüttelnd – im Dezember 1918 in sein Tagebuch. Und dann gab es noch Wilhelms politische Ambitionen, die stark darauf hindeuten, dass er Wieringen eher als sein Elba als sein St. Helena betrachtete. Was aus diesen Ambitionen wurde, wird in den letzten Kapiteln erzählt.
Kronprinz Wilhelm: Ein Hohenzoller auf Holzschuhen ist eine petite histoire eines vielleicht nicht sehr beeindruckenden Mannes in einer vielleicht nicht sehr ansprechenden Umgebung. Aber die Kombination des Kronprinzen und der Insel liefert eine schöne Geschichte, die nicht nur in diesem Buch erzählt, sondern auch farbenfroh illustriert wird. Und es spielt keine Rolle, dass Wilhelm kein dominanter Monarch, großer General oder begabter Staatsmann war. Wie die Autoren treffend sagen, er war »umstritten, und deshalb faszinierend«.