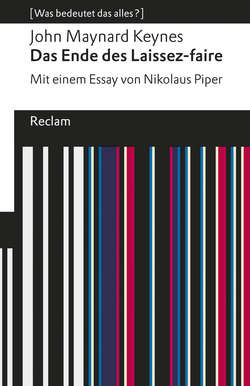Читать книгу Das Ende des Laissez-faire. Mit einem Essay von Nikolaus Piper. - John Maynard Keynes - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
I
ОглавлениеDie Einstellung zu öffentlichen Angelegenheiten, die wir üblicherweise unter den Begriffen »Individualismus« und »Laissez-faire« zusammenfassen, speist sich aus vielen verschiedenen Denkströmungen und Gefühlsquellen. Mehr als hundert Jahre lang wurden wir von unseren Philosophen beherrscht, weil sie wie durch ein Wunder fast alle in diesem einen Punkt übereinstimmten oder doch übereinzustimmen schienen. Wir tanzen zwar noch nicht zu einer neuen Melodie. Doch es liegt Veränderung in der Luft. Was einst die deutlichsten und am klarsten erkennbaren Stimmen waren, die seit jeher die politisch denkende Menschheit belehrten, vernehmen wir nur noch undeutlich. Jene aus verschiedensten Instrumenten erklingende Musik, jener Übereinklang der vernehmbaren Stimmen, klingt allmählich ab.
Am Ende des 17. Jahrhunderts wich das Gottesgnadentum der Monarchen der natürlichen Freiheit und dem Gesellschaftsvertrag sowie das göttliche Recht der Kirche dem Prinzip der Toleranz und der Meinung, dass eine Kirche »eine auf Freiwilligkeit beruhende Gesellschaft von Menschen« ist, die »sich nach eigener Vereinbarung zusammentun«.1 50 Jahre später wich der göttliche Ursprung und die absolute Stimme der Pflicht dem Nutzenkalkül. In den Händen von Locke1 und Hume2 begründeten diese Lehren den Individualismus. Diese Übereinkunft setzte beim Einzelnen Rechte voraus; die neue Ethik, die nichts weiter als die wissenschaftliche Erforschung der Folgen der rationalen Eigenliebe war, stellte den Einzelnen in den Mittelpunkt. »Die einzige Mühe, die sie [die Tugend] verlangt«, sagte Hume, »ist die einer genauen Abwägung und einer beständigen Bevorzugung des größeren Glücks.«2 Diese Ideen stimmten mit den praktischen Vorstellungen von Konservativen und Juristen überein. Sie lieferten eine zufriedenstellende geistige Grundlage für die Eigentumsrechte und die Freiheit des mit Besitz ausgestatteten Individuums, mit sich selbst und seinem Eigentum zu tun, was ihm beliebte. Darin lag einer der Beiträge des 18. Jahrhunderts zu der Luft, die wir noch immer atmen.
Die Absicht dahinter, das Individuum stark zu machen, zielte darauf, den Monarchen und die Kirche zu entthronen; das Ergebnis war – dank der ethischen Bedeutung, die nunmehr Verträgen zugewiesen wurde – eine Stärkung von Eigentum und Gesetz. Doch dauerte es nicht lange, bis die Gesellschaft erneut Forderungen an den Einzelnen erhob. Paley3 und Bentham4 nahmen den utilitaristischen Hedonismus3 zwar aus den Händen von Hume und seinen Vorgängern an, erweiterten ihn jedoch zum gesellschaftlichen Nutzen. Rousseau übernahm den Gesellschaftsvertrag von Locke und entlockte ihm den Gemeinwillen. In beiden Fällen vollzog sich der Übergang durch die erneute Betonung von Gleichheit. »Locke setzt seinen Gesellschaftsvertrag ein, um die natürliche Gleichheit des Menschen zu modifizieren, insofern dieser Begriff die Gleichheit des Eigentums oder gar von Privilegien im Hinblick auf die allgemeine Sicherheit impliziert. Für Rousseau5 ist die Gleichheit nicht nur der Ausgangspunkt, sondern auch das Ziel.«4
Paley und Bentham gelangten zu demselben Ziel, doch auf unterschiedlichen Wegen. Paley vermied eine egoistische Schlussfolgerung seines Hedonismus durch einen Deus ex machina6. »Tugend«, sagt er, »besteht darin, der Menschheit Gutes zu tun nach dem Willen Gottes und um der ewigen Glückseligkeit willen« – und stellte auf diese Weise zwischen dem Ich und den Anderen erneut Parität her. Bentham erreichte dasselbe Ergebnis vermittels reiner Vernunft. Es gibt keinen vernünftigen Grund, so Bentham, das Glück eines Einzelnen, und wäre man es auch selbst, dem eines anderen vorzuziehen. Daher ist das größte Glück der größten Zahl das einzige vernünftige Ziel des Handelns – wobei er zwar den Begriff des Nutzens von Hume übernahm, die zynische Schlussfolgerung dieses weisen Manns jedoch vergaß: »Es läuft der Vernunft nicht zuwider, wenn ich lieber die Zerstörung der ganzen Welt will, als einen Ritz an meinem Finger. Es widerspricht nicht der Vernunft, wenn ich meinen vollständigen Ruin auf mich nehme, um das kleinste Unbehagen eines Indianers oder einer mir gänzlich unbekannten Person zu verhindern. […] Die Vernunft ist nur der Sklave der Affekte und soll es sein; sie darf niemals eine andere Funktion beanspruchen, als die, denselben zu dienen und zu gehorchen.«7
Rousseau leitete Gleichheit aus dem Naturzustand ab, Paley aus dem Willen Gottes, Bentham aus einem mathematischen Indifferenzprinzip. So zogen Gleichheit und Altruismus in die politische Philosophie ein, und aus dem Zusammenfluss von Rousseau und Bentham speisten sich Demokratie wie utilitaristischer Sozialismus.«
Das ist die zweite Strömung – hervorquellend aus längst verendeten Kontroversen und in längst verebbten Haarspaltereien ausmündend –, die bis auf den heutigen Tag die Atmosphäre unseres Denkens durchdringt. Doch hat sie die vorherige Strömung nicht ausgetrieben, sondern sich mit ihr vermischt. Dem frühen 19. Jahrhundert gelang diese wundersame Vereinigung. Es brachte den konservativen Individualismus von Locke, Hume, Johnson8 und Burke9 mit dem Sozialismus und demokratischen Egalitarismus von Rousseau, Paley, Bentham und Godwin10 in Einklang.5
Dennoch wäre es diesem Zeitalter schwergefallen, jenen Einklang von Gegensätzen zu erreichen, wenn nicht die Ökonomen gewesen wären, die gerade im rechten Augenblick auf die Bühne traten. Die Vorstellung einer göttlichen Harmonie zwischen privatem Vorteil und dem öffentlichen Wohl ist bereits bei Paley zu erkennen. Doch waren es die Ökonomen, die dieser Vorstellung eine solide wissenschaftliche Grundlage gaben. Stelle man sich einmal vor, dass durch die Wirkung von Naturgesetzen jene Einzelnen, die aufgeklärt ihre eigenen Interessen unter Freiheitsbedingungen verfolgen, immer dazu tendieren, gleichzeitig das allgemeine Interesse zu befördern! Unsere philosophischen Schwierigkeiten wären gelöst – zumindest für den Mann der Praxis, der seine Bemühungen dann darauf konzentrieren könnte, die notwendigen Freiheitsbedingungen für sich zu sichern. Zur philosophischen Lehre, dass die Regierung kein Recht dazu hat, sich einzumischen, und zur göttlichen Lehre, dass eine Einmischung auch nicht notwendig ist, käme nun ein wissenschaftlicher Beweis hinzu, dass ihre Einmischung auch unzweckmäßig wäre. Das ist die dritte Denkströmung, die sich gerade erst bei Adam Smith11 entdecken lässt, der sich weithin bereitfand, das Gemeinwohl auf »die natürliche Bemühung jedes Einzelnen [zu gründen], seine eigene Lage zu verbessern«, welche aber erst zu Beginn des 19. Jahrhunderts vollständig und gezielt ausgebaut wird. Das Prinzip des Laissez-faire war dazu angetreten, den Individualismus mit dem Sozialismus in Einklang zu bringen und Humes Egoismus mit dem größten Wohl der größten Zahl zu vereinen. Der politische Philosoph konnte guten Gewissens den Stab an den Geschäftsmann abgeben, denn letzterer vermochte das summum bonum12 des Philosophen schlicht und einfach dadurch zu erreichen, dass er seinen eigenen privaten Profit verfolgte.
Doch es waren noch einige andere Zutaten nötig, um die Sache zum Laufen zu bringen. Zum einen die Korruption und Inkompetenz der Regierung des 18. Jahrhunderts, von denen viele Erblasten bis ins 19. Jahrhundert hinein blieben. Der Individualismus der politischen Philosophen wies in Richtung Laissez-faire. Die göttliche oder (je nachdem) wissenschaftliche Harmonie zwischen Privatinteresse und öffentlichem Vorteil wies auf das Laissez-faire hin. Doch vor allem die Unfähigkeit öffentlicher Verwaltungsbeamter nahm Männer der Praxis für das Laissez-faire ein – eine Grundstimmung, die sich seither keinesfalls in Luft aufgelöst hat. Fast alles, was der Staat im 18. Jahrhundert tat und was über seine minimalen Funktionen hinausging, war schädlich oder erfolglos oder schien es wenigstens.
Zum anderen ging der materielle Fortschritt zwischen 1750 und 1850 auf individuelle Initiative zurück und verdankte dem direkten Einfluss der gesellschaftlichen Institutionen so gut wie gar nichts. So bestärkte die praktische Erfahrung, was a priori13 gedacht wurde. Die Philosophen und Ökonomen sagten uns, dass aus unterschiedlichsten tiefen Gründen das uneingeschränkte private Unternehmertum das größte Wohl aller fördere. Und was könnte dem Geschäftsmann mehr entgegenkommen? Und konnte ein von der Praxis herblickender Zeitgenosse etwa leugnen, dass der Segen der jenes Zeitalter auszeichnenden Verbesserungen, in dem er lebte, auf die Tätigkeiten von Einzelnen zurückzuführen waren, die »etwas aus sich machen« wollten? Der Boden war also fruchtbar für eine Lehre, derzufolge staatliches Handeln, sei es nun aus göttlichen, natürlichen oder wissenschaftlichen Gründen, eng beschränkt werden und das Wirtschaftsleben so weit wie möglich unreguliert bleiben und dem Geschick und der praktischen Vernunft der einzelnen Bürger überlassen werden sollte, die durch das so überaus löbliche Motiv in Bewegung versetzt werden, es in der Welt zu etwas zu bringen.
Als der Einfluss von Paley und seinesgleichen nachzulassen begann, erschütterten die Neuerungen Darwins14 die Grundlagen des Glaubens. Nichts schien gegensätzlicher zu sein als die alte und die neue Lehre – die Lehre, die die Welt als das Werk eines göttlichen Uhrmachers15 betrachtete, und die Lehre, die augenscheinlich alles aus Zufall, Chaos und Äonen von Zeit entwickelte. Doch am folgenden Punkt unterstützten die neuen Ideen die alten. Die Ökonomen lehrten, dass Wohlstand, Handel und Maschinen Geschöpfe des freien Wettbewerbs waren: Der freie Wettbewerb brachte London hervor. Doch die Darwinisten konnten noch einen draufsetzen: Der freie Wettbewerb brachte den Menschen hervor. Das menschliche Auge galt nicht mehr als Beweis für eine Vorsehung, die wunderbarerweise alles zum Besten eingefädelt hatte, das Auge war vielmehr die höchste Errungenschaft des Zufalls, der unter Bedingungen freien Wettbewerbs und des Laissez-faire wirkte. Das Prinzip des Überlebens des Tüchtigsten konnte als weit ausgreifende Verallgemeinerung der Ökonomie Ricardos16 betrachtet werden. Im Lichte dieser umfassenderen Synthese erschienen dann sozialistische Eingriffe nicht nur unzweckmäßig, sondern auch geradezu gotteslästerlich, als wären sie nur darauf aus, die vorwärts gerichtete Bewegung des gewaltigen Prozesses zu verzögern, durch den wir wie dereinst Aphrodite aus dem Urschlamm des Ozeans entstiegen waren.17
Daher führe ich die merkwürdige Übereinstimmung der politischen Alltagsphilosophien des 19. Jahrhunderts auf den Erfolg zurück, mit dem sie verschiedenartige und einander bekriegende Schulen versöhnten und alle guten Dinge zu einem einzigen verschmolz. Hume und Paley, Burke und Rousseau, Godwin und Malthus18, Cobbett19 und Huskisson20, Bentham und Coleridge21, Darwin und der Bischof von Oxford22 hatten alle, wie sich herausstellte, praktisch dasselbe gepredigt – Individualismus und Laissez-faire. Das war die Kirche von England und jene waren ihre Apostel, wobei die Gemeinde der Ökonomen dafür zuständig war, zu beweisen, dass auch nur die geringste Abweichung von jenem Glauben unweigerlich finanziellen Ruin mit sich brachte.
Diese Gründe und diese Atmosphäre liefern die Erklärung dafür (unabhängig davon, ob wir uns darüber im Klaren sind oder nicht – und in unserem verkommenen Zeitalter sind die meisten von uns hier reichlich unwissend), warum wir derartig voreingenommen zugunsten des Laissez-faire sind und warum staatliches Handeln zur Regulierung des Geldwerts oder zur Entwicklung der Investitionen oder zur Bevölkerungsentwicklung in vielen aufrechten Herzen zu argem Verdacht bewegt. Wir haben jene Autoren nicht gelesen; wir würden ihre Argumente absurd finden, sollten sie uns zufällig in die Hände fallen. Trotzdem, meine ich, würden wir wohl nicht so denken, wie wir es eben tun, wenn Hobbes, Locke, Hume, Rousseau, Paley, Adam Smith, Bentham und Miss Martineau23 nicht so gedacht und geschrieben hätten, wie sie es taten. Das Studium der Ideengeschichte ist eine notwendige Vorstufe auf dem Weg zur Befreiung des Geistes. Ich weiß nicht, wodurch jemand konservativer wird: dadurch, dass er nichts außer der Gegenwart oder nichts außer der Vergangenheit kennt.