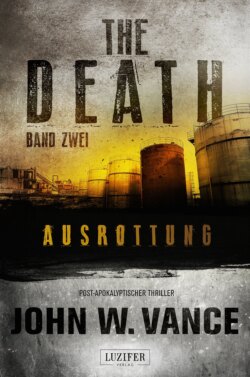Читать книгу AUSROTTUNG (The Death 2) - John W. Vance - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеTag 209
28. April 2021
North Topsail Beach, North Carolina
Rückblickend kam Tess die lange, grauenvolle Fahrt von Reed, Illinois aus wie der leichteste Teil ihrer beschwerlichen Heimreise vor. Sie stand jetzt schon seit zehn Minuten reglos in der Auffahrt ihres alten Hauses und ließ die Augen nicht von der verwitterten Fassade, deren blaue Farbe abblätterte. Dass es schon nach wenig mehr als sieben Monaten so verwahrlost aussah, fand sie seltsam. Vielleicht lag es am hohen Gras und dem Unkraut zusammen mit dem Müll und Schutt überall auf der Straße, dass ihr Heim plötzlich den Eindruck einer Bruchbude vermittelte. Eine Angst, die ungewöhnlich für sie war, nahm sie mittlerweile voll und ganz in Beschlag. Die Antwort auf alles, was sie sich im Laufe der vergangenen Monate gefragt hatte, wartete drinnen auf sie, doch war sie auch bereit, sie zu finden?
Brianna saß im Humvee. Sie starrte auf Tess’ Rücken, ohne den Blick abzuwenden. Sie wäre gerne ausgestiegen, um sich zu vergewissern, ob alles okay war, wusste jedoch insgeheim, warum sie sich nicht rühren konnte.
Tess’ Wunsch zum Trotz war Devin losgegangen, um die Straße und Umgebung des Hauses zu überprüfen, falls Gefahr drohte. Bei seiner Rückkehr traf er sie an genau der Stelle an, wo sie auch gestanden hatte, bevor er verschwunden war. Er ging auf sie zu, aber sie hob eine Hand, um ihm zu verstehen zu geben, er solle sich nicht weiter nähern.
Devin gehorchte sofort und schaute besorgt zu Brianna hinüber, die nur mit den Achseln zuckte. Er erwog kurz, Tess’ Anweisung einfach zu ignorieren, wusste aber, dass er ihren Zorn auf sich ziehen würde, falls er es tatsächlich tat. Stattdessen rief er laut: »Hinten ist die Luft rein. Hab niemanden gesehen, allerdings ist jemand eingebrochen. Hübsches Haus übrigens.«
»Tess, das reicht jetzt«, murmelte sie bei sich. »Geh rein und finde heraus, wo dein Mann steckt.«
Plötzlich fiel Brianna eine schnelle Bewegung auf. Im Haus auf der anderen Straßenseite wackelte ein Fensterladen, und wie es aussah, zog ein Schatten vorbei.
Ihr Wagen stand im rechten Winkel zu den Gebäuden mitten auf der Straße.
Sie lehnte sich über die Mittelkonsole, um durch das Türfenster auf das Haus zu schauen; nichts, keine Bewegung mehr, doch das bedeutete nicht, dass dort niemand war. Jetzt war sie ebenfalls beunruhigt und rief: »Devin, ich glaube, ich habe etwas im Haus gegenüber gesehen – Nummer 17!«
Daraufhin stürzte er mit seinem Gewehr im Anschlag zum Humvee und starrte nun ebenfalls gebannt auf die Häuserfront.
Als Tess das bemerkte, bewegte sie sich endlich. Sie drehte sich um und blickte auch zu dem Haus hinüber, das Brianna meinte. Nach kurzer Überlegung fiel ihr wieder ein, wer dort wohnte: Mr. Phil Banner aus New York und seine Frau, die den Winter gemeinsam im Süden des Landes verbracht hatten. Dass er überlebt und sich gegen all das Geschehene behauptet hatte, war nicht auszuschließen.
»Dort lebt Mr. Banner, er ist harmlos«, erklärte Tess.
Devin drehte seinen Kopf betont langsam zu ihr und erwiderte: »Harmlos? Niemand ist mehr harmlos.«
»Ich bin gleich zurück«, sagte sie und machte nun einen ersten Schritt auf ihr altes Zuhause zu.
Der Salzgeruch des Atlantiks stieg ihr in die Nase und weckte sofort schöne Erinnerungen an ihre gemeinsamen Tage mit Travis. Als sei es gestern gewesen, entsann sie sich des ersten Mals, als sie das Haus gesehen hatte. Sie war von Travis mit dem Kauf des Anwesens überrascht worden, weshalb er ihr sogar die Augen verbunden hatte, damit sie nicht erfuhr, wo es sich befand. Sie musste ein wenig schmunzeln, als sie an diesen besonderen Moment zurückdachte, in dem sie in Wirklichkeit sehr wohl gewusst hatte, wohin er sie bringen würde.
Wird ein Sinn plötzlich blockiert, schärfen sich automatisch die anderen. Sie hatte die Trägerbrücke, die auf die Insel führte, anhand des Fahrgeräuschs erkannt, und dass sie in Ozeannähe gewesen waren, hatten ihr die Möwen verraten. Deren Geräusche blieben nunmehr aus, doch die alte Überführung existierte noch. Als er damals in der Einfahrt geparkt hatte und aufgeregt ausgestiegen war, um die Beifahrertür zu öffnen, hatte ihr Gehör, aber auch ihre Nase darauf hingedeutet: Der intensive Salzgeruch war ihr entgegengeweht und das Rauschen der Brandung hatte es endgültig besiegelt. Bevor er mit ihr zur Tür gelangt war, hatte sie aufgeregt gerufen: »Topsail Beach; du hast uns ein Haus am Topsail Beach gekauft!«
Sie erreichte nun die Treppe und schaute die abgewetzten Holzstufen hinauf, die zum Eingang führten. Wie die meisten Wohnhäuser auf Topsail Island stand es hoch über der Erde auf Pfählen. Optisch war das zwar nie ihr Geschmack gewesen, doch sie hatte darüber hinweggesehen, weil sie dieses Fleckchen ihr eigen nennen durfte.
Nachdem sie die erste Stufe erreicht hatte, ließ sie noch einen Moment verstreichen. Sie blinzelte bemüht, schaute wieder nach oben und sagte leise zu sich selbst: »Tess, genug jetzt. Deine Freunde warten, also geh.« Dies war der letzte Ansporn, den sie benötigte. Sie wusste, sie zögerte dies alles hinaus, und je länger sie dies tat, desto angreifbarer waren sie. Mit neu entdeckter Zuversicht erklomm sie die Stufen und näherte sich dem Eingang. Das Fliegengitter war zerrissen, und die Tür dahinter stand weit auf. Jemand hatte ein großes X mit einer Null darüber darauf gemalt. Während Tess es anschaute, fragte sie sich, was es bedeuten mochte, verdrängte den Gedanken aber sofort wieder. Vielmehr interessierte sie, wie lange die Tür schon offenstand. Am Zustand des Wohnzimmers erkannte sie augenblicklich, dass die Räume schon seit Monaten frei zugänglich und den Elementen ausgesetzt gewesen waren.
Der Anblick ihrer von der Natur und Fremden zerstörten Wohnung machte sie nicht wütend, sondern lediglich traurig, weil der einzige Ort, der für sie stets Glück und Liebe symbolisiert hatte, nun hinfällig und unwiederbringlich verloren war. Ihr blieben zwar noch die Erinnerungen, doch dies bedeutete gleichzeitig, dass ihr altes Leben nun endgültig zu Ende war. Ihr verwüstetes Eigenheim verdeutlichte greifbar und anschaulich, was aus der Welt geworden war.
Nachdem sie die Glock 17 aus ihrem Schulterhalfter gezogen hatte, öffnete sie das Gitter. Durch die breiten Panoramafenster zum Strand und dem dahinterliegenden Meer hin fiel genügend Licht ein, um alles deutlich zu erkennen. Das Knirschen von Glassplittern bei ihren ersten Schritten im Haus drang an ihr Ohr, außerdem nahm sie einen unangenehmen und starken Modergeruch wahr. Sie ging noch ein Stück weiter und blieb dann stehen; zu vorsichtig konnte man heutzutage gar nicht sein. Auch wenn anscheinend monatelang niemand hier gewesen war, wusste sie nach etwas mehr als vier Wochen auf der Straße, dass man niemals ein Risiko eingehen durfte. Also achtete sie darauf, ruhig zu atmen und schritt langsam voran. Sie ging die Zimmer nacheinander ab, gelangte dabei jedoch nur zu der Erkenntnis, dass jemand alles aus dem Haus gestohlen hatte, was ihm irgendwie wertvoll vorgekommen war. Als sie das Ausmaß des Durcheinanders sah, befürchtete sie, dass sie Travis Nachricht nicht finden würde. Er hatte nichts weiter gesagt, als dass er sie an einem sicheren Platz hinterlegt hatte, doch wo war dieser genau? Einer, auf den sie spekuliert hatte, war der am Fußboden verschraubte Tresor, doch der stand nicht mehr dort und ein quadratisches Loch klaffte an seiner Stelle. Ihre Gedanken schlugen Purzelbäume, und sie hastete von einem mutmaßlichen Fleck zum anderen, doch jede Idee erwies sich als Trugschluss. Als ihr nichts mehr einfiel, sackte sie erschöpft und verärgert auf den Boden.
Während sie dasaß und die ringsum verstreuten Scherben dessen betrachtete, was einst ihr Leben gewesen war, grübelte sie verbissen darüber nach, wo er den Zettel hinterlassen haben konnte. Sie hatte die Fotoalben durchgeblättert, die Bibel und seine Lieblingsromane; sie hatte jede Schublade in jedem Zimmer durchsucht, doch da war nichts. Wo war er nur? Gab es überhaupt eine Nachricht?
Sie wusste nicht, wie lange sie schon auf dem Boden hockte, als ein Klopfen an der Tür sie aus ihren Überlegungen riss.
»Tess, ich bin’s, Devin. Geht es dir gut?« Als er in der offenen Tür stand, wirkten seine Umrisse größer als er in Wirklichkeit war.
»Ja, schon«, antwortete sie. »Komm rein.«
Er betrat den Raum und schaute sich um. »Also, an deiner Stelle würde ich ja in Erwägung ziehen, hier mal aufzuräumen.« Er feixte.
»Hier ist nichts!«
»Du kannst die Nachricht nicht finden?«
»Nein, gar nichts. Ich habe ewig lange gesucht, aber nichts von ihm entdeckt, das wie ein Hinweis aussieht und mir irgendetwas sagen könnte.« Sie klang zutiefst frustriert.
»Na ja, dass das Licht kaputt ist, hilft auch nicht unbedingt beim Suchen«, meinte er, während er den Schalter abwechselnd nach oben und unten drückte.
Sie schaute ihm zu, bis er damit aufhörte und in die Wohnung kam. Dabei trat er achtlos Gerümpel aus dem Weg, bei dem es sich einmal um ihre geschätzten Habseligkeiten gehandelt hatte. Als er in die angrenzende Küche schaute, musste er plötzlich lachen.
»Was findest du denn so lustig?«, fragte Tess verwirrt.
»Hattest du mal einen Kühlschrank und eine Spülmaschine, oder ist …«
Sie unterbrach ihn: »Natürlich hat irgendein Arschloch geglaubt, etwas damit anfangen zu können.«
»Ha, was für ein Trottel.«
»Na ja, jeden Tag steht ein Idiot auf«, entgegnete sie, erhob und streckte sich. »Wie geht es Bri?«
»Gut. Dein Nachbar hat sich nicht mehr bemerkbar gemacht. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob da wirklich etwas gewesen ist, aber falls doch, haben Brando und sie das draußen im Griff. Deshalb dachte ich mir: Schau mal rein, vielleicht kannst du dich nützlich machen.«
»Wie spät ist es?«, fragte Tess.
»Es ist bereits Nachmittag, du bist schon eine ganze Weile hier drin«, meinte er. »Wir haben uns langsam Sorgen um dich gemacht.« Er ging hinüber und legte eine Hand auf ihre Schulter. Die Anspannung stand ihr ins Gesicht geschrieben, und die Hoffnungslosigkeit, die sie empfand, strömte geradezu aus ihr heraus.
»Jemand mit einem frischen und unvoreingenommen Blick hilft bestimmt«, sagte sie nachdenklich. »Warum übernimmst du nicht das Arbeitszimmer? Es ist die erste Tür links.«
»Kein Problem.« Er verschwand in dem besagten Raum und wollte dort instinktiv das Licht anknipsen, doch nichts geschah. Als er auf den breiten Schalter schaute, sah er, dass dieser herzförmig war. »Ich muss schon sagen, dieses Büro kannst auch nur du eingerichtet haben.«
Tess stöberte wieder im Schlafzimmer. Sie kroch nun auf allen Vieren herum und hob jeden Papierschnipsel auf. »Warum glaubst du das?«
»Weil ich mir nicht vorstellen kann, dass ein starker hartgesottener Marine ein Herz als Lichtschalter an die Wand montiert hat.«
Als sie das hörte, stürzte sie aus dem Zimmer zum Büro und blieb im Türrahmen stehen. Sie schaute auf den stilisierten Schalter und rief: »Das ist es! Er hat die Nachricht dahinter versteckt, ganz sicher.«
»Hinter dem Lichtschalter?«
»Ja.« Sie suchte auf dem Schreibtisch nach einem Werkzeug zum Abschrauben. »Hilf mir, wir müssen etwas finden, mit dem wir das Ding von der Wand bekommen.«
»Ernsthaft, du meinst, er hat sie dort versteckt?«
»Gut möglich; es wäre nicht das erste Mal. Niemand schaut an solchen Stellen nach, und diesen Schalter habe ich Travis zu unserem ersten Jahrestag geschenkt.«
Devin brauchte nicht zu suchen, er nahm einfach sein Schweizer Taschenmesser hervor und klappte den Flachkopfschraubendreher auf. Als er ihn Tess gab, fragte er: »Du hast deinem Mann – einem Marine – einen herzförmigen Lichtschalter geschenkt? Das findet selbst meine metrosexuelle Seite tuntig.«
»Halt die Klappe, das war etwas Persönliches. Dahinter steckte eine Vorgeschichte«, blaffte sie ihn an und schnappte sich das Werkzeug aus seiner Hand.
»Davon bin ich überzeugt. Hatte diese Vorgeschichte auch was mit Rollenspielen und Kopfmasken mit Reißverschluss zu tun?«
Sie knurrte ihn an, ohne sich die Mühe zu machen, auf seinen Kommentar einzugehen. Schnell löste sie die Verkleidung und nahm sie ab. Als sie hinter den Kippschalter schaute, entdeckte sie ein gefaltetes Stück Papier. »Da ist etwas!«, rief sie aufgeregt.
»Und ich dachte, ich hätte schon alles erlebt, aber das ist ja unglaublich«, meinte Devin.
Ihre Hände zitterten, während sie auch den Mechanismus abschraubte. Ein kräftiger Ruck, dann hatte sie ihn abgerissen und warf ihn achtlos beiseite. Mit der anderen Hand fummelte sie das zusammengefaltete Papier heraus. Einen Moment lang schaute sie es sich an, bevor sie es öffnete. Mit jeder Falz, die sie aufschlug, wurde ersichtlicher, dass die ominöse Botschaft gar keine war, sondern eine Karte.
Devin blickte über Tess’ Schulter. Beide waren extrem gespannt, und in gewisser Weise fühlte er sich an Weihnachten erinnert.
Als sie das Papier komplett aufgefaltet hatte, stellte es sich als Karte von Colorado heraus, und die einzige Markierung darauf war ein Kreis um eine Fläche neben drei handgeschriebenen Buchstaben: DIA.
»Was bedeutet das?«, fragte Devin. »Ist er an einem Flughafen?«
»Ja, wenn mich nicht alles täuscht, steht die Abkürzung DIA für Denver …«
»… International Airport«, fuhr er dazwischen und führte ihren Gedanken zu Ende.
Dann schauten sich die beiden verwirrt an.
Devin trat zurück und fuhr sich mit einer Hand durchs Haar, bevor er sich ihr wieder zuwandte. »Bist du sicher, dass das die ganze Nachricht ist?«
Sie gab ihm mit einem Blick zu verstehen, dass dies so war, antwortete aber: »Travis war sehr vorsichtig, er muss sich Sorgen gemacht haben. Am Telefon wollte er es mir aus welchen Gründen auch immer nicht sagen, und indem er es hier versteckte, gab er mir zu verstehen, dass er wusste, dass etwas Schlimmes passieren würde.«
»Muss ich derjenige sein, der das Offensichtliche ausspricht?«
»Was meinst du?«
»Wüsste ich, dass das Ende der Welt bevorsteht, würde ich dir einfach sagen, wohin ich verschwinde. Ich meine, diese ganze Sache, dieser ganze Trip ist doch totaler Unsinn, wenn du mich fragst.«
»Travis hatte bestimmt einen guten Grund dafür. Er wusste, dass er am Telefon nicht vertraulich mit mir reden konnte. Vielleicht fürchtete er um sein Leben, vielleicht …«
»Dennoch hat er dein Leben gefährdet. Er hätte dir auch einen besseren Hinweis als diesen geben können. Hättest du beim Verlassen von Norddakota gewusst, wo er steckt, wärst du jetzt dort. Das ist – entschuldige, wenn ich das so sage – selten dämlich.«
Tess warf ihm einen strengen Blick zu. »Er hatte einen guten Grund dafür, anders kann es nicht sein!« Sie hasste es, Travis in Schutz nehmen zu müssen, tat es aber automatisch. Seit dem Zusammenbruch war kein Tag vergangen, an dem sie sich nicht die gleiche Frage gestellt hatte, doch dass Devin es nun tat, machte einen Unterschied. Er kannte Travis nicht, deshalb war es für ihn ein Leichtes, ihren Mann zu verurteilen. Seitdem sie Daryls Haus verlassen hatten, waren Tess’ Meinungsverschiedenheiten mit Devin immer häufiger und heftiger geworden, was das Reisen in mancher Hinsicht anstrengend hatte werden lassen.
Jetzt öffnete Devin seinen Mund, schwieg dann aber doch. Ihm war klar, dass egal was er sagen würde, es nichts brachte, sondern lediglich Öl ins Feuer gießen würde. Unabhängig davon, wie dämlich oder unnötig es war, die Botschaft dort zu hinterlassen, hatten sie nun endlich eine Spur, der sie folgen konnten, und eine sehr lange Reise vor sich.
Während Tess die Karte betrachtete, fuhr sie mit ihren Fingern darüber. Dann hielt sie sich das Papier an die Brust und schloss die Augen.
Devin streckte eine Hand nach ihr aus. Er fühlte sich mies und wollte sich entschuldigen, doch ein Schrei von Brianna hielt ihn von seinem Eingeständnis ab.
Tess steckte die Karte hastig in eine ihrer Taschen, zog die Glock und stürmte zur Tür hinaus. Devin war dicht hinter ihr, das AR-15 schussbereit. Als sie das Haus verließen, konnten sie sehen, was gerade geschah: Brianna wurde von einem halben Dutzend kleiner Jungen umzingelt.
Diese wirkten zunächst harmlos – schließlich waren es noch Kinder –, doch nachdem sie die Eingangstreppe hinuntergelaufen waren, eilten die beiden trotzdem auf Brianna zu, die mit einer Pistole in der Hand neben dem Hummer stand, und erkannten nun, dass die Kinder mitnichten ungefährlich waren.
Fleckige, zerschlissene Kleidung klebte an ihren verhärmten Körpern, ihre eingefallenen Gesichter waren dreckig und in ihren knochigen Händen hielten sie Schläger oder Rohrstücke, mehrere von ihnen sogar Feuerwaffen. Sie verhöhnten Brianna, deren Gesichtsausdruck deutliche Furcht erkennen ließ.
»Hilfe! Devin, Tess, Hilfe!«, schrie sie erneut, weil sie nicht sah, dass die beiden bereits unterwegs zu ihr waren.
»Bri, wir sind gleich bei dir!«, rief Tess zurück.
Die Kinder, die nicht damit gerechnet hatten, dass die Frau Verstärkung bekam, schauten nun hoch und erkannten, dass Tess und Devin näherkamen.
Die Hälfte von ihnen drehte sich um und stellte sich ihnen entgegen. Zwei hielten je einen Revolver in der Hand, der dritte hatte einen Colt M1911.
»Wartet, Jungs. Nehmt die Waffen herunter. Das ist doch nicht nötig«, rief Devin mit erhobenem Gewehr.
»Hört zu, egal was ihr euch vorgestellt habt: Es wird nicht passieren. Solltet ihr etwas zu essen suchen, können wir euch gerne helfen«, ergänzte Tess. Sie hielt ihre Pistole mit dem Lauf nach unten, um zu zeigen, dass sie nichts Böses im Schilde führte.
Devin schaute kurz zu ihr hinüber und fragte: »Tess, was soll das? Wir wissen nicht, wer sie sind und wozu sie vielleicht imstande wären.«
Ohne seinen Blick zu erwidern, entgegnete sie: »Das sind bloß Kids.«
»Hast du dir da drin etwa den Kopf gestoßen?«, fragte er spöttisch.
»Ihr seht hungrig aus. Wir haben Lebensmittel, von denen wir euch etwas abgeben können, okay?«, sagte sie.
Brando stand nun neben Brianna. Sein Bein war infolge der Schusswunde noch bandagiert, die er sich einige Wochen zuvor bei Daryl in Reed im Bundesstaat Illinois zugezogen hatte, sein Kampfgeist war aber mehr oder weniger ungebrochen. Er sträubte sein Fell und knurrte die Jungen böse an.
Diese begannen, Tess auszulachen, wobei sich derjenige mit dem Revolver derart verausgabte, dass er fast keine Luft mehr bekam.
Devin war die Situation, die sich gerade vor ihm abspielte, nicht geheuer. Seit das Chaos sieben Monate zuvor ausgebrochen war, hatte er viel erlebt, aber ihnen waren noch niemals gewaltbereite Kinder untergekommen. Er packte das Gewehr noch fester und zielte auf den Jungen mit dem Colt. Dieser war ungefähr zehn Jahre und damit auch der älteste, weshalb die anderen zu ihm aufzuschauen schienen.
»Wie heißt du?«, fragte Tess.
Er nahm die Pistole herunter und antwortete: »Alex.«
Sie lächelte ihn an. »Alex, hi, ich bin Tess. Bist du hungrig?«
Er nickte.
»Wir können euch helfen«, sagte sie.
»Sie sollen Brianna in Ruhe lassen«, verlangte Devin.
»Also gut, wir geben euch etwas zu essen, aber könnt ihr, du und deine Freunde, zuerst unserer Freundin ein bisschen Platz lassen?«, fuhr Tess fort.
Alex zuckte mit dem Kopf, damit ihm das fettige Haar nicht mehr in den Augen hing. Er lächelte und entgegnete: »Sicher doch.«
Diese schlichte Antwort genügte. Die anderen fünf Jungen senkten ihre Waffen und gingen ein paar Schritte rückwärts.
Devin, der dieser Entwicklung immer noch nicht so recht traute, stemmte sich das Gewehr weiterhin fest gegen die Schulter.
»Hey, Lady, was ist mit ihm?«, fragte Alex, während er auf Devin zeigte.
Sie schaute mit erwartungsvollem Blick zu ihm hinüber. Devin ging seitwärts in ihrer Richtung und blieb dicht neben ihr stehen, ohne mit seiner Waffe auch nur einen Zoll von dem Jungen abzulassen. »Tess, mir gefällt das nicht«, flüsterte er.
Sie erwiderte genauso leise: »Das sind nur hungrige Jungs.«
»Ganz genau.«
Tess wies seine Bedenken von sich, steckte ihre Glock ein und ging an Alex vorbei zum Heck des Humvees. Nachdem sie die Klappe geöffnet hatte, zog sie eine Kiste mit Einmannpackungen heraus und ließ sie auf den Boden fallen.
Alex stieß einen Pfiff aus, woraufhin zwei der anderen Jungen, die ungefähr sieben Jahre alt waren, hinüberliefen und die Rationen aufhoben.
»Sind wir jetzt quitt?«, fragte Tess.
Alex erweckte zwar den Anschein, gerade erst zehn zu sein, legte aber das Benehmen und die Ausstrahlung eines Erwachsenen an den Tag. So wie er sie mit seinen dunkelbraunen Augen anschaute, wirkte er sehr bedrohlich.
Devin hatte dies sofort erkannt, seine Gefährtin aus unerfindlichen Gründen jedoch nicht. Tess war seit ihrer Ankunft am Topsail Beach, als sie vor dem Haus Island Drive 18 geparkt hatten, einfach nicht mehr sie selbst.
»Habt ihr die Karre vom Stützpunkt Lejenue?«, fragte Alex neugierig.
Sie verneinte.
»Woher kommst du?«, bohrte er weiter.
»Von hier.« Sie zeigte auf ihr altes Haus.
Er drehte sich um, lächelte andeutungsweise und entgegnete: »Du stammst aus der Gegend?«
»Kann man so sagen. Wo sind denn deine Eltern?«
»Sie leben nicht mehr«, platzte einer der Siebenjährigen heraus. »Sind alle tot.«
»Wo wohnt ihr?«, fragte Tess.
Alex zeigte auf das Gebäude, in dem Brianna Stunden zuvor Bewegungen ausgemacht hatte. »Ich hab euch doch gesagt, dass dort jemand war!«, rief sie, nun, da sie sich bestätigt sah.
Tess stieß einen langen Atemhauch aus. Sie hatte zwar Mitleid mit den Jungen, erkannte aber, dass ihnen etwas Abgebrühtes und Verzweifeltes innewohnte. Indem sie sich auf ihre Intuition verließ, sagte sie jetzt: »Nun gut, Jungs, wir müssen weiter. Lasst es euch schmecken und trinkt bitte mehr Wasser als üblich, wenn ihr die Sachen esst, denn ansonsten kriegt ihr Verstopfung.«
Brianna öffnete die Fahrertür, woraufhin Brando hineinsprang, dann stieg auch sie ein.
Alex’ Miene zeigte keinerlei emotionale Regung. Als Devin das sah, hob er sein Gewehr langsam wieder an und machte sich auf alles gefasst.
Nachdem Tess um den Wagen herumgegangen war, stieg sie an der Beifahrerseite ein.
Die anderen Jungen behielten Devin im Auge und warteten darauf, dass ihr Anführer Befehle erteilte.
Alex wandte sich dem Mann zu und grinste.
Der Motor des Humvees sprang stotternd an.
Die Spannung setzte Devin heftig zu. Er wusste einfach, dass diese Sache schiefgehen würde, und er wollte nicht Gefahr laufen, zu unterliegen, weil er zu langsam war, weshalb er die Waffe richtig anlegte und rief: »Alex, ich habe nichts gegen dich, aber denk gar nicht erst daran, etwas Dummes zu tun!« Er zielte auf die Brust des Jungen und hakte den Zeigefinger am Abzug ein.
»Wir sind quitt! Nicht schießen!«, rief Alex. Er strahlte eine sonderbare Ruhe aus – sonderbar deshalb, weil er für jemanden seines Alters einfach zu gelassen wirkte.
»Miss Slattery, Miss Slattery, sind Sie das?«, rief auf einmal ein kleines Mädchen. Es war wie aus dem Nichts aufgetaucht.
Brianna wendete den Wagen und fuhr neben Devin vor, womit sie ihm die Sicht auf Alex versperrte.
»Miss Slattery, Miss Slattery!«, wiederholte das Mädchen aufgeregt. Es rannte zur Fahrertür und fing an, gegen die Scheibe zu klopfen.
Brianna schaute hinunter in das schmutzige Gesicht des Kindes, das auch nicht älter als sieben sein konnte, und auch dessen Augen zeugten von Verzweiflung.
Als Tess hinübersah, veränderte sich ihre Miene. »Stell den Motor ab!« Tess stieg wieder aus und lief mit ausgebreiteten Armen um den Wagen herum.
»Meagan, oh mein Gott, Meagan, du bist es!«
Das Mädchen warf sich an Tess’ Brust und klammerte sich an ihr fest. »Fahren Sie nicht wieder weg, bitte«, wimmerte das Kind. »Wir brauchen Sie. Ich habe solche Angst.«
Tess drückte das Kind genauso innig. »Ich kann nicht glauben, dass du es wirklich bist.«
»Sie wollten gerade fahren, bitte tun Sie es nicht!«, flehte Meagan wieder.
Tess machte sich von ihr los und betrachtete sie genauer. Ihr Gesicht war schmuddelig, ihr dichtes, langes, braunes Haar zerzaust und fettig, sodass es an Dreadlocks erinnerte, zumal es sich auch genauso anfühlte.
Sie fing an zu weinen und zu zittern. »Bitte verlassen Sie uns nicht.«
»Wo steckt deine Schwester? Ist Melody bei dir?«
Meagan nickte. »Aber sie ist krank.«
Tess stand auf, nahm sie bei der Hand und sagte: »Bring mich zu ihr.«
Devin beobachtete das alles, allerdings nicht ohne weiterhin genau auf Alex zu achten.
»Hey, Lady, du darfst da nicht rein«, blaffte der Junge sie an.
Tess ignorierte ihn und ging zügig auf das Haus zu, in dem die Kinder Unterschlupf gefunden hatten.
Devin trat nun ans Beifahrerfenster des Wagens. »Fahr die Straße hinunter und stell ihn dort ab«, wies er sie an. »Klemm dich hinter die dicke Kanone auf der Ladefläche. Ich traue diesen kleinen Scheißern nicht über den Weg.«
Brianna hinterfragte den Befehl nicht, sondern führte ihn genau so aus.
Alex’ Alter und Unreife zeigten sich nun allmählich. Seine Schläfen pulsierten, während er mit zusammengebissenen Zähnen beobachtete, wie sich Tess dem Gebäude näherte. Während seine Freunde begannen, die Einmannpackungen zu verzehren, ging er ebenfalls auf das Haus zu.
Devin blieb ihm dicht auf den Fersen. »Hey, Alex, wo sind denn die Erwachsenen abgeblieben?«, fragte er in dem Versuch, eine Unterhaltung zu starten und mehr Informationen zu erhalten.
»Hast du doch gehört: Sie sind alle tot«, antwortete der Kleine. Er ging schnell und heftete seine Augen auf Tess’ Rücken.
»Hier gibt es überhaupt keine Erwachsenen mehr?«
»Keine netten, nein.«
Devin blickte ihn äußerst verwirrt an wegen dieser seltsamen Antwort.
»Lady, ich hab gesagt, du kannst da nicht rein!«
Tess hatte die Fliegengittertür mittlerweile erreicht. Sie drehte sich zu Alex um und erwiderte: »Meagan ist meine Freundin und ihre Schwester ebenfalls. Sollte es Melody schlecht gehen, werde ich versuchen, ihr zu helfen. Außerdem lasse ich mir nichts von Kindern sagen.« Daraufhin öffnete sie die Tür und betrat ein dunkles und stinkendes Wohnzimmer. Der durchdringende Geruch von Fäkalien traf sie vollkommen unvorbereitet, weshalb sie sich beinahe übergeben musste. Als sich ihre Augen an die dürftigen Lichtverhältnisse gewöhnt hatten, schaute sie sich um. Überall lagen Dreck und Müll, der Raum war die reinste Deponie.
»Wo ist Melody?«
Meagan führte sie durch den Unrat in ein Schlafzimmer hinein. Dort lag ihre Schwester auf schmutzigen Decken. Die zierliche Fünfjährige hatte sich zusammengerollt und zitterte heftig.
Tess eilte an ihre Seite und strich ihr die blonden Locken aus dem Gesicht.
»Melody, Süße, ich bin es – Miss Slattery«, wisperte sie sanft, während sie den Kopf des Mädchens streichelte.
Das Kind öffnete die Augen ein wenig und sah die Frau an, wobei es versuchte zu lächeln, was ihm jedoch nicht gelang. Der winzige Körper strahlte eine intensive Hitze aus. Tess betrachtete Melody genauer, um herauszufinden, weshalb sie unter so hohem Fieber litt. Als sie das fleckige Federbett aufschlug, entdeckte sie eine kleine Stichwunde an einer Wade, die bereits rot entzündet war. »Wie ist das passiert?«, frage sie Meagan.
»Alex hat sie mit einem Rechen geschlagen.«
»Netter Kerl, dieser Alex«, knurrte Tess laut.
»Du kannst mich mal, Lady«, wetterte er. Mittlerweile stand er in der Tür.
Tess hatte nicht bemerkt, dass er hereingekommen war, beachtete ihn aber nicht weiter. Sie sah sich im Raum um … der Schmutz und Verfall … der widerliche Gestank – all das war abstoßend. Sie musste sich um Melody kümmern, doch dieser Ort kam dafür nicht infrage. Sie schob die Arme unter das Mädchen – das stöhnte dabei leise auf – und nahm sie vorsichtig auf den Arm. »Komm, Schätzchen, ich werde mich darum kümmern, dass es dir wieder besser geht.«
Melody war so schwach, dass sie sich nicht an Tess festhalten konnte. Ihre Ärmchen baumelten hinunter wie dünne Stöcke. Tess drückte sie fest an sich und ging auf die Schlafzimmertür zu.
Alex blieb trotzig im Weg stehen. »Du bringst sie nirgendwohin, sie gehört zu unserer Bande«, posaunte er hinaus.
»Mach sofort Platz!«, befahl Tess.
»Nein!«
»Pass auf, Freundchen, ich weiß nicht, wo dein Problem liegt, aber du verschwindest jetzt sofort«, drohte Devin, der ihm von hinten auf die Schulter tippte.
Alex entzog sich seiner Hand und stieß ihn zurück.
Devin war das Benehmen des Jungen endgültig leid. Er packte ihn im Genick und schob ihn mit Gewalt aus dem Türrahmen.
Alex widersetzte sich, konnte aber nichts gegen den Erwachsenen ausrichten. »Lass mich los!«
Devin drückte ihn gegen eine Wand. »Hör zu, du Dreikäsehoch, mir ist es egal, ob du bis jetzt überlebt hast. Dieses kleine Mädchen da braucht medizinische Fürsorge. Du kannst uns jetzt entweder helfen oder dich verziehen. Sieh es so: Einen Mund weniger zu füttern.«
»Zwei«, sagte Meagan, die Tess folgte.
Alex hörte auf zu zappeln und starrte den Mann verärgert an.
Devin ließ ihn vorsichtig los und fragte: »Ist jetzt alles okay?«
Der Junge antwortete nicht, sondern starrte ihn nur weiter an.
Tess hielt sich nicht mit dem Streit der beiden auf. Ihr Anliegen bestand einzig und allein darin, eine sichere und saubere Bleibe für Melody zu finden. Als sie wieder zum Eingang kam, trat sie die Tür auf. Draußen konnte sie endlich frische Luft atmen. Nie zuvor in ihrem Leben hatte sie etwas so Abstoßendes gesehen wie die Umstände, unter denen diese Kinder hausten. Zielstrebig stapfte sie die Treppe hinunter und dann über die Auffahrt zur Straße. Zuerst erwog sie, in das Gebäude zurückzukehren, das sie einmal ihr Zuhause genannt hatte, doch dann wurde ihr klar, dass sie das nicht wollte. Ein Anwesen weiter rechts ähnelte ihrem, verfügte aber über ein weiteres Schlafzimmer. Da sie sich nicht sicher war, was genau sie tun sollte, suchte sie Meagans Blick. »Wie wäre es, wenn wir zu dir nach Hause gehen würden?«
Das Kind schüttelte vehement den Kopf. »Nein.«
»Aber das ist doch gar nicht schlimm«, hielt Tess dagegen. »Die Umgebung ist dir vertraut, und das wird dir bestimmt gut tun.« Sie begann, auf Meagans Elternhaus zuzugehen, das dritte Gebäude von ihrem Grundstück aus gesehen.
»Nein!«, schrie das Mädchen plötzlich.
Nun blieb Tess stehen und schaute sie verwundert an.
»Nein, das geht nicht! Mommy und Daddy sind noch dort.«
Jetzt verstand Tess alles. Ohne noch eine Sekunde mehr zu vergeuden, marschierte sie weiter auf das größere Nachbarhaus zu. Geräumigkeit mochte zwar eine Rolle spielen, doch sie hoffte inständig, es befinde sich in einem brauchbaren Zustand.
Nachdem Devin sie eingeholt hatte, fragte er: »Wohin willst du?«
»Dieses Haus ist besser, dort ist mehr Platz«, erwiderte sie, während sie rasch an den stehengelassenen Autos in der Einfahrt vorbeiging. »Bitte sieh dir die Tür an.«
Während sich Tess und Devin dem Haus näherten, schaute Brianna von der Heckklappe des Humvees aus neugierig zu.
Die Knaben, die auf der Straße geblieben waren, bedachten sie nur mit kurzen Blicken, weil sie immer noch mit dem Essen der Feldrationen zugange waren.
Devin lief die lange Eingangstreppe hinauf und blieb vor der Tür stehen. Auch sie war beschädigt, der Knauf mitsamt einem Teil des Holzes war am Querriegel abgebrochen – ein eindeutiges Zeichen dafür, dass jemand die Tür eingetreten hatte. Als Devin sie aufstieß, offenbarte sich ihm ein ähnlicher Anblick wie in Tess’ Heim: Alte, persönliche Gegenstände lagen kaputt am Boden verstreut, doch das Haus befand sich insgesamt in einem besseren Zustand, was ihn überraschte. Er brauchte nicht lange, um sich zu vergewissern, dass die Luft in allen Zimmern rein war, und kehrte dann zur Tür zurück, wo Tess auf grünes Licht von ihm wartete.
»Alles leer. Das zweite Schlafzimmer links sieht perfekt aus«, meinte er und machte eine Handbewegung den langen Flur hinunter.
Sie rauschte an ihm vorbei. Als sie den Raum betrat, verstand sie, was Devin damit gemeint hatte: Die Wände waren rosa gestrichen und mit Postern beklebt, die Kätzchen und Regenbogen zeigten. Sie dachte an das Mädchen, das hier gelebt hatte, allerdings nur flüchtig.
Tess legte Melody behutsam auf das Bett und wollte sie gerade zudecken, als sie zögerte.
»Devin bring mir bitte frisches Wasser, Seife, einen Waschlappen – und Ibuprofen!«
Devin lief wieder nach draußen.
»Liebes, sei so gut und suche einen Schlafanzug in der Schublade dort aus«, wies Tess Meagan an.
Das Kind fand ein langes Nachthemd, auf dessen Vorderseite eine Prinzessin gedruckt war. »Hier.«
»Super«, erwiderte Tess und begann dann, Melody auszuziehen. Während sie das Mädchen aus den dreckigen Kleidern schälte, war sie entsetzt wegen ihrer schlechten Verfassung und der mangelnden Hygiene.
Gerade als sie das letzte Stück ausgezogen und beiseite geworfen hatte, kehrte Devin mit allem zurück, was er hatte besorgen sollen.
»Wie geht es ihr?«, fragte er.
Tess antwortete nicht, weil sie befürchtete, Meagan damit zu beunruhigen. Darum sah sie Devin lediglich an und verzog ihr Gesicht.
»Wie kann ich helfen?«, fuhr er fort.
Sie schaute ihn wieder an. »Richte dich schon einmal hier ein. Wir werden in absehbarer Zeit nirgendwohin gehen.«
Devin nickte und verließ den Raum wieder.
***
Tess schloss sanft die Tür und ging ins Wohnzimmer, das sauber und aufgeräumt war, wie sie angenehm verwundert feststellte. In der Stunde, die vergangen war, seit sie Melody gewaschen und verarztet hatte, hatte Brianna saubergemacht.
»Sieht toll aus«, meinte Tess.
»Ich hatte Hilfe.« Brianna zeigte auf Meagan.
»Wo ist Dev?«, fragte Tess.
»Vor dem Haus«, antwortete Brianna. »Er schiebt Wache.«
Tess ging zur Tür, blieb aber noch einmal kurz stehen, um Meagan zu umarmen.
Das Mädchen schmolz unter der zärtlichen Berührung geradezu dahin und erwiderte die Geste, wobei sie ein »Danke« ins Ohr der Erwachsenen flüsterte.
»Keine Ursache, Maus«, wisperte Tess zurück. Sie drückte Meagan noch einmal fest und verließ dann das Haus.
Devin hockte dort wie ein Raubvogel und überwachte die Umgebung mit dem Ar-15 auf seinem Schoß. Das Licht der Nachmittagssonne fiel schräg auf ihn ein, sodass er einen langen Schatten gegen die Front des Hauses warf. Um seine Augen vor der Helligkeit zu schützen, trug er eine alte Mütze der New England Patriots, die er vor Wochen gefunden hatte. So lang wie jetzt war Devins dunkles Haar in seinem ganzen Erwachsenenleben noch nicht gewesen; es schaute unter der Kopfbedeckung hervor und kräuselte sich. Er hatte zwar schon in Betracht gezogen, es zu schneiden, scherte sich aber mittlerweile einfach nicht mehr darum. Genauso gleichgültig verhielt er sich bezüglich seines Bartes, der jetzt schon gut einen Viertelzoll lang war; er wuchs weniger dicht als sein Kopfhaar und war durchgehend grau meliert.
Tess fand sein neues, herberes Aussehen attraktiver als den verängstigten, glatt rasierten Mann, den sie in Illinois kennengelernt hatte.
»So, jetzt kann sie erst einmal ruhig schlafen. Hoffentlich geht es ihr bald besser, wenn sie nicht mehr in diesem Drecksloch sitzen muss«, sagte Tess.
Devin blickte auf und grinste. »Ich wollte vorhin schon fragen, aber der Zeitpunkt schien nicht so passend: Diese Mädchen werfen unseren Plan über den Haufen, hab ich Recht?«
»Rutsch mal rüber«, bat Tess.
Devin machte Platz, damit sie sich neben ihn auf die Holzstufe setzen konnte.
»Ja, der Plan hat sich geändert. War natürlich nicht meine Absicht, aber wie hätte ich diese kleinen Mädchen alleinlassen können?«
»Ich sage ja gar nichts dagegen. Jeder – nicht nur du – wäre ein Unmensch, wenn er sie dem Herrn der Fliegen vorwerfen würde.«
»Herr der Fliegen?«, hakte Tess verwirrt nach.
Er neigte überrascht den Kopf zur Seite. »Du kennst das Buch nicht?«
»Sollte ich denn?«
»Wie alt bist du noch gleich?«
»Hör auf. Worum geht es darin denn?«
»Was habt ihr denn in der elften oder zwölften Klasse in amerikanischer Literatur gelesen?«
»Weiß ich nicht mehr.«
»Herr der Fliegen ist ein Roman über eine Gruppe Jungen, die auf einer Insel stranden. Sie gründen so etwas wie eine eigene Gesellschaft, in der es allerdings bald gewalttätig und barbarisch zugeht.«
»Jetzt verstehe ich.«
»Was zum Teufel sollte das übrigens vorhin?«
»Was genau meinst du?«
»Dass du ihnen etwas zu essen gegeben und versucht hast, mit Hannibal Lecters Sohn zu verhandeln.«
»Diese Anspielung kapiere ich«, entgegnete sie lachend. »Das, mein Freund, bedeutet, die Initiative zu ergreifen, bevor eine Situation entgleisen kann.«
»Du weißt genauso gut wie ich, dass diese Bengel nur Ärger stiften.«
»Da hast du Recht, aber ich glaube nicht, dass sie so heimtückisch sind wie die verdammten Kannibalen, mit denen wir uns herumgeschlagen haben«, relativierte Tess.
»Das ist jetzt nicht erfunden, ich habe mal eine Doku zur Apokalypse auf dem Discovery-Channel gesehen … oder war’s der History-Channel? Wie dem auch sei, da diskutierten Fachleute über die Reaktion der Menschen auf exakt die gleichen Verhältnisse, die wir nun erleben. Jedenfalls kam da auch das Thema Kinder zur Sprache, die laut einhelliger Meinung aller Experten in einer solchen Lage zu den skrupellosesten Mördern überhaupt werden würden.«
»Also gehe ich davon aus, dass du auf sie geschossen hättest?«
»Ich meine, jetzt im Nachhinein nicht, aber vorhin wahrscheinlich schon. Du hast den Vorteil, es rückblickend zu betrachten, um deinen Standpunkt zu vertreten.«
Tess entgegnete im ruhigen Tonfall: »Was du über diese Jungen sagst, stimmt schon. Sie wollten uns wahrscheinlich wirklich etwas antun, aber ich weiß, dass Menschen manchmal einfach nur etwas Bestimmtes brauchen. Ich händigte es ihnen aus, und das lenkte sie ab. Außerdem gab ich ihnen zu verstehen, dass ich keine Angst vor ihnen habe, und dieses Selbstbewusstsein entwaffnete sie, nicht zu vergessen natürlich, dass du sie die ganze Zeit über im Visier hattest. Werden diese Kinder über kurz oder lang jemanden verletzen? Ja, bestimmt! Aber das interessiert mich nicht, solange ich nicht selbst davon betroffen bin.«
»Wie sieht jetzt dein Plan aus? Wir müssen uns trotzdem Gedanken über diese Kids machen, weil sie unsere Nachbarn sind«, meinte Devin, während er zu dem Haus auf der anderen Straßenseite schaute, in dem sich die Jungen verschanzt hatten.
»Ein Glück, das wir dich haben, um uns vor einem Zehnjährigen und seiner Bande von Zweitklässlern zu beschützen.« Tess grinste, während sie sein Bein tätschelte.
»Freut mich zu sehen, dass du diese Sache ernst nimmst.«
»Oh, verlass dich darauf, Gefahr ist überall im Verzug, Mann. In dieser Stadt kenne ich mich wenigstens aus.«
»Das würde ich nicht glauben, denn sie ist mit Sicherheit nicht mehr dieselbe.«
Tess wollte erst ein Gegenargument anführen, hielt sich dann aber zurück, um sich seine Worte noch einmal durch den Kopf gehen zu lassen. Sie brauchte nicht lange, um zu begreifen, dass er Recht hatte. Sie kannte zwar die Straßen und die Umgebung, aber weder die Beweggründe derer, die dort draußen waren, noch die Hintergründe dessen, was sie gerade durchmachten.
»Meine Güte, ihr hört euch mehr und mehr wie meine Eltern an«, sagte Brianna stöhnend. »Ständig am Streiten. Seit unserem letzten gemeinsamen Abendessen bei Daryl bist du total aggressiv, Tess.«
Als sich die beiden Älteren umdrehten, sahen sie, dass Brianna hinter dem Fliegengitter stand.
»Ich stimme ihr zu«, bemerkte Devin.
»Und du«, hielt Brianna ihm vor, »bist immerzu schießwütig.«
»Ich versuche doch nur, dafür zu sorgen, dass uns nichts passiert«, erwiderte Devin, um sein Tun zu verteidigen.
»Brianna trifft es auf den Punkt. Was sollte die Aktion mit dem Kerl in dem Kaufhaus vor Salem?«
»Er kam auf uns zugelaufen, und ich wusste nicht, ob er bewaffnet war.«
Tess musste lachen. »Er kam nicht auf uns zugelaufen, sondern humpelte und war bestimmt schon achtzig.« Der Vorfall, auf den sie sich bezog, lag erst wenige Tage zurück.
»Ihr zwei dürft gerne glauben, was ihr wollt. Ich habe ihn nur deshalb erschossen, weil er nicht auf mich gehört hat, als ich sagte, er soll stehen bleiben.«
»Weil wahrscheinlich die Batterie seines Hörgeräts leer war«, ergänzte Tess scherzhaft.
Brianna brach in lautes Gelächter aus.
»Also wirklich, leckt mich doch – alle beide«, schimpfte Devin.
Brianna öffnete die Tür und kam nach draußen. Sie schaute zur Brandung an den Strand hinunter.
Tess wandte sich Devin zu, der nun schmollte. Wieder klopfte sie ihm aufs Bein. »Bleib locker«, sagte sie. »Wir ziehen dich doch nur ein bisschen auf.«
»Manchmal bin ich mir da nicht so sicher.«
Tess wandte sich an Brianna. »Hübsch, nicht wahr?«, fragte sie.
Die Jüngere schwieg. Sie schaute sehnsüchtig zum Ufer. Die Sonnenstrahlen brachten das Wasser zum Funkeln. Sie seufzte laut. »Ich würde am liebsten ins Meer springen.«
»Bist du je an der Küste gewesen?«
»Nein.«
Tess sah Devin an und zwinkerte. »Dann solltest du ein kurzes Bad nehmen.«
»Meint ihr wirklich?«
»Klar, warum nicht?«, pflichtete Devin ihr bei.
Nun strahlte Brianna. »Ich schau mal nach, ob ich einen Badeanzug finde.« Mit diesen Worten verschwand sie wieder im Haus.
»Du gehst mit ihr und ich halte hier die Stellung«, erklärte Devin.
»Ruf mich aber, falls Melody aufwacht«, bat Tess, ehe auch sie hineinging, um Sachen für einen Abstecher an den Strand zusammenzusuchen.
***
Brianna ließ sich laut lachend in den Sand fallen. Sie grinste so breit, dass man alle ihre Zähne sah.
Tess warf einen breiten Schatten auf sie. »Was ist daran denn so lustig?«, wollte sie wissen.
»Oh mein Gott, du hast ja keine Ahnung. Ich wollte schon immer im Meer schwimmen. Das war genial, vielen Dank.« Sie setzte sich aufrecht hin und ließ den Blick über das scheinbar endlose Wasser schweifen.
»Freut mich, dass es dir gefallen hat«, erwiderte Tess.
»Ich wünschte, ich könnte mich immer so fühlen.«
»Das würde ich mir für uns alle wünschen.«
»Tut mir leid wegen deines Hauses. Ist wirklich jemand eingebrochen?«
»Ja, aber ich habe trotzdem gefunden, wonach ich gesucht habe.«
»Sorry, ich hätte schon früher fragen sollen, aber mit diesen Jungen, Meagan, Melody und alldem konnte ich nicht …«
»Du musst dich für nichts entschuldigen.«
»Wann fahren wir denn wieder?«
»Das weiß ich nicht genau. Hier, brauchst du ein Handtuch?«
Brianna nahm es entgegen und begann, ihr langes, blondes Haar trocken zu rubbeln. Die Freude, die sie innerlich nach dieser kurzen Ruhepause empfand, war von unschätzbarem Wert, und sie nahm wohlwollend zur Kenntnis, dass sie eine Weile vor Ort bleiben würden, denn das Leben unterwegs war anstrengend und unberechenbar. Sie verstand, dass es keine Garantien gab, doch vorübergehend irgendwo unterkommen zu können, vermittelte ihr wenigstens ein bisschen das Gefühl, sicher zu sein.
»Du kennst die Mädchen also?«
»Ja.«
»Was geschieht jetzt?«
Tess setzte sich in den feuchten Sand, lehnte sich zurück und stützte ihre Ellbogen auf. Dann legte sie den Kopf in den Nacken und schaute hoch zu dem dunkelblauen Himmel. »Zuerst müssen wir dafür sorgen, dass es Melody wieder besser geht. Sobald sie auf den Beinen ist, brechen wir in Richtung Denver auf.«
»Dort war ich noch nie.«
»Du bist nicht viel herumgekommen, oder?«
»Nein, die Strecke, die wir bis jetzt zurückgelegt haben, war die bisher weiteste Reise meines Lebens. Hätte ich das alles bloß unter anderen Umständen sehen können …«
»Geht mir ganz genauso.«
Ihre kurze, friedliche Pause wurde jäh unterbrochen, als Devin rief: »Tess, komm schnell!«
Sie rannten zum Haus zurück. Als sie die dem Strand zugekehrte Seite des Gebäudes erreichten, erkannten sie den Grund für Devins Ruf. Alex und seine Clique waren wieder aufgekreuzt.
»Lady, wir sind hier, um uns zu unterhalten«, sagte er mit ernster Stimme.
Tess prustete fast vor Lachen, weil er so hart und furchteinflößend erscheinen wollte. Sie wusste, er war nicht vertrauenswürdig und durchaus zum Töten in der Lage, doch beobachten zu müssen, wie ein Zehnjähriger versuchte, einen bewaffneten Erwachsenen einzuschüchtern, hatte schon etwas Komisches an sich.
»Wir leben in einem freien Land, also nur zu«, erwiderte Devin.
»Wir brauchen mehr zu essen«, fuhr Alex fort.
»Ich denke, das nächste Geschäft …«, begann Devin, doch Tess unterbrach ihn.
»Wir können momentan nicht mehr abgeben, doch …«
»Ihr müsst«, fuhr der Junge dazwischen.
»Würdest du mich bitte zu Ende reden lassen?«, entgegnete Tess. »Ich schlage vor, dass wir – ihr und ich – morgen gemeinsam auf Essenssuche gehen.«
»Nein.«
»Wenn ihr mehr zu essen wollt, müsst ihr danach suchen«, klärte sie ihn auf.
»Nein.«
»Ich werde nicht mit einem Zehnjährigen debattieren.«
»Ich bin elf.«
Devin schmunzelte. »Egal.«
»Alex, wir können nicht mehr abgeben, und müssen selbst Nachschub beschaffen. Also, hier muss es noch eine Menge zu essen geben. Auf Topsail Island wohnten Tausende, und ihr könnt doch nicht jeden Haushalt abgegrast haben.«
»Es gibt hier nichts mehr zu essen«, widersprach Alex.
»Und woher wollt ihr das so genau wissen?«
Nun ließ er den Kopf hängen. Die Tatsache, dass er wohl oder übel Schwäche zeigen musste, nagte an seinem unreifen Gemüt, doch er wehrte sich dagegen, ihr die Wahrheit zu unterbreiten. »Ist eben so.«
Tess machte einen Schritt auf ihn zu und sagte zu einem der anderen Jungen: »Worum geht es? Wir können euch helfen, aber das funktioniert nicht, solange wir nicht wissen, was hier genau gespielt wird.«
Der Knabe, der nicht älter als acht sein konnte, wirkte nervös, als er sagte: »Die Männer haben es uns gesagt.«
Der Anführer stieß ihn kräftig mit einem Ellbogen an und brüllte: »Halt die Klappe!«
»Welche Männer?«, fragte Tess. »Alex spuck es einfach aus, wir können euch helfen.«
Der Junge senkte abermals den Blick und murmelte etwas Unverständliches.
»Tess, das führt zu nichts, dieser Kerl ist bestimmt geistig zurückgeblieben!«, knurrte Devin.
Alex hob den Kopf und warf ihm einen wütenden Blick zu.
Tess rückte dem Kleinen noch dichter auf den Leib. Als sie so nah war, dass er sie fast berühren konnte, gewann sie den Eindruck, er fürchtete sich vor ihrer Nähe.
»Alex, wir können euch nicht noch mehr zu essen geben, aber wir können helfen, etwas zu besorgen. Bitte, es geschieht zu eurem Besten.«
Nach einer beklommenen Pause berichtete der Junge ihr, dass vor einigen Tagen eine Gruppe von Männern aufgetaucht war, ungefähr ein Dutzend. Sie waren von Tür zu Tür gegangen, um Nahrungsmittel zu suchen. Er erwähnte auch ältere Teenager, die ihrer Gruppe zu Beginn angehört hatten und angeblich von den Männern entführt worden waren.
»Wie viele haben sie denn mitgenommen?«, wollte Tess wissen.
»Vier.«
»Haben sie etwas zu euch gesagt?«
»Sie haben uns davor gewarnt, irgendwo anders hinzugehen. Wir durften kein Essen mehr suchen, sie nahmen uns weg, was wir hatten, und behaupteten, dass dies jetzt ihr Revier war. Wir sollten uns nicht von der Stelle rühren, und sollten wir uns was zum Beißen besorgen, wäre es das Gleiche, wie ein direkter Diebstahl von ihnen.«
»Wie lange ist das her?«
»Zwei Wochen.«
Tess suchte Devins Blick. Der zog lediglich eine Augenbraue hoch.
»Wie könnt ihr uns da helfen? Diese Männer waren böse. Ich will nicht, dass sie zurückkommen und uns wehtun.«
»Wir werden auf euch aufpassen. Für heute Abend bekommt jeder von euch noch eine Soldatenration, aber morgen gehen wir gemeinsam Nahrungsmittel suchen.« Das äußerte Tess mit gedämpfter Stimme, bevor sie eine Hand ausstreckte und Alex’ Schulter rieb. Dieses Mal entzog er sich nicht.
Er nickte nur und sagte: »Gut.«
»Devin, du hast gehört, wie unser Abkommen lautet. Hol den Jungs noch je eine Ration«, bat sie und wandte sich wieder an Alex. »Morgen brechen wir dann auf und besorgen uns etwas zum Essen.«
»Was, wenn sie zurückkommen?«, fragte der Junge.
»Na ja, das ist ganz einfach«, erwiderte Tess. »Wenn sie zurückkommen, legen wir sie um!«
Außerhalb von Livermore, Colorado
Als sie so dasaß und sich den Bauch rieb, wehte der Wind sanft durch Loris dickes, braunes Haar. Wieder ertappte sie sich dabei, Gefallen an dem alten Holzschaukelstuhl auf der Vorderterrasse ihres neuen Zuhauses zu finden. Travis und sie hatten die verlassene Ranch entdeckt, nachdem sie Horton und seinen Handlangern am internationalen Flughafen von Denver nur knapp entronnen waren. Einzig an diesen Momenten nachmittags auf der Veranda empfand sie so etwas wie Seelenfrieden. Sie hatte es aufgegeben, sich um richtigen Schlaf zu bemühen; zum Glück bot ihnen das Haus nicht nur Obdach, sondern war auch bestens mit Nahrung, Wasser, Medikamenten, Waffen und Melatonin ausgestattet. Letzteres ein natürliches Schlafmittel, das sie regelmäßig einnahm, um leichter zur Ruhe zu kommen, was ihr aber nur leidlich gut gelang. Schloss sie die Augen und dämmerte weg, wurde sie kurz darauf von wiederkehrenden Albträumen geplagt.
Travis musste von Gott geschickt worden sein, denn ohne ihn wären sie und ihr ungeborenes Baby nicht mehr am Leben. Gleich nachdem sie das Haus fanden, hatte er damit begonnen, es für sie herzurichten. Zuerst hatte er sich zur Aufgabe gemacht, es im Rahmen seiner Möglichkeiten abzusichern und einen Geheimraum mit Vorräten bestückt, falls Horton oder andere ungebetene Gäste anrücken würden. Seine Bestandsaufnahme der Lebensmittel las sich erfreulich, doch sie waren trotzdem nicht unendlich; sie würden annähernd neun Monate lang davon zehren können, ehe man sie wieder aufstocken musste. Ein weiteres Plus des Anwesens bestand darin, dass die früheren Bewohner einen Garten und eine große Menge Saatgut hinterlassen hatten. Travis’ Schätzungen zufolge stand das Haus auf einem Grundstück von knapp zehn Morgen. Auf diesem Land befanden sich neben der Ranch – einem einstöckigen Haus mit Holzfassade – eine Scheune von zweitausend Quadratfuß und zwei kleinere Schuppen als Nebengebäude. Die Scheune, eine Metallkonstruktion, stand voller Arbeitsgeräte, darunter ein Traktor, je drei Quads und Schneemobile, zahllose Werkzeuge und andere Gegenstände, die sich als nützlich erweisen könnten. Auf diesen Ort gestoßen zu sein, kam einem Lottogewinn gleich. Selbst die Männerkleidung, die sie gefunden hatten, passte Travis wie angegossen, sodass er sich endlich seiner Marineuniform entledigen konnte. Lori war jedoch realistisch und wusste, dass ihr Glück nicht ewig dauern würde.
Bislang unerwähnte Probleme, die unweigerlich zur Sprache kommen mussten, waren ihre Schwangerschaft, das Befinden ihres Ehemanns David und ihres Sohnes Eric sowie Travis’ Verlobte. Über sie hatte er zwar nicht viel gesprochen, doch Lori glaubte, dass er ihretwegen krank vor Sorge war. Ihre Aufgabe für heute stand fest: Sie würden gemeinsam anfangen, sich diesen Problemen zu stellen und einen Plan schmieden, um sie anzupacken.
Einer der Gründe für ihren beruflichen Erfolg hatte darin bestanden, dass sie niemals etwas unerledigt gelassen hatte. Standen noch irgendwelche Fragen offen, dann klärte sie diese. Die vergangenen Wochen waren für sie beide eine angenehme Flucht vor der Wirklichkeit gewesen, doch sie konnten sich nicht für immer hier verkriechen. Und sollte ihr Baby eine Chance erhalten, zu überleben, brauchten sie den Impfstoff R-59.
***
Als die Sonne den Horizont berührte und ein weiterer Tag zu Ende ging, beschloss sie, das Gespräch mit Travis jetzt zu führen.
»Ich bin müde«, meinte er, während er über einen großen Teller Nudeln herfiel, die sie gekocht hatte.
Lori saß ihm gegenüber an einem kleinen, runden Esstisch in der Mitte der geräumigen, offenen Küche und stocherte in ihrer Mahlzeit nur herum. Die Themen diskutieren zu wollen machte sie nervös, aber sie wusste, dass daran kein Weg vorbeiführte. Aufgrund einer gewissen Art, die sie an sich hatte, neigte sie dazu, viel Aufhebens zu machen, wo es gar nicht notwendig war. Dieser Eigenheit war sie sich vollends bewusst, deshalb überlegte sie lange und gründlich, wie sie die heiklen Punkte ansprechen sollte.
»Äh, Travis, ich denke, wir müssen uns mal unterhalten«, begann sie, während sie Spaghetti um ihre Gabel wickelte.
Im orangegelben Schein der Kerzen war ein reges Schattenspiel entstanden, und ein Beobachter hätte die Szene fast romantisch gefunden, obwohl sie für Lori auf merkwürdige Weise eher verstörend wirkte.
Travis nuschelte mit vollem Mund: »Worüber?«
»Ich wollte nicht darüber reden, solange du damit beschäftigt warst, das Haus für uns bereit zu machen und es einzurichten, aber wir müssen Dinge besprechen, die vielleicht nicht ganz so angenehm sind.«
Nun blickte er zum ersten Mal von seinem Teller auf und sagte: »Ich bin kein Kind mehr, also raus mit der Sprache.«
Verlegen lächelnd fing sie an: »Zuerst mein Mann und mein Sohn. Dass ich mir Gedanken um sie mache, dürfte dir klar sein. Ist dir mittlerweile etwas eingefallen, das wir tun können, um ihnen zu helfen?«
Er wischte sich den Mund mit einer Papierserviette ab und trank einen kräftigen Schluck Wasser. »Ich habe darüber nachgedacht, bisher aber ungern mit dir darüber geredet, weil ich glaube, dass es nicht viel gibt, was wir für sie tun können.«
»Wirklich?«
»Halt es dir doch mal vor Augen: Alles was du mir über den Kanzler erzählt hast, lässt mich zu dem Schluss gelangen, dass er die beiden entweder umgebracht hat oder gefangen hält, weil er darauf aus ist, sie gegen dich verwenden zu können, falls du je zurückkehren solltest. Das würde ich zumindest so tun. Er hat kein anderes Druckmittel gegen dich in der Hand außer deiner Familie. Sie zu töten würde ihm keinen Vorteil einbringen, aber das bedeutet nicht, dass er es nicht doch getan haben könnte, weil …«
»Weil was?«
»Weil du ihm die Tour vermasselt hast.«
Lori schnaufte beschwerlich. »Ich hatte keine andere Wahl, ich musste davonlaufen. Hätte ich einfach abwarten sollen, um sie zurückzuholen? Falls ihnen etwas zustößt, ist es allein meine Schuld. Ich wollte nicht, dass es so weit kommt, aber es ist einfach passiert. Wie hätte ich das ahnen können?«
»Lori, mach dich nicht selbst fertig. Natürlich wolltest du nicht, dass es so weit kommt, es hat sich einfach so ergeben. Du stehst nämlich in der Pflicht, dein ungeborenes Kind zu schützen.«
»Tue ich das? Ich meine, manchmal denke ich, dass ich ziemlich hoch pokere, was das angeht. Ich könnte ja … was wäre, wenn ich eine Fehlgeburt hätte? Was würde das alles dann noch bringen? Nichts.« Sie brach in Tränen aus, woraufhin ihr klar wurde, dass sie versuchte, ihn aufzuwühlen, aber eigentlich selbst diejenige war, die aufgeregt war.
»Du hattest deine Gründe, es war deine Entscheidung. Du kannst nicht zurückrudern und es dir anders überlegen. Uns bleibt jetzt nichts weiter übrig, als einen Ausweg zu suchen. Ich bin froh, dass wir darüber sprechen. Um ehrlich zu sein, habe ich selbst den richtigen Zeitpunkt abgewartet, um es auf den Tisch zu bringen. Ich wollte dich einfach nicht aufregen, aber so wie es aussieht, ist es ja schon geschehen.«
»Nein, nein, nicht deinetwegen. Es liegt an mir selbst – die Hormone.«
»Ach, und ich dachte, das ist bei Frauen allgemein so«, entgegnete er im Versuch, die Stimmung zu heben.
»Ha, ha, Witzbold«, gab sie mit verhaltenem Lächeln zurück.
»Da ist es ja wieder. Ich mag dein Lächeln.«
»Ich bin so frustriert. Dass wir keinen Plan haben, gefällt mir nicht. Ich hasse es, mich hilflos zu fühlen. Ich will für David und Eric stark sein.«
»Im Augenblick wüsste ich nicht, was du unternehmen könntest, ohne dein Baby zu gefährden.«
»Okay, sprechen wir darüber: Ich brauche dieses Mittel. Ich muss R-59 beschaffen. Wie sollen wir das hin bekommen?«
»Selbstverständlich habe ich mir in meiner unendlichen Weisheit eine mögliche Vorgehensweise überlegt, was das angeht«, sagte er, während er sich zurücklehnte und ein wenig den Angeber hervorkehrte.
»Mach’s nicht so spannend.«
»Siehst du? Das ist einer der Unterschiede zwischen Militärs und Zivilisten. Ihr regt euch über alles gleich dermaßen auf, wohingegen brenzlige Situationen für uns so alltäglich sind, dass wir sie herunterspielen und mit einem Lachen abtun können. Streng genommen lieben wir Soldaten Action. Aus diesem Grund haben wir uns überhaupt erst rekrutieren lassen.«
Ohne auf seine Gehässigkeit einzugehen, fragte sie: »Wie sieht denn jetzt deine Vorgehensweise aus?«
Travis beugte sich wieder nach vorne, stützte seine Ellbogen auf den Tisch auf und antwortete: »Es gibt eine Sache, auf die sich Marines etwas einbilden, nämlich die Liebe zu ihren Kameraden. Wenn wir kämpfen, tun wir es für unseren Nebenmann. Ich brauche nur an einen meiner guten Freunde zu gelangen, und dann kann ich den Impfstoff besorgen.«
Er machte eine Pause und grinste. Sie wartete darauf, dass er fortfuhr, doch das tat er nicht.
»Das ist alles?«
»Im Grunde ja.«
»Das ist keine konkrete Vorgehensweise, sondern nur eine grobe Idee.«
»Ach, du willst genaue Einzelheiten zur Mission?«
»Ja!«
»Die musst du nicht erfahren, ganz im Gegenteil: Mir wäre es lieber, wenn du nichts davon wüsstest.«
»Sei nicht dumm, ich will nicht, dass du dein Leben riskierst, weil du kopflos vorgehst, also weihe mich bitte ein.«
»Da du darauf bestehst«, erwiderte er und legte ihr seinen Plan dar. Er erzählte ihr von einem guten Bekannten – einem anderen Captain, mit dem er die Offiziersschule besucht hatte. Dieser gehörte einer Einheit an, die als aktive Sicherheitstruppe in den Notlagern des Heimatschutzes in Region VIII stationiert war.
Als Lori dies hörte, fragte sie: »Woher weißt du, wo genau er sich aufhält und ob er R-59 überhaupt besorgen kann?«
»Ich weiß nicht genau wo er ist, kenne aber seinen Stützpunkt, eine vorgezogene Operationsbasis südlich von Rapid City in Süddakota. Als die Lager größer wurden, zog man Militärverbände zur Verstärkung ab. Seine Einheit erhielt den Auftrag, die Sicherheitskräfte vor Ort zu unterstützen.«
»Und du weißt genau, wo sich dieser Stützpunkt befindet?«
»Relativ genau, ja.«
»Warum bist du dir so sicher, es bis dorthin schaffen zu können?«
»Das bin ich mir nicht.«
»Wird er dir wirklich helfen können?«
»Keine Ahnung, aber haben wir – hast du – eine andere Wahl? Ich werde losziehen und das Impfmittel für dein Baby besorgen. Wir können von Glück reden, weil wir noch Zeit haben, doch ich muss bald aufbrechen.«
Sie sah ihn verdutzt an.
»Wie du weißt, ist meine Verlobte irgendwo dort draußen. Jetzt, da ich außer Dienst bin, würde ich sie gerne finden, doch dir gegenüber fühle ich mich ebenfalls verpflichtet.«
Nun streckte sich Lori über die Tischplatte aus und nahm seine Hand. »Travis, das ist mir auch schon durch den Kopf gegangen, und ich halte es einfach nicht für richtig, mit dir hier zu sein, während die Liebe deines Lebens irgendwo dort draußen verschollen ist.«
»Mir gefällt das auch nicht, aber solche Opfer müssen Militärs eben bringen, wenn sie sich einziehen lassen. Ich habe einen Eid abgelegt, mein Land zu verteidigen, doch dieses Land gibt es jetzt nicht mehr. Ehe ich mich versah, landete ich gemeinsam mit dir an diesem Ort. Und jetzt habe ich eben die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass du mit deinem Baby sicher bist.«
»Ich sollte dich begleiten.«
»Nein, da draußen ist es zu gefährlich.«
»Aber wie soll das funktionieren? Ich kann doch nicht allein hierbleiben.«
»Lori, ich bin fast fertig damit, dieses Grundstück so auszubauen, dass dir hier nichts passieren kann. Ich werde nicht allzu lange fort sein. Sobald ich mit dem Impfstoff zurückgekehrt bin, können wir vielleicht in Erwägung ziehen, dass du Tess gemeinsam mit mir suchst, aber dich jetzt mitzunehmen, käme mir einfach falsch vor.«
Er legte seine Hand auf ihre und drückte sie. Er hatte Lori zwar gerne um sich und fand sie attraktiv, doch seine Zuneigung hatte sich von simpler Anziehung zu einem Bewusstsein entwickelt, auf sie aufpassen und sich um ihr Wohlergehen kümmern zu müssen.
Lori biss sich auf die Zunge; sie hatte sich so sehr daran gewöhnt, immer ihren Willen durchzusetzen oder ihren Standpunkt bis zum Erbrechen geltend zu machen. Er war ihr eine große Hilfe und sehr liebenswürdig gewesen, wie konnte sie da seinen Plan anfechten? Eigentlich gab sie ihm ja auch Recht, denn hierzubleiben war für ihr Baby die beste Entscheidung.
Sie erschraken beide, als plötzlich eine Autotür zugeschlagen wurde.
Travis drehte seinen Kopf ruckartig in die Richtung, aus der das Geräusch gekommen war, und lauschte angespannt.
»Hast du …«, begann Lori.
»Pst«, unterbrach er sie und blies augenblicklich die Kerzen aus.
Draußen wurden noch mehr Autotüren zugeschlagen. Er sprang vom Tisch auf, griff zu seiner Pistole und dann nach Loris Arm.
»Was?«
»Ins Versteck!«
Sie ließ ihn einfach die Führung übernehmen.
Die beiden liefen den Flur hinunter und stürzten durch die erste Tür links in einen Büroraum. Dort öffnete er einen Schrank, schob die darin hängenden Kleider beiseite und drückte fest gegen die Hinterwand. Ein Stück von vier mal vier Fuß sprang heraus, denn es war mit einem Magnetgelenk befestigt worden.
»Schnell, rein da!«, drängte er sie.
Sie tat, was er verlangte und kroch hastig durch die Öffnung. Travis hatte den Raum aus je einem Teil der Schränke im Büro und einem angrenzenden Schlafzimmer abgetrennt. Die falschen Wände bestanden aus Materialien, die er in der Scheune gefunden hatte. In dem Raum konnte man sich relativ bequem verstecken. Im Boden befand sich eine Falltür, die in einen Tunnel unter das Haus führte. Durch diesen konnte man kriechen, um unbemerkt zu fliehen. Sowohl im Versteck als auch darunter lagen Nahrung, Wasser, Feuerwaffen, Taschenlampen, Decken, zusätzliche Kleidung und Hygieneartikel bereit, allen voran Toilettenpapier und ein Eimer, die bei der Armee auf dem Feld häufig vergessen wurden, wie Travis nur zu gut wusste.
»Da ist alles drin, was du brauchst, um es bis zu einer Woche lang auszuhalten. Ich komme zurück, sobald die Luft rein ist«, versprach er, bevor er das Wandstück wieder einsetzte.
»Halt«, rief sie aufgeregt.
Er stockte und sah Lori an, die in der Nische kauerte. »Was ist denn noch?«
»Pass auf dich auf!«
»Immer doch«, antwortete er, zwinkerte und schloss sie ein.
Sie steckte ihren Kopf zwischen die Knie und fing an zu beten.
Travis rückte alles so zurecht, dass es wieder wie ein normaler Schrank aussah, und ging ins Wohnzimmer, um dort aus dem großen Fenster zu schauen. Draußen sah er im schwachen Licht des aufgehenden Mondes zwei Pickups neben der Scheune, aber keine Spur von deren Insassen. Sein Herz raste, und sein Instinkt sagte ihm, dass es nur noch eine Frage von wenigen Momenten sei, bis er auf jemanden stieß. Er wusste, eine solche Situation überstand man am ehesten, indem man einfach ruhig abwartete. Die Ausbildung im Marinekorps hatte ihn gelehrt, dass man in der Abwehr neun Mal höhere Chancen hatte als in der Offensive. Mit dieser Kenntnis legte er sich im hinteren Schlafzimmer auf die Lauer. Als er dort im Dunkeln wartete, wünschte er sich ein Nachtsichtgerät, behalf sich aber seiner anderen Sinne und lauschte aufmerksam.
Er schreckte auf, als er unverständliches Geflüster von der Scheune her hörte. Vermutlich, so dachte er, handelte es sich lediglich um Plünderer, die es nicht auf einen Kampf anlegten.
Während er geduldig darauf wartete, dass sie sich am Hauptgebäude zu schaffen machten, dachte er an Lori, ihre jüngste Unterhaltung, und nach kurzer Zeit auch an Tess. Kein Tag verging, an dem er sich nicht um sie sorgte. Er vermisste sie und bedauerte gewissermaßen, in Loris Schwierigkeiten verwickelt worden zu sein, doch sein Handeln hatte sich einfach aus einem Bauchgefühl heraus ergeben.
Nach einiger Zeit – er wusste nicht, wie viele Minuten verstrichen waren – kam der Moment, den er vorausgesehen hatte, und zwar lautstark. Die Eingangstür gab einem kräftigen Schlag nach, woraufhin es im Flur schepperte, als Glas und Holz zu Bruch gingen. Travis bemühte sich, ruhig zu atmen, und legte eine Flinte auf das Fußende des Bettes. Die Waffe, ein Remington 870 Vorderschaft-Repetiergewehr, verfügte über einen zwanzig Zoll langen Lauf mit Magazinrohrverlängerung. Er war auf alles gefasst, womit man ihn angreifen würde.
Mehrere Stimmen wurden über den Flur und von den Wänden weitergetragen.
Lori saß zitternd in ihrem Versteck. Als die Tür aufgeflogen war, hatte sie einen Satz gemacht und schnell zu einem Revolver gegriffen, den sie vorher auf einer Kiste gesehen hatte. Der kleine Verschlag war so dunkel, dass sie kaum etwas erkennen konnte, und im Finsteren zu hocken, machte sie umso ängstlicher. Sie konzentrierte sich darauf, nicht panisch zu werden.
Anhand der Stimmen erkannte Travis, dass es sich um Männer handelte – mindestens vier, schätzte er.
Sie lachten und polterten durch das Wohnzimmer. Als sie die Küche erreichten, wurden sie plötzlich still.
Travis sah die Lichtkegel ihrer Taschenlampen über die Wände, den Boden und die Decke entlanghuschen. Warum sie auf einmal schwiegen, war ihm sofort klar: Sie hatten die Teller mit dem frisch zubereiteten, noch warmen Essen auf dem Küchentisch entdeckt!
»Ist hier jemand?«, rief ein Mann so laut, dass seine Stimme durch den Flur schallte.
Lori verkrampfte sich, als sie ihn hörte. Wieder betete sie, dieses Mal aber ausschließlich für Travis Unversehrtheit.
Er bekam mit, dass sich die Männer leise besprachen.
»Hey, wir wissen, dass jemand da ist«, rief der Mann. »Hier stehen noch warme Nudeln. Kommt raus, wir wollen euch nichts Böses. Die Bransons, denen dieses Land gehört, sind unsere Nachbarn.«
Travis glaubte ihm nicht.
»Ihr seid zu zweit, wir zu fünft. Kommt raus!«, verlangte der Fremde.
Lori presste ihre Lippen fest aufeinander und klammerte sich an die Pistole.
»Ich schlage euch was vor: Wir lassen euch einfach wieder allein«, sagte der Mann. »Wir wollen keinen Ärger, kommen aber morgen noch einmal zurück, um Hallo zu sagen.«
Nach weiterem Hin und Her, das Travis nicht verstand, hörte er Schritte. Nicht lange danach sprangen die Motoren der Pickups an.
Da er sich nicht sicher war, ob sie sich wirklich verzogen hatten, blieb er einfach sitzen.
***
Stunden waren vergangen, seit Travis die Wagen hatte davonfahren hören. Nun, da er glaubte, sich ohne Gefahr umschauen zu können, erhob er sich langsam und verließ vorsichtig den Raum. Langsam, Schritt für Schritt, ging er über den Teppich auf dem Flur. Dort wo er ins Wohnzimmer führte, fiel genügend Mondlicht ein, um zu erkennen, dass dieses wirklich leer war. Er zog eine Taschenlampe hervor und schaltete sie ein, ihr Strahl erhellte den Raum und bestätigte seine Vermutung. Niemand da. Nun untersuchte er die beschädigte Haustür und das durchwühlte Wohnzimmer. Dabei dachte er plötzlich an Lori, die immer noch allein und verängstigt in ihrem dunklen Versteck saß. Als er sich an der Schrankwand zu schaffen machte, schrie sie auf: »Travis?«
»Ja, ich bin’s, tut mir leid, ich hätte dich vorwarnen sollen.« Nachdem er das Paneel herausgenommen hatte, beugte er sich zu ihr hinein.
Sie atmete erleichtert auf und nahm seine Hand. Als sie aufstehen wollte, stellte sie fest, dass ihre Beine eingeschlafen waren.
»Alles okay mit dir?«, fragte Travis.
»Nein, gar nichts ist okay!«
Er half ihr dabei, sich durch die enge Öffnung zu zwängen, und trug sie anschließend in das hintere Schlafzimmer, wo er sie auf das Bett legte.
»Entschuldige, du musstest sehr lange da drin bleiben, aber ich wusste einfach nicht, ob sie wirklich alle verschwunden waren, als ich ihre Autos wegfahren hörte.«
»Schon gut. Mir war schon klar, dass du sicher sein wolltest.«
Er brachte ihr eine Flasche Wasser, und während sie sich ausruhte, ließen sie die Geschehnisse des Abends Revue passieren, nicht zu vergessen die Tatsache, dass die Unbekannten am Morgen zurückkehren wollten.
»Was tun wir jetzt am besten?«, fragte Lori.
»Wir haben zwei Optionen: Entweder bleiben wir und stellen uns – sie könnten ja tatsächlich harmlos sein – oder wir fliehen, bloß wüsste ich nicht wohin.«
»Warum haben sie sich nicht die Mühe gemacht, uns zu suchen?«
»Weil sie nicht dumm sind. Sie haben geahnt, dass wir auf sie warten würden. Solange ich es nicht müsste, würde ich auch nicht nach jemandem suchen.«
»Wie können wir uns denn fünf Männer vom Leib halten? Was, wenn sie noch mehr Leute mitbringen?«
»Mag sein, dass sie auch überhaupt nicht wiederkommen«, stellte Travis in Aussicht. »Möglicherweise war es nur eine leere Drohung, und sie lassen sich nie mehr blicken, weil sie selbst um ihr Leben fürchten. Wir haben in dieser Hinsicht tatsächlich einen Vorteil.«
»Ich finde, wir sollten abhauen.«
Travis setzte sich auf die Bettkante und sah Lori an; ein Teelicht beleuchtete ihr Gesicht und ließ ihre Augen schimmern. In diesem Moment kam er sich schwach vor und wollte sie am liebsten küssen. Er widerstand dem Drang zwar, fragte sich aber, wieso ihn diese Empfindung plötzlich überkam. Lag es daran, dass sie so schutzbedürftig war? Oder fühlte er sich wirklich zu ihr hingezogen? Aber was war mit Tess? Unvermittelt stand er auf und sagte: »Reden wir morgen darüber. Schlaf jetzt ein wenig.« Dann ging er hinaus.
Lori fühlte sich von seinem abrupten Aufbruch vor den Kopf gestoßen, und während sie dalag, überlegte sie, was er wohl plötzlich hatte. Da sie zu aufgedreht und ängstlich zum Einschlafen war, stand sie auf und suchte Travis. Als sie ins Wohnzimmer kam, saß er in einem breiten Sessel im Mondlicht.
»Ist alles in Ordnung bei dir?«, fragte sie.
»Ja, absolut. Ich dachte nur, du bräuchtest vielleicht ein bisschen Ruhe.«
»Sicher?«
»Ja, mit mir ist nichts«, behauptete er und wechselte prompt das Thema: »Ich habe den schweren Bauernschrank vor die Haustür geschoben. Außerdem werde ich hier schlafen, einfach sicherheitshalber.«
Sie legte eine Hand auf seine Schulter und erwiderte: »Ich wiederhole mich zwar, aber ich finde, dass ich mich gar nicht oft genug bei dir bedanken kann. Du hast mir das Leben gerettet und tust es immer wieder. Ich weiß nicht, was wir ohne dich tun würden.«
»Keine Ursache.«
»Wie kann ich mich je dafür erkenntlich zeigen?«
»Dazu besteht kein Anlass. Du musst jetzt unbedingt ein bisschen schlafen.«
»Travis, ich bin kein Kind mehr und weiß, wann ich Ruhe brauche.«
»Das habe ich mir schon fast gedacht.«
»Ist Denken denn keine schwierige Aufgabe für Marines?«
Sie grinste, doch er ließ sich nicht darauf ein. »Ich finde, wir sollten morgen früh verschwinden. Wir nehmen den alten Minivan hinter dem Haus und verziehen uns.«
Sie setzte sich auf den Couchtisch und starrte Travis an.
»Findest du den Plan gut?«, hakte er nach.
»Ja, ich würde sagen, wir brechen unsere Zelte hier ab und machen uns gemeinsam auf die Suche nach deinem Freund. Und danach finden wir Tess.«
Er beugte sich nach vorne und seufzte. »Wenn ich aber sage, dass wir verschwinden, fällt mir ein, dass es unterwegs gefährlicher sein könnte als hier. Ich bringe mich selbst durcheinander.«
»Das brauchst du nicht. Wir brechen morgen früh auf – packen zusammen, so viel wir können, und hauen ab.«
Er schaute sie wieder an. »Dann steht der Plan also fest?«, fragte er. »Wir verlassen diesen Ort und fahren in Richtung Rapid City?«
Sie legte ihre Hand erneut auf seinen Oberarm und sagte mit sanfter Stimme: »Wir sitzen beide im selben Boot. Lass uns Verbindung zu deinem Freund aufnehmen, den Impfstoff besorgen und anschließend deine Verlobte suchen.«
»Und was wird aus David und Eric?«
»Ich muss einfach fest daran glauben und hoffen, dass der Kanzler sie nicht umbringt«, antwortete sie ohne Zögern. »Und wenn der richtige Zeitpunkt kommt, werde ich versuchen, sie zu befreien.«
»Was tust du, falls er sie schon getötet hat?«, fragte Travis.
»Dann kann ich mir das sparen. Mein Baby und ich werden an irgendeinem sicheren Ort unterkommen und weiterleben.«
»Das ist alles?«
Während sie Travis ernst anschaute, versicherte sie: »Glaub mir, falls er sie umgebracht hat und ich die Chance erhalte, ihm ihren Tod mit gleicher Münze heimzuzahlen, werde ich das tun!«
Internationaler Flughafen von Denver
Horton hielt sich das Telefon mit einigem Abstand ans Ohr – nicht weil es zu laut war, sondern weil er kein weiteres Wort mehr von dem hören wollte, was der Anrufer von sich gab. Er war es leid, sich sagen zu lassen, was er tun sollte, was er anders angehen müsste oder falsch gemacht hatte. Als er Jahre zuvor zum Kanzler gewählt worden war, hatte er sich mehr Entscheidungsgewalt erhofft. Nie hätte er geglaubt, dass der Rat die gesamte Operation mit detaillierten Vorgaben leiten würde. Am meisten aber ärgerte er sich darüber, Lori verloren zu haben. Nicht, weil er keine andere Lebensgefährtin hätte finden können, es lag eher daran, dass er nicht in der Lage gewesen war, sie aufzuhalten – ein extrem peinlicher Fauxpas, der ihn fast seinen Stellung gekostet hatte. Da die paar Geheimnisse, die sie kannte, mittlerweile nutzlos waren, bestand keine Eile, sie zu finden. Der Plan zur Säuberung war im vollen Gange – die Katze im Wesentlichen aus dem Sack gelassen. Lori zu schnappen, zählte nicht zu den Operationszielen, sondern hatte eine persönliche Bewandtnis.
In den Wochen nach ihrer Flucht war er damit fortgefahren, die sogenannte Säuberung durchzuführen. Es ging voran, doch eine zweistellige Millionenzahl von Menschen erschießen zu lassen, dauerte eben seine Zeit. Ihm schwebte eine selektive Tötung vor. Er wollte die Besten und Gescheitesten verschonen – diejenigen mit verwertbaren Fertigkeiten. Außerdem war er entschlossen, sich Zeit zu nehmen, um sicherzugehen, dass alle Lagerbewohner vorher DNS-Proben abgaben. Wer die Tests bestand, durfte am Leben bleiben. Sein System funktionierte auf eine schlichte Art und Weise: Es gab eine Elite, der auch Horton angehörte, die Kriegerklasse, die Auserwählten und die Arbeiterklasse. War die DNS von jemandem unbrauchbar oder die Person selbst wertlos, wurde sie als Belastung betrachtet und beseitigt. Leider erschwerte sein Auswahlverfahren die Säuberung in Nordamerika ein wenig, und dies passte dem Rat nicht, daher dieser Anruf.
Er schaute sich in seinem edel eingerichteten Büro um, während die Stimme in der Leitung weiter auf ihn einredete. Horton verehrte und bewunderte die Kunstwerke, die er gesammelt hatte, nicht nur die Gemälde, sondern auch die Skulpturen. Eine Machtposition innezuhalten, ermöglichte ihm einen gewissen Luxus und gab ihm Privilegien, wozu auch das Anhäufen von Kunstwerken aus der früheren Welt gehörte. Er ließ die alten Museen von seinen Angestellten durchforsten, um eine Kollektion zusammenzustellen, die ihresgleichen suchte.
Sein Gesprächspartner wurde langsam lauter, was Horton unangenehm war und ihn unsanft in die Realität zurückholte.
»Ja, ich bin noch am Apparat«, sagte er betont ruhig in die Sprechmuschel. »Sicher verstehe ich das. Sofort, danke und auf Wiederhören.« Er schaute auf den nunmehr stillen Hörer und wollte auflegen, schleuderte ihn jedoch, kurz bevor er die Station berührte, wutentbrannt quer durch das Zimmer. Dann stand er auf, ging zu einem Schränkchen und öffnete dessen furnierte Tür. Darin standen ein Dutzend Kristallkaraffen mit erlesenstem Scotch und anderen Whiskeys. Er zog eine niedrige, gedrungene Flasche hervor, nahm ein Glas und ging damit zur Couch, deren Lederpolster schokoladenbraun war. Nachdem er sich niedergelassen hatte, schenkte er sich ein Glas ein und wollte sich entspannen. Doch kaum dass er einmal genippt hatte, läutete es. Er knurrte genervt und rief: »Ja? Wer ist da?«
Die Tür ging auf, und im Rahmen stand Roger Wilcox, sein neuer Stabschef. »Sir, die Personen, nach denen Sie verlangt haben, sind jetzt vor Ort.«
Horton rieb sich die Augen und überlegte, wen er meinen konnte. Da ihm kein Licht aufging, fragte er: »Nach wem habe ich denn verlangt?«
»Sir, David und Eric …«
Nun riss er die Augen weit auf. Die Namen halfen seinem Gedächtnis sofort auf die Sprünge. Er fuhr hoch und entgegnete: »Gut, gut. Bringen Sie sie sofort zu mir.«
Roger nickte und schloss die Tür. Einen Augenblick später öffnete er sie wieder und kam mit David und Eric herein.
Horton ging mit ausgestreckter Hand auf sie zu und begrüßte sie: »Meine Herren, vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Ich weiß dies wirklich zu schätzen.«
David sah ihn argwöhnisch an, schüttelte seine Hand aber dennoch. Er wusste, eine Hand wäscht die andere, und es war wichtig, gute Beziehungen zu pflegen, vor allem mit dem Kanzler. »Mr. Horton, was können mein Sohn und ich für Sie tun?«
»Bitte treten Sie ein und nehmen Sie Platz. Darf es etwas zu trinken oder zu essen sein?«, fragte der Kanzler.
David und Eric schüttelten beide den Kopf.
Nun saßen sie zu dritt im vorderen Gesellschaftszimmer. Die ersten Momente verstrichen in betretener Stille mit verlegenen Blickwechseln, doch Horton wirkte dem rasch entgegen, indem er die Initiative ergriff und direkt auf den Punkt kam. »David, wissen Sie, wo Ihre Frau ist?«
»Verzeihung, ich wusste gar nicht, dass Sie sie vermissen«, erwiderte der Mann mit erstaunter Miene.
»Doch, sie hatte sozusagen einen Nervenzusammenbruch und machte sich einfach davon. Wir vermuteten, sie habe versucht, Sie in Camp Sierra zu erreichen.«
David schaute Eric an, ehe er sich wieder Horton zuwandte und sagte: »Nein, wir haben sie nicht gesehen. Geht es ihr denn gut?«
»Leider nicht, glaube ich. Sie wissen ja, dass sie schwanger ist, und ich kann es mir nicht erklären, doch sie geriet plötzlich einfach ganz außer sich und floh aus der Basis. Wir machen uns Sorgen um sie und das Befinden ihres Babys, denn sie war ein wichtiger Teil unseres Architektenteams für Arcadia.«
»Wann genau ist sie denn verschwunden?«, fragte Eric.
Horton öffnete den Mund und war drauf und dran, die Wahrheit preiszugeben. Dann aber log er, weil er glaubte, die wirklichen Begebenheiten würden sich seltsam anhören. »Vor ein paar Tagen. Seitdem suchen wir nach ihr, stehen aber nach wie vor ohne einen Anhaltspunkt da. Sie hat sich praktisch in Luft aufgelöst.«
»Meinst du, sie ist zum Camp gekommen, um uns zu treffen?«, fragte Eric seinen Vater.
»Das ist alles meine Schuld«, sagte dieser in düsterem Tonfall.
Die Bemerkung machte Horton hellhörig. »Warum sagen Sie das?«
»So wie wir beide auseinandergegangen sind … Ich, äh, war nicht sonderlich nett zu ihr. Sie wissen bestimmt, was ich ihr im Zusammenhang mit Ihnen vorgeworfen habe, oder?«
»Ja, aber dass ist mir gleichgültig. Allerdings fiel mir ungefähr zu jener Zeit auf, dass es emotional sehr bergab ging mit ihr. Es kostete uns große Mühen, sie zum Arbeiten zu bewegen. Irgendwann bekam sie Wahnvorstellungen und dann hatte sie sich auch schon davongemacht.«
»Gibt es irgendetwas, das wir tun können?«, fragte Eric.
»Ja, durchaus«, antwortete Horton.
Vater und Sohn erweckten den Eindruck, unbedingt helfen zu wollen.
»Sie beide müssen hierbleiben. Wir werden für Sie sorgen und auch eine Arbeit für Sie finden. Ihre Sachen lassen wir herbringen.«
»Aber sagten Sie nicht, sie sei wahrscheinlich unterwegs zum Lager, um uns zu suchen?«, hakte David nach. »Wäre es da nicht besser, wenn wir dort bleiben würden.«
»Sie wollten doch wissen, ob Sie etwas tun können, und das Beste wäre, Sie bleiben hier.«
David und Eric wechselten einen Blick, bevor sie zustimmend nickten. »Na gut.«
Horton hätte ihnen am liebsten alles erzählt, sie mit der Wahrheit konfrontiert und dann töten lassen, aber er riss sich zusammen. Sein Groll gegen den Rat trieb ihn dazu, das genaue Gegenteil dessen zu tun, was er gefühlsmäßig vorhatte. Falls es ihm gelang, die Flüchtige ausfindig zu machen, stellten sich die beiden vielleicht noch als nützlich heraus. Er würde sie gegen Lori einsetzen können. Der Rat hatte ihm aufgetragen, über seine persönlichen Rachegelüste hinwegzukommen, doch sich im Zaum zu halten, war ihm aus tiefster Seele zuwider. Er wollte seinen Vorgesetzten die Stirn bieten … er wollte Lori finden, damit sie dabei zusehen konnte, wie ihr Ehemann und Sohn vor ihren Augen starben. Nie in seinem Leben hatte ihn jemand emotional dermaßen aus der Fassung gebracht wie sie. Er konnte es sich nicht erklären, weshalb er sich von ihr so stark angezogen fühlte. Doch dass sie ihm die kalte Schulter gezeigt hatte, wusste jeder, und die Probleme, in die er ihretwegen geraten war, mussten vergolten werden. Nach so vielen Jahren disziplinierter Geduld und Planung, die er durchgestanden hatte, konnte er sich dieser Sache einfach nicht auf pragmatische Weise nähern. Das Bedürfnis, Lori zu finden und es ihr heimzuzahlen, war wie ein Feuer, das heiß in seiner Brust loderte.