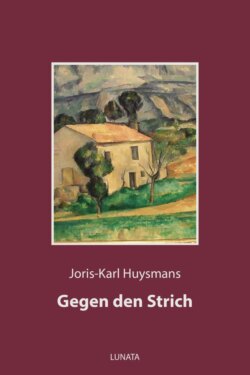Читать книгу Gegen den Strich - Joris-Karl Huysmans - Страница 8
Erstes Kapitel
ОглавлениеMehr als zwei Monate vergingen noch, bevor sich Herzog Jean in die stille Zurückgezogenheit seines Häuschens in Fontenay vergraben konnte. Einkäufe aller Art nötigten ihn, noch eine Weile in Paris zu verbleiben und die Stadt oft von einem Ende bis zum andern zu durchlaufen.
Lange hatte er nachgeforscht und gegrübelt, ehe er die neue Wohnung endlich den Tapezierern überlassen konnte.
Vormals, da er noch schöne Frauen zu sich kommen ließ, hatte er ein Boudoir nach seiner Angabe einrichten lassen, wo sich inmitten kleiner geschnitzter Möbel aus hellem japanischen Kampferholz unter einem Zelt von indischem Rosa-Atlas der nackte Körper beim künstlichen Wiederschein des bauschigen Stoffes noch zarter färbte.
Jenes Gemach, dessen große Spiegel sich beständig reflektierten und so eine ganze Reihe von Rosa-Boudoirs darstellten, war bei den Damen der galanten Welt sehr berühmt gewesen; denn es machte ihnen grosses Vergnügen, ihre Nacktheit in dieses sanfte Inkarnat zu tauchen, wie auch den starken Duft der Möbel einzuatmen.
So hatte er unter anderem aus Hass und Verachtung seiner Kindheit unter dem Plafond dieses Boudoirs einen kleinen Käfig aufgehängt, in dem ein kleines Heimchen zirpte, wie er’s oft in der Asche der hohen Kamine im Schlosse Lourps gehört, während jener langen stillen Abende, die er bei seiner Mutter zubringen musste; und die Erinnerung daran, wie an das Alleinsein in seiner traurigen Jugend stieg in wirrem Durcheinander vor ihm auf. Bei den Bewegungen des Weibes, welches er liebkoste, und dessen Geschwätz oder Lachen seine Vision verscheuchte und ihn plötzlich in die Wirklichkeit versetzte, – in diesem so weltlichen Boudoir entstand ein Kampf in seiner Seele, ein Bedürfnis, alle die erlittenen Trübsale zu rächen, eine Wut, durch schändliche Gemeinheiten die Familienerinnerungen zu besudeln, das rasende Verlangen, auszukeuchen auf diesem Menschenleib, bis zum letzten Tropfen die wahnsinnigsten der sinnlichen Verirrungen auszukosten.
Dann wieder einmal, wenn der Spleen ihn packte und wenn bei nassem Herbstwetter der Widerwille gegen sein Heim und gegen den trüben wolkenschweren Himmel draußen ihn erfasste, dann flüchtete er sich an das verborgene Plätzchen, bewegte leise den Käfig und beobachtete, wie derselbe sich rings herum unzählige Male widerspiegelte, bis es seinen trunkenen Augen endlich vorkam, als ob der Käfig sich nicht mehr bewegte, dass aber das ganze Boudoir schwanke und sich drehe wie in einem sanften rosa Walzer.
Ein anderes Mal, als Jean des Esseintes sich wieder durch seine Sonderbarkeit auszeichnen wollte, hatte er ein Möblement nach seltsamem Geschmack zusammengestellt. Er teilte seinen Salon in eine Reihe von Nischen, die alle verschieden ausgeschmückt waren und die miteinander vereinigt werden konnten. Es waltete hier eine tolle Übereinstimmung von freundlichen und düstern, von zarten und krassen Farben. Dann ließ er sich in einer dieser Nischen nieder, deren Dekoration ihm am besten mit der Eigenart des Werkes, welches er gerade las, zu harmonieren schien.
Schließlich hatte er noch einen hohen Saal herrichten lassen, in dem er seine Lieferanten empfing. Sie mussten sich nebeneinander in eine Art von Kirchenstühlen setzen. Hier bestieg er eine hohe Kanzel, von der herab er ihnen eine Predigt über die Eitelkeit und das Geckentum der Welt hielt. Er forderte von hier aus seinen Schuhmacher und Schneider feierlich auf, sich aufs genaueste nach seinem päpstlichen Schreiben hinsichtlich des Schnittes zu richten, wobei er sie mit einem pekuniären Kirchenbann bedrohte, so sie nicht die in seinem väterlichen Ermahnungsschreiben und seinen Encykliken gegebenen Anweisungen buchstäblich zur Ausführung brächten.
So erlangte er bald den Ruf eines höchst exzentrischen Menschen, den er dadurch zu krönen suchte, dass er sich Anzüge aus weissem Samt anfertigen ließ; wie er auch Westen aus Goldbrokat trug und statt der Krawatte einfach einen großen Veilchenstrauss in den weiten Ausschnitt seines Hemdes steckte. Dann gab er den Literaten oft großartige Diners, unter anderem ein Trauerdiner nach dem Muster des achtzehnten Jahrhunderts, um ein ganz unbedeutendes kleines Missgeschick, das ihm zugestoßen, klassisch zu feiern.
Der Esssaal war ganz schwarz ausgeschlagen. Er führte nach dem völlig umgestalteten Garten hinaus, dessen Alleen zu diesem Zweck mit feinem Kohlenstaub bestreut waren; das kleine mit Basaltstein umrandete Wasserbecken war mit schwarzer Tinte gefüllt, die Gebüsche bildeten Fichten und Zypressen. Die Mahlzeit wurde auf einem schwarzen Tischtuch serviert, auf dessen Mitte sich Blumenkörbe, mit Veilchen und Skabiosen gefüllt, befanden. In hohen Kandelabern brannten grünliche Flammen, und Wachskerzen in Armleuchtern erhellten den Saal. Ein unsichtbares Orchester spielte Trauermärsche, und die Gäste wurden von nackten Negerinnen, bekleidet mit Pantoffeln und kleinen Strümpfen aus Silbergewebe, die mit glänzenden Kügelchen besäet waren, bedient.
Man ass von Tellern mit schwarzem Rande: Schildkrötensuppe, russisches Schwarzbrot, reife türkische Oliven, Kaviar, Seebarben (ein im Süden von Frankreich sehr beliebtes Gericht), Wildbret in schwarzer Sauce, so schwarz als wär’s Lakritzensaft und Stiefelwichse, Trüffelpüree, Schokoladenpudding, dem dann ganz dunkle Blutpfirsiche, blauschwarze Trauben, Maulbeeren und schwarze Kirschen folgten. Man trank aus dunklen Gläsern die Weine von Limagne und Roussillon, von Tenedos, Val de Peñas und Porto und labte sich schließlich nach dem Kaffee mit Nussschnaps, Kwas, Porter und Stout.
Die Einladungen zu diesem Diner waren auf Papier mit breitem, schwarzem Trauerrand geschrieben.
Aber diese Extravaganzen und Tollheiten, in denen er früher seinen Ruhm suchte, hatten sich erschöpft.
Heute gedachte er nur mit Verachtung jener kindischen Albernheiten und veralteten Prahlereien, jener absurden Kleidung und seltsamen Ausschmückungen seiner Wohnung. Jetzt beabsichtigte er, sich einfach ein bequemes Heim zu seinem persönlichen Vergnügen zu schaffen und nicht das Staunen anderer zu wecken. Er hatte jetzt nur vor, sich eine ruhige, wenn auch barocke Wohnung einzurichten, die sich für seine künftige einsame Lebensweise am besten eignen sollte.
Als das Haus in Fontenay von seinem Architekten schließlich hergestellt und nach seinen Wünschen und Plänen eingerichtet war, und als ihm nur noch die innere Ausschmückung zu erledigen übrig blieb, da stellten sich ihm die ersten Schwierigkeiten in den Weg.
Das was er wollte, waren nämlich Farben, welche beim Lampenlichte Stich hielten. Ob sie bei Tage hart oder unschön, war ihm gleich, da er die Nacht zum Tage zu machen gedachte, da er sich sagte, dass man dann erst ganz allein sei, und der Geist erst wirklich bei der näheren Berührung der Schatten der Nacht belebt und erregt werde. Er fand eine gewisse Befriedigung darin, sich ganz allein in einem großen, hell erleuchteten Raume aufzuhalten, während alles um ihn herum wie ausgestorben war.
Sorgfältig überlegend wählte er die Farben.
Blau wird bei Licht ein ungewisses Grün; und wenn es Kobalt oder Indigoblau ist, so wird es schwarz aussehen; ist es hell, so verändert es sich in grau, und ist es blau wie der Türkis, so nimmt es eine trübe eisige Färbung an, es sei denn, dass man es mit einer anderen Farbe mischt; sonst kann man es kaum in einem Raum verwerten. Andererseits nimmt das Eisengrau ebenfalls eine unfreundlich schwere Färbung an; Perlgrau verliert seine Zartheit und verwandelt sich in schmutziges Weiss; Braun wirkt trübe und erkaltend; und was Dunkelgrün, Kaisergrün und Olivengrün anbelangt, so hat es denselben Nachteil wie Dunkelblau und verschmilzt mit Schwarz; bleiben also nur noch die blassgrüneren Farben, wie Pfauengrün, dann Zinnober, die Lackfarben, hier aber verjagt das Licht das Blau und lässt das Gelb hervortreten, welches wieder einen unnatürlich verschwommenen Ton annimmt.
Es war auch nicht daran zu denken, Lachsfarbe, Maisgelb oder Rosenrot zu nehmen, denn diese weichen Farben standen im Widerspruch mit den Gedanken seiner Abgeschiedenheit; unmöglich war ebenfalls Veilchenblau, da es bei Licht verschwimmt und das Rot darin allein des Abends hervortritt, doch was für ein Rot! Dick und klebrig! Es schien ihm außerdem überflüssig, zu dieser Farbe seine Zuflucht zu nehmen, denn wenn man ein wenig Santonine einmischt, so erscheint es violett; diese Farbe ist nicht leicht zur Wandbekleidung zu verwenden.
Er nahm daher von diesen Farben Abstand, und so blieben ihm nur noch drei übrig: Orangegelb, Zitronengelb und Rot.
Er zog das Orangegelb vor, indem er durch sein eigenes Beispiel die Wahrheit einer Theorie bestätigte, welche er im Übrigen für mathematische Richtigkeit erklärte: nämlich, dass eine Harmonie zwischen der sinnlichen Natur eines Menschen, der wirklich Künstler ist, und der Farbe existiert, welche sein Auge besonders lebhaft sieht.
Wenn man die große Menge beiseitelässt, deren grobe Netzhaut weder die eigenartige Harmonie der Farben bemerkt, noch den geheimnisvollen Reiz ihrer Abstufungen und ihrer Zusammenstellung kennt; wenn man gleichfalls die Bürger-Philister beiseitelässt, welche unempfänglich für die Pracht und den Sieg der starken kräftigen Nuancen sind, und um sich nur auf diejenigen zu beschränken, deren Augen durch Literatur und Kunst verfeinert sind, so erscheint es zweifellos, dass das Auge desjenigen, der Ideales träumt und der Illusionen bedarf, gewöhnlich eine Vorliebe für Blau und dessen Abstufungen, sowie für die lila und perlgraue Farbe habe, vorausgesetzt, dass diese Nuancen weich und verschwommen bleiben und nicht die Grenze überschreiten, wo sie in ein bestimmtes Violett und scharfes Grau übergehen.
Diejenigen aber, die frei und ungebunden leben, kräftige Sanguiniker, starke energische Menschen sind, gefallen sich meistens in schimmernden Farben, wie Rot und Gelb, wie sie auch die Zimbelschläge des Zinnobers und der Chromfarben lieben, die sie blenden und berauschen.
Die geschwächten und nervösen Menschen dagegen, deren sinnlicher Appetit nach Speisen sucht, welche scharf gewürzt sind, – die Augen dieser hektischen, überreizten Naturen lieben fast alle die krankhaft aufregende Farbe mit täuschendem Glanze, mit scharfem, unruhigem Wechsel: das Orangegelb.
Die Wahl, welche der Herzog Jean treffen würde, ließ also kaum Zweifel zu; dennoch aber entstanden neue Schwierigkeiten, denn wenn auch das Rot und Gelb sich bei Licht glänzend bewährten, so geschieht das nicht immer bei ihrer Zusammenstellung. Das Orangegelb verschärft und verwandelt sich oft in Dunkelrot oder gar in Feuerrot.
Bei Kerzenlicht versuchte er alle seine Farbenzusammenstellungen und entdeckte eine, welche gleich zu bleiben und sich nicht den Anforderungen zu entziehen schien, die er an sie stellte. Nachdem diese Vorkehrungen beendet waren, bemühte er sich, so viel es eben möglich war, für sein Arbeitszimmer die orientalischen Farben und Teppiche zu vermeiden, die prahlend und gewöhnlich geworden sind, seit Parvenüs sie sich in den großen Modemagazinen zu herabgesetzten Preisen leicht verschaffen können.
Nach reiflicher Überlegung entschloss er sich dazu, die Wände wie seine Bücher mit Saffian-Leder mit breitgedrückten Narben oder mit satiniertem Kap-Leder bekleiden zu lassen.
Als das Getäfel derartig geschmückt war, ließ er die Leisten und Gesimse mit dunkler Indigofarbe und einer blauen Lackfarbe bestreichen, so, wie sie die Wagenbauer für das Äußere der Wagen verwenden; und der etwas gewölbte Plafond, ebenfalls mit Saffian-Leder bezogen, öffnete sich wie ein ungeheures rundes Fenster, eingefasst von orangegelbem Leder: ein kreisförmiges Himmelszelt von königsblauer Seide, in dessen Mitte silberne Seraphine mit ausgebreiteten Flügeln schwebten.
Er hatte richtig kalkuliert: Das Getäfel veränderte sein Blau nicht, es wurde gehalten und erwärmt durch das Orangegelb, welches ebenfalls Farbe hielt, unterstützt und belebt durch den kräftigen Zug der blauen Farben.
Was die Möbel anbetrifft, so hatte Herzog Jean keine allzu große Mühe, da der einzige Luxus dieses Zimmers nur aus Büchern und seltenen Blumen bestehen sollte; er begnügte sich damit, an den Wänden Bücher- und Fachschränke aus Ebenholz aufzustellen, indem er sich für später vorbehielt, die frei gebliebenen Zwischenräume mit einigen Bildern und Zeichnungen zu schmücken. Dann ließ er den getäfelten Fußboden mit Fellen von wilden Tieren belegen. In der Nähe eines großen massiven Tisches aus der Mitte des 15. Jahrhunderts standen tiefe Lehnstühle und ein altes Kirchenpult aus Schmiedeeisen – eines jener antiken Chorpulte, auf welches ehemals der Diakonus das Chorbuch gelegt, und auf dem jetzt einer der schweren Folianten des Glossarium mediae et infimae latinitatis von dem Gerichtsschreiber du Cange stand.
Die Fenster, mit Scheiben aus bläulichen Flaschenböden von rissigem Schmelz und Goldrand, schnitten die Aussicht auf das Land ab und liessen nur ein gedämpftes Licht eindringen; sie wurden außerdem mit Vorhängen aus alten Messgewändern verhängt, deren dunkles, fast rauchiges Gold sich in einem matt rotgelben Gewebe verlor.
Und endlich noch befand sich auf dem Kamine, dessen Bekleidung ebenfalls aus einem prachtvollen florentinischen Messgewand hergestellt war, zwischen zwei Monstranzen aus vergoldetem Kupfer byzantischen Stils, welche der alten Abtei Bois-de-Bievre entnommen waren, eine wunderbar schöne Messtafel mit drei getrennten Fächern von ausserordentlicher Zartheit; unter dem Glas ihres Rahmens sah man ferner auf Pergament in entzückender Messbuchschrift kopiert und mit kostbarer Ausmalung versehen drei Werke von Baudelaire: zur Rechten und Linken Sonette mit dem Titel »der Tod der Verliebten«, »der Feind« – und in der Mitte in Prosa: »Any where out of the world«.