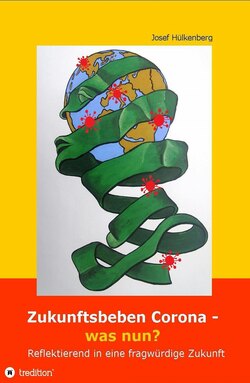Читать книгу Zukunftsbeben Corona - was nun? - Josef Hülkenberg - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеEinführung
Die Programmplanungen hatten gerade erst begonnen, als sich das Zukunftsbeben ankündigte und der Lockdown auch die Bildungshäuser lahmlegte.
Zukunftsbeben – ein Ereignis, diesmal eine Pandemie, nahm seinen Lauf mit der Kraft, die Entwicklung des Weltgeschehens dauerhaft zu verändern.
Schon angekündigte Seminare wurden auf Eis gelegt, Termine für den Herbst 2020 nur unter Vorbehalt abgesprochen. Darunter waren auch die Anfragen zu Vortrag und Salongespräch „Neue Normalität nach Corona?“.
Derartig eingestimmt nahm ich meine Rolle ein als Beobachter gesellschaftlicher Entwicklungen unter spezifischen Fragen:
• Wird es eine „neue Normalität“ geben?
• Was wird als „neue Normalität“ gesehen?
• Zu welchen Einsichten führt uns die zeitlich nicht kalkulierbare Pandemie?
• Wie werden wir Bürger die drastischen Einschränkungen unseres Alltagslebens hinnehmen und verarbeiten?
• Welche Zukunftswünsche treten auf?
Wir stehen vor einer fragwürdigen Zukunft. Bedroht durch ein neues, unkontrolliertes Virus tritt ihre Ungewissheit deutlicher hervor. Diese Zukunft ist jeder Fragestellung würdig. Die Pandemie hat unser allgemeines Lebensrisiko um eine weitere Dimension erweitert. Das Virus ist in der Welt, Mutationen sind jederzeit möglich. Wie werden wir diese zusätzliche Bedrohung in das individuelle und gesellschaftliche Leben integrieren? Welche politischen Entscheidungen sollen dieser neuen Situation gerecht werden? Entscheidungen, die alle Beteiligten des Gemeinwesens binden. Wollen wir, und wenn JA, wie wollen und können wir Einfluss nehmen auf diese Entscheidungen?
Wer heute noch sagt: „Politik interessiert mich nicht!“ sollte morgen nicht sagen: „Das konnte ja niemand kommen sehen.“ Die Bewältigung der aktuellen Pandemie ist mehr als eine medizinische Aufgabenstellung. Sie stellt unser gesamtes modernes Lebensmodell infrage. Sie ist eine Anforderung, der wir uns zu stellen haben und deren Folgen wir noch lange im sozialen Miteinander, in der Wirtschaftsentwicklung und in eingeschränkter politischer Handlungsfähigkeit aufgrund der hohen Neuverschuldung spüren werden.
Moderne Medien schaffen Zugänge zu einer Informationsmenge, die selbst von darauf trainierten Wissenschaftlern kaum mehr zu bewältigen ist. Üblicherweise behelfen wir uns damit, nur den uns subjektiv wichtigen Informationen Aufmerksamkeit zu schenken. Dieser im Prinzip sinnvolle Schritt enthält allerdings die Gefahr, dass wir uns in eine sich selbst verstärkende Meinungsblase verfangen, nach und nach unsere Weltsicht verengen und eine restriktive Weltanschauung vertreten.
Dieser Gefahr können wir entgehen, indem wir uns immer wieder der Tatsache stellen, dass all unser Wissen, all unsere Einsichten nur fragmentarisch sind – Bruchstücke, die sich jederzeit verändern, ergänzen oder wegfallen können. Selbst die Gesamtheit unseres je fragmentarischen Wissens und aller Einsichten ist ein Bruchteil gemessen am Ozean unseres Nichtwissens.
Im Mosaik eigener und fremder Wissensfelder, eigener und fremder Einsichten lassen sich Muster entdecken, die uns zur Orientierung dienen.
Unsere zum Glück offene Gesellschaft, plural in Wertekonzepten, ethnischen Varianten und politischen Interessen, erweist sich zum Zerreißen gespannt. Unterschiedliche, oftmals sich massiv widersprechende Interessen und Grundansichten bestimmen Alltag, öffentlichen Diskurs und politische Debatten.
Im Hintergrund der vielfachen, strittigen Sachfragen werden methodische Probleme immer deutlicher:
• Wie kann man sich auf sachgerechte und ethisch verantwortbare Entscheidungen einigen, wenn jeder andere Interessen, Pläne und Ziele verfolgt?
• Reicht dann die Macht einer relativen Mehrheit zur tragfähigen Entscheidung? Zu einer Entscheidung, die dann auch von allen mitgetragen wird?
• Werden die in der Abstimmung Unterlegenen ihre eigenen Interessen und Pläne aufgeben, oder werden sie danach streben, ihre Macht zu erweitern, um mit neuer Mehrheit dann nach den eigenen Plänen zu handeln?
Dieses methodische Dilemma hat das Potenzial, die bislang entwickelte demokratische Kultur zu zerstören. Es zu lösen, bringt diese Kultur aber um wesentliche Schritte auf echte Demokratie voran. Solche Dilemmata löst man nicht im Hau-Ruck. Sie verlangen geduldiges, kraftvolles Engagement. Das eigene, wie das gesellschaftliche Leben reflektierend können wir diese Aufgabe gemeinsam meistern.
Sie, liebe Leserin, lieber Leser, lade ich ein zu gedanklichen Spaziergängen entlang coronabedingter Krisenerscheinungen. Es wird keine wissenschaftliche Analyse, sondern eine auf die Zukunft ausgerichtete Betrachtung von Phänomenen, Handlungsmöglichkeiten und Ressourcen. Solcher Spaziergang entlang einer TIMELINE ähnelt einer Stadtführung, bei der selbst vermeintlich Bekanntes immer wieder neu beleuchtet wird. Dabei werden Handlungsmuster erkennbar. Muster1, wie wir mit der Krise umgehen, aber auch Muster, wie wir die Folgen der Krise gesellschaftlich bewältigen können. Fragmentarische Erkenntnisse und Informationen lassen sich wie im Mosaik zuordnen, um neue oder tiefere Orientierung zu geben und zum zielorientierten Handeln zu führen.
Im choreographischen Zusammenspiel unterschiedlicher Denkansätze und Methoden entsteht ein Weg, in bewusster Reflexion solcher Muster unseren gesellschaftlichen Lebensstil auf eine naturverträgliche und nachhaltige Lebensform anzupassen. Diese Anpassung kann sogar auf Basis demokratischer Entscheidungen und breiter Akzeptanz geschehen.
1 zur Bedeutung der Muster und ihrer Erkennung siehe: Josef Hülkenberg, Nur mal angenommen… Demokratie ginge anders, tredition Hamburg, 2015,Seite 116 — im weiteren abgekürzt: Nur mal angenommen