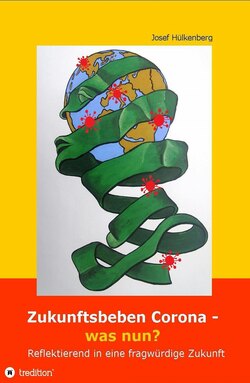Читать книгу Zukunftsbeben Corona - was nun? - Josef Hülkenberg - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеEine Krise namens Corona
Wenn uns die ach so gern verdrängte Fragilität und Unsicherheit des Lebens aus liebgewordenem Alltag wirft, sprechen wir schnell von Krisen.
Der Ausnahmezustand, hervorgerufen durch die Corona-Pandemie, löste nicht nur Ängste aus um Gesundheit und Leben, sondern ebenso um den Erhalt des Wohlstands und des bisherigen Lebensstils. Ängste auch um den Bestand geschichtlich erkämpfter demokratischer Rechte und Strukturen. Zudem sorgten sich Menschen um die Freiheit des wirtschaftlichen Wettbewerbs. Noch bevor die Wirkung der beschlossenen Maßnahmen sorgfältig überprüft werden konnte, wurden Rufe laut nach einer „Exit-Strategie“. Gleichzeitig verwiesen nachdenkliche Stimmen auf die Chancen, nun endlich Wirtschaftsprozesse an die Gemeinwohlorientierung zu binden, soziale Gerechtigkeit durch längst geforderte Verteilungsstrukturen wie Vermögenssteuer, Transaktionssteuer oder Grundeinkommen zu fördern oder die im Konzept der globalisierungsentgrenzten Wirtschaftsabläufe dezentral neu zu verankern.
Die gesellschaftliche Ruhepause schuf Raum, über das zwischenmenschliche Miteinander in regionalen, nationalen oder supranationalen Dimensionen nachzudenken. So führte die Corona-Krise die Abhängigkeit des Homo Sapiens als Teil unseres regionalen Ökosystems als auch der weltumspannenden Biosphäre neu vor Augen. Nach und nach schwindet der Druck, den die Epidemiegefahr auf das gesellschaftliche Leben auslöst.
Endlich! Mai 2020 – der Lockdown wurde gelockert. Händler, Museen, Friseure, Kirchen und viele andere mehr durften für ihre Angebote wieder öffnen. Die unselige Verbannung der Kinder von Spielplätzen, aus Kitas und Schulen findet schrittweise ihr Ende. Noch gelten Auflagen, doch auch die werden nach und nach zurückgenommen.
Allzu streng haben wir es häufig ohnehin nicht genommen. Bei Spaziergängen in Wäldern und Parks drängten sich schon Fragen auf: „Seit wann haben so viele Kleinkinder betagte Eltern?“, „Leben in unserer Stadt tatsächlich so viele Großfamilien in einem Haushalt?“ oder „Wie variabel ist eigentlich 1,50 m?“.
Die gelebten Abweichungen von den Vorschriften schlugen sich zum Glück nicht in der Corona-Statistik nieder – so schufen sie Raum für die Lockerungen. Die Abweichler, die Unduldsamen, die Ungehorsamen und Widerspenstigen halten wieder einmal die Freiheitssehnsucht wach. Auch ihnen gebührt es zu gratulieren.
Doch jede, auch die zurückgewonnene Freiheit hat ihren Preis und der heißt: Mitverantwortung! Nun gilt es nicht mehr, gehorsam bis untertänig den Anweisungen von Vater Staat oder Mutter Kirche zu folgen. Uns wächst so wieder die schwere Verantwortung zu, durch eigenes Verhalten die Pandemie unter Kontrolle zu halten – bis eines Tages Impfstoffe und Medikamente diese Verantwortung erleichtern. Abseits vom betreuten Denken haben wir selbst zu klären:
• Wann und wieweit kann ich Besuche bei Verwandten und Freunden verantworten?
• Wie nahe wollen wir uns kommen?
• Wie halten wir es demnächst mit Kneipengängen, Theater-, Kino- oder Stadionbesuchen?
Nicht alles Erlaubte ist auch gut für uns und die Mitmenschen – da gilt es abzuwägen. Diese Einsicht des längst verstorbenen Apostel Paulus gilt eh und je, auch nach fast 2000 Jahren.
Wie schnell absorbieren wir das „Abenteuer Corona“ und fliehen zurück in eine vermeintliche frühere Normalität? Vielleicht suchen wir dabei sogar alles nachzuholen, was uns zwischenzeitlich entging. Vielleicht aber halten sich noch Stimmungen und Einsichten des grundlegenden Wandels unserer Lebensart, um neuen Krisen die Schärfe zu nehmen. Die Reflexion der Pandemie und ihrer gesellschaftlichen Wirkungen kann Wege aufweisen, ein neues gesellschaftliches Miteinander zu entwickeln.
Wir können die Pandemie durchstehen, unsere Bewegungs- und Kontaktfreiheit zurückgewinnen und die Zukunft mit neuen Erfahrungen gestalten, sobald wir unseren Preis der klugen Mitverantwortung zahlen.
Das geschieht nicht von heute auf morgen. Es wird ein anstrengender Weg. Es dauert sehr lange, bis verschiedene Erfahrungen sich zu Einsichten und neuem Verhalten verdichtet haben. Es ist unsere Entscheidung, ob wir diesen Weg für ein humanes, naturverträgliches Miteinander auf uns nehmen.
Wieder zerfällt ein Weltbild
Es gehört wohl zum Menschsein, hebt es uns doch von den Tieren ab: unsere Gedanken gehen immer wieder über die Alltagsdinge und ihren Banalitäten hinaus. Sobald der Alltag uns etwas Zeit lässt und wir den Kopf frei haben nachzudenken, sinnieren wir: über das Leben, die Welt im Allgemeinen und was Gott, Göttinnen oder wer sonst die Welt beherrscht, mit uns vorhaben. Immerhin sind wir mit Fähigkeiten ausgestattet, die uns Fragen und Denken ermöglichen und erlauben. Vielleicht sind wir nicht alle Vor-Denker, aber auch Nach-Denken fordert uns Einiges ab, soll es nicht zum Nachplappern verkommen. Wir tauschen unsere Gedanken mit den Mitmenschen aus und stellen fest, wie gemeinsam getragene Überlegungen dem sozialen Miteinander Struktur und Sicherheit geben. Manchmal sind wir offen und aufgeschlossen für neue Überlegungen und Einsichten, manchmal suchen wir Sicherheit vor fremdem Gedankengut. Die Geschichte der Menschheit ist ein ständiges Ringen zwischen diesen Polen. Auf den Kampfplätzen des Denkens haben nicht unbedingt die „richtigen“ Ideen gewonnen, sondern vor allem die machtvolleren. Was „richtig“ war, erwies sich erst weit später im Zusammenleben der Menschen.
Weltbilder, seien sie naturwissenschaftlich, ethisch, religiös oder gar spirituell verankert, geben uns Orientierungs- und Handlungsrahmen für unser Leben. Heikel wird es, wenn jemand mit seinen Ansichten oder gar seiner Lebensweise diesen Orientierungsrahmen gründlich infrage stellt. Dann wird schon mal Sokrates zum Giftbecher verurteilt, der Nazarener gekreuzigt oder dem Galileo der Prozess gemacht. Heute gehen wir mit Querdenkern scheinbar humaner um. Sie werden „nur“ gemobbt, mit Shitstorms belegt, verächtlich gemacht und sozial geächtet. Der eigenen Verunsicherung suchen wir häufig zu entgehen, indem wir das alte Kinder-Versteckspiel nachahmen: solange ich mir die Augen zuhalte, sieht mich keiner!
Damit verhindern wir allerdings nicht, dass irgendwann nicht mehr Gedankenspiele, sondern Ereignisse uns die Hände vom Gesicht reißen. Dann ist „plötzlich“ die Erde keine Scheibe mehr oder der Mittelpunkt des Universums. Dann zerplatzt der Mythos des Menschen als Krone der Schöpfung und wir erkennen uns als die aggressivste Lebensform auf dem Planeten. Ausgerechnet ein Virus namens Corona (lat. für Krone) schlägt uns aktuell wieder einmal die Schöpferkrone um die Ohren.
Die Mythen einer besseren Zukunft können wie Seifenblasen platzen oder eingehen, weil wir als „göttlicher Ingenieur“ uns immer wieder zu Zwischenlösungen verlocken lassen, die sich in der Folge als noch größere Probleme erweisen.2
Noam Chomsky, (*1928) Linguist und einer der einflussreichsten Intellektuellen der USA, beschrieb 2017 den Untergang des amerikanischen Traums vom freien Land. Einem Land unbegrenzter Möglichkeiten zu individuellem Aufstieg, zu Wohlstand und Privilegien, zu sozialer Mobilität in Freiheit und Unabhängigkeit. Chomsky begründete das Scheitern dieses Traumes an der ungelösten Konzentration von Reichtum und Macht und dem Mangel an Visionen:
„Die Great Depression, die schwere Wirtschaftskrise der 1930er-Jahre in den USA, die ich selbst noch miterlebt habe, war eine harte Zeit – subjektiv gesehen viel härter als die heutige. Aber es herrschte das Gefühl vor, irgendwie auch wieder da raus zu kommen, die Erwartung, es werde irgendwann schon wieder besser:»Heute haben wir vielleicht keine Arbeit, aber morgen ganz bestimmt, und gemeinsam können wir an einer besseren Zukunft arbeiten.« Politischer Radikalismus hatte Hochkonjunktur und nährte die Hoffnung auf eine bessere Zukunft – eine, in der mehr Gerechtigkeit, Gleichheit und Freiheit die repressiven Klassenstrukturen aufbrechen würden. »Irgendwie wird es vorangehen«, dachten alle.
Auch in meiner Familie gehörten viele zur Arbeiterklasse und hatten keinen Job. Aber die Gewerkschaftsbewegung war im Aufschwung, Ausdruck und Quelle von Optimismus und Hoffnung zugleich. Und das fehlt heute.»Nichts wird mehr, wie es mal war«, das ist heute die Stimmung – es ist aus und vorbei.“3
Als der Journalist Gabor Steingart 2011 seinen „Nachruf auf unser Leben, wie es bisher war“ veröffentlichte, stand die uns so lieb gewordene, gesellschaftliche Normalität schon längst auf der Kippe. Nach seiner Vorstellung führten uns das Weltfinanzbeben (2008) und die Kernschmelze im japanischen Fukushima (2011) zum Ende der Normalität.4
Warnungen, der von den Bewohnern der Industrieländer vorrangig betriebene Lebensstil schädige die weltweiten Ökosysteme, zerstöre die soziale Balance zwischen den Ländern und in den Ländern und gefährde sogar die eigenen Lebensgrundlagen, füllen längst Buchregale und Mediatheken. Ebenfalls schrieben zahlreiche Autoren Konzepte für die überfällige „Wende der Titanic“5. Aktivisten in zahllosen Projekten schufen Blaupausen für eine naturverträgliche, sozial akzeptable und kulturell befriedigende Lebensweise.
Doch die Verdrängungskraft weiter Bevölkerungsteile und die Ignoranz mächtiger Interessengruppen sorgten dafür, dass die „Titanic“ auf Kurs blieb. Weltweit verstreute Kriege, die Papst Franziskus als „Dritten Weltkrieg“ brandmarkte, mehrfache weltumspannende Krisen der herrschenden Finanz- und Wirtschaftssysteme, Zusammenbrüche von Versorgungssystemen reichten nicht zur umfassenden Besinnung und Neuorientierung.
In der Zeit von James Dean ließ sich noch sagen: „Denn sie wissen nicht, was sie tun“. Für unsere Gesellschaften gilt längst: „Denn sie tun nicht, was sie wissen.“
Um die Muster des derzeitigen politischen Handelns zu verstehen, lohnt eine mentale Distanz zur aktuellen Informations- und Meinungsflut. Erinnern Sie sich noch an den Club of Rome mit seinem Bericht über die Grenzen des Wachstums? Oder an Heinz Haber (1913-1990) und Hoimar von Ditfurth (1921-1989), die schon vor Jahrzehnten noch heute wichtige wissenschaftliche Erkenntnisse in eigenen TV-Sendungen leicht verständlich erklärten? Ihre damaligen Beiträge wirken nun wie Prophezeiungen heutiger Zustände. Doch offenbaren sie auch Hinweise auf die Bewältigung jener Herausforderungen, die nach einem Exit aus den derzeitigen Beschränkungen wieder – oder besser noch weiterhin – auf der Agenda stehen.
Wie werden wir mit dem Coronavirus, wie mit dessen uns noch unbekannten Kollegen zu leben lernen? Wie mit den vermuteten 1,5 Millionen Virenarten in der Biosphäre? Denn sie sind in der Welt, sie bleiben! Unsere derzeitige Lebensweise, vor allem in den Industrieländern, unser Umgang mit der Natur, eröffnet neuen Krisen immer wieder die Türen.
Homo Sapiens erfährt seine Grenze
Die Corona-Pandemie stellt unser gesellschaftliches Wertesystem brachial infrage. Der Homo Sapiens schwang sich auf zum Herrn und Herrscher über Natur und Biosphäre. Wissenschaftler sprechen seit einigen Jahren mal stolz, mal warnend vom Anthropozän. Gemeint ist damit, dass das Verhalten der Gattung Mensch für Zukunft und Existenz des Planeten Erde entscheidend geworden ist.
Nun kommt ein kronenartiges Virus daher und erzwingt drastisch unsere Einsicht, dass wir doch Teil von Natur und Biosphäre sind. So stehen wir am Scheideweg. Stellen wir uns weiterhin ein auf einen Kampf um die Beherrschung der Natur oder schließen wir Frieden, und fügen uns in die angestammte Rolle der Kreatur? Antike Mythen unterschiedlicher Kulturen und biblische Reflexionen beschreiben die Menschen als Teil der Schöpfung, Kreatur und zugleich herausgehoben als der Schöpfung Hirte und Hüter.
Die dennoch über Jahrtausende kulturell gepflegte Illusion von der Herrschaft über die Schöpfung erfährt durch die Pandemie einen herben, tödlichen Dämpfer. Nur die radikale Änderung unseres Lebensstils kann eine Menschheitskatastrophe abwenden. Quarantäne und staatlich verordnete Beschränkungen von Versammlungen, öffentlichen Veranstaltungen und Reisen wirken auf diese Verhaltensänderung hin. Physische Distanz der Menschen zueinander und eine konsequente Hygiene sind längst das Gebot der Stunde. Europäische Staaten und einzelne deutsche Städte verhängten Ausgehverbote, um Menschenansammlungen zu verhindern, die dem Virus zu seiner Verbreitung nutzen. Dabei nehmen die Politiker und Krisenmanager die Einschränkung und Aussetzung anerkannter und verfassungsrechtlich geschützter Bürgerund Menschenrechte in Kauf. Kulturbetriebe, Schulen und Kindertagesstätten wurden geschlossen, Veranstaltungen in Bildungseinrichtungen verboten, Gremien vertagten sich oder wurden abgesagt, ganze Wirtschaftszweige wurden gedrosselt und gerieten an den Rand der Existenz. Ein Blick über den Atlantik zu den USA oder Brasilien zeigen die Folgen miserablen politischen Managements.
Um Erhalt des Lebens und der Gesundheitsinfrastruktur willen nimmt die Mehrheit der Bevölkerung diese Einschränkung an und akzeptiert die häusliche Isolation. Moderne digitale Technik erlaubt, Kontakt mit der Außenwelt zu halten und die „Welt ins Haus“ zu holen. Auch wenn die auf der Welt verteilten Server unter der rasant ansteigenden Datenverarbeitung durch Stream-Dienste im Internet ächzen und an die Grenzen der Kapazität kommen, bringen sie uns auch Nachrichten über positive Folgen der erzwungenen gesellschaftlichen Entschleunigung. In der Mehrzahl der von der Pandemie betroffenen Länder konnte der exponentielle Anstieg der Infektionen durch Lockdown-Maßnahmen gebrochen werden.
Satellitenbilder belegen den Rückgang des Smog über chinesischen und italienischen Industrieregionen und Ballungszentren. Die stinkende Brühe in Venedigs Kanälen regeneriert sich zur Wasserlandschaft, in der wieder Fische sichtbar werden. In der Lagune werden im klaren Wasser wieder Fischschwärme gesichtet. Delphine trauen sich in die stillgelegten Häfen Sardiniens. Für einen Hirschen endete der Versuch der Rückeroberung seines angestammten Lebensraumes jedoch tödlich. Er wurde in der Innenstadt Bocholts entdeckt und auf Weisung der Polizei von einem herbeigerufenen Jäger erschossen.
Was seit Jahren in Umwelt- und Klimapolitik proklamiert, aber nie ernsthaft verfolgt wurde, holt sich die Natur in kurzer Zeit zurück. Diese Erfahrungen können unsere Überzeugungen von einem naturverträglichen gesellschaftlichen Leben der Menschen bekräftigen. Noch stehen uns Wochen, vielleicht Monate des virusbedingten Ausnahmezustandes bevor. Wir können die Einschränkungen bejammern und beklagen. Wir können und dürfen sie auch zur gründlichen Reflexion und Neubesinnung unseres Lebens während und nach der Krise nutzen: zur Reflexion über ein gesellschaftliches Leben als Teil der Natur. Ein Leben resilient6 im Umgang mit den aus der Natur erwachsenden Gefahren und Risiken der uns anvertrauten Schöpfung.
Zukunftsbeben
Als Zukunftsbeben bezeichnen Forscher Momente, die den Lauf der Geschichte drastisch und nachhaltig verändern. Auslöser können Naturkatastrophen wie Erdbeben, Vulkanausbrüche oder Tsunamis sein.
Zu sozialen Zukunftsbeben werden Ereignisse, die von Menschen selbst herbeigeführt wurden oder durch die Reaktionen der Menschen auf Naturereignisse. Soziale Zukunftsbeben werden durch menschliche Entscheidungen geformt.
• Kein Virus hat die Schulen und die Kitas geschlossen. Kein Virus hat Ausgangssperren und Kontaktsperren verhängt. Nicht Covid-19 hat den Lockdown beschlossen, um sich an der Ausbreitung zu hindern. Den Viren sind die Zahlen der Infizierten und Toten egal. Es waren Menschen, die auf das Erscheinen des Virus reagierten und für die ihnen anvertrauten Menschen Schutzmaßnahmen entschieden.
• Den Viren ist es egal, ob wir die durch ihr Erscheinen ausgelöste Situation zu einer Reflexion und Neuorientierung unseres zwischenmenschlichen und gesellschaftlichen Verhaltens nutzen oder möglichst schnell wieder in alte Normalität zurückfallen.
• Den Viren ist es egal, ob wir beim virtuellen abendlichen Klatschen für die Corona-Helden bleiben, oder die neu entdeckte Systemrelevanz tariflich und gesundheitspolitisch bestätigen.
Den Viren ist all das egal. Es ist allein unsere Sache. An uns liegt es, wozu wir uns entscheiden, was wir entscheiden und wen wir entscheiden lassen. Zwischenmenschliches Handeln schafft Strukturen. Reflektiertes zwischenmenschliches Handeln kann die Strukturen schaffen, die wir wollen.
Allerdings ist der Weg nicht einfach. Der Weg in eine für Mensch und Natur tragtüchtige Zukunft ist zu bewältigen als Gemeinschaftsleistung aller Menschen, die sich mit der Vielfalt ihrer Kompetenzen aktiv in die Entwicklung einbringen.
Tragtüchtig – ein im Deutschen selten genutztes Wort. Wir sprechen zumeist von Nachhaltigkeit, doch wird dieser Begriff inzwischen inflationär gebraucht. Mit Nachhaltigkeit wird auch der vom dänischen Soziologen Helge Hvid eingebrachte Begriff „Bæredygtighed“ übersetzt. Tragtüchtig jedoch ist die ursprüngliche und eigentliche Bedeutung des verwandten Begriffes.
Als tragtüchtig erweist sich ein System, wenn und solange es die ihm zugeschriebenen Eigenschaften unter Beweis stellt. Längst ist nicht alles tragtüchtig, was auch tragfähig war. Ein gegenwärtiges Musterbeispiel dazu liefert die Autobahnbrücke der A1 zwischen Leverkusen und Köln:
Die von den Bauingenieuren Schumann und Homberg entworfene Rheinbrücke wurde am 5. Juli 1965 eröffnet. Die Pläne der Bauingenieure basierten auf den Planungsvorgaben von 1959 und kalkulierten eine ausreichende Tragfähigkeit der Konstruktion ein. Vor der Freigabe für den Verkehr wurde die Brücke verschiedenen Belastungstests unterzogen. Damit wurde die geplante Tragfähigkeit auf ihre tatsächliche Tragtüchtigkeit geprüft. Erst der Nachweis der Tragtüchtigkeit erlaubte die Freigabe.
Alterungsprozesse, Materialmüdigkeit, ungenügende Wartung, vor allem aber das weit über die einstigen Planungsvorgaben angestiegene Verkehrsaufkommen führten zur mangelhaften Tragtüchtigkeit der Brücke, sodass seit November 2012 für Fahrzeuge auf der Brücke eine Tonnagebeschränkung von maximal 3,5 t gilt.
Zur menschengerechten und naturverträglichen Zukunft brauchen wir tragfähige Konzepte. In praktischen Projekten ist ihre Tragtüchtigkeit zu prüfen. Dann sind sie durch politische Entscheidungen allgemein zu verankern.
Alle Schotten dicht
Zerfällt Europa? Fällt Deutschland in die Kleinstaaterei früherer Jahrhunderte zurück? Die Pandemie fördert Grenzschließungen und bislang unwesentliche Grenzziehungen zwischen Bundesländern. Scheitert Europa am Föderalismus, weil die Einzelstaaten ihre Schotten dicht machen?
Ist es nicht eher ein gesundes Zeichen, dass es noch Schotten gibt, die sich bei Gefahr schließen lassen? Schlägt ein Schiff Leck, sichern geschlossene Schotten vor dem Untergang, weil die Schadstelle abgeschottet werden kann. Brandschutztüren gehören zur Sicherheitsstruktur größerer Gebäude, damit eventuelle Brandherde nicht ungehindert auf das ganze Haus übergreifen können. Eierkartons oder Flaschenkästen sind nicht nur gute Transportmittel, sie schützen die Waren auch vor unsachgemäßen Transport.
Wer die Schotten dicht macht, sichert die Gesamtheit vor der Schadensausbreitung. Kluge Kapitäne lockern die Schotten erst, wenn und soweit das Leck abgedichtet ist. Allerdings haben sie einen Vorteil gegenüber heutigen Politikern in der Pandemie: das eindringende Wasser ist sichtbar, spürbar und macht sofort nasse Füße. Das Virus, das unserer Gesellschaft ein Leck geschlagen hat, ist zwar totgefährlich, doch unsichtbar. Da steigt die Ungeduld der Passagiere und so mancher ruft zur Meuterei auf der Titanic auf.
Selbst wenn sich unter dem Druck der „Meuterer“ einzelne Politiker in den Wettbewerb um den Preis des coolsten Landesvaters begeben, sie belegen damit die Qualität dezentraler Systeme. Organisationen, auch Staatswesen sind stabiler und resilient, strukturieren sie sich dezentral, angepasst an den jeweiligen Lebensraum der Menschen. Kooperationen und Koordination zwischen den Einheiten fördern und stärken das Gesamtsystem. Subsidiarität ist der Begriff, der dafür in den Lehrbüchern steht.
Leben in Koexistenz mit Corona
Gegen ein Virus und die dadurch ausgelöste Epidemie oder gar Pandemie sind Wut und Empörung sinnlos. Da mag sich mancher über mangelndes oder überzogenes Krisenmanagement empören. Auch die Konsequenzen eines sinnvollen und effizienten Krisenmanagements mögen persönlichen Unmut bewirken. Wer mag schon gern auf unbestimmte Zeit zu Hausarrest, Ausgangssperre, Versammlungsverbot und Homeoffice verpflichtet werden?
Die aktuellen Einschränkungen gehen nicht nur aufs persönliche Gemüt, sie beeinträchtigen lieb gewordene, bei Dauer auch notwendige Versorgungsketten und analoge soziale Netze. Private Feiern, Besuche bei Freunden, Besuche von Theater und Kino, Besprechungen mit Kollegen entfallen oder werden in die virtuelle Welt des Internet verlagert.
Die Ansteckungsgefahr des Virus Covid-19 reduziert unseren gesellschaftlichen Umgang auf ein sozial und psychologisch unzulängliches Minimum. Jeder Tag eingeschränkter Grundrechte verstärkt die psychischen Folgen. Dabei mögen hoffentlich viele Bürger diese Beschränkungen als Verlust betrachten. Doch besteht auch die Gefahr der Gewöhnung an derartige behördliche Maßnahmen. Dann könnte es ein leichtes sein, auch andere politische Krisenfälle durch Außerkraftsetzung bestehender Rechte anzugehen.
Unmut oder Empörung sind keine adäquate Antwort auf diese Herausforderung. Vielen Mitbürgern gelingt es, die vorgegebenen Einschränkungen mit konstruktiver Energie anzunehmen und mit geändertem Sozial- und Konsumverhalten dem Leben neue Qualität zu geben.
Dazu ein typisches Alltagserlebnis: die Warenauslage beim Bäcker war in der Vielfalt sehr eingeschränkt. Doch fand ich alles, was mir ein gutes Frühstück sicherte. Bemerkung der Fachverkäuferin: „Corona trägt dazu bei, dass die Kunden auch mit weniger zufrieden sind.“
Re-Gnose – keine Angst vor Wandel
Begründete Wahrscheinlichkeiten geben Orientierung zur Auswahl nächster Schritte in unbekanntem Gelände. Solche Wahrscheinlichkeits-Aussagen kennen wir als Prognosen.
Die Vielzahl der prognostischen Möglichkeiten und die häufig sich widersprechenden Szenarien lösen allerdings oft Irritationen oder gar Ängste aus. Derartige Ängste können gemildert werden durch Rückblicke auf frühere ähnliche Situationen, auf überstandene Krisen und wie es sich seinerzeit ergab und entwickelte. Eine andere in der Visionsarbeit bewährte Methode ist der Rückblick aus einer sich vorgestellten Zukunft. Im Kontext der Corona-Krise brachte der Trendforscher Matthias Horx diese Methode mit seiner Wortschöpfung Re-Gnose ins öffentliche Bewusstsein. In seinem am 19.3.2020 erschienenen Essay „Die Welt nach Corona“ lädt er seine Leser ein, sich gedanklich in ein Café im Herbst 2020 zu versetzen, um sich rückblickend zu wundern, wie wir die Krise überstanden. Eine interessante Denkübung, die Ängste vor den anstehenden Wandlungsprozessen nehmen kann. Diese Übung kann staunen lassen, wie wir innerhalb weniger Wochen behördlich verfügte Abstandsbestimmungen, Hygieneregeln im öffentlichen Miteinander und massive Einschränkungen verfassungsrechtlich geschützter Grundrechte hinnahmen und in unseren Alltag integrierten.
Solche Rück-Blicke verringern dann Ängste, wenn sie aus einer optimistischen Position gemacht werden. Mit dieser Methode wird jedoch nicht erarbeitet, welche Zukunft uns erstrebenswert ist und wie wir sie erreichen könnten.
Versetzten wir uns mit Horx gedanklich in ein Straßencafé im Herbst 2020, könnten wir hocherfreut mit Johannes Mario Simmel formulieren und mit Milva singen: „Hurra, wir leben noch!“7. Bei Cappuccino, Rotwein oder Pernod könnten wir nachdenken, was uns dieses Überleben sicherte. Solch rückblickendes Nachdenken kann uns zu sehr unterschiedlichen Entscheidungen führen:
• eine neue Lebensart zu pflegen, die uns sowohl sozial als auch ökologisch in eine zukunftsfähige Balance bringt,
• oder voll verdrängter Lebensgier nun erst recht alles nachzuholen, was Corona uns versagte.
Unsere individuellen Richtungsentscheidungen würden die „Welt nach Corona“ verändern. Unsere veränderten Wahrnehmungen in der Krise und aus der Krise würden unser Verhalten und unseren gesellschaftlichen Umgang miteinander neu prägen. Die erlebten Tatsachen würden „etwas mit uns machen“. So viel Prognostik erlaubt sich der Trendforscher Matthias Horx.
Die zur Re-Gnose notwendige Projektion in ein Straßencafé im Herbst 2020 sagt leider nichts über den gesellschaftlichen Zustand, der uns im Café umgibt. Sitzen wir Gäste immer noch mindestens 2 m voneinander entfernt? Muss ich für jeden Schluck meinen Mundschutz lüften? Sind die Einschränkungen der Grundrechte zurückgenommen oder beibehalten, vielleicht sogar ausgeweitet für eine längst überfällige Klimapolitik? Was sagen uns Re-Gnosen zur Verwirklichung angestrebter Zukunftssituationen?
Eine angestrebte Zukunft fällt uns nicht zur eigenen Verwunderung einfach zu. Eine angestrebte Zukunft ist eine gestaltbare Herausforderung. Das bedeutet Arbeit in der Gegenwart an der Zukunft. Arbeit auch in klassisch-physikalischer Bedeutung. Sie erinnern sich: Arbeit = Kraft x Weg!
Für die Arbeit an der Zukunft ist die Formel um einiges komplexer:
Optimistische Zukunfts-Szenarien mögen uns verlocken und Zukunftsangst nehmen. Zu diesem Zweck ist die Re-Gnose eine ausgezeichnete und erprobte Methode. Durch Ängste gelähmt, gelingt es uns nicht, die Zukunft in unserem Sinne mitzugestalten und die dazu nötigen Kräfte und Energien aufzubringen. Dennoch sollten wir uns stets bewusst sein, dass Re-Gnosen passive Betrachtungen sind, welche die engagierte Mitverantwortung für die Gestaltung der Zukunft nicht ersetzen können.
Zukunft betrachten oder gestalten?
In den Tagen der Corona-Krise ist allerorten von Politikern, Bischöfen, Schauspielern, Medizinern und x-beliebigen an- und ungefragten Bürgern zu hören, diese Krise sei eine Chance zu persönlicher und gesellschaftlicher Neuorientierung. Wie Horx scheinen sie aber darauf zu setzen, dass solche Neuorientierung wohl irgendwie geschehe. Andere setzen darauf, der aktuell breite Wunsch nach Neuorientierung biete nun Raum zur erwünschten Realisierung bislang ungenügend beachteter Zukunftskonzepte. Gemeinwohl-Ökonomie, sanfter ökologischer Tourismus, Grundeinkommen und Verbot von Waffenexporten zählen zu solchen zukunftsfähigen Konzepten.
Wie aber wollen wir diese Ziele erreichen? Wie sehen die Baupläne aus, damit die guten Konzepte keine Luftschlösser bleiben? Damit sie mehr werden als nette Vorzeigeprojekte, sondern gesellschaftliche Wirklichkeit prägen. Welche Konstruktions- und Strukturelemente sind zu beachten für eine tragtüchtige Zukunft?
Für solche Fragen der Zukunftsgestaltung bietet die Neurolinguistische Programmierung (NLP) ein bewährtes Instrument: die TIMELINE. Diese Methode begnügt sich nicht mit einer einfachen Zukunftsvorstellung. Sie fordert zu klaren Zielbildern heraus und fragt aus dieser Zukunft rückblickend nach den Strategien, wie dieses Ziel erreicht wurde.
Sie verlangt auch eine umsichtige Gegenwartsbetrachtung, sowie eine Betrachtung des zielorientierten Weges. Diese Methode erlaubt einen größeren zeitlichen Rahmen als Perspektive des Möglichen.
Warum also nicht den Blick auf eine Nach-Corona-Zeit über den Herbst 2020 oder den Sommer 2021 weiten, beispielsweise auf eine Perspektive 2030+?
S0 wurde im Jahr 2016 unter der Federführung des Bundesforschungsministeriums und des Bundesumweltministeriums sowie unter der Beteiligung der Ressorts für Inneres, Wirtschaft und Verkehr der Wettbewerb „Zukunftsstadt 2030+“ gestartet.
51 deutsche Städte gingen an den Start und entwickelten in Bürgerdialogen unter wissenschaftlichen Begleitungen ihre Konzepte zur zukunftsfähigen Kommune. In die Endphase kamen acht Kommunen, die nun mit jeweils 1,8 Millionen € Preisgeld an die Realisierung ihrer Konzepte gehen. Den vielen beteiligten Bürgern in diesen Städten ist die Perspektive auf 2030+ also nicht mehr fremd.
Wollen wir auch dann noch Fische sehen in den Kanälen Venedigs? Soll man auch dann noch von Indien aus den Himalaya sehen können? Wollen wir unter der Wahrung all unserer Grundrechte den widersinnigen Massentourismus in eine neue Reisekultur gewandelt haben?
An welchen Schulen und Universitäten sollen die nachkommenden Generationen auf die Gestaltung ihrer Zukünfte vorbereitet werden?
Wird es uns noch wichtig sein, ob Online-Händler unsere Bestellungen per Drohnen ausliefern, während wir Arbeitskraft und Arbeitswünsche unserer Mitmenschen missachten?
2 Jacques Neirynck, Der göttliche Ingenieur — Die Evolution der Technik, Lausanne 1986, dt. Renningen 1994
3 Noam Chomsky, Requiem für den amerikanischen Traum, München 2017, S. 9
4 Gabor Steingart, Das Ende der Normalität, Piper München, 2011
5 Herbert Rauch, Alfred Strigl, Die Wende der Titanic — Wiener Deklaration für eine zukunftsfähige Weltordnung, oekom München, 2005
6 Resilienz oder psychische Widerstandsfähigkeit ist die Fähigkeit, Krisen zu bewältigen und sie durch Rückgriff aufpersönliche und sozial vermittelte Ressourcen als Anlass für Entwicklungen zu nutzen.
7 Johannes Mario Simmel, Hurra, wir leben noch, Droemer Knaur, München 1978