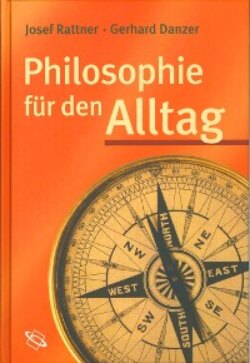Читать книгу Philosophie für den Alltag - Josef Rattner - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1. Rätselhaftes Leben
ОглавлениеDie allgemeine Meinung geht dahin, dass Philosophie nur etwas für Philosophen ist. Diese werden als habituelle Bewohner des Elfenbeinturms gesehen; dort denken sie sich ihre Begriffssysteme aus, die in sich schlüssig sein mögen, aber letztlich nicht viel mit der Realität zu tun haben. Vor allem unter Naturwissenschaftlern besteht auch heute noch Distanziertheit zu vielen philosophischen Anliegen. Man schwört auf die exakte Wissenschaft und reagiert mit einem Gemisch von Unsicherheit und Herablassung auf das angeblich wirklichkeitsfremde Philosophieren, mit dem man in der Praxis nicht viel anfangen kann.
Diese Ablehnung der Philosophie ist unklug und längst nicht mehr up to date. Das mochte im 19. Jahrhundert teilweise berechtigt sein, weil sich die spekulative Philosophie damals tatsächlich um stellenweise abgehobene Denkbereiche bemühte. Da die naturwissenschaftliche Forschung florierte, glaubte man sich berechtigt, die Philosophie in globo über Bord werfen zu können.
Heute weiß jedoch jeder besonnene Forscher, dass er in Theorie und Praxis überall und immer wieder philosophische Themen streift. Philosophie wird unentbehrlich, wenn man die Grundfragen eines Faches oder einer Spezialdisziplin in Betracht zieht. Daher mehren sich die Bemühungen um eine wechselseitige Durchdringung von philosophischem und wissenschaftlichem Denken.
Wie aber kommt man in die Philosophie hinein? Der Laie denkt, er müsse zahlreiche philosophische Lehrbücher durcharbeiten. Das wäre gewiss nicht unnütz, ist aber sehr anstrengend und zeitraubend. Auch erfordert es Vorkenntnisse, die vom Nichtphilosophen kaum zu erwarten sind. Wer je als laienhafter Interessent einen Klassiker der Philosophie zu studieren versucht hat, wird zugeben müssen, dass er dabei nur wenig verstanden und profitiert hat.
Literaturstudium ist wichtig, aber nicht der einzige Weg in die Philosophie. Nach Meinung moderner Philosophen ist das Selbstdenken ebenso nützlich wie das Bücherlesen. Husserl, Heidegger und Sartre z. B. betonen, dass sich im Rahmen der Alltäglichkeit dauernd Philosophie ereignet. Wir können keinen Schritt tun, ohne mit philosophischen Fragen konfrontiert zu werden. Infolge von Bildungsmangel und Denkfaulheit übersehen wir diese ständigen Herausforderungen unserer Denkfähigkeit.
Wir wollen in der Folge eine Reihe von Themen beim Namen nennen, die sich einem inmitten der Alltäglichkeit als Grundfragen der Philosophie aufdrängen. Wer wach genug ist, muss nur Augen und Ohren offen halten, und ist schon mitten im Bereich der Philosophie angelangt. Das ist es, was wir gelebte Metaphysik nennen. Wir könnten auch von gelebter Ontologie sprechen; denn diese beiden Begriffe sind beinahe austauschbar. Ontologisch fragen wir nach dem Seinscharakter und der Seinsbeschaffenheit; metaphysisch wollen wir den Grund aller Dinge erkunden.
– Die Grundfrage jedes denkenden Menschen und der Philosophie ist: Was ist die Welt? Philosophie wurde mitunter als universale Wirklichkeitswissenschaft definiert. Im Unterschied zu den einzelnen Fachwissenschaften befasst sie sich nicht nur mit einer Region der Realität, sondern eben mit ihrem Ganzen. Was ist dieser rätselhafte Kosmos, in dem wir zum Bewusstsein erwachen?
Die griechische Philosophie in ihren Anfängen stieß bereits auf dieses Problem. Sie suchte nach dem Urstoff der Welt und fand ihn unter anderem im Wasser, in der Luft, im Feuer und (bei Empedokles) in den vier Elementen, die durch Liebe vereinigt und durch Hass oder Kampf getrennt werden. Die letztgenannte Ontologie wurde teilweise noch von Sigmund Freud übernommen, in dessen Lehre vom Eros und vom Thanatos die empedokleische Metaphysik Auferstehung feierte.
Noch heute zehren wir von den Erkenntnissen der alten Griechen. Sie schufen z. B. die Atomistik, die erstaunlich modern anmutet. Nur wissen wir jetzt, dass auch Atome teilbar sind und aus kleineren Elementarteilchen bestehen. Seit Albert Einstein sind Materie und Energie konvertierbar; das bedeutet, dass das Weltall eigentlich aus Energie besteht. Damit nähert man sich Heraklit an, der dieselbe Einsicht hatte, dabei aber die Metapher Feuer für Energie verwendete.
Aber was ist nun die Welt? Die biblischen Schöpfungsmythen wörtlich zu nehmen, ist angesichts der neueren Kosmologie hinfällig geworden. Die riesigen Räume des Universums passen nicht zu einem anthropomorphen Schöpfer. Woher dann jedoch der Raum, die Materie, die Energie? Diese Woher-Frage ist vermutlich von vornherein unergiebig. Sie passt in die Menschenwelt und die terrestrischen Verhältnisse, wo die Ursachen- und die Urheberfrage sich allemal stellt. Derlei ist auf den Kosmos möglicherweise nicht übertragbar.
Wir wissen lediglich, dass unsere jetzige Welt etwa vierzehn oder fünfzehn Milliarden Jahre alt ist. Sie hat wahrscheinlich mit einem Urknall begonnen, wonach das punktförmige Universum in eine gewaltige Expansion hineingeriet. Seither dehnt sich der Kosmos aus, alles strebt auseinander und wird vielleicht zu einem gewissen Zeitpunkt wiederum schrumpfen und ineinander stürzen.
Wird dann dieselbe Ereigniskette wieder von neuem beginnen? Dann wäre Nietzsches seltsamer Wiederkunftsgedanke bestätigt! Wir wissen es nicht. Aber der Alltagsphilosoph wird sich fragen müssen, welche Bedeutung in diesem rätselhaften Weltganzen ihm selbst zukommt. Eine Welt ohne Gott, ein Universum in zyklischer, zentrifugaler und zentripetaler Bewegung, und darin ein Planet, auf dem Menschen zum Bewusstsein ihrer selbst erwachten: Was ist der Sinn des Ganzen? Was bedeutet der Kosmos für uns, und was bedeuten wir für ihn?
Nur in seltenen Momenten reflektieren wir diese große Welt. Ähnlich wie die Tiere leben wir in einer kleinen Welt, die man auch Umwelt nennen könnte. Das ist die Welt unserer Behausung, unserer Arbeitsstätte, unserer Liebesbeziehung und unserer Sozialkontakte. Aber dann und wann leuchtet hinter dieser Miniaturwelt der Kosmos auf. Die ihn erforschenden Wissenschaften sind auf dem Wege, ihn besser und genauer zu verstehen. Was werden wir noch über die Geschichte, die Struktur und die Zukunft des Universums erfahren?
– Die zweite ontologische Frage, die jedem nachdenklichen Menschen aufstößt, lautet: Was ist Leben? Man muss kein Naturforscher oder Philosoph sein, um zu sehen, dass Lebendiges von der so genannten toten Materie grundverschieden ist. Die unbelebte Welt hat ihre Gesetzmäßigkeiten, aber die Lebewelt unterliegt diesen nur zum Teil. Die Philosophen sprechen davon, dass das Leben eine eigene Seinsregion darstellt, in welche die Gesetze von Physik und Chemie wohl hineinwirken, aber überlagert und verändert sind durch organismische Spielregeln.
Wichtige Merkmale des Lebendigen sind Empfindungs- und Reaktionsfähigkeit, Fortpflanzung, Stoffwechsel und eine Form von Gedächtnis. Jedes Lebewesen wird irgendwie seiner Umwelt bewusst und kann Erfahrungen speichern. Bei der unbelebten Materie lässt sich höchstens im übertragenen Sinne davon sprechen, dass sie sich erinnern kann. Leibniz erklärte bei Gelegenheit, dass das Gedächtnis der Materie unendlich kurz sein müsse. Anders bei den Lebensträgern: Je höher sie in der Entwicklung stehen, umso gesteigerter ist ihr Erinnerungsvermögen. Zwischen Mensch und Tier klafft diesbezüglich eine enorme Differenz. Das Tier hat ein punktuelles Bewusstsein, indes der Mensch sich nicht nur seines eigenen Lebens, sondern auch der Geschichte der Welt erinnert.
Wie hat es nun aber die Materie geschafft, Sensibilität, Bewusstheit, Gedächtnis und Entwicklungsfähigkeit zu erlangen? Wiederum begnügt sich das schlichte Volk mit dem biblischen Schöpfungsbericht, der die Erschaffung der Pflanzen, der Tiere und des Menschen an das Ende der Schöpfungswoche verlegt. Für uns Heutige hat dieser Werdegang aber zwei bis drei Milliarden Jahre gedauert. Es spricht vieles dafür, dass das Lebendige durch Selbstorganisation der Materie entstanden ist. Wie das geschah, ist derzeit noch rätselhaft. Aber immerhin hatte der Kosmos schier unendlich viel Zeit, um alle Kombinationen der Physik und Chemie auszuprobieren, und irgendwann gelang der große Zufallstreffer, der die Evolution in Gang setzte.
Durch die Entschlüsselung des genetischen Codes durch James Watson und Francis Crick hat die Biochemie des Lebendigen großen Auftrieb bekommen. Aber Tausende Fragezeichen sind geblieben. So meint Crick, dass das Leben durch Meteore aus dem Kosmos auf die Erde verpflanzt wurde. Das ist denkbar, denn einfache Aminosäuren sind durch Spektralanalysen im Universum vielfach festgestellt worden. Das verlagert jedoch das Problem der Biogenese lediglich und löst es nicht.
Wo immer auch das Leben herkommt, ist es unverkennbar, dass wir in ihm ein fragiles Gebilde vor uns haben, dem die Kompaktheit der unbelebten Materie abgeht. Wo Lebendiges in Erscheinung tritt, ist auch das Sterben eingeplant. Geburt und Tod gehören wesensmäßig zu den Lebensträgern.
Dadurch kommt es in diesen zur so genannten inneren Zeit, die von der Raumzeit oder kosmologischen Zeit differenziert werden muss. Der Mensch ist sich sogar dieser (im Sinne Henri Bergsons) Dauer durchaus bewusst; er wird häufig des Faktums inne, dass Zeit an ihm nicht nur wie ein äußerlicher Prozess abläuft, sondern regelrecht durch eigene Bewusstseinsaktivität gezeitigt werden muss. Der Mensch weiß um Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft; in ihm ist die Zeitstruktur des Seins transparent geworden.
Seit Charles Darwin steht der Evolutionsgedanke fest und unerschütterlich; die Frage ist nur, durch welche Mechanismen oder Dynamismen die Entwicklung eingeleitet und fortgesetzt wurde: War es im Wesentlichen ein mechanistisches Geschehen? Ein zufälliges Vorangehen und Aufsteigen in der Differenzierung und Vervollkommnung? Oder gar eine Lebensschwungkraft, ein Perfektionsdrang, der sieghaft immer bessere und vollkommenere Organismen schuf?
Das Thema wird immer noch lebhaft diskutiert und wohl nicht so bald seine Lösung finden. Staunen angesichts des Lebendigen ist jedoch am Platze, denn hier haben wir es mit einer Seinsvariante zu tun, die möglicherweise ein Unikum im Kosmos darstellt. Ob es in anderen Galaxien Leben ähnlich wie auf der Erde gibt, weiß niemand, trotz der blühenden und zügellosen Phantasie der Science-Fiction-Autoren, die das Universum mit pseudoterrestrischen Zivilisationen bevölkern, in denen es ungefähr so kläglich und hochstaplerisch zugeht wie bei uns auf der Erde.
– Das dritte Welträtsel, dessen wir gewahr werden, wenn wir mit einem philosophischen Blick in die Welt schauen, ist das Bewusstsein. Das ist eine Eigentümlichkeit, die wir nur den Lebewesen zuschreiben können. Auch hier gibt es gravierende Unterschiede. So können wir kaum annehmen, dass die Pflanze ein echtes Bewusstseinsleben aufweist. Sie reagiert natürlich vielfach auf ihre Umwelt, es fehlt aber ein zentralisiertes Nervensystem. Allerdings wird immer wieder behauptet, dass auch die Pflanzen eine Art Psyche besitzen. Gustav Theodor Fechner, der berühmte Physiker im 19. Jahrhundert, hat sogar ein Buch veröffentlicht mit dem Titel: Nanna oder das Seelenleben der Pflanzen.
Das Tier benötigt ein Bewusstsein, weil es sich frei im Raume bewegt und dementsprechend ständig seine Umwelt wahrnehmen und beurteilen muss. Das ist vermutlich die primäre Bewusstseinsfunktion. Aber das tierische Bewusstsein kann wohl kaum mit dem menschlichen gleichgesetzt werden. Es ist nämlich durchaus punktuell oder, wie Nietzsche es ausdrückt, „kurz angepflockt an den Pflock des Augenblicks“.
Einen so genannten Bewusstseinsstrom im eigentlichen Sinne des Wortes stellen wir nur beim Menschen fest. Es fehlt dem Tier die Dreidimensionalität der Zeitlichkeit, nämlich die dauernde Synthese von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Das Tier lebt immer gegenwärtig, und das macht zum Teil den Reiz seiner Anmut, die natürliche Selbstverständlichkeit seiner Bewegungen und Reaktionen und seine Unschuld aus. Die Enge seines Zeitbewusstseins korreliert mit seiner relativen Weltarmut. Tiere fassen nur Gegenstände und Sachverhalte auf, die sie vital interessieren. Anders beim Menschen: Er ist ein weltoffenes Wesen, und sein Zeiterleben dehnt sich unendlich weit in Vergangenheit und Zukunft aus.
Franz Brentano, Edmund Husserl und andere haben beobachtet, dass Bewusstsein immer Bewusstsein von etwas ist. Das nennt man die Intentionalität. Bewusstsein ist immer gerichtet auf etwas, was mehr oder minder außerhalb seiner selbst ist. Damit wollen diese Autoren die Vorstellung bekämpfen, dass das Bewusstsein ein Kasten ist, in dem Wahrnehmungen, Vorstellungen, Willensregungen und Empfindungen herumschwirren. Das ruft uns in Erinnerung, dass der Mensch durch sein Bewusstsein stets über sich selbst hinaus greift und sich so mit der Wirklichkeit in allen ihren Gestalten verknüpft.
Weiter oben sprachen wir vom Bewusstseinsstrom, und auch er ist bedenkenswert. Es ist doch seltsam, dass unsere Bewusstseinsaktivität eine Kohärenz besitzt, die das gesamte gelebte Leben umgreift. Immer tragen wir den Ballast unserer Vergangenheit mit uns, und dauernd sind wir mit unserer Zukunft beschäftigt. So wird unsere Gegenwart zu einem winzigen Jetztpunkt inmitten gewaltiger Zeiträume, die vor und hinter ihm liegen.
Man muss sich aber nicht vorstellen, dass diese Bewusstseinswelt aus nebeneinander liegenden Zeitpartikeln besteht. Bergson war der Meinung, dass die Bewusstseinstätigkeit eines Menschen einer Symphonie ähnele, einem großen Sinnzusammenhang, in dem alles und jedes einander beeinflusst und durchdringt.
Vermutlich stellt diese innere Zusammengehörigkeit aller Bewusstseinselemente einen wichtigen Faktor der psychischen Gesundheit dar. Als Freud seine erste Neurosentheorie formulierte, gewann er den Eindruck, dass man dann psychisch krank wird, wenn der Sinnkonnex des Bewusstseins und der Lebensgeschichte infolge von psychischen Traumen zerrissen wird. Die Kranken leiden, wie er 1895 (Studien über Hysterie) sagte, an Erinnerungslücken, die durch die Therapie ausgefüllt werden müssen. Überblickt der Patient weithin seine bewusste und seine verdrängte Biographie, so erlangt er Intaktheit des Ich und ein souveränes Lebensgefühl.
Je mehr sich ein Mensch seines gelebten Lebens erinnern kann, desto ausgeprägter sind Ichstärke und Personalität. Schopenhauer deklarierte, die wesentlichste Eigenschaft des Genies sei das sehr weitläufige Sich-erinnern-Können an die eigene Lebensgeschichte. Darum kultivieren hochgeistige Menschen die Erinnerung, indem sie eventuell Tagebücher führen oder viele Aufzeichnungen machen, in denen sie ihre Schicksale festhalten und reflektieren.
Jedenfalls ist das Bewusstsein eine Seinsschicht, die wir nicht zum Anhängsel und bloßen Derivat der Biologie machen können. Nicolai Hartmann spricht davon, dass wir es hier mit einer neuen ontologischen Region zu tun haben. Wohl sind Seele und Bewusstsein von der biologischen Seinsschicht getragen und mitbestimmt, aber wir müssen uns damit vertraut machen, dass es eine gewisse Autonomie in der Bewusstseinstätigkeit gibt.
Alle materialistischen Doktrinen, die das Seelische und das Bewusste in den Bereich des Biologischen hinunterprojizieren wollen, sind unzulänglich. Schon die schlichte Lebenserfahrung scheint zu zeigen, dass man vom Bewusstsein her zu biologischen Fakten Stellung beziehen kann, etwa Impulsen, Trieben oder Bedürfnissen Einhalt gebietet, wenn dies im höheren Interesse der personalen Ganzheit liegt.
Dieses Bewusstsein ist in sich selbst transparent. Es gleicht zwar einem Lichtkegel, den man verschieden ausrichten kann. Aber im Prinzip ist es für sich selbst durchsichtig; Alain, der französische Philosoph, sagte: „Wissen ist nicht nur wissen von etwas, sondern auch wissen um sich selbst.“ Wir deuten hier nur an, dass dieses Statement Probleme aufwirft, etwa im Zusammenhang mit dem Unbewussten in der Tiefenpsychologie. Aber mit dieser Frage können wir uns hier noch nicht auseinandersetzen; wir werden später darauf zurückkommen.
– In den obigen Ausführungen leuchtet bereits auf, dass jedes Bewusstsein auch Selbstbewusstsein ist. Auf menschlicher Ebene wird die Bewusstseinsfunktion ständig begleitet durch eine Eigenkontrolle. Das wird angesprochen in der Definition von Kierkegaard, der vom menschlichen Selbst aussagt, es sei ein Verhältnis, das zu sich selbst ein Verhältnis hat.
Diese innere Aufgebrochenheit macht die Größe und die Tragik des Menschen aus. Er kann nie schlicht dahinleben, sondern wird bedingt durch die Einstellung, die er zu sich selber hat. Dieses Selbstverhältnis hat auch Sigmund Freud beobachtet, als er die Theorie des Über-Ich einführte, also die These von einer Stufe im Ich, in welcher sich die Selbstwahrnehmung, das Gewissen und das Ich-Ideal niederschlagen.
In den späten Theorien des Schöpfers der Psychoanalyse tritt die Beschäftigung mit dem Über-Ich immer deutlicher hervor. Freud meinte, dass eine Pathologie dieser psychischen Instanz nicht nur den individuellen, sondern auch den kollektiven Neurosen zugrunde liegt. Hat der Kulturprozess krankhafte Wertmaßstäbe und Ideale hervorgebracht, dann liegt das Selbstverhältnis aller Kulturmenschen sehr im Argen, und sie können sich niemals mit ihrer Triebschicht oder der vitalen Basis ihres Lebens überhaupt fruchtbar auseinandersetzen. Eine Korrektur der Wertungen und Ich-Ideale stand beim alten Freud im Mittelpunkt jeglicher Psychotherapie.
Auch die Philosophie vor Kierkegaard hat bereits dieses Selbstverhältnis im menschlichen Bewusstsein registriert. Hegel definierte das Bewusstseinsleben als ein Für-sich, im Gegensatz zum An-sich-Sein, das man in der gesamten materiellen Welt beobachtet. Durch diese Selbstbezogenheit ist eine gewisse Schizophrenie in den Menschen von Natur eingepflanzt. Immer besteht er aus zwei Teilen, und wenn diese sehr auseinander klaffen, kann möglicherweise der Ausbruch einer schizophrenen Erkrankung begünstigt werden.
Es mag wohl daher kommen, dass der Mensch stets mit einem gewissen Neid auf die an sich seiende Welt blickt, die ihm imponiert durch ihre majestätische Ruhe und Unerschütterlichkeit. Demgegenüber – wenn man etwa ein Gebirgsmassiv oder das Meer in ihren schier grenzenlosen Dimensionen in Betracht zieht – ist das Bewusstsein etwas Hinfälliges, Schwaches und Kränkelndes. Das wird noch besonders betont durch den Umstand, dass das um sich selbst wissende Bewusstsein seine Todverfallenheit kennt, also durch das Sterbenmüssen geängstigt wird.
Jean-Paul Sartre weist darauf hin, dass viele Menschen in ihrem Leben das Unmögliche versuchen, aus ihrem Für-sich-Sein ein An-sich-Sein zu machen; sie wollen nicht Menschen wie alle Menschen sein, sondern Naturgewalten, deren Macht und Größe übermenschlich ist. Das ist eine der Erklärungen für den menschlichen Größenwahn und die Aufhebung der zwischenmenschlichen Solidarität.
Um die Tatsache des Selbstbewusstseins im Bewusstsein wissen die Menschen seit den Anfängen der Kultur. Wer sich selbst beim Namen nennt oder auch nur Ich sagt, bekennt sich zum Wissen um sich selbst. Wir können beobachten, wann im Kinde das Selbstbewusstsein im Keim aufdämmert. Die heutige Vermutung geht dahin, dass dies im Allgemeinen etwa im dritten Lebensjahr geschieht.
Manche Dichter haben dieses Erlebnis eindrücklich beschrieben; so etwa Jean Paul, der ganz genau zu wissen glaubte, wann und wo ihm im dritten Jahr die Einsicht kam, dass er Ich sei. Der schweizerische Dichter Carl Spitteler behauptete sogar, dass er als Einjähriger in der Wiege lag, zur Decke hochsah und wusste, dass er ein Ich habe. Aber das ist wohl ein bisschen übertrieben.
In der Philosophie war das Ich-Bewusstsein immer präsent. Zum eigentlichen Gegenstand einer großen Besinnung machte es jedoch erst René Descartes. In seinen Meditationen aus dem Jahre 1637 bezweifelt er radikal alle Annahmen, die er in seinem Geist vorfindet; er landet aber zuletzt bei der unmittelbaren Gewissheit, dass er – Cogito! – ein denkendes Ding sei, seiner selbst gewiss. Das war eine große Entdeckung, die den Gang der Philosophie seither mächtig beeinflusst hat. Im Grunde sind alle Philosophen der Neuzeit ein wenig Cartesianer, auch wenn sie in vielen Punkten mit dem scharfsinnigen Franzosen nicht übereinstimmen.
Sartre, der in der Tradition von Descartes verankert ist, spricht in seinem Hauptwerk Das Sein und das Nichts (1943) nicht vom menschlichen Dasein (wie etwa Heidegger), sondern immer nur vom Cogito, und damit meint er das sich selbst transparente Bewusstsein, das den Menschen von allen übrigen Lebewesen abhebt.
– Das nächste Thema, das wir beim Einstieg in eine Philosophie der Alltäglichkeit antreffen, ist der Mitmensch. Er figuriert in den fachphilosophischen Texten als der Andere. Wie ist mein Verhältnis zu ihm und sein Verhältnis zu mir? Der Laie mag sich fragen, was es da viel zu bedenken gibt. Manche Mitmenschen mögen wir, gegen andere hegen wir Abneigung, und fast alle anderen (und das sind sehr viele) sind uns gleichgültig. Soll auch dies der philosophischen Reflexion unterworfen werden? Es soll nicht nur, es muss!
Seit den Anfängen der Philosophie erörtern die Philosophen das soziale Leben des Menschen. Wir greifen hier nur auf moderne Autoren zurück. In Heideggers Sein und Zeit (1927) lesen wir die lapidare Feststellung: Dasein ist Mit-Sein. Das bedeutet im Rahmen dieser Existenzphilosophie, dass in allen Lebensverhältnissen das menschliche Miteinander immer auch schon präsent ist. Nirgends kommt der Mensch ohne Mitmenschlichkeit aus.
Damit ist etwas Richtiges gesehen, aber Heidegger lässt es bei dieser summarischen Konstatierung bewenden. Sein Schüler Karl Löwith fand 1928 diese Feststellung kaum ausreichend. Er verfasste daher eine Habilitationsschrift mit dem Titel Das Individuum in der Rolle des Mitmenschen, worin er sehr subtil die Formen der Mitmenschlichkeit abhandelt. Das ist übrigens einer der Grundsteine zu dem, was man in diesem Fachbereich Sozialontologie nennt.
Auch Sartre, der im Allgemeinen gern auf den Spuren Heideggers wandelt, schreibt in Das Sein und das Nichts, diese Art der Diskussion des Miteinander sei roh und barbarisch. Er findet, dass Hegel diesbezüglich schon viel differenzierter auf das Verhältnis von Mensch und Mitmensch eingegangen sei. Dabei bezieht er sich auf Hegels Buch Phänomenologie des Geistes (1806 / 07). Dort gibt es ein seit jeher viel beachtetes Kapitel „Herr und Knecht“, das sehr kontroverse Interpretationen stimuliert hat.
Hegel sagt, dass bei der Begegnung zweier Selbstbewusstseine stets ein Kampf um die Überlegenheit stattfindet. Wenn Menschen einander begegnen, stellt sich immer die Frage, wer Herr und wer Knecht sein soll. Mit anderen Worten: Jedes Selbstbewusstsein will sich selbst als Subjekt definieren; und um das zu ermöglichen, soll der andere Objekt sein.
In allen geschichtlichen und sozialen Situationen erkennt Hegel das untergründige Ringen der Menschen um Überlegenheit. Zum Herrn wird jener, der die Macht und Unabhängigkeit höher ansetzt als das Leben. Der Knecht jedoch wählt das Überleben um jeden Preis, und das führt ihn in ein Sklavendasein. Aber Hegel weiß auch, dass kein Mensch die Unterjochung leicht erträgt. Daher träumt der Sklave immer von Herrschaft, und wenn es die Verhältnisse erlauben, revoltiert er und entmachtet seine Unterdrücker. Man sieht, dass in Hegel sein Fortsetzer und Widersacher Karl Marx bereits angelegt ist.
Aber Hegel ist nicht nur der Diagnostiker des ubiquitären Willens zur Macht in der Menschengemeinschaft. Er beschreibt auch die Möglichkeit, dass die Selbstbewusstseine einander akzeptieren und sich solidarisieren. Da das menschliche Selbst etwas sehr Fragiles ist, benötigt es dringend diese Unterstützung durch ein Du. Hegel formuliert sogar: „Das Sein des Selbstbewusstseins liegt in der Anerkennung durch ein anderes Selbstbewusstsein.“ Dieses Verhältnis nennen wir Achtung, Wohlwollen oder gar Liebe. Nach Hegel gedeiht der Mensch nur in dieser Atmosphäre der wechselseitigen Bejahung, und es macht das Glück und Unglück seines Lebens aus, ob er derlei in ausreichendem Maße findet.
Das ist eine sehr moderne Erkenntnis, die etwa durch die Tiefenpsychologie vielfach bestätigt wird. Schon das Kleinkind benötigt für sein Wachsen und Werden die schier uneingeschränkte mütterliche Zuwendung, was ja Anerkennung in höchstem Maße bedeutet. Später im Leben gelten ähnliche Bedingungen. Menschen, die nicht mehr an Bejahung durch ein Du glauben, erkranken physisch oder psychisch und können sogar einem Wahn anheim fallen.
Aber warum ist wechselseitige Bejahung im Menschenleben so schwierig und so selten? Auch hier weiß Hegel bereits Bescheid. In seinem genannten Werk postuliert er, dass auf der Ebene der Begierde jedes Selbstbewusstsein auf den Tod des anderen Selbstbewusstseins auszugehen pflegt. Anders ausgedrückt: Wenn uns Begierde und Angst antreiben, kommen wir erst zur Ruhe, wenn der Mitmensch sich in die Objektrolle fügt und uns zur Verfügung steht. Gelingt es uns aber, ihm liebend zu begegnen, dann wollen wir nicht die Auslöschung seiner Freiheit und seines Bewusstseins. Wir können neben ihm frei sein und auch ihm die Freiheit gönnen.
Sartre, der diese Ausführungen von Hegel trefflich benützt, bringt diese Einsichten unter in seiner berühmten Analyse des Blicks. Er erörtert, was geschieht, wenn ein Mensch allein in der Landschaft ist. Dann überblickt er nämlich alle Dinge und Gegebenheiten und ist souveränes Bewusstsein. Kreuzt aber ein Mitmensch auf, der ihn anblickt, wird er auf die conditio humana zurückgeworfen und ist eben Subjekt und Objekt zugleich.
Das erträgt nur, wer eine gewisse Stärke in sich fühlt. Je schwächer der Mensch ist, umso radikaler will er nur Subjekt (und das heißt fast gottähnlich) sein. In jedem Menschen steckt nach Sartre das bewusste oder unbewusste Verlangen, Gott zu werden – und das ist nun einmal zum Scheitern verurteilt.
Wiederum kann man korrigierend sagen, dass es auch die Möglichkeit des liebenden Blicks gibt. Da wird nicht via Anschauen und Beobachten um Herrschaft gekämpft, sondern man fasst den anderen ins Auge, um sein Wohl und seine Entwicklung anzustreben. Nicolai Hartmann hat diesen Gesichtspunkt in seiner Ethik (1926) erörtert. Die große Frage ist allerdings, wie die Menschen dazu angeleitet werden können, mit einem liebenden Blick in die Welt zu schauen. Derlei fehlt uns an allen Ecken und Enden.
Es zeigt sich also, dass das Verhältnis Mensch und Mitmensch viel komplexer ist, als zunächst angenommen. Auch Martin Buber hat in verschiedenen Schriften (Ich und Du; Zwiesprache; Das Problem des Menschen) diese Problematik geistvoll diskutiert. Er ist der Meinung, dass der Mensch nur insofern Mensch ist, als er ein dialogisches Leben führt. Nur in der Zwiesprache wächst der Mensch zur Menschlichkeit heran. Hört die Kommunikation auf, zerfällt das Menschliche. Zwischen Ich und Du wird demnach die Substanz des Menschendaseins konstelliert. Wären wir dialogfähiger, könnten wir eventuell die Menschenwelt in Ordnung bringen.
Über die Wichtigkeit dieses Anthropinons (dieses Wesensmerkmals des Menschen) wissen wir zu wenig. Wir wissen, wie wir uns ernähren und physisch pflegen sollen; aber dass geordnete und gute menschliche Beziehungen so unentbehrlich sind wie der Sauerstoff zum Atmen, wird uns nicht beigebracht. Deshalb jagen wir äußeren Gütern nach und vernachlässigen die Beziehungswelt, welche die wahre Heimat des Menschen ist.
Gewiss ist hieran auch unser Gesellschaftssystem mit der dazugehörigen Ideologie schuld. Wir huldigen dem Kampf aller gegen alle und denken, dass trotzdem eine soziale Harmonie zustande kommen soll. Das ist wahrscheinlich ein schrecklicher Irrtum. Soll jemals eine intakte Menschenwelt entstehen, müssen Kommunikation und Kooperation der Leitstern jeglichen Handelns werden. Fast alle Utopien zeichnen einen solchen Zustand, und wenn sie auch manchmal etwas verstiegen anmuten, haben sie in der Tendenz recht, wenn sie diese Zielrichtung angeben.
Auch für die Selbstentfaltung brauchen wir immer den Mitmenschen als Helfer, Partner und Gefährten unserer Entwicklung. Manche Phänomenologen betonen sogar, dass jedes Werden des Menschen ein Mit-Werden (Eugen Minkowski) ist. Nehme ich nicht den anderen oder die anderen auf meinem Wege mit, sind meine eigenen Bestrebungen zur Sterilität und zum Scheitern verurteilt. Fürwahr: Dasein ist Mit-Sein, und das in einem Grade, wie es sich der Laienverstand kaum träumen lässt.
Ludwig Feuerbach, der vor 150 Jahren die anthropologische Wende in der modernen Philosophie vollzog, äußerte, dass nach dem Wegfallen der Gottesidee der Mitmensch in unserem Denken und Fühlen einen ähnlichen Rang einnehmen müsse wie früher die Gottheit. Das ist ein sehr hoher Anspruch, aber im Rahmen der Lehre Feuerbachs (Grundsätze einer Philosophie der Zukunft, 1843) hat das einen wohl umschriebenen Sinn. Erst der Mensch mit dem Mitmenschen zusammen macht echtes Menschsein aus.
– Wir sind bisher davon ausgegangen, dass der Andere ein geschlechtsneutrales Wesen ist. Das ist natürlich nicht der Fall; er ist entweder Mann oder Frau (und daneben Kind, Erwachsener oder Greis). Die Beziehung zwischen den beiden Geschlechtern ist wiederum ein Philosophicum hohen Ranges. Was sich zwischen Mann und Frau abspielt und ereignet, hat das Interesse der Denker seit jeher in Anspruch genommen.
Nun ist die Aufteilung in Männlichkeit und Weiblichkeit ein Phänomen, das schon bei den einfachsten Formen des Lebendigen auftritt und sich durch nahezu alle Arten hindurch manifestiert. Auf diese Weise wird die Fortpflanzung der Lebewesen gesichert. Kein Zweifel, dass dies eine sehr nützliche Einrichtung ist. Indem der Nachwuchs durch sexuelle Kopulation erzeugt wird, kommt es zur Genmischung, was unendliche Mannigfaltigkeit des Phäno- und Genotypus hervorbringt.
Des Weiteren wird wohl auch die Mutationsrate begünstigt; und da Mutation und Selektion die Motoren des Artenwandels sind, haben wir hier einen Evolutionsfaktor vor uns, dessen Bedeutung kaum überschätzt werden kann. Darwin hat bekanntlich die Evolution nicht nur auf den Kampf ums Dasein und das Überleben des Tüchtigsten zurückgeführt, sondern auch auf die sexuelle Zuchtwahl. Die vitalsten und tüchtigsten Männchen haben die größten Chancen bezüglich der Begattung und damit der Weitergabe ihres Erbgutes; ähnlich ist es mit den schönsten und ansprechendsten Weibchen.
Fasst man also die Beziehung der beiden Geschlechter ins Auge, so wird man mit der Sexualität konfrontiert, die ebenfalls eines der großen Lebensrätsel ist. Was sie genauer bedeutet, erschließt sich erst der umfassenden Reflexion. Zudem muss man sich bewusst sein, dass das Sexuelle auf menschlicher Stufe nicht dasselbe bedeutet wie im Tierreich. Warum ein solcher Unterschied zu stipulieren ist, wird weiter unten erklärt.
Ein Versuch, das Wesen der Sexualität zu deuten, findet sich bei Platon im Symposion. Darin wird der Mythos verkündet, dass die Menschen ursprünglich Doppelwesen waren, d. h. zwei Köpfe, zwei Rümpfe, vier Arme und vier Beine hatten. Diese Urmenschen hätten sich Rad schlagend durch die Gegend bewegt; es muss ein drolliger Anblick gewesen sein.
Da sich diese Doppelmenschen gegen die Götter vergingen, wurden sie entzweigeteilt und die Hälften in alle Winde auseinander getrieben. Seither, meint Platon, ist jeder Mensch nur eine halbe Portion und sucht fieberhaft jene Ergänzung, die er verloren hat. Findet er aber das entsprechende Supplement, ist er selig und will sich mit ihm vereinigen. Denn dadurch werden alle Gebrechen der menschlichen Natur geheilt und die ursprüngliche Ganzheit wieder restituiert.
Das klingt wie ein Kindermärchen, enthält aber tiefe Einsichten. Tatsächlich scheint es in der Sexualität um die Ganzwerdung des Menschen zu gehen. Die Natur hat für diese Totalisation eine hohe Lustprämie eingesetzt. Daher sehen wir Tier und Mensch eifrig bemüht, das Fortpflanzungsgeschäft zu betreiben. Schopenhauer sieht es sogar als Hauptaktion im Tier- und Menschenleben. Hat ein Lebewesen sich fortgepflanzt, dann ist seine Lebensaufgabe erledigt und es kann im Grunde bald sterben. Denn wichtig ist nicht das Individuum, sondern nur die Erhaltung der Art.
Was Schopenhauer im Tierreich sah, übertrug er unbedenklich auf die Menschenwelt. Auch dort geht es seiner Ansicht nach hauptsächlich darum, dass jeder Hans seine Grete, jeder Topf seinen Deckel und – beinahe drückt er sich so derb aus – jeder Penis seine Vagina findet. Alles andere sei Brimborium und nicht eigentlich von Belang. Das ist eine grandiose Vereinfachung, die sich nur ein großer Philosoph leisten kann. Wir anderen müssen genauer differenzieren. Für die Mann-Frau-Beziehung finden wir bei Tier und Mensch mehrere Funktionsbereiche, die wir etwa folgendermaßen auflisten können:
Es geht um die Zeugung und Aufzucht des Nachwuchses; auch außerhalb dieses Anliegens wird sexuelle Befriedigung angestrebt, die vor allem beim Menschen von der direkten Fortpflanzungsintention merklich abgelöst ist; das Paar bildet eine Zeit überdauernde Schutz- und Trutzgemeinschaft in einer feindlichen Umwelt; auf menschlicher Ebene kommt wechselseitige Anerkennung und Wertschätzung hinzu. Vorformen hiervon gibt es gewiss schon bei den Tieren, wo wir auch monogame Partnerschaften kennen.
Wenn wir die Erkenntnisse des vorangehenden Abschnittes im Sinn behalten, gelingt es uns vielleicht, das Wesen der menschlichen Sexualität tiefgründiger zu erfassen, als es bei jeder materialistischen oder naturalistischen Theorie der Fall ist. Solche Doktrinen glauben immer, tierische und menschliche Sexualität in einen Topf werfen zu können.
Selbst in der Psychoanalyse wird diese Irreführung noch perpetuiert. So sagt Freud, dass das Sexuelle dem so genannten Nirwana- oder Konstanzprinzip unterliege. Es sei lediglich eine Methode der Spannungsminderung im Organismus. Immer, wenn Spannung herabgesetzt wird, werde das als Lust empfunden. Man vereinige sich also mit dem Partner, um triebhafte Angespanntheit zu bewältigen; und das sei schon fast alles.
Wir unsererseits glauben, dass Sexualität mehr bedeutet. Sie ist vielleicht gar nicht unter den Begriff Trieb allein zu subsumieren, der sehr viel Dunkelheit enthält. Wir wollen auf diese Diskussion nicht eingehen, aber immerhin Zweifel daran anmelden, dass triebhafte Abreaktion allein das sexuelle Bedürfnis erkläre.
Dem phänomenologischen Blick zeigt sich, dass das Sexuelle eine Weise ist, sich den eigenen Leib anzueignen und in ihm zu wohnen. Normalerweise ist der Mensch außerhalb seiner selbst und setzt seinen Organismus instrumental ein, indem er mit der Welt im tätigen Umgang steht. Das ist anstrengend und verlangt sozusagen danach, immer wieder periodisch in den Leib einzutauchen und dabei Erholung zu finden. Das geschieht im Schlaf und eben auch in der Sexualität.
Das Beglückende und Erquickende des Sexualaktes liegt darin, dass der Mensch in ihm vollumfänglich leibhaft zu existieren versucht. Das alltägliche Gespaltensein kommt zur Ruhe, und man wird identisch mit sich selbst. Hierzu braucht man aber, anders als beim Schlaf, den Sexualpartner, mit dem gemeinsam die Leibwerdung der Existenz vollzogen wird.
Ein anderer Gesichtspunkt ist folgender: Wir sagten weiter oben mit Hegel, dass das Sein des Selbstbewusstseins in der Anerkennung durch ein anderes Selbstbewusstsein begründet ist. Nun wäre es teilweise abgehoben, wenn derlei nur durch Worte, Mimik und Gestik zustande käme. Im sexuellen Geschehen bemühen sich die Liebenden darum, einander die Bejahung mit dem vollen Einsatz ihrer Leiblichkeit zu demonstrieren.
Das ist der Sinn des Zärtlichseins sowie der sexuellen Vereinigung und Verschmelzung im Orgasmus. Sozusagen bis in alle Zellen des Organismus hinein findet eine wechselseitige Bestätigung statt, die den Sexualakt möglicherweise zu einem kurzfristigen Himmel auf Erden macht. Er ist auch die Quelle vieler innerer und äußerer Entwicklungen. Die Daseinsanalyse erklärt, dass der Sinn des Koitus nur sehr bedingt in der Spannungsreduktion liegt, viel mehr in der Daseinseinigung und Daseinsmehrung, d. h. in der Eintracht mit einem Du und den daraus abgeleiteten Entfaltungsimpulsen.
Rainer Maria Rilke betonte (Brief an einen jungen Arbeiter, 1922), dass das Sexuelle der Ort sei, wo wir alle noch Kind bleiben, selbst wenn wir schon erwachsen sind. Es erlaubt dementsprechend eine tiefe Regression, die mit Glücksgefühlen verbunden ist. Wer den Menschen diesen Freudenquell vergifte, sei im Grunde lebensfeindlich. Noch radikaler drückt sich Nietzsche aus, der die Sexualfeinde in der abendländischen Geistesgeschichte Irrenhäusler nennt, welche die ganze Welt zu einer Nervenklinik umgestalten wollten.
Im Mann-Frau-Verhältnis liegt also eine Beziehung zum anderen vor, die von schier unendlicher Tragweite für die Seinsfülle und Selbstverwirklichung des Menschen ist. Leider ist dieses zentrale menschliche Verhältnis selten so beschaffen, dass es die beschriebenen Aufgaben und Funktionen erfüllen kann. Wenn Mann und Frau als Partner einander seelisch und sexuell bestätigen sollen, müssen sie dazu auch in der Lage sein.
Nun kann dies nur fruchtbar realisiert werden, wenn beide Beteiligten über eine gesunde Sexualität verfügen und genügend Selbstachtung in sich tragen, um Hingabe und Wertschätzung für das Du leisten zu können. Die meisten Menschen sind in beiderlei Hinsicht tragisch blockiert. Ihre sexuelle Funktion ist gehemmt, ihre Beziehungsfähigkeit durch Angst vor dem Du und verschrobene Fremdwahrnehmung deformiert.
So kommt es zu einer Dialektik zwischen beiden Unzulänglichkeiten; um die Hingabe zu vermeiden, entzieht man dem Partner die notwendige Akzeptanz, was zu trennenden Gefühlen führt. Diese setzen sich in Angst und Aggression um, wodurch wieder das Sexuelle verunmöglicht wird. Daher die universelle Partnerschaftsmisere, das Unglück in Liebe und Ehe und die vielen Scheidungen, welche die Sozialpolitik beunruhigen.
Erst wenn die Beteiligten lernen, in der Paarbildung und in der Geschlechtlichkeit eine exquisite Bedingung ihrer eigentlichen Selbstwerdung zu sehen, können sie dem Sinn der Mann-Frau-Beziehung entsprechen. Das benötigt oft psychotherapeutische Hilfe. Wie viele Ängste müssen dabei abgebaut, wie viele Vorurteile korrigiert werden! Erst jenseits des Kampfes der Geschlechter kann jenes Ideal verwirklicht werden, das im Chor einer Mozart-Oper angesprochen wird, nämlich: „Mann und Frau und Frau und Mann – reichen an die Gottheit an!“
– Wir haben bisher drei Schichten der Wirklichkeit ins Auge gefasst: Das materielle Sein, das Leben und das Bewusstsein (Psyche). Das ist aber ein unvollständiges Konzept der Realität. Es gibt nämlich noch eine vierte Schicht, und sie ist für das Verstehen des Menschen von grundlegender Bedeutung. Es handelt sich um das geistige Sein, also die ontologische Sonderregion des Geistes.
Wenn Naturwissenschaftler das Wort Geist hören, wird ihnen oft (und das war vor allem im 19. Jahrhundert so) recht unbehaglich. Sie identifizieren nämlich Geist sehr leicht mit den Geistern, und dann sehen sie schon die Gefahr des Spiritismus herannahen. Aber der Spiritismus ist vermutlich eine durchaus ungeistige Angelegenheit. Unseres Erachtens ist er nur eine Form des Aberglaubens.
Wenn wir von Geist reden, meinen wir etwas ganz Realistisches, keinen Spuk und nichts Überweltliches. Geist ist ein Wesensmerkmal des Menschen, ein Anthropinon. Kein anderes Lebewesen verfügt über Geistigkeit. Tiere sind intelligent, aber geistig sind sie nicht. Erst mit dem Menschen taucht die Dimension des Geistes im Kosmos auf.
Geist ist identisch mit Person, Vernunft, eventuell auch Existenz im Sinne der Existenzphilosophie. Er zeigt sich unter anderem in Weltoffenheit, Freiheit und Selbstgestaltung des Menschen. Durch den Geist gewinnt der Mensch teilweise eine weltüberlegene Haltung. Er hat sozusagen einen Standort außerhalb des Naturgeschehens, zu dem er Stellung nimmt und das er bewertet.
Die Geistigkeit ist schon in der Biologie des Menschen angelegt. Wir denken hierbei nicht nur an die vergrößerte Hirnmasse, die natürlich auch in Betracht fällt. J. G. Herder betonte schon im 18. Jahrhundert, dass ein Lebewesen mit aufrechtem Gang, mit einer Werkzeughand (opponierbarer Daumen) und Parallelisierung der Augenachsen für den Geist disponiert ist. Denn so kann der Mensch werktätig in die Welt eingreifen und schauend in die Ferne und Zukunft blicken. Heidegger sagt lapidar: „Der Mensch ist ein Wesen der Ferne.“ Tiere jedoch sind an ihre Nähe gebunden; sie blicken nicht weit und sind oft dem Boden zugewandt; der Raum des Himmels ist ihnen kaum zu Eigen.
Der Geist ist hauptsächlich Gegenstand der so genannten Geistes-, Kultur-, Human- und Geschichtswissenschaften. Diese haben sich bekanntlich erst nach den Naturwissenschaften voll emanzipieren können. Auch darum sind viele Menschen mit ihnen nur halb vertraut. Die Psychologie nimmt eine eigentümliche Stellung zwischen den Natur- und Geisteswissenschaften ein. Das kommt daher, dass viele seelische Reaktionen entweder von der Leibsphäre oder von der Geistigkeit stark beeinflusst werden.
Die Psychoanalyse sollte eine echte Naturwissenschaft sein; Sigmund Freud als waschechter Aufklärer, Materialist und Sohn des 19. Jahrhunderts wollte sich unbedingt an die exakten Wissenschaften anlehnen. Das führte zu Determinismus, Kausalismus und Triebtheorie sowie stellenweise zu einem Reduktionismus, der berechtigte Kritik gefunden hat.
Es gibt hierzu eine hübsche Anekdote. Als Freud 1936 seinen 80. Geburtstag feierte, kam sein Schweizer Schüler und Freund Ludwig Binswanger nach Wien und hielt dort einen Festvortrag. Darin bekannte er sich zur Psychoanalyse, bemängelte aber an ihr, dass sie der geistigen Dimension des Menschen bisher nicht gerecht geworden sei. Freud dankte für die Ausführungen Binswangers, sagte ihm aber sinngemäß, er könne seine Haltung nicht billigen. Er, Freud, habe sich immer im Souterrain der Seelenforschung aufgehalten und dort die Triebstruktur des Menschen erkundet. Nun behaupte man, dass im ersten Stock des Hauses die vornehmen Herrschaften der Geisteswissenschaft wohnhaft seien. Hätte er noch ein Arbeitsleben vor sich, würde er sich anheischig machen, auch diese Sippschaft im Souterrain unterzubringen.
Das ist ihm nicht gelungen, und es wird auch für andere Leute kaum realisierbar sein. Geist ist kein bloßes Triebderivat; er geht auch nicht im rein Seelischen auf. Er ist eine autochthone Schicht, wohl abhängig von Physis und Psyche, aber relativ frei ihnen gegenüber. Das ist wenigstens die Überzeugung aller, die sich vorurteilsfrei mit der Dimension der Geistigkeit beschäftigen. Was ist nun aber Geist? Es gibt viele Aspekte, durch die wir seiner ansichtig werden. Hier nur eine eher lückenhafte Aufzählung:
– Geist ist Abstand zu sich selbst und zur Welt. Zwischen dem Menschen als Physis und Psyche und als Geistigkeit klafft ein Hiatus; ähnlich besteht auch ein Hiatus zwischen Mensch und Welt. Infolge dieser Abgesondertheit ist der Mensch nicht in seine Umwelt verzahnt. Tiere werden determiniert durch innere Motivationen und äußere Bedingungen; man kann einen Großteil ihrer Aktivitäten kausal beschreiben. Beim Menschen kommt zwischen Motiv, Anstoß und Handlung der Verzögerungsfaktor der Besonnenheit hinzu. Wiederum war es Herder, der in seinen Schriften die Besonnenheit als das Menschlichste am Menschen beschrieb.
– Geist ist Fähigkeit zum Symbolgebrauch. Der Mensch ist nach Ernst Cassirer ein animal symbolicum. Wo er in Erscheinung tritt, eröffnet sich die Welt der symbolischen Formen. Tiere kennen nur Zeichen, die in direkter Abhängigkeit zum Gezeigten stehen. Nicht so das Symbol; es ist eine freie Schöpfung und vermehrt die Freiheit des Menschen in seiner Welt. Besondere Symbolschöpfungen gibt es in den Wissenschaften und Künsten, im Alltag sowie in Mythen und Religionen.
– Eine exquisite Symbolschöpfung des Menschen ist die Sprache. Sie ist ein Wunderwerk des Geistes. Durch sie schafft der Mensch eine Welt innerhalb der Welt, beinahe eine Gegenwelt, in der er fast noch mehr heimisch ist als in der handfesten Realität. Durch sie wächst sein Freiheitsspielraum unermesslich. Nur sprachlich konnte der Mensch seine Herrschaft über die Welt entwickeln und ausbauen. Und wenn er darin noch weitergehen will, kann er dies nur, indem er die Sprache perfektioniert. Ludwig Wittgenstein sagt: „Die Grenzen meiner Sprache sind die Grenzen meiner Welt.“
– Geist ist auch die Fähigkeit zur Abstraktion. Der unmittelbare Sinneseindruck führt zur Bildung von Begriffen, die tausendfältige Erfahrung zusammenfassen können. Die menschliche Sprache ist eine Begriffssprache, also Resultat der abstrahierenden Intelligenz.
– Des Weiteren eröffnet sich dem menschlichen Geist das Reich der Werte. Geistigkeit ist Werterkenntnis. Nach Nicolai Hartmann sind Werte ein ideales Sein, d. h. nicht greifbare Realität, aber deshalb nicht weniger wirklich. Sie sind die Sphäre des Sollens, also dessen, was durch den Menschen (und nur durch ihn allein) verwirklicht werden kann. Es gibt die Werte der Wahrheit, Schönheit, Gerechtigkeit, des Guten und der Echtheit; daneben noch viele andere, die den Kosmos der Werte konstellieren.
Nach Max Scheler sind die Gefühle die Organe, durch die wir Werte wahrnehmen. Das bedeutet, dass zwischen Gefühl und Geist ein enger Konnex bestehen muss. Man hat nur so viel Geistigkeit, wie die vorhandene Emotionalität tragen kann. Gefühlskarge Menschen jedoch sind per definitionem ungeistig.
– Durch den Geist kommt im Menschen auch eine Veränderung des Zeiterlebens zustande. Das haben wir bereits weiter oben erwähnt. Die Entfaltung der drei Dimensionen der Zeitlichkeit sind ein Werk des Geistes. Durch sie ist der Mensch in der Lage, biographisch und autobiographisch zu denken, und das ist ein Kernstück seiner geistigen Potenz. Weitere Aspekte des Geisteslebens sind das Bewusstsein der eigenen Endlichkeit und Sterblichkeit, das Wissen um den Tod. Wir könnten noch viele weitere Punkte namhaft machen, wollen es aber dabei bewenden lassen.
Was wir bisher dargelegt haben, ist jedoch nur der personale Geist, das subjektive Geistigsein des Menschen. Das ist aber bei weitem nicht ausreichend. Seit Hegel ist unsere Aufmerksamkeit auf den objektiven Geist gelenkt, der das viel umfassendere Geistesphänomen darstellt. Diesem Philosophen zufolge findet eine dauernde Wechselwirkung zwischen subjektivem und objektivem Geiste statt, und nur wer das sieht, kann das Phänomen Geist begreifen.
Der subjektive Geist wird getragen von der psychophysischen Existenz des Individuums. Wer aber ist der Träger des objektiven Geistes? Nach Hegel ist dies das soziale Kollektiv, sei es das Volk, eine Gesellschaft, der Kulturraum oder die Zeitgenossenschaft. Diese Kollektivindividuen bringen gewissermaßen die Fülle und Mannigfaltigkeit des kollektiven Geisteslebens hervor. Dabei handelt es sich um Sprache, Wissenschaften, Künste, Sitten und Bräuche, Rechtsnormen sowie ökonomische, politische und soziale Strukturen.
Der objektive Geist hat seine Geschichte. Während die Individuen kommen und gehen, bleibt der kollektive Geist mehr oder minder beständig und entfaltet sich auf eigene Weise. Er ist die geistige Atmosphäre einer Epoche, ihre geistig-kulturelle Welt. An dieser Instanz bilden sich Individuen und Gruppen heran, und sie könnten nichts bewirken, wenn ihnen nicht der objektive Geist alle Wege des Wachsens und Werdens bahnt. Entzieht sich der Einzelne dieser Quelle der Kultur, wird er zum „abgeschiedenen Geist“ (Hegel), welcher der Bedeutungslosigkeit und Sterilität anheim fällt.
Diese Form des Geistes ist das wahrhaft Verbindende unter allen Menschen dieser Erde. Geistige Wahrheiten oder Schönheiten gehören allen, und es wäre lächerlich, auf sie partikuläre Besitzansprüche zu erheben. Hartmann sagt: „Bewusstsein bleibt isoliert, aber Geist verbindet.“ Durch geistige Einsichten und Arbeiten wird die universale Menschengemeinschaft auf dieser Erde bereits anvisiert, indes Politik und andere Machtambitionen dazu eher im Widerspruch stehen.
Nur nebenbei sei bemerkt, dass es auch das Phänomen des objektivierten Geistes gibt. Das sind jene Dinge und Tatsachen, in denen individuelle und kollektive Geistesarbeit ihren Niederschlag gefunden haben. So haben wir drei Zonen des Geistes vor uns, die interdependent sind. Indem die Masse des objektiven und des objektivierten Geistes anwächst, hebt sich langsam das Niveau der Kultur, und Individuen und Gruppen, die ihren Lebenslauf beginnen, können von dieser Erhöhung profitieren. So geht der Kulturprozess voran, aber Rückfälle geschehen häufig, weil geistlose Menschen und Zustände diesen Siegeslauf behindern.
Versteht man all das Gesagte richtig, dann sieht man den Menschen als Schöpfer und Geschöpf der Kultur. Hieran müssen sich vor allem die Naturwissenschaften erinnern, die den Menschen als bloßes Naturwesen definieren wollen. Das ist sicherlich zu eng gedacht. Manche Autoren sagen sogar, dass die eigentliche Natur des Menschen die Kultur sei. Jeder Naturalismus zeichnet ein Zerrbild des Menschen.
Das zeigt uns aber auch die Aufgabe, die sich in unser aller Leben stellt. Was an wahrhaft Menschlichem in und an uns ist, haben wir durch den objektiven und objektivierten Geist empfangen. Sie sind die großen Geber, die ihr unerschöpfliches Füllhorn über Einzelnen und Gruppen ausleeren. Wer nun edel empfindet, will nicht nur Empfänger sein, sondern die geschenkte Gabe mit Zins und Zinseszins zurückgeben. Das ist die Art der Kulturheroen, die durch titanischen und unermüdlichen Einsatz die Werke der Kultur vermehren und so den Raum des Humanen ausdehnen.
Geist ist eben nicht nur ein Faktum, sondern auch eine ideale Forderung. Er ist ein Sollen, also eine moralische Verpflichtung. An der Haltung ihm gegenüber entscheidet sich Wert und Unwert des Menschen. Vor allem die Philosophie macht uns auf diese Zusammenhänge aufmerksam und ist daher für die Lebensorientierung unentbehrlich.
– Die letzte philosophische Frage, die wir in unserem Zusammenhang diskutieren wollen, ist: Wer bin ich? Sie ist gewiss eine der Hauptfragen der Philosophie. Aber merkwürdigerweise wird sie nicht von vielen Philosophen gestellt. Viele Denker imitieren die Objektivität der Naturwissenschaften und klammern die eigene Persönlichkeit mehr oder minder aus. So gelangen sie höchstens zur Frage: Was ist der Mensch? Aber diese ist nicht identisch mit der Frage nach dem Wesen unserer Persönlichkeit.
Nur die so genannten existenziellen Denker sind von den Rätseln der eigenen Person fasziniert. In der Moderne waren es vor allem Sören Kierkegaard, Friedrich Nietzsche, Martin Heidegger, Karl Jaspers und Jean-Paul Sartre, welche die Selbsterforschung mit der Seinsanalyse fruchtbar verknüpften. Auch der sehr spekulativ denkende Edmund Husserl lässt in seinen Abstraktionen immer wieder den Rückgang auf die eigene Individualität spüren; nur so konnte er zum Begründer der Phänomenologie werden.
Nun wird hier so mancher Laie einwenden, dass man doch schnell sagen könne, wer man sei. Man verweist auf Herkunft, Beruf, Titel, Auszeichnungen, menschlichen Anhang, Besitz, soziale Stellung und Geltung. Der Philosoph wird jedoch mit einer solchen Auskunft nicht zufrieden sein. Seiner Meinung nach werden hiermit nur Außenbezirke der Persönlichkeit benannt. Das tiefere Selbst eines Menschen ist in solchen Bestimmungen nicht enthalten. Man wird also den vorlauten Laien dahingehend informieren, dass alle seine Redensarten nur Zeugnisse von Selbstverkennung, Selbstvergessenheit und Selbstentfremdung sind.
Das wahre Selbst eines Menschen muss lange und mühsam gesucht werden. Es liegt nicht an der Oberfläche, sondern im Verborgenen. Nicht umsonst hat Heraklit am Anfang der europäischen Geistesgeschichte den stolzen Ausspruch getan: „Ich habe mich selbst gesucht.“ Er wusste offenbar, dass nur jenseits der kollektiven und individuellen Selbsttäuschungen der Kern der Person zum Vorschein kommt.
Von Kindheit an suggeriert die Umgebung dem Menschen, wer er ist und wer er sein soll. So werden ihm ein Familienstandpunkt, eine Nationalität, eine Religiosität, eine Klassenlage und die Teilhaberschaft an allen Spielregeln und Verhaltensweisen der Epoche aufoktroyiert. Daher ist jede ernste Selbstsuche zunächst ein destruktiver Akt. Man muss sich energisch von unzähligen Denk- und Verhaltensschablonen befreien, wenn man Ich-Selbst werden will.
Kierkegaard und Max Stirner nannten Menschen, denen das gelang, Einzelne oder den Einzigen. Auch Nietzsche hat oft darauf hingewiesen, dass jeder Mensch ein Unikat der Natur sei, wobei der Weg zu den Quellen der eigenen Individualität nur schwer gefunden werden kann. Es sei immer ein Sich-los-Reißen aus wichtigen menschlichen und sozialen Bindungen, das zum Selbstsein führt.
Am ehesten beobachten wir diesen Prozess bei echten Künstlern, die sich nicht nivellieren und gleichschalten lassen, sondern von der Frage bewegt sind, wie sie selbst die Welt sehen und gestalten können. Sie sind spontan genug, um sich über die Routine des Lebens und Denkens hinwegzusetzen. Es lockt sie das Abenteuer der eigenen Existenz. Sartre sagt in seinen Frühschriften, dass beim Menschen die Existenz der Essenz vorausgehe. Das bedeutet, dass es keine Formel für den Menschen gibt. Er entdeckt sich erst, indem er sich selber schafft. Vor der Reflexion muss deshalb der spontane Lebensakt stehen. Picasso drückt das originell aus, indem er sagt: „Zuerst finde ich, nachher suche ich!“ Und Cromwell, der englische Revolutionär, sagte wohl aus der Erfahrung des eigenen Lebens heraus: „Nie steigt ein Mensch höher, als wenn er nicht weiß, wohin er geht.“
Erst am Ende unseres Lebens können wir sagen, wer wir wirklich sind. Denn der Lebenslauf bringt unsere Wesenszüge nach und nach ans Licht, indem wir handelnd und entscheidend von uns selbst überrascht werden. Es empfiehlt sich sehr, auf diese Weise unter offenem Horizont zu leben, sein Leben im Sinne einer philosophischen Lebenskunst zu gestalten. Dabei ist Wachsen und Entwicklung identisch mit Selbsterkenntnis. Ein bloßes Nachdenken über sich selbst führt niemals in die Tiefen unseres Wesens hinein. Goethe, selbst ein Lebenskünstler von höchster Potenz, formulierte das richtige Lebensprogramm in folgendem Vers:
„Verweile nicht und sei dir selbst ein Traum,
und wie du reisest, danke jedem Raum,
bequeme dich dem Heißen wie dem Kalten;
Dir wird die Welt, du wirst ihr nie veralten.“