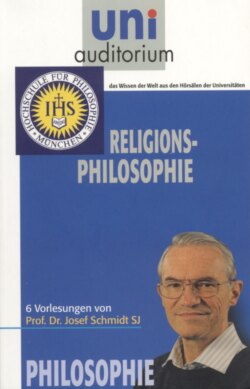Читать книгу Religions-Philosophie - Josef Schmidt - Страница 8
Die griechische Antike
ОглавлениеIn der griechischen Antike erwuchs das philosophische Nachdenken in einer Reflexion über die Religion. Es war in einer Art von Reflexion, die auf das Philosophische hinweist. Das zeigte sich in der Weise, dass man sich sagte: Die verschiedenen Göttergeschichten, die der eine Ort so, der andere Ort anders erzählt, das eine griechische Volk so, das andere anders, diese verschiedenen Kulttraditionen, was haben sie und ihre Götter miteinander zu tun? Offenbar ist es doch ein göttlicher Bereich, der irgendwie zusammengehört. Homer in seinen bekannten Epen – dier Ilias und der Odyssee – zeigt uns eine Götterwelt, eine sehr bunte Götterwelt. Diese verschiedenen Götter, die natürlich aus verschiedenen Traditionen stammen, sollen aber vereint sein in einer Familie am Olymp. Der Göttervater ist Zeus. Dies ist ein Versuch, die Göttervielfalt irgendwie zu ordnen.
Ein anderer großer Dichter, etwas später als Homer, Hesiod, erzählt in seiner Theogonie die Göttergeschichte als einen Entstehungszusammenhang. Auch dies ist ein Versuch, Einheit in die Göttervielfalt zu bringen. Hesiod spricht von einem Anfang, der in der Leere besteht, dem Chaos. Das kommt von “chaskein”, Gähnen. Es ist der gähnende Abgrund, gleichsam das „Nichts“, aber irgendwie ein schöpferisches „Nichts“, aus dem dann die verschiedenen Götter entstehen.
Zunächst entstehen aus dem Chaos Eros, die Liebe, aber auch „Nacht“ und „Licht“, also die Unterschiede und deren Zusammenhang und dann – zunächst einmal – das, worauf wir stehen, Gaia – die Erde. Gaia gebiert aus sich heraus ihren großen Gegensatz, den Himmel – Uranos –, und aus der Ehe mit ihm, also der Vereinigung von Erde und Himmel, entstehen dann die anderen Götter und Göttergenerationen. Zunächst die des Kronos und schließlich die des Zeus, der dann am Olymp die Götterfamilie begründet.
Wir sehen also, dass in der Religion eine bestimmte Reflexion auf den großen Zusammenhang beginnt, auf allgemeine Entstehung. Das sind die Anfänge philosophischer Reflexion.
Dann beginnen die Griechen zu fragen, wie sich denn über einen allgemeinen Ursprung, über einen Ursprung, der alles umfasst, den auch die Religion und die Göttergeschichten zum Thema haben, sprechen lässt. Und das so, dass wir nicht mehr mittels bestimmter Göttergeschichten darüber sprechen, sondern so, dass alle es verstehen können, alle, auch andere Völker.
Die Griechen hatten ja durch ihre Kolonien Kontakt mit verschiedenen anderen Völkern. Sie waren schon ganz interkulturell ausgerichtet. Und deswegen entsteht nicht im Kern Griechenlands, sondern in den Außenbereichen, dort, wo man den anderen Kulturen begegnet, in Kleinasien, an dessen Westküste, und in Unteritalien, ein neues Fragen nach dem Allgemeinen und dem allgemeinen Ursprung. Alle sollten es verstehen können. Und wie können es alle verstehen?
In Begriffen, die alle kennen. Das sind zunächst Begriffe, die aus der Anschauung genommen werden. So wird die Frage nach dem Ursprung zunächst ganz abstrakt gestellt, einfach die Frage nach dem allgemeinen Ursprung. Das Wort dafür ist im Griechischen “arché”. Die Antworten werden gegeben mit dem, was in gewisser Weise jeder begreifen kann und jeder sehen kann. Da sagt Thales: Es ist das Wasser, aus dem alles Leben kommt. Wo Wasser ist, da ist Leben. In der Wüste ist nichts davon, weil da kein Wasser ist.
Ein anderer sagt: Der Ursprung ist das, was wir „Atem“ nennen, also die Luft, das, was Leben spendet. Alles kommt also aus dem Atem oder aus der Luft.
Wieder ein anderer sagt: Die Ursprungskraft ist das Feuer. Das ist die arché, aus der sich dann alles differenziert. Wenn man das Erste noch dazu nimmt, aus dem nach Hesiod alles hervorgegangen ist, Gaia, die Erde, dann haben wir die vier klassischen Elemente, also Luft und Wasser, Feuer und Erde, die bis ins 19. Jahrhundert als Grundelemente des raumzeitlichen Kosmos galten.
So sprachen die Griechen über den allgemeinen Ursprung. Aber wenn die Vernunft und die Reflexion einmal begonnen haben, dann hört das nicht irgendwo auf. Ein Philosoph, Anaximander, sagte: Diese Begriffe, in denen die arché bisher gedacht wurde, sind noch zu anschaulich. Ein Bereich steht neben dem anderen. Wasser ist nicht Erde usw. Das Allgemeine, das Erste, muss anders zum Ausdruck gebracht werden. Er hat den Begriff Apeiron dafür. Es ist die Verneinung von Peras, die Grenze, meint also einfach das Unbegrenzte. Die arché ist also das Unbegrenzte.
Und ein anderer Philosoph, in Unteritalien, Xenophanes, knüpft an diese Reflexion über das „Eine“, aus dem alles stammt an. Er sagt, von daher ist auch die Religion zu betrachten. Diese ist so auf einen vernünftigen Gehalt zu bringen. Denn was ist denn eigentlich das Göttliche? Da spricht man von diesen vielen Göttern und erzählt irgendwelche Geschichten. Aber das sind doch nur unsere Vorstellungen, unsere Projektionen. Das kritische Nachdenken darüber führt zu dem, was der eigentliche Gehalt des Göttlichen ist. So ergibt sich bei Xenophanes eine Sicht der Religion, die einerseits kritisch ist, sehr kritisch sogar, und andererseits eine Erneuerung der Religion durch Vernunft und durch Philosophie darstellt.
Ich kann Ihnen Zitate vorlesen, die ganz amüsant sind. Xenophanes sagt: “Die Äthiopier behaupten, ihre Götter seien stumpfnasig und schwarz. Die Traker blauäugig und blond”. Die einen sagen das über die Götter, andere sagen wieder etwas anderes. Und dann gibt es den bissig ironischen Satz von ihm: “Wenn die Rinder und Pferde und Löwen Hände hätten und mit diesen Händen malen könnten und Bildwerke schaffen könnten wie Menschen, würden die Pferde die Götter in der Gestalt von Pferden abbilden. Die Rinder in der von Rindern. Und sie würden solche Statuen meißeln, ihrer eigenen Körpergestalt entsprechend”.
Das heißt, die Religion besteht weitgehend aus Projektionen. Nun, wir kennen diesen Begriff aus der Neuzeit. Nach Feuerbach ist die ganze Religion eine große Projektion. Aber bei Xenophanes ist das anders. Er entlarvt religiöse Vorstellungen als Projektionen, aber mit dem Ziel, die Religion selbst zu erneuern, zu vertiefen, und zu einem Gottesbegriff zu kommen, der der Vernunft Stand hält, dem alle zustimmen können, aus welcher Kultur sie auch kommen. Eben diese Allgemeinheit der Verständigung über das Umfassendste und Grundlegendste, das ist „Vernunft“. Somit ist in einer Reflexion über die Religion, über den religiösen Gehalt, das entstanden, was man im Abendland „Vernunft“ nennt. Xenophanes kommt auf diesem Wege schließlich sogar zu einem Gottesbegriff, der ein sehr erhabener ist und der sich an den Monotheismus annähert, wenn er sagt: “Ein einziger Gott ist unter Göttern und Menschen der größte, weder dem Körper noch der Einsicht nach den sterblichen Menschen gleich. Als Ganzer sieht er, als Ganzer versteht er”. Hier taucht der Begriff Noein, “Verstehen” auf., durch den der Gott gekennzeichnet wird.
Dann heißt es noch: “Immer verbleibt er am selben Ort, ohne irgendwelche Bewegung, denn es geziemt sich für ihn nicht, bald hierhin, bald dorthin zu gehen, um seine Ziele zu erreichen”.
Die Göttergeschichten erzählen nämlich, dass z.B. Zeus mal dahin und dorthin geht und die Opfer entgegennimmt. Das ziemt sich nicht für einen Gott. Gott muss also vernünftig gedacht werden, wie es einem Vernunftbegriff von ihm entspricht.