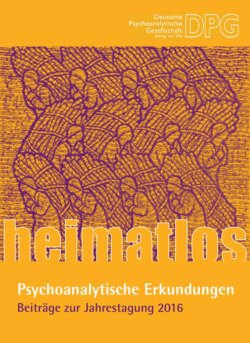Читать книгу heimatlos - Joshua Durban - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Nach Hause – Skizzen zur Geschichte der Heimweh-Krankheit (F. Schmoll)
ОглавлениеÜber Heimat können eigentlich nur die Heimatlosen reden. Sie artikulieren den Anspruch auf Beheimatung ohne jede Fragwürdigkeit. Heimweh ist nun ganz sicher etwas, von dem wir ausgehen müssen, dass es jeden Heimatlosen, jeden Heimatvertriebenen, jeden Flüchtling und Migranten plagt, dass er es mit sich schleppt – gleichwie er damit zurande kommt, ob als existenzielle Infragestellung, als harmloses Sentiment oder vielleicht auch als schöpferische Möglichkeit (Flusser 1992). Natürlich sind bei der Symptomatik „Heimweh“ die Ursachen genauso von Interesse wie die psychischen Energien. Im Fall der Krankheits-Geschichte Heimweh fasziniert freilich auch die Frage, wie dieses Symptom in der Geschichte des europäischen Wissens diagnostiziert und gedeutet wurde. Welchen Reim machten sich eigentlich welche Wissenschaften zu welchen Zeiten auf diese Sehnsucht der Heimatlosen, nach Hause kehren zu dürfen? So besehen ist die Geschichte des Heimwehs, seit es zunächst als „Schweizer Krankheit“ in der europäischen Geschichte dokumentiert ist, bis hin zu E.T., der sein Heimweh mit seinen Telefonaten zum drei Millionen Lichtjahre entfernten Heimat-Planeten lindern möchte, auch eine Geschichte von Deutungsversuchen, von Versuchen, Beziehungen zwischen Heimat und Fremde auszubalancieren.
Eine der frühen Quellen zur Geschichte des Heimwehs stammt aus dem „liber familiarum“ des Krummenauer Pfarrers Alexander Bösch, der 1683 niederschrieb: „Glych im Anfang, als ich gen Zürich kamm, veillycht wegen Heimwehes und weil ich der Spyss nicht gewohnet hatte, ohne Milch sein müesst, bin ich in schwere Krankheit gefallen.“ (zit. nach Baumann 2013, S. 102) Da mag man hellhörig werden, dass da einer in schwere Krankheit fällt, weil er seine vertrauten Speisen entbehren muss, vor allem Milch. Noch anderes ist bemerkenswert: Alexander Bösch stammte aus dem Toggenburg – zwischen seiner heimisch-vertrauten Welt, aus der er aufgebrochen war und dieser unwägbaren-abweisenden Fremde in Zürich lagen gerade mal rund 80 Kilometer! Heute ein Katzensprung, damals eine unendlich ferne Fremde.
Ein Leiden in und an der Fremde also. Fünf Jahre später, 1688, erschien in Basel die erste medizinische Dissertation zu diesem neuen Leiden von Johannes Hofer (Hofer 1688). Die Malaise wurde zur Maladie, bald zur medizinisch anerkannten Krankheit. Sie wurde nicht harmlose, sondern als nicht selten tödliche Krankheit beschrieben. Heimweh, Nostalgia, das erschien in den sich häufenden Beobachtungen, als eine Krankheit mit drastischen Auswirkungen. Dabei ging es nicht um ein flüchtiges Gefühl, mehr als nur um eine melancholische Verstimmung; Heimweh besaß die Macht, den Körper zu befallen, tat körperlich „weh“. Die untrüglichen Symptome: trauriges Umherirren, Herzrasen, überempfindliches Fremdeln gegenüber unvertrauten Sitten und Gewohnheiten, Ablehnung ebensolcher Speisen, infolgedessen Abmagerung und Auszehrung. Bleibt die Behandlung aus, für die nur eine baldige Heimreise in Frage kommt, erfolgt der Tod. Hofers Diagnose: Heimweh sei ein „symptoma imaginiationis lessae“, gründe also in einer „verletzten“ oder krankhaften Einbildungskraft. In der Fremde vermöge der Befallene nur mehr an seine verlorene Heimat denken, verkläre und überhöhe sie mit der Folge, dass ihre Anziehungskraft umgekehrt alle Vitalität im unvertrauten Hier und Jetzt betäube. Physiologisch sei dies in den „Spiritus animales“ zu lokalisieren – in den „Lebensgeistern“, die über die Nervenbahnen transportiert werden. Und im Fall ungewollten Aufenthalts in der Fremde, so Hofer, werde genau jene Nervenbahn im Gehirn über Gebühr gereizt, in der die Idee des Vaterlandes sitze!
Befällt hier eine leidende Psyche den Körper? Oder umgekehrt? Erzeugt ein kranker Körper Seelenleid? Johann Jakob Scheuchzer sinnierte 1706 zunächst darüber, ob da möglicherweise ein Schweizer Volkscharakter zur Verweichlichung tendiere. Wie könne es sein, so der Ausgangspunkt seines Sinnierens, dass eine „sonsten so freye / starke und dapfere Nation sich überwinden und unterjochen lasse von einer solchen Krankheit“? (Scheuchzer 1706, S. 57f). Nichts weniger als die Ehre der Schweizer als wehrhaftes und starkes Bergvolk stand also auf dem Spiel! Scheuchzer war Naturforscher, Universalgelehrter, Alpenreisender und Landeskundler, gleichsam: ein Anthropologe des alpinen Menschen und Erkunder seines Lebensraums. Er verlagerte kurzerhand den Deutungsansatz aus der Innenwelt der „Volksseele“ in die Außenwelt der physischen Natur. Scheuchzer lokalisierte die Ursachen im physikalischen Mechanismus des Luftdrucks, dessen Höhe im fremden Flachland für die Schweizer ganz einfach ungewohnt und deshalb ungesund sei. Die Schweizer bewohnten den „obersten Gipfel von Europa“; dort atmen sie eine „reine, dünne /subtile Luft, welche wir auch selbst in uns essen / und trinken / durch unsere Land-Speisen / und Getränke / welche eben denselben Luft enthalten.“ (Scheuzcher 1706, S. 58)
Er macht also nicht das Innere einer schweizerischen „Volksseele“, sondern das Äußere des Luftdrucks verantwortlich. Die Schweizer, die als Gebirgsbewohner reine, dünne Luft atmen, seien ganz einfach den Tiefdruck des Flachlandes nicht gewohnt. Das darf natürlich nicht nur als simple mechanische Ideologie gelesen werden, nach der äußere Verhältnisse einen inneren Zustand erzwingen. Mit der Luft wird die Welt aufgenommen und einverleibt, sie dringt ein in die Speisen, der Äther, der alles durchdringt …
Heimweh kommt natürlich nicht einfach so in die Welt, das hat handfeste sozialhistorische Ursachen. Ent-Ortung als Entfremdung, das trifft just jene sozialen Gruppen, für die es in einer an ihre Grenzen gekommenen traditionalen Gesellschaft keinen verbindlichen Platz (mehr) zu geben scheint und die die heimatlichen Horizonte aus Not hinter sich lassen müssen: Schweizer Soldaten, Gesinde, Tagelöhner, Auswanderer, Vaganten, Bettler, Dienstmädchen … Hier ist Heimweh die Antwort auf erzwungene Mobilität und Migration, die als Verlust Bearbeitung erfahren. Zunächst, im 18. Jahrhundert, weist der Name „Schweizer Krankheit“ darauf hin, dass es sich da womöglich um etwas handeln, das nur einen besonders immobilen Menschenschlag heimsuchen mag.
Bald allerdings zeigt die Aufnahme in die großen Enzyklopädien der Zeit, dass es sich offenkundig um ein europäisches Leiden handelt (Bunke 2009). Im 18. Jahrhundert erfährt das zeitgenössische Wissen um das Heimweh seine Lexikalisierung – es findet Aufnahme in die großen Enzyklopädien der Zeit. Das heißt ganz einfach: Es wird nun allgemeingültiges, akzeptiertes Wissen. Bald löst sich das Krankheitsbild aus seinen spezifisch helvetischen Bedingungen und wird zu einer allgemein-menschlichen Krankheit. Zum medizinischen Wissen kommen im 19. Jahrhundert völkerpsychologische Deutungsvorschläge hinzu: „Heimweh“, schreibt der Psychiater Willers Peter Jessen 1841 im „Encyclopädischen Wörterbuch der medicinischen Wissenschaften“, „ist nicht nur bei den meisten europäischen Völkern, sondern auch bei den Indianern, Ungern, Sibiriern, Grönländern, Eskimos u. s. w. beobachtet worden.“ (Jessen 1841, S. 297). „Vorzugsweise“, ergänzt er vielsagend, „scheint aber die Disposition zur Nostalgie bei Völkern, wie bei Individuen, gebunden zu seyn an eine geringe Stufe der Civilisation (…). Während der primitive „Wilde“ an die ihm vertraute Umwelt gefesselt sei, so Jessen, habe der „wahrhaft Gebildete, der Naturforscher, der Gelehrte, der Weltweise (…) in der ganzen Welt seine Heimath (…).“ (Jessen 1841, S. 298) Also – der „primitive“ Mensch sei wie das Tier, gefesselt an ein kleines Stück Welt – dem Zivilisierten, Entwickelten dagegen die ganze Welt Heimat.
Schließlich verlagert sich die Diskussion in die Forensik und damit auf die Zusammenhänge zwischen „Heimweh und Verbrechen“. Als Karl Jaspers im Jahre 1909 seine Dissertation „Heimweh und Verbrechen“ vorlegte, stellte er an den Anfang eine erläuterungsbedürftige Ambivalenz: „Schon lange haben die mit unglaublicher Grausamkeit und rücksichtsloser Brutalität ausgeführten Verbrechen Interesse erregt, die man von zarten Geschöpfen, jungen und gutmütigen, noch ganz im Kindesalter befindlichen Mädchen ausgeführt sah. Der Widerspruch zwischen Tat und Täterin, die Motivlosigkeit oder unzureichende Motivierung und darum das Rätselhafte und Unverständliche der Ereignisse erregten Mitgefühl oder Abscheu.“ (Jaspers 1990, S. 1)
Zarte Geschöpfe, grausamste Gewalt. Tat und Täterinnen wollten unter dem bürgerlichen Wertehimmel um 1900 partout nicht zusammenpassen. Kindliche Wesen, psychisch labil aufgrund ungestillter Sehnsucht nach Geborgenheit, verwaist, unbehaust. Sie entladen ihren Schmerz des Nicht-Nachhause-Könnens in exzessiver Gewalt: vornehmlich Brandstiftung (die reinigende Kraft des Feuers, Zerstörung fremder Heimat!) und Mord (die Ermordung ihnen zur Fürsorge anvertrauter Kinder) – so lauten die Tatbestände, durch welche die Delinquentinnen ihr Ziel zu erreichen suchen: Rückkehr. War das Heimweh zunächst ein männliches Problem der Söldner und Soldaten, wurde im 19. Jahrhundert daraus eine weibliche Krankheit. Heimweh – das ist in jedem Fall auch hier mehr als nur der bittere Schmerz, nicht dort sein zu können, wo man sich zugehörig fühlt und Anerkennung erfahren darf. Entfremdung als Ent-Ortung: Jetzt ist es die Geschichte doppelgesichtiger Wesen, die durch unverschuldetes Schicksal zu Schuldigen werden. Kranken sie am Bösen, das sie befällt? Oder kranken sie an den Verhältnissen ihrer Zeit? An einer Gesellschaft, welche die Erfahrung von Zugehörigkeit nicht zu vermitteln vermag? Sind sie überhaupt schuldfähig?
Auch hier ist es die Erfahrung abweisender Fremde, die in der Vorstellungswelt der Betroffenen umgekehrt die idealisierte Heimat als einzig möglichen Aufenthaltsort erscheinen lässt. Auch dann, wenn diese tatsächlich nie eine war, die Geborgenheit zu spenden vermochte, sondern eine kalte, gleichgültige Umwelt. So wie im Falle der „Blassen Apollonia“ 1845 in der Geschichte des brillanten Erzählers Hermann Kurz. Das Mädchen Apollonia muss zu einer fremden Familie, um deren Kind zu hüten. Wiewohl sie zuhause immer nur Abweisung erfahren hatte, zog es sie magisch zurück: „Aus diesem kümmerlichen Leben“, heißt es in der Erzählung, „sog ihr angebornes sehnsüchtiges Wesen immer mehr Nahrung; ihr Heimweh, das früher gleichsam heimatlos gewesen war, nahm jetzt eine bestimmte Richtung, alle ihre Gedanken waren nach der Heimath, nach den Ihrigen gewendet.“ (Kurz 1858, S. 351) Der Drang nach Hause erschien nicht mehr kontrollierbar: „Die vielen Anstrengungen, die ihr die Pflege des Kindes verursachte, der Kummer bei Tag und die schlaflosen Nächte untergruben ihre von Natur zarte Gesundheit; der Drang nach Heimath, der immer wilder und heftiger wurde, (…) zerrüttete ihren Geist. (…) In ihren ungeordneten Gedanken verfiel sie darauf, wenn das Kind stürbe, so würde ihre Herrschaft sie als unnütz nach Hause schicken. So scheint es, daß nach und nach, nur wie dämmernd, der Wunsch in ihr aufgestiegen sei, es möchte das Kind und mit dem Kinde sie selbst erlöst werden.“ (Kurz 1858, S. 352) Aus Heimweh begeht sie schließlich einen Kindsmord, allein diese Tat verspricht Erlösung. Danach kommt ihr nur ein Wunsch über die Lippen: „Sie gab nichts zur Antwort, als Heim!“ (Kurz 1858, S. 356)
Im Deutungsversuch von Jaspers kann es natürlich nicht mehr die Wirkung eines unwirtlichen Äußeren auf die Landschaften der Psyche sein. Jetzt ist es – umgekehrt – die Seele, deren beschränkte Einbildungskraft für eine unvertraute Fremde nicht empfänglich ist. Die geistige Enge der Geburtsheimat bewirkt eine gleichsam im Primitiven verhaftete Beschränktheit des Empfindens. Jaspers bezieht sich explizit auf Willers Peter Jessen, der bereits 1841 auf den Mangel an innerer Freiheit und Stabilität als Humus der Heimweh-Krankheit hinwies: „Wer zu geistig freiem selbsttätigem Leben erwacht ist, vermag überall auf der Welt seine eigene Existenz mit der Umgebung in Einklang zu setzen. Wer zu solcher Selbsttätigkeit nicht gelangt ist, bleibt gleichsam mit der ihn umgebenden Außenwelt verwachsen, alle Gefühle und Gedanken sind in ihr festgewurzelt, (…) und mit seiner Heimat verliert er gleichsam die Hälfte seines Ichs.“ (Jessen 1841, S. 298) Die Fremde bleibt abweisend verschlossen, weil sie nie erlernt wurde und deshalb immer nur auf das Eigene zurückweist. Aus dieser pathogenen Fixierung erwächst das tödliche Zusammenspiel aus Heimweh und Verbrechen – je unversöhnlicher die Außenwelt mit der unfreien Innenwelt kontrastiert, desto radikaler der Drang sie wieder in eins zu setzen. Mit allen Mitteln.
Von Heimweh, auch das zeigt Jaspers auf, werden nicht nur junge Menschen, sondern vor allem die Angehörigen unterer sozialer Schichten befallenen – solche, für die es in der angestammten Heimat keinen Platz mehr gibt, weil diese sie nicht mehr nähren kann – junge Dienstmädchen vom Land, Soldaten, die in der Heimat kein Auskommen mehr finden, Taglöhner, Entwurzelte … Heimweh – das war das Symptom einer Zeit, in der vormoderne Gesellschaften an die Grenzen ihrer Aufgabe gelangt waren, ihren Angehörigen Zugehörigkeit zu ermöglichen. Die alte, nicht bessere, aber eben die vertrautere Welt brach aus den Fugen. Eine seit dem Dreißigjährigen Krieg unaufhaltsam wachsende Bevölkerung konnte nicht mehr ernährt werden. Rund ein Drittel der Einwohner in vielen Landstrichen Deutschlands wählte notgedrungen die Auswanderung, um wenn nicht Glück, so doch Brot und Auskommen in Amerika, Russland oder Südosteuropa zu finden. Das angestammte „Heimatrecht“ als Versorgungssystem verlor seinen sozialen Sinn, weil die Industriegesellschaft nicht mehr auf Sesshaftigkeit, sondern auf Mobilität drang. Sozialhistorisch gemünzt erscheint die Heimweh-Krankheit also als Symptom umfassender Enttraditionalisierung im Übergang von Agrar- zu modernen Industriegesellschaften.
Heimweh und Verbrechen – diese Zusammenhänge müssen natürlich aus ihrer Zeit herausgelesen und verstanden werden. Aber: Sie verweisen auf die allgemeinere Frage, wie Imaginationen des Heimatlichen nicht immer auch als Nachtseite, als Kehrseite, das Verbrechen, die Bereitschaft zu rücksichtlosem Exzess in sich tragen – das Unheimliche als verdrängter Anteil des Heimisch-Vertrauten. Die Ambivalenzen waren beständig präsent: Ungestilltes Heimweh – entfesselte Brutalität; zarte Geschöpfe – barbarische Gewalt; Gemütlichkeit und Brutalität – mit diesem vordergründig Nicht-Zusammengehörenden hat der Berliner Religionswissenschaftler Klaus Heinrich die wechselseitig verflochtenen Beziehungen als „Charakteristikum einer spezifisch nationalen Mentalität“ der Deutschen zusammengefasst (Heinrich 1984, S. 47). Gemütlichkeit und Brutalität – zwei Seiten einer deutschen Heimat-Medaille. Die Geschichte des Heimwehs, so ließ denn auch Elisabeth Bronfen 1996 ihr Vorwort zur Neuausgabe von Karl Jaspers „Heimweh und Verbrechen“ enden, diene „einer doppelten Mahnung: Sie lassen uns nicht nur erfahren, wie der Verlust von Heimat ganz plötzlich und unerwartet Gewalt und Verbrechen hervorrufen kann. Sie drängen uns auch die Erkenntnis auf, dass einer zur Plombe erstarrten Vorstellung von Heimat der Ausbruch von Gewalt immer eingeschrieben ist.“ (Bronfen 1996, S. 25)
Zweierlei soll diese kleine Skizze zur historischen Verlaufsform der Heimweh-Krankheit vergegenwärtigen. Zum einen will sie daran erinnern, was Heimatlosigkeit bedeuten kann (nicht muss!), was der Verlust von Heimat und dann vor allem die Erfahrung einer abweisenden Fremde denn auch an Gewalt und Verbrechen hervorzubringen vermag.
Und da wäre zum anderen der Hinweise, welche Sprengsätze gedeihen, wenn die Vorstellungen der eigenen Heimat nur fixe Ideen sind: unbeweglich, weltabgewandt, immun gegen Wandel und nur das Eigene im Mittelpunkt. Das sind dann Imaginationen von Heimat, die nur Humus für die monokulturelle Züchtung des Eigenen liefern, das Eigene als Bollwerk, und die als Nachtseite, Verbrechen und Gewalt, die Bereitschaft zu rücksichtlosem Exzess in sich tragen – das Unheimliche als verdrängter Anteil des Heimisch-Vertrauten.