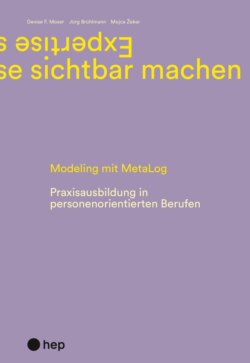Читать книгу Expertise sichtbar machen (E-Book) - Jürg Brühlmann - Страница 6
Оглавление2Ausbilden in personenbezogenen Berufen
Das Ausbilden in Berufen mit Anwesenheit von Klienten ist anspruchsvoll und komplex. Die beruflichen Situationen sind nicht genau planbar und werden situativ gestaltet. Die Arbeitsbeziehung muss geschützt bleiben.
Die Gestaltung der Ausbildung in personenorientierten Berufen ist aus den folgenden Gründen anspruchsvoll:
–Die Fachperson kann in praktischen Ausbildungssituationen ihr Wahrnehmen, Denken und Tun nicht über den Kopf der Klienten hinweg kommentieren.
–Jede berufliche Situation ist einzigartig und muss situativ gestaltet werden. Auch in unsicheren Situationen müssen Entscheidungen gefällt und die berufliche Handlungsfähigkeit gewahrt werden.
–Zum Instrumentarium in personenbezogenen Berufen gehören hauptsächlich die Sprache, der Körper sowie das, was im vorliegenden Buch Inszenierung oder Szenik genannt wird. Dazu gehören der Einsatz von Instrumenten und Material, die Gestaltung und Organisation von Zeit und Raum wie auch die räumliche und körperliche Inszenierung der Fachperson selbst.
–Die Prozessqualität ist mitentscheidend für den Erfolg. Die situativ eingesetzte berufliche Kompetenz ist in ihrer beobachtbaren Performanz für den Betrachter nur teilweise erkennbar und verschieden interpretierbar.
Herausforderungen und Anforderungen
Die Qualität des beruflichen Tuns muss heute in allen Berufen gewissen fachlichen Standards genügen. Situationen in personenbezogenen Berufen sollen kontextbezogen und situativ passend bewältigt werden. Während Interaktionen bleibt damit sehr viel Ermessens- und Gestaltungsraum, der auf dem Hintergrund von beruflicher Expertise und Kompetenz geformt wird. Die Herausbildung von beruflicher Identität und eines beruflichen Habitus1 geschieht primär in der Praxis, wenn Studierende während ihrer Arbeit Fachpersonen als vorbildliches, handlungssicheres, erfolgreiches, reflektierendes Modell2 erleben, fragmentierte Wissensbestände sinnstiftend verknüpfen und berufliche Situationen in einem Prozess selbst gestalten können.
Berufsbilder und Ansprüche an Fachpersonen
Der Bildungsforscher John Hattie illustriert die Ansprüche in personenbezogenen Berufen für den Lehrberuf so: «Gut sind jene [Lehrer], welche die Freude der Kinder für ein Fach wecken können, und jene, die ein Talent in den Kindern sehen, von dem die Schüler nicht einmal selbst wussten, dass sie es haben. Es geht letztlich darum, Freude am Lernen zu vermitteln. (…) Lehrer sind die Dirigenten eines Orchesters: Sie müssen den Ton angeben, das Tempo setzen und wissen, wohin sie mit dem Stück wollen. Doch ab einem gewissen Punkt sollten sie den Musikern den Platz geben, sich zu entfalten.» 3
Für Berufe im Sozial- und Gesundheitswesen gelten ähnliche Wirkfaktoren. Es geht wesentlich um die Ressourcenorientierung und die situativ stimmige Gestaltung der Interaktion mit den Klientinnen und Klienten.
Die folgenden Auszüge aus verschiedenen personenbezogenen Berufsbildern verdeutlichen die Ansprüche, die heute an Fachpersonen gestellt werden.
«Die Fachfrau, der Fachmann Gesundheit gestaltet und pflegt in ihrem/seinem Berufsalltag eine respektvolle berufliche Beziehung zu den Klientinnen und Klienten und richtet ihr/sein Handeln an deren Bedürfnissen aus. Sie/er respektiert die Klientinnen und Klienten als Individuen mit ihren spezifischen Wertesystemen. (…) Die Fachfrau/der Fachmann Gesundheit unterstützt das körperliche, soziale und psychische Wohlbefinden von Personen jeden Alters in deren Umfeld und gestaltet mit ihnen den Alltag.» Bildungsplan Fachfrau/Fachmann Gesundheit FaGe EFZ.
Verordnung über die berufliche Grundbildung. Bern: SBFI 2016
«Absolventinnen und Absolventen (für Sozialarbeit) leisten einen wichtigen Beitrag zur Begleitung und Unterstützung von Menschen in verschiedenen Lebenssituationen. Sie beraten Einzelpersonen, Familien und Gruppen, unterstützen bei Finanzfragen, der Suche nach Arbeit und Wohnraum oder der Gestaltung von sozialen Netzwerken. Sie sind fähig, bei der Eingliederung zu helfen sowie Arbeits- und Freizeitangebote zu schaffen, die das Zusammenleben stärken und die Lebensqualität fördern. Sie sind Fachpersonen für die Mitgestaltung sozialer Räume. In der Öffentlichkeit schaffen sie Verständnis für die Situation benachteiligter Menschen.»
Das Studium Soziale Arbeit. Zürich: Fachkonferenz Soziale Arbeit. www.sassa.ch
«Kinderbetreuer und Kinderbetreuerinnen übernehmen die Betreuung und Pflege von Säuglingen und Kleinkindern in Kinderheimen, Kinderhorten und Kindertagesstätten. Sie fördern die anvertrauten Kinder in der emotionalen, sozialen und geistigen Entwicklung. Die Betreuenden beschäftigen sich in vielfacher Weise mit den Kindern, z. B. sprechen und spielen sie mit ihnen und regen sie zu eigener Tätigkeit an. Außerdem fördern sie die Bewegungsentfaltung der Kinder, singen und basteln mit ihnen und führen sie zur Selbstständigkeit»
Kinderbetreuer/Kinderbetreuerin Südtirol.
Bozen: Südtiroler Landesverwaltung 2018
«Die Lehrperson ist verantwortlich – für eine fachgerechte Unterrichtsführung und Lernbegleitung (gemeint sind insbesondere angemessene Lernaufgaben und Fördermassnahmen), – für eine nachvollziehbare Beurteilung der Schülerinnen und Schüler, – für die Professionalität der Beziehungsgestaltung in ihrem Zuständigkeitsbereich (z. B. bezüglich der Regeln in der Klasse, der Abmachungen mit den Eltern), – für den Schutz der Integrität der Kinder und die Erfüllung der gesetzlichen Fürsorgepflichten (Kindesschutz), – für ihre Mitwirkung in der geleiteten Schule (vor allem bezüglich der schulinternen Vereinbarungen), – für ihre persönliche Weiterbildung.»
Der Berufsauftrag der Lehrerinnen und Lehrer.
Zürich: LCH 2014
«Aufgabe der Ärztinnen und Ärzte ist es, das Leben zu erhalten, die Gesundheit zu schützen und wiederherzustellen, Leiden zu lindern, Sterbenden Beistand zu leisten und an der Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen im Hinblick auf ihre Bedeutung für die Gesundheit der Menschen mitzuwirken.»
(Muster-)Berufsordnung für die in Deutschland tätigen Ärztinnen und Ärzte.
Deutsche Bundesärztekammer: 2018
«Das Berufsbild der Physiotherapeutin, des Psychotherapeuten beinhaltet die Planung, Gestaltung und Durchführung des physiotherapeutischen Prozesses. (…) Maßgeblich entscheidend für den Behandlungserfolg sind darüber hinaus die soziale Kompetenz und das Einfühlungsvermögen der Physiotherapeutinnen und -Therapeuten.» Berufsprofil Diplomierte/-r Physiotherapeut/-in.
Wien: Physio Austria 2004
«Der Polizist, die Polizistin kommuniziert mit verschiedenen Interaktionspartnern situationsgerecht und führt schwierige Gespräche sachlich und zielorientiert, ist sich möglicher Wirkungen der nonverbalen Kommunikation sowie der Subjektivität der Wahrnehmung bewusst und berücksichtigt diese Aspekte in seinem Verhalten, um Konflikte oder Eskalationen möglichst zu vermeiden, lotet die eigene Belastungsgrenze aus und ist in der Lage, die kurzfristigen Stressreaktionen der typischen Belastungen im Polizeiberuf bei sich und anderen mittels zweckmässiger Strategien stressreduzierend anzugehen, erkennt und analysiert Konflikte oder konfliktträchtige Situationen und geht bei konfliktbeladenen Konstellationen deeskalierend vor, (…) geht auf Menschen in verschiedensten Situationen und kulturellen Hintergründen mit der nötigen Empathie ein.» Rahmenlehrplan für Polizist/Polizistin.
Neuchâtel: Paritätische Kommission 2014
Komplexität im Berufsalltag
Die Beispiele zeigen, dass in personenbezogenen Berufen eine hohe situative Flexibilität gefragt ist. Die Komplexität im Berufsalltag zeigt sich in folgenden Merkmalen.4
–Multidimensionalität
Neben dem direkten Klientenkontakt müssen immer auch das soziale Umfeld, ökonomische Bedingungen, Lebensumstände, Biografie, persönliche Ressourcen und Werthaltungen mitberücksichtigt werden.
–Gleichzeitigkeit
In der Arbeitssituation muss oft auf gleichzeitig stattfindende Ereignisse und Bedürfnisse eingegangen werden.
–Unaufschiebbarkeit
Reaktionen auf Geschehnisse müssen meist unmittelbar erfolgen und können zeitlich nicht aufgeschoben und extemporalisiert werden.
–Kontext- und Situationsorientierung
Interventionen berücksichtigen das aktuelle Geschehen im Umfeld und die persönliche Situation der Beteiligten.
–Unvorhersehbarkeit
Situativ eintretende Ereignisse mit Klientinnen und Klienten sind meist nicht planbar und oft überraschend.
–Relevanz für die Zukunft
Berufliches Handeln hat in Situationen mit kurzen Reaktionszeiten oftmals Auswirkungen auf die weitere Zusammenarbeit und Entwicklung.
Aus den Anforderungen der Berufsbilder und den für personenbezogene Berufe typischen Merkmalen wird deutlich, dass core practices5 und somit wesentliche Teile der beruflichen Handlungskompetenzen vor allem in konkreten Praxissituationen erlernt werden können. Dafür sind Ausbildungsmethoden nötig, welche auf wesentliche Berufssituationen fokussieren und die Studierenden reflektierend teilnehmen lassen.
Der erfolgreiche Umgang mit veränderlichen Kontextbedingungen und der Bezug zu den Klientinnen und Klienten erhöhen die Qualität der beruflichen Tätigkeit.
Von der Kompetenz zur Performanz
Berufliche Kompetenz ist zuerst einmal ein Potenzial und zeigt sich erst in der Umsetzung. Kompetentes berufliches Handeln setzt bei der Fachperson ausreichend Wissen, Können und Wollen voraus.6 Kompetenzen sind somit persönliche, im Team sowie auch im Umfeld verfügbare Ressourcen, Wissenskonstrukte, Fertigkeiten und Fähigkeiten, um bestimmte Herausforderungen performativ zu lösen. Dieser Pool an Handlungsmöglichkeiten muss in personenbezogenen Berufen in sich immer wieder verändernden Situationen adaptiv genutzt werden. Erst in der jeweiligen beruflichen Handlung und Situation wird ein Teil der verfügbaren beruflichen Kompetenz einer Fachperson oder eines Teams als Performanz und Handlungskompetenz beobachtbar und erkennbar.7
Welche Überlegungen die Handlungen leiten, ist in der Performanz nicht immer offenkundig. Erst Einblicke in die Vorbereitungen und Planungen, das nachträgliche Reflektieren sowie das Kommentieren einer beruflichen Situation im Moment machen die der Performanz zu Grunde liegenden situationsspezifisch angewendeten Kompetenzen nachvollziehbar.
Abbildung 1: Performanz als situativ realisierte berufliche Kompetenz
Performanz ist ein situativ realisiertes Ergebnis. Performative Ereignisse wirken immer auch zurück auf die Organisation, die Ressourcenbereitstellung, das Wissen, das Kompetenzenreservoir und den Habitus eines Teams oder einzelner Fachpersonen.
Ausbildung eines beruflichen Habitus
Aufbauend auf dem individuellen und gemeinsamen Ressourcenpool von Fachpersonen, von Teams sowie Organisationen und weiter angereichert durch erworbenes Wissen und reflektierte Erfahrungen aus immer wieder neuen Berufssituationen, bildet sich der spezifische Habitus von Fachpersonen und Berufsgruppen.8 Der Habitus zeigt sich in einer von aussen identifizierbaren Art, wie die berufliche Rolle verstanden, ausgefüllt und realisiert wird. Für Lernende sind Teilnahme und Beobachtung im beruflichen Kontext sowie Reflexionsmöglichkeiten mit Berufsangehörigen für die eigene berufliche Identitätsentwicklung wesentlich.
Der Einblick in die handlungsleitenden Überlegungen während dem performativen beruflichen Akt ermöglicht den Lernenden Zugänge zu einem Teil der für sie beim Beobachten sonst unsichtbar bleibenden beruflichen Kompetenzen.
Berufsgeheimnisse und Gelingensbedingungen
Situativ angewendetes berufliches Wissen und berufliche Erfahrung bleiben Berufsgeheimnisse, wenn dieses Know-how für Lernende verborgen bleibt. Damit Klientinnen und Klienten nicht zum Objekt von Erklärungen werden, geschieht dies bisher meist vor und nach der gemeinsam erlebten Situation in analysierenden und planenden Vorbereitungen sowie in reflexiven Auswertungsgesprächen im Sinne der reflection on action.9 Mit der Methode Modeling mit MetaLog steht eine neue Möglichkeit zur Verfügung, um mit reflection in action bereits während der beruflichen Tätigkeit in Anwesenheit von Klienten die Transparenz des beruflichen Tuns zu erhöhen.
Berufsgeheimnisse in der Arbeitssituation
In der konkreten Situation sind oftmals kleine, aber wesentliche Details für das Gelingen entscheidend. Bereits in zeitlich kurzen und scheinbar unspektakulären Situationen wird enorm viel berufliches Know-how angewendet, das weit über die im Voraus planbaren Aktionen hinausgeht. Oft geschieht eine konkrete Intervention routiniert und ritualisiert, teilweise aber auch unbewusst. Bekannt sind diese Formen von eingesetztem Wissen in Routinesituationen als knowing in action, embodied knowledge und tacit knowledge.10 Was, wie, wozu und wann jeweils welche beruflichen Tätigkeiten ausgeführt werden, bleibt den Beobachtenden einer beruflichen Situation verborgen, auch dann, wenn es den Akteuren selbst bewusst ist. Die situativen Gelingensbedingungen sind aber entscheidend für den Erfolg, auch wenn sie nicht Anspruch auf allgemeine Gültigkeit haben.
«Praxisausbildende in Sozialer Arbeit erhalten mit der Methode Modeling mit MetaLog ein Werkzeug, das ihnen Orientierung und Klarheit gibt, wie sie in beruflichen Situationen die Anleitung von Auszubildenden aktiv gestalten können.»
Santino Güntert,
Dozent Soziale Arbeit
Wenn Lernende Berufssituationen ohne Ausführungen, Erklärungen und Begründungen beobachten, eröffnet sich ihnen ein grosser Interpretationsspielraum mit möglichen Missverständnissen. Für Studierende ist es bedeutsam zu wissen, aus welchen Gründen welche im Voraus überlegten oder situativ in einer bestimmten Situation getroffenen Entscheidungen umgesetzt werden und welche Faktoren die Chancen für eine möglichst gut gelingende berufliche Herausforderung erhöhen.
«Das Potenzial von Modeling mit MetaLog liegt für mich in der Verbindung verschiedener Reflexions- und Handlungsebenen.»
Klaus Müller,
Dozent Gesundheit und Soziale Arbeit
Abbildung 2: Offengelegte Berufsgeheimnisse sind der Schlüssel für berufliches Lernen (Werbung Appenzeller Käse, zvg Contexta AG)
Analysieren von beruflichen Situationen
Berufliche Situationen mit Klienten laufen meist in drei Phasen ab: Vor der Situation – in der Situation – nach der Situation. Die Planungen und Ideen zu möglichen Abläufen werden während der Umsetzung laufend situativ angepasst. Nach der beruflichen Sequenz können die Erfahrungen nochmals analysiert und mit Learnings weitergenutzt werden.
Frageraster zur Planung von modellierten Sequenzen
Um die Planung von Sequenzen für beobachtende Studierende zu erleichtern, können die folgenden Fragen für die Analyse der Gelingensbedingungen hilfreich sein.
Vor der Situation planbare Aspekte
–Was weiss ich aus Analyse, Vorerfahrungen, Vorwissen? Was sind bisherige Erfahrungen mit den bekannten oder vergleichbaren Personen und Gruppen in ähnlichen Situationen? Auf welches berufliche Wissen beziehe ich mich?
–Worauf stelle ich mich ein? Plane ich mögliche Alternativen?
–Was sind die beruflichen und persönlichen Standards, auf welche ich mich beziehe? An welche internen Regeln, Vorgaben der Einrichtung, welchen state of the art, welche berufliche Ethik, bewährte persönliche Vorgehensweisen und Routinen werde ich mich halten?
–Wie plane ich die räumliche und zeitliche Inszenierung, die Dramaturgie, den Materialeinsatz, mögliche Interventionen? Wie kann ich die Situation glaubwürdig, kohärent und effizient vorbereiten und gestalten? Dazu gehören unter anderem Raumgestaltung, Zeitpunkt, Dauer, Abläufe, Sequenzierung und Rhythmisierung, Art der Führung, Kooperation und Partizipation, Settings und Sozialformen, Materialvorbereitung, mein(e) Standort(e), Bewegungen.
In der Situation gestaltbare Aspekte
–Welche Bilder, Gefühle, Stimmungen, Körpersensationen, Ressourcen nehme ich bei mir wahr?
–Was kann ich in der Situation bei den Klienten und anderen Menschen beobachten und wahrnehmen?
–Was sind meine Interpretationen, Hypothesen, Vermutungen?
–Welche Möglichkeiten, Vorgehensvarianten, Alternativen bieten sich? Wo sind Entscheidungen nötig? Wie priorisiere ich?
–Auf welche Erfahrungen, Routinen, Abmachungen, Regeln, Vorschriften, Theorien nehme ich Bezug?
–Welche Ressourcen kann ich erkennen? Was traue ich in der Situation jemandem zu, was nicht und weshalb? Was kann die Klientin selbst beisteuern, mitentscheiden? Was könnten andere Klienten, ich selbst, Kolleginnen und Kollegen, Vorgesetzte oder Material und Hilfsmittel beitragen?
–Wie gehe ich in der Situation konkret vor? Was, wie und wozu tue ich etwas? Wie setze ich Material, meine Stimme, meinen Körper, meine Hände ein? Wo stehe ich, wie sitze ich, wie bewege ich mich, wohin lenke ich meine Aufmerksamkeit?
–Wozu und wie schaffe ich Transparenz für die Teilnehmenden?
Nach der Situation reflektierbare Aspekte
–Wie bin ich wie vorgegangen? Welche Alternativen wären möglich gewesen? Was ist gelungen? Weshalb ist es gelungen?
–Wo zeigten sich Stolpersteine? Wo gab es Probleme? Wie habe ich sie erkannt? Wie bin ich damit umgegangen? Was gibt es daraus zu lernen? Was wären alternative Vorgehensweisen? Welche Erkenntnisse gewinne ich?
Manchmal entscheiden unscheinbare, aber wichtige Berufsgeheimnisse über das Gelingen von situativ gestalteten Situationen mit Klienten. Mit dem Sprechen darüber können sie kontextbezogen im Moment erläutert werden.
Implizites und Bewusstheit
Erfolgreiche Sportlerinnen oder virtuose Künstler können oft kaum erklären, worauf sich ihr Erfolg zurückführen lässt. Sobald sie selbst ausbilden, müssen sie hingegen umfassend Bescheid wissen und berufliche Expertise vermitteln können. Dazu gehört auch emotionales, sensomotorisches und prozedurales Wissen, welches berufliches Verhalten steuert. Die Kunst der Ausbildenden besteht darin, ihr oftmals stilles Wissen (tacit knowledge, knowing in action) in Form von reflection on action bewusst und verfügbar zu machen.11 Dieses Wissen ist oft mit unbewussten, früheren Erfahrungen verknüpft, die auch emotional und sensorisch abgespeichert sein können (embodied knowledge).
«Modeling mit MetaLog ist eine gute Technik, um Lernenden Hintergrundwissen während der Durchführung derselben zu vermitteln, quasi ein erklärender Untertitel bei einem Film.»
Elmar Tratter,
Dozent Gesundheits- und Sozialberufe
«Die Ausbilderin ist gezwungen, ihr Expertinnenwissen zu explizieren und Handlungs-entscheidungen transparent zu machen.»
Klaus Müller,
Dozent für Gesundheit und Soziale Arbeit
Abbildung 3: Bewusste Kompetenz als ideale Voraussetzung für das Ausbilden in der Berufssituation
Diethelm Wahl12 sagt es prägnant: «Was ist ein Praktiker? Das ist ein Mensch, bei dem alles funktioniert, aber er weiss nicht, warum. Was ist ein Theoretiker? Dies ist ein Mensch, der zwar weiss, wie es geht, bei dem aber nichts funktioniert». Das Denken während des Tuns kann irritieren und die Selbstverständlichkeit der Handlung verunsichern.
Verlangsamung ermöglicht Bewusstheit
Diethelm Wahl schlägt deshalb vor, handlungsleitende, subjektive und oftmals implizite Theorien durch vielfältige Formen des Bewusstmachens explizit und damit bearbeitbar zu machen. Implizit bedeute nicht, dass Wissen nicht bewusstseinsfähig wäre. Wenn Fachpersonen in typischen, wiederkehrenden Situationen agieren oder unter Druck handeln, sei ein hoher Prozentsatz ihrer innerpsychischen Prozesse nicht im Bewusstsein, obwohl sie durchaus erkennen können, was sie denken, fühlen und wie sie im Detail agieren. Wahl empfiehlt, mitten im aktuellen Geschehen mit erhöhter Aufmerksamkeit selbstbeobachtend auf den üblicherweise implizit verlaufenden Handlungsprozess zu achten, auch wenn damit Handlungssicherheit verloren geht. Durch die bewusste Wahrnehmung eigener Gefühle und Gedanken werde zwar spontanes, intuitives und routiniertes Agieren verlangsamt. Der Gewinn sei aber, dass der bewusstmachende Effekt deutlich stärker sei als bei nachträglicher Selbstreflexion.13
«Die Praxislehrkraft benötigt neben den pädagogischen Kompetenzen, fachliche (Sachanalyse), methodische (Struktur der Anleitung), personale (Bedingungsanalyse) und sozial-kommunikative (Durchführung der Anleitungssituation) Kompetenzen.»
Ellen Rewer,
Lehrkraft für Bildung im Operationsdienst, Gesundheitswesen
Ansprüche an die Praxisausbilderinnen
Für die Ausbilderinnen wird die berufliche Tätigkeit durch die Verlangsamung anforderungsreicher. Ihre Aufmerksamkeit liegt gemäss Wahl nicht nur auf der Steuerung der beruflichen Handlungsprozesse, sondern auch auf der detaillierten Wahrnehmung des eigenen Handelns. Im Modus der Selbstbeobachtung während der beruflichen Tätigkeit handelt eine Fachperson als Subjekt und ist gleichzeitig Objekt ihrer Beobachtung.
Routinierte Fachpersonen sind sich Details ihrer Kompetenz oftmals nicht mehr bewusst. Sie handeln stark intuitiv. Im Hintergrund wirkt ihre Erfahrung unabhängig von der damit entwickelten Qualität oder Kompetenz.14 Die Kunst besteht darin, dieses erst einmal unbewusste, schweigende und mit Situationen verknüpfte Wissen bewusst zu machen und anderen Personen aktiv zur Verfügung stellen zu können, ohne Erkenntnisse aus Einzelfällen zur Regel zu machen.15 Für die Ausbildung ideal wäre die bewusste Kompetenz der Fachperson: Ich weiss, dass ich weiss, was ich weiss.
Situative Bewusstheit als Chance auch für die Klienten
Skeptiker befürchten, dass eine gewisse Illusion der Reflexivität, wie es Bourdieu nennt, hemmend wirke, «weil sich die Akteure der sozialen Bedingtheit und Vermitteltheit dessen, was sie als gegeben und unmittelbar einleuchtend wahrnehmen, gar nicht bewusst sein können – weil sie also gerade nicht wissen, was sie tun. Nur von einem Standpunkt außerhalb ihrer Praktiken und im Bruch mit ihrem Selbstverständnis und dem Common Sense lässt sich erkennen, was sie selbst nicht zu sehen in der Lage sind.»16 Gut ausgebildete und erfahrene Fachpersonen mit hoher Bewusstheit in der Situation sind aufgrund bisheriger Erfahrungen aber durchaus in der Lage, ihren Klienten situativ und ungeplant den fachlichen Hintergrund zu erläutern. Sie können zum Beispiel sagen: «Ich mache das so, weil …, meine Kolleginnen machen das wahrscheinlich anders.»
«Zwei Dinge faszinieren mich am Modeling mit MetaLog: Erstens, dass ich mein professionelles Handeln mit lautem Denken begleiten kann und zweitens, dass ich mit der betroffenen Person sprechen kann für die Ohren der Praktikantin. Das finde ich phänomenal, so viele Fliegen auf einen Klatsch!»
Renate Ausserbrunner,
Supervisorin und Organisationsberaterin
In der Situation denken und handeln
D. A. Schön hat das Potenzial der reflection in action bereits früh erkannt. Insbesondere wenn es zu Freude, Überraschungen oder auch ungewollten Ergebnissen kommt, sieht er Chancen für das Bewusstmachen des handlungsleitenden beruflichen Wissens (knowing in action).17 Es sei zwar nicht möglich, alles in einer Arbeitssituation steckende Know-how aufzuzeigen. Aber «sometimes while doing it» gelinge es durchaus, einen Teil der handlungsleitenden Wissensbestände zu benennen: «What features did I notice, when I recognize this thing? What procedures am I enacting, when I perfom this skill?».
«Im Rahmen der Workshops zur Methode Modeling mit MetaLog habe ich nun mehrfach von den Teilnehmenden folgenden Ausspruch gehört: ‹Ich neige auch schon als Therapeutin dazu, den Klientinnen und Klienten viele Details der Behandlung zu erklären. Ich denke, wenn ich das noch etwas bewusster einsetze, dann wird mir das Sprechen eines MetaLogs bald gut gelingen.›»
Sophia Bräkling,
Berufspädagogin Pflege und Therapie
Menschen können also nicht nur über etwas Bevorstehendes oder Erlebtes nachdenken, «think about doing», sondern auch in der Situation selbst reflektieren, «think about doing something while doing it».18
Im Gegensatz zur reflection on action vor und nach der beruflichen Situation ist diese von D. A. Schön und auch D. Wahl erläuterte reflection in action bisher methodisch nicht weiter umgesetzt und genutzt worden.
Nachdenken und Sprechen über das berufliche Handeln während des Arbeitsprozesses macht unsichtbares, implizites berufliches Know-how explizit.
Gestaltungsmittel
In personenorientierten Berufen stehen in der Phase der Performanz im Wesentlichen drei Gestaltungsmittel zur Verfügung. Für den beruflichen Erfolg ist die Qualität der Anwendung dieser Instrumentarien hoch relevant. In Praxisphasen können Studierende die Gestaltungsmittel in konkreten beruflichen Situationen kennen lernen und deren Nutzung als Teil ihrer professionellen Kompetenz für ihr zukünftiges berufliches Repertoire weiterentwickeln.
Sprache
Die Auswahl und Strukturierung von Inhalten, die situative Passung und wertschätzende Art der Formulierungen sowie die Modulation der Stimme prägen die verbale und averbale Kommunikation in Gesprächen oder Inputs, die Stimmung, die Beziehung und das Verständnis einer Sache.
Körper
Die Wahrnehmung, Positionierung, Bewegung und Ausrichtung des eigenen Körpers im Raum sowie spezifische Handlungen, Hilfestellungen, Handlings und Berührungen und die nonverbale Kommunikation über Mimik und Gestik sind wesentliche Elemente für die Gestaltung von Berufssituationen.
Szenik
Elemente der Inszenierung wie die Gestaltung von Zeit und Raum oder die Nutzung von Material und Infrastruktur prägen die Atmosphäre und formen die Situation. Gesteuert wird der Einsatz dieser Inszenierungselemente unter anderem durch Einstellungen und Werthaltungen, Motive und Ziele, Routinen, Regeln und Standards, situative Begebenheiten, Beobachtungen, Wahrnehmungen, Einschätzungen, Erfahrungen und Expertisen sowie Emotionen.
Abbildung 4: Methodische Einsatzformen von Sprache, Körper und Szenik in der Situation mit Klienten
Sprache, Körper und Szenik sind bestimmende Gestaltungsmittel in personenbezogenen Berufen.
Theoriebezüge zum Lernen in der Praxis
Modelllernen im Praktikum
Die Geste des Zeigens steht am Ursprung der menschlichen Kommunikation.19 Das Vorzeigen und Nachmachen gilt als Urform der Kulturvermittlung20, fristet aber besonders in personenbezogenen Berufen konzeptionell eher ein Schattendasein. Petersen und Oser (2013) haben diese naheliegende Ausbildungsmöglichkeit für Berufssituationen − allerdings ohne Anwesenheit von Klienten − mit wichtigen didaktischen Hinweisen ausführlich dargelegt. Ein der Handlung unterlegter Kommentar führt zur situativen Lenkung der Aufmerksamkeit und unterstützt die Aufnahme, Fokussierung, Reflexion und Abspeicherung von erfahrenen Ereignissen.21 Colins et al. betonen das Erleben und Reflektieren variationsreicher Situationen, was die Vergleichsmöglichkeiten sowie den Transfer auf weitere situative Kontexte erleichtert.22 Riesen (1995) spricht von der «Demonstration der Prozesse, welche dem sichtbaren Lern- und Problemlöseverhalten zu Grunde liegen». In Modeling mit MetaLog können diese Chancen realisiert werden.
Reflection in action
In ihren Veröffentlichungen zum Cognitive Apprenticeship kritisierten auch schon Collins et al. die geringe Verknüpfung von im schulischen Kontext erworbenem Wissen mit dem beruflichen Handeln. Sie folgern daraus, dass dieses Wissen nicht zur Problemlösung genutzt werde und somit für den späteren Anwendungskontext nutzlos bleibe.23 Es fehle an der Vermittlung von Problemlösestrategien, wie sie etwa erfahrene Personen zur Bewältigung komplexer realer Probleme heranziehen.24 Genauso blieb die Methodik des Modelllernens auch in den Pflegeberufen beim unbefriedigenden learning by looking, beim Stehlen mit den Augen, Nebenherlaufen und Simulationssituationen stehen.25 So geht das Beobachten des Modells nahtlos über ins angeleitete Arbeiten. Auch der von D. A. Schön ausgelegte Pfad der «reflection in action» oder Diethelm Wahls « Entschleunigung» wurden methodisch nicht konsequent weiterverfolgt und -entwickelt. Hochschulen haben in den letzten Jahren mit Begleitformaten den Ansatz der reflection on action ausgebaut und nutzen Praktika verstärkt als Forschungs- oder Reflexionspraktika, aber nicht für das direkte Lernen,26 indem Ausbilderinnen ihr angewendetes implizites Wissen (tacit knowledge) möglichst offenlegen und so als handlungsleitendes Wissen in der Situation (knowing in action) über das laute Denken (reflection in action27, clinical reasoning28) bewusst machen.
Es geht darum, die Studierenden nicht in ein Meister-Lehrlings-Verhältnis, welches sie zu Adjutanten macht,29 einzubinden, sondern ihnen Einsicht in die Verbindung von Wissen und Handeln30 zu geben und berufsrelevante Praktiken im Sinne von core practices31 transparent zu gestalten. Studierende können so Denk- und Entscheidungsprozesse sowie domänenspezifische Zusammenhänge, welche beruflichen Handlungen zu Grunde liegen,32 bereits in der Situation kennenlernen, reflektieren und adaptieren.33
Bewusste Handlungssteuerung
Konstruktivistische Theorien gehen davon aus, dass Lernen ein aktiver, selbstgesteuerter und gleichzeitig kooperativer, sozialer und kultureller Prozess des Wissensaufbaus ist.34 Bestehende Wissensbausteine werden dabei mit neuen Wissenselementen verknüpft. Neurologische Forschungen zeigen, dass Lerneffekte über die Gleichzeitigkeit von durch alle Sinne wahrnehmbaren Situationen verstärkt werden.35 Indem die modellierende Fachperson mit dem MetaLog arbeitet, können Lernende mit der Kombination von Modelllernen36 und Erklärungen zunehmend mögliche Strategien in ihr eigenes Denken und Handeln integrieren.37 Wie D. Wahl ausführlich beschreibt, kann mit Techniken zur Entschleunigung Zeit gewonnen werden, um das berufliche Handeln auch unter Druck zu reflektieren.38 Der MetaLog als Sprechen nach aussen unterstützt genauso wie das von Wahl empfohlene «Sprechen nach innen» die Reflexion während dem Tun. Es wird Raum geschaffen, in dem handlungssteuernde Strukturen, evidenzbasierte Erfahrungen und subjektive Theorien besser wahrgenommen und, wie Wahl sagt, Prozesse entautomatisiert werden können. Von den Klienten wird diese unmerkliche Verlangsamung intuitiv als angenehm registriert und führt bei ihnen meist zu einer Beruhigung und Stressabbau.