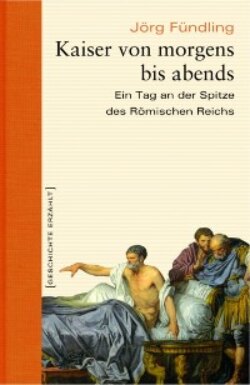Читать книгу Kaiser von morgens bis abends - Jörg Fündling - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Tagesanbruch
Lever auf dem Palatin
ОглавлениеEr wacht allein auf – praktisch allein. Natürlich zählt das Personal nicht mit. Ein paar Schritte von ihm, im Vorzimmer, haben seine Kammerdiener darauf gewartet, benötigt zu werden, weitere sind in Hörweite und ebenso die Wache. Er hat sich wecken lassen; sinnlos, Zeit zu verschwenden; zwar wird er meistens von selber wach, aber man weiß nie.1
Noch ist es dunkel; das kennt er nicht anders. Über Mittag wird er vermutlich dazu kommen, etwas Schlaf nachzuholen, wenn er muss – und falls er vorher zügig durch den Zeitplan gekommen ist. Leider hängt das nicht an ihm allein. Was wird heute wohl an Briefen eingehen? Wie viele neue Anfragen und Gesuche?
Von letzter Woche sind noch zwei, drei Gesandtschaften übrig, die er zwischen die anderen schieben muss ... das geplante Edikt ... das Konzept zur Senatsrede, einige treffend formulierte Stellen braucht er noch. Und das Essen am Abend. Er freut sich schon darauf und fürchtet es trotzdem – wie lang die paar Stunden manchmal werden können! Egal, mit den meisten Freunden muss er sowieso sprechen, Capito hat eine unterhaltsame Ader, auf ihn lässt sich rechnen – und man selbst ist zwar nicht mehr ganz jung, aber man hält sich ermutigend frisch. Soll der Abend nur kommen! Doch das Ziel ist noch weit; die Reise beginnt ja erst.
Kritische Selbstbetrachtung
Morgens zuerst sich sagen: Begegnen werde ich einem Wichtigtuer, einem Undankbaren, einem Frechling, einem Hinterlistigen, einem Verleumder, einem Egoisten.
MARC AUREL, Selbstbetrachtungen 2,1,1.
Vor der Tür wird es lauter. Das kaiserliche Schlafzimmer – wir können es in den Grundrissen der Paläste nicht genau identifizieren, aber mit Sicherheit ist es kein riesiger Paraderaum wie in einem Barockschloss – bleibt je nach Geschmack des Bewohners nicht ganz privat. In den cubicula großer römischer Häuser empfängt der Hausherr tagsüber wichtigen Besuch, und auch mancher Kaiser lässt seine engsten Freunde schon an sich heran, während er noch im Bett liegt.
Das Aufstehen ist kein großes Zeremoniell wie in der Frühen Neuzeit, sondern bloße Notwendigkeit; man wäscht sich kurz das Gesicht, man wechselt die Tunika – oder lässt die am Leib, in der man geschlafen hat, und zieht vielleicht noch eine weniger zerknitterte darüber.2
Die römische Zeitrechnung
Der Tag in Rom, von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang gemessen, bestand aus zwölf ,elastischen‘ Stunden, deren Länge sich im Winter bis auf ca. 45 Minuten nach unserem Maß verkürzte, im Sommer auf 75 Minuten ausdehnte. Die modischen – und teuren – Wasseruhren waren mit der Sonnenzeit kaum zu synchronisieren; bei Verabredungen außer Haus gehörten längere Wartezeiten mit dazu.
In Rom ist es die Stunde der Barbiere, der tonsores, Leute mit sicherer Hand „wie Neros Thalamus es war, dem der Bart eines Drusus zum Opfer fiel“, und mit flinker Zunge. Schade, dass sie ihre Zeit brauchen, wenn sie einen nicht verstümmeln sollen. Der Sklave, der das Messer an Caesars Kehle setzen darf, ist besonders behutsam, also auch besonders langsam, und flüstert ihm vielleicht ein paar Wünsche seiner Bekannten (und zahlender Bittsteller, die sich auskennen) zu, aber eher Nachrichten und Gerüchte; sein Kunde macht sich, wenn er dabei stillhalten kann, vielleicht ein paar Notizen auf eine Schreibtafel. Ein Dummkopf, wer’s nicht gern hört; mit der Dienstpost kommen solche Details jedenfalls nicht.3 Gestern waren seine Augen etwas rot, schien ihm, doch die Salbe – Florus’ Kollyrium hat Asklepiodoros sie genannt, und sie habe seinerzeit Claudius’ Mutter sogar vor der Blindheit bewahrt – hat angeschlagen, und es brennt nicht mehr.4 (Wozu hat man einen Palast voller Ärzte. Solange sie nur untereinander keinen Krieg anfangen). Wenn die medizinisch geschulten Freigelassenen einer Meinung mit ihren „unabhängigen“ Kollegen sind, kann man sich gratulieren. Seit Jahren plagt ihn der dumme Verdacht, dass Medizin eine Modesache ist – und dass die überbezahlten Palastärzte ihm grundsätzlich das teuerste Mittel verschreiben.5
Nun noch etwas durchatmen, den Klatsch auf sich wirken lassen und in Gedanken sieben. Das frische Gefühl auf den Wangen allein ist eine kleine Verzögerung wert. Nur der ganze Aufwand um seine Frisur dürfte nicht sein. Wieviel es an etwas so Einfachem zu kämmen und zu kräuseln gibt; „ihr haltet mich wohl für die Augusta“, hat er neulich gesagt. Streut doch gleich Blattgold obendrauf!6
Fürst und Familie
Noch ist er für alle, die ihn so sehen dürfen, in Hauskleidern, relativ schlicht und natürlich makellos. Die Toga ist hauptsächlich Straßenkleidung und für öffentliche Orte. Ein Spezialfall ist der Empfang von Besuchern, die selber förmlich gekleidet sind; nur ein Nero brachte es fertig, fernerstehende Senatoren oder die Öffentlichkeit durch Herumlaufen in Halstuch und geblümter Tunika ohne Gürtel zu schockieren. Auch dann lässt der Monarch es üblicherweise bescheiden angehen; an normalen Tagen genügt die toga praetexta, die ,einfache‘ Purpurtoga, wie sie auch ein Konsul oder Praetor anlegt, kombiniert mit den Schuhen eines Patriziers. Von Rechts wegen haben die Kaiser Anspruch auf das reich mit Gold verzierte Gewand eines triumphierenden Feldherrn, doch die wenigsten legen es an, wenn gerade kein großes Fest ist. Hat der Herrscher nahe Verwandte, ziehen sie sich im Idealfall schlicht an; so sieht man den jungen Marc Aurel, der schon Caesar ist, nur in unscheinbarer Kleidung, wenn sein Herr und Vater Antoninus ihn nicht begleitet. Der ,Kronprinz‘ achtet auch sonst darauf, die Unterschiede nicht zu verwischen: Seine Morgenbesucher fertigt er zügig im eigenen Schlafzimmer ab, dann eilt er hinüber, um dem Kaiser seine Aufwartung zu machen.7
Ein Familienereignis ist dieser Morgen auf dem Palatin also höchstens bedingt. Die Kaiserin wacht so gut wie sicher in ihrem eigenen Zimmer auf – das römische Ideal des gemeinsamen Ehebetts scheitert in der Praxis des ersten Haushalts von Rom wohl an den sozialen Verpflichtungen. Jedenfalls sparen unsere Quellen dieses delikate Thema weitgehend aus. Ob sich die Gatten beim Frühstück sehen? Möglich, aber das Frühstück ist eine magere Sache – nicht viel mehr als Brot und etwas zum Hinunterspülen – und muss üblicherweise bis zur dritten Stunde des Tages warten, wenn die Arbeit schon lange begonnen hat.
Im Fall des Exzentrikers Caligula leistet der a cubiculo, der Oberkämmerer (wir können beinahe „Butler“ sagen), ihm Gesellschaft und sorgt für Konversation. Er ist ein freigelassener Sklave, oft hochgebildet, nicht selten ehrgeizig – und von seinem Wort hängen Karrieren ab. Von Caligulas vier Frauen hören wir nichts.8
Auch Kindergeschrei in den Palastfluren ist die Ausnahme. Längst nicht jeder Kaiser hat eigene legitime Kinder, seien sie leiblich oder adoptiert. Andere – den Nachwuchs einer Konkubine oder gar aus einem Ehebruch – würde er nie anerkennen, noch weniger würde es die römische Gesellschaft. Umgekehrt wird ein ,junger‘ Vater nicht so oft Kaiser, sondern der hat, wenn überhaupt, wahrscheinlich Kinder, die sich der Mündigkeit nähern. Erst dann werden sie beruflich interessant für ihn – die Töchter muss er zeitig verloben (und zeitig bedeutet eine Heirat mit 12 bis 14 Jahren), die Söhne an ihre öffentlichen Aufgaben heranführen. Jüngere Kinder werden auf Münzen und bei Auftritten vor Publikum zwar als Garanten der Zukunft präsentiert, aber im Innern des Palastes sind sie zwangsläufig Nebensache. Ihre Eltern sehen sie täglich, doch die Hauptpersonen in ihrem Leben sind die Amme (nutrix) und später der Erzieher (nutritor), durchweg Sklaven oder Ex-Sklaven. Wenn die Kaiserin wesentlich mehr tut, als die Arbeit der Erzieher zu überwachen und für gute Lehrer zu sorgen, ist das bereits ein großes zeitliches Opfer. Die Väter sind die meiste Zeit über die großen Abwesenden; wenn ein Kind alt genug ist, darf es vielleicht beim Abendessen neben der Liege seiner Eltern sitzen. Tagsüber bleibt es unsichtbar und würde nur stören – vorlaute Kinder finden manche Römer zwar spaßig, aber nur solange es nicht die eigenen sind.9
Empfangsbereit
Inzwischen macht sich der Princeps endgültig fertig; jetzt muss er sich drapieren lassen, denn zahlreiche Besucher kommen von Amts wegen. Die Leiden des Anziehens beginnen. Die Toga für heute morgen wird aus den Tiefen des Raums gebracht; mehrere spezialisierte Sklaven haben sie von der Schneiderpuppe operiert, auf der sie gewartet hat, und beginnen sie nun am stehenden Kaiser in die endgültigen Falten zu legen, ein vornehm kompliziertes Relief.
Besser bedient wird keiner in Rom, schneller auch nicht, aber es bleibt eine erneute Geduldsprobe. Man erstarrt, man kann sich höchstens noch unterhalten, auf ein paar unkomplizierte Fragen die Antworten geben, die man nachher ausformuliert unterzeichnen wird – „Abgelehnt“; „Für ihn immer“; „Haben wir dazu nicht ein Reskript von meinem Vorgänger?“; „Später, später“ – und zeigen, wie geduldig man ist. Danach fällt er in die zum Gewand passende Gangart – würdevoll und doch so zügig wie möglich, scheinbar unbelastet vom Gewicht des Stoffs, aber behutsam genug, damit ihn nicht an jeder Ecke aufmerksame Begleiter in Form zupfen müssen.10
Kaiser Vespasians Morgen
Er hielt sich in groben Zügen an folgenden Tagesablauf. Solange er Kaiser war, wurde er immer ziemlich früh und noch im Dunkeln wach; später las er erst gründlich seine Post und die Berichte aller Dienststellen, dann ließ er seine Freunde hereinkommen, und während sie ihm ihre Aufwartung machen, zog er sich eigenhändig Schuhe und Kleider an.
SUETON, Vespasian 21
Jetzt wäre der Kaiser passend gekleidet, um sich den Göttern zu widmen. Jeder Hausherr ist sein eigener Priester, dieser erst recht; es gibt das tägliche kleine Opfer vor den verschiedenen Hausgöttern im Schrein, ab und zu auch eine größere Zeremonie, bei der Blut fließt. Manche der eintreffenden Freunde werden hinzugebeten – und sind nicht immer freundlich gesinnt; so stand rund um den opfernden Galba an dem Tag, da er sterben sollte, neben anderen auch der Hauptverschwörer und Nachfolger Otho. Aber zumindest der spätantike Dichter Ausonius verrichtete sein Gebet unrasiert und gleich nach dem Aufstehen – zu Gott, nicht zu den Göttern, wie er eigens betonte.11
Ein besonders wichtiges Büro hat seinen ersten großen Moment des Tages, das officium admissionis, der Empfangsdienst des Palastes; Freigelassene ab admissione überprüfen die Listen der Zutrittsberechtigten (bei der Güteklasse der zuerst Eintretenden reicht eine Gesichtskontrolle), der Vorhang zum Audienzraum teilt sich unter den geübten Händen der velarii, ein nomenclator ruft zum Empfang den Namen jedes Glücklichen aus. Die Zeremonie des „Morgengrußes“, die salutatio, kann sich furchtbar in die Länge ziehen; vor dem Palast stauen sich die Wartenden, wenn es ein besonderer Tag ist, und auch enge Vertraute des Kaisers müssen dann gelegentlich lange warten und retten sich in Konversation. Daheim wartet womöglich schon ihr eigenes Publikum aus Schützlingen, Freunden und Bekannten.12
Wer sich keine Sorgen um den Status zu machen braucht, spart sich den einen oder anderen Termin; Marc Aurels Rhetoriklehrer Fronto kokettiert gegenüber seinem Schüler damit, er komme ja keineswegs täglich in der Morgendämmerung und sei zu seiner freudigen Zerknirschung trotzdem bei Marcus wie bei Kaiser Antoninus gut angeschrieben. An Feiertagen wie dem 1. Januar (an dem Rom seinen Treueeid auf den Herrscher leistet) oder am Jahrestag des Herrschaftsbeginns besteht dagegen Anwesenheitspflicht.13
Patron und Klient
Das traditionelle Sozialsystem der Klientel – Leben im persönlichen Schutz eines Mächtigeren – bestimmte den Verlauf des Morgens für zahlreiche Römer. Dem Grad ihres Prestiges und der Vertrautheit zum Patron nach werden die verschiedenen Klienten vorgelassen, zeigen ihren Respekt, tragen Anliegen oder Wünsche vor und nehmen Geschenke mit. Seinerseits ist der Patron oft zugleich Klient eines noch wichtigeren Mannes, nur werden solche Begriffe dann schonend vermieden; hochrangige Besucher des Kaisers gelten als seine „Freunde“.
Es geht sehr hierarchisch zu. Jeder, den der Kaiser auf einen halbwegs wichtigen Posten berufen hat, ist definitionsgemäß schon „ein Freund des Kaisers“, im weiteren Sinn auch jeder Senator, aber natürlich gibt es engere und engste Freunde – mal selbstgewählt, mal durch den sozialen Rang diktiert – so wie es höhere und höchste Posten gibt. Und auch der eine oder andere schlichte Nicht-Freund steht vor der Tür. Die Reihenfolge des Eintretens wird genau registriert, und sie ist in der Gesellschaft der Hauptstadt ein empfindlicher Punkt. Unter Claudius gab es den Versuch, ganz offiziell unter all diesen amici nach erstem Zutritt, zweitem Zutritt und so weiter zu unterscheiden – eine Rangliste, die auf lange Sicht ein großer Schritt hin zu einem wirklichen Hofstaat à la Versailles gewesen wäre. Es gehörte zu den populärsten Maßnahmen des jungen Nero, sie aufzuheben; der Stolz allzu vieler kaiserlicher amici aus den hinteren Reihen stand auf dem Spiel.14
Jeder Senator, jeder sonstige amicus bekommt seinen Kuss auf den Mund, die engsten Freunde zuerst und länger als die anderen. Worte werden gewechselt, auch sie in genau überlegter Länge und Herzlichkeit; erste Bitten werden vorgebracht. Der Kaiser vermisst drei vertraute Gesichter; deren Boten warten auch schon, alle mit kurzen Nachrichten in der Hand – Erkältung, Augenentzündung, Gicht. Die Armen. Er schickt gleich Besserungswünsche zurück und beschließt ein paar Zeilen hinzuschreiben. Eigenhändig ist doch noch etwas anderes.15
Es lässt sich gut an heute. Der Besuch wäre abgearbeitet, die Falten liegen noch, wie sie sollen, der Magen knurrt nicht mehr (ein zweites Frühstück wäre trotzdem schön, aber irgendwer wird ihm schon zwischendurch eine Kleinigkeit servieren, sie kennen ihn ja). Eigentlich ist soviel Appetit ja unmoralisch, und es gibt Leute, die behaupten würden, er sei auf dem Weg, ein zweiter Vitellius zu werden. Unsinn – bisher stopft er sich weder mit Gerichten im Millionenwert voll noch mit Essensresten aus der nächsten Kneipe. Aber mit trockenem Brot kann er den halben Tag über nicht durchhalten – und wie gewisse Vorgänger es ganz ohne Essen bis zum Abend geschafft haben, begreift er nicht. Schließlich ist er nicht zum Hungerkünstler berufen, sondern zum Herrscher.16