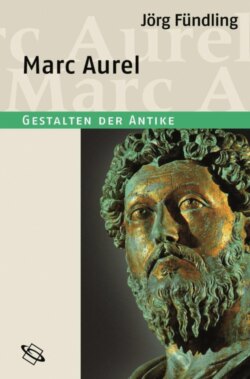Читать книгу Marc Aurel - Jörg Fündling - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3. Zur Weisheit berufen
ОглавлениеKönnte nur einer diese Lehre ganz verinnerlichen – wie es sein sollte –, dass wir alle zuallererst von Gott geboren sind …, dann denke ich, dass er nichts Unedles oder Niedriges von sich glauben wird. Wenn dich dagegen der Kaiser adoptiert, wird niemand deinen Hochmut aushalten können; doch wenn du erfährst, du bist ein Sohn des Zeus, erhöht dich das nicht?
Epiktet, Diss.1,3,1f.
Längst vor dem Schicksalsschlag von 138 hatte festgestanden, dass Marcus nur die beste Erziehung genießen würde. Der Unterricht seiner jungen Jahre spielte sich in seinem Elternhaus und dem seines Großvaters ab. Marcus selbst bedankte sich postum bei „meinem Urgroßvater“, wohl Catilius Severus, „nicht in den öffentlichen Unterricht gemusst und zuhause gute Lehrer gehabt zu haben“. Diese Erleichterung kann sich aus vielen Ängsten erklären: vor geringerer Qualität der öffentlichen Lehrer oder vor deren brutaleren Umgangsformen, vielleicht auch aus Scheu vor einer zu großen Menschenmenge. Die Liste seiner uns bekannten Erzieher aller Altersstufen ist erstaunlich lang, eindeutig wegen der Überzeugung Späterer, hier habe die Pädagogik ein Meisterwerk vollbracht – der Autor der Historia Augusta ließ seinen Marc Aurel den versammelten Lehrern sogar göttliche Ehren erweisen. Ihre Reihe beginnt mit Euphorion, einem Sklaven oder Freigelassenen, der ihm die Schrift beibrachte, dem Schauspieler Geminus, der anhand ausgewählter Klassikertexte Grammatik lehrte, und dem Geometrie- und Musiklehrer Andron (beide Disziplinen galten als mathematisch). Marcus belohnte sie später reich.1
Jenseits des Grundschulunterrichts warteten statt eines gewöhnlichen Grammatiklehrers einige der besten Sprachlehrer Roms. Der aus Dalmatien stammende Trosius Aper übernahm den lateinischen Sprachunterricht, dazu oder danach Tuticius Proculus aus Nordafrika; er brachte es bis zum Proconsul einer Provinz und Marcus übernahm die Amtskosten für ihn. Für das Griechische gewann die Familie sogar den berühmten Alexander von Kotyaeion. Marcus’ Erinnerung verrät, dass ihn dieser Homerspezialist in einer kleinen Gruppe unterrichtete, und hält das pädagogische Geschick fest – Fehler verbesserte Alexander scheinbar beiläufig und ohne sie in den Mittelpunkt zu stellen. Dass Marcus sich ausgerechnet daran erinnerte, darf als Indiz gelten, wie verletzlich sich der Junge durch eigene Wissenslücken fühlte.2
Die traditionelle dritte Stufe bildete für die Söhne der Oberschicht der Rhetorikunterricht, der etwa ab dem achtzehnten Lebensjahr zur eigenen Tätigkeit in Recht und Politik anleitete. Antoninus sorgte zusätzlich für juristischen Beistand durch eine angehende Größe der Zeit, seinen Beamten Volusius Maecianus, der nach 161 mit einem Aufstieg in den Senat belohnt wurde. Im Griechischen ‚verschliss‘ Marcus zwei Lehrer, ehe er schließlich beim großen Herodes Atticus lernen durfte, der Hauptfigur der griechischen Rhetorik jener Jahre und dem ersten Bürger Athens, der seinerseits als Jugendlicher im Haus von Marcus’ Großvater mütterlicherseits gelebt hatte. Anders im Lateinischen: Von Anfang bis Ende blieb es bei einem aufstrebenden Rhetor und Anwalt, einem Virtuosen des modisch gewordenen archaischen Stils, dem erstaunlichen Cornelius Fronto aus Cirta, dem Marcus ein Leben lang in Freundschaft, ja Liebe verbunden blieb. Besuche öffentlicher Deklamationen garantierten, dass der Caesar die Vielfalt der in Rom gepflegten Redestile kannte, so gezielt sein Lehrer ihn auf einen moderaten Archaismus hinlenkte. Doch so begabt der junge Mann zur Freude Frontos war, das Fach hatte einen schweren Stand bei ihm. Später dankte er den Göttern, „dass ich in Rhetorik und im Dichten und den übrigen Studien nicht noch weiter vorankam, bei denen ich vermutlich stehengeblieben wäre, wenn ich gemerkt hätte, dass ich bequeme Fortschritte machte“. Er begeisterte sich für ein bloßes Randgebiet der üblichen römischen Erziehung: „Großen Lehrern anvertraut gelangte er zu den Weisungen der Philosophie.“3
Als Wegbereiter erscheint ein gewisser Diognetos, der ohne die Selbstbetrachtungen nur noch als Mallehrer des Patriziersohnes bekannt wäre. Das Bild eines – vielleicht zu früh – auf Ernst und Eifer drängenden Lehrers zeichnet sich ab, der auf der Beschäftigung mit wesentlichen, ertragreichen Dingen bestand. Die Charaktereigenschaft, die er Marcus mitgab, nennt dieser to akenóspoudon, ein Wort, das ebenso „Aversion gegen das Sich-Vertiefen in Müßiges“ wie „gegen scheinbare Reife“ oder „gegen Altklugheit“ heißen kann. Der Junge interessierte sich zeitweise für Spektakuläres, ja Okkultes; Diognetos stellte sich zwischen ihn und diverse Zauberer und Wahrsager: Um die Zukunft sollte er sich nicht kümmern, wenngleich er stets viel auf seine Träume gab. Auch Kritik hinzunehmen will Marcus von diesem Mann gelernt haben. Es war viel Einengung dabei, aber zugleich ermutigte der Advokat des Lebensernstes seinen Schüler zum Verfassen erster – zweifellos erbaulicher – Dialoge und brachte ihn mit Weisheitslehrern in Kontakt.4
Die stoische Philosophie war im zweiten Viertel des 2. Jahrhunderts aus Rom nicht mehr wegzudenken. Senatoren wie Marcus’ Großvater standen unter dem Eindruck einer ganzen Reihe von Standesgenossen, bei denen diese ‚Lebenshilfe‘ mit den Idealen der Republik verschmolz, auf die sie zurückblickten wie auf eine Heroenzeit. Es war nicht gut gegangen: Ein Häuflein rigoroser Außenseiter hatte sich mit Nero, dann mit Vespasian und dessen Söhnen angelegt. Man bewunderte ihre tödliche Konsequenz nicht ohne Kopfschütteln. Zu Marcus’ Jugendzeit gab es etliche Stoiker, die im Senat saßen, ebenso etliche Verehrer der längst untergegangenen Republik, doch kombinierten die allermeisten mit der Sprache der auf wenige Kerntugenden orientierten Lebensführung – oder mit jener des ärmlichen, glorreichen alten Rom – einen durchaus angepassten Lebenswandel. In den politisch ruhigeren Verhältnissen nach 100, einer Zeit ohne große Aderlässe im Senat, erinnerte man sich an den Anspruch der Philosophie, eine Richtschnur im Leben und im Sterben zu sein, und ehrte sie in Erinnerung an jene, die damit Ernst gemacht hatten. Gleichwohl war man zweifellos dankbar, dass die Feuerprobe ausblieb. Das Versprechen einer erhabenen Gleichgültigkeit gegenüber Krankheit und Leid behielt seinen Reiz, auch wenn die Drohung von Unehre, Folter und Tod ferngerückt war. Attraktiver musste nun der Anspruch sein, sich innerlich über die Nöte und Gefährdungen seiner sozialen Rolle erheben zu können, sich nur noch an den wenigen Werten zu messen, die zählten. Wir denken uns das Leben der oberen Kreise Roms zu gern als müßig und gelangweilt, womöglich als dekadent und sehr nutzlos. Aber wenn es ein Nichtstun war, dann ein sehr hektisches. Jeder der Hunderte von Senatoren stand in häufigen Gesprächen oder Briefkontakt mit Standesgenossen, mit Provinzstädten, Vertretern des Ritterstandes oder des Lokaladels und pflegte ein, zwei jener Privatinteressen, die man zu pflegen hatte.
Die römische Gesellschaft in Gang zu halten kostete physische Anstrengung, auch wenn ihre Spitzen natürlich kein Sklavendasein führten, so sehr Spötter ihnen genau das vorhielten. Eine Philosophie innerer Distanz und einer Tugend, die sich selbst genug war, passte ausgezeichnet dazu. Sie war nicht ohne Gefahren; die Stoa konnte auch zu freud- und teilnahmsloser Kälte entarten. Ausgerechnet die Zwänge des Soziallebens mäßigten dies. Ein Senator benötigte den vollendeten Takt eines Höflings, aber mehr als nur das. Aufrichtige Freundlichkeit, Zugänglichkeit und Fürsorge standen hoch im Kurs und gaben der ‚mehrheitsfähigen‘ Ausprägung der Stoa eine gewisse Wärme, die, falls vorgespielt, doch gut gespielt war.
Jedoch war die Stoa nicht mehr ganz jene natürliche Verbündete des senatorischen Standesethos, eine Denkschule, die zum konsequenten Handeln nach den Maßgaben des römischen Tugendideals erziehen konnte. Der junge Marcus war ein fleißiger Leser der Lehren Epiktets, eines einstigen Sklaven, der über würdige Gesten und Adelsstolz der kaiserzeitlichen Vornehmen allerhand Verletzendes zu sagen hatte, das die Angst um Reichtum, Position und Kaisergunst bloßlegte. Man konnte meinen, einen Kyniker vor sich zu haben, vor dem sich die Triebe und Urängste vergrößert zeigten, nur dass die Mehrzahl solcher „Hunde“ eher durch demonstrative Unsauberkeit, rüde Worte, Essen halbverdorbener Speisen und so weiter ihre Unabhängigkeit zeigen wollte. Jenseits von Provokationen dieser Güte war der Kynismus der Kaiserzeit ein Verwandter der Stoa, und umgekehrt finden sich Impulse der kynischen Lehre ausgerechnet in Marcus’ Verhalten wieder. Die ostentative Bedürfnislosigkeit, die Abhärtung durch karge Kost und schlechtes Nachtlager wären den Schulhäuptern früherer Epochen nicht ganz unsympathisch, aber doch fremd erschienen. Etwas Unbedingtes, das man für eine Rückbesinnung auf die Gründer der Schule hielt, sprach sich in den Forderungen eines Musonius und Epiktet aus, die aus der Erkenntnis der inneren Freiheit vor allem einen Willensakt machten, der ständig zu wiederholen sei. Aus der kurzlebigen Lehre des unabhängigen Philosophen Sextius, eines Zeitgenossen des Augustus, war die Überzeugung haftengeblieben, das Leben sei ein ständiger Kampf um die Herrschaft über sich selbst. So lernte Marcus eine gewandelte Form der alten Lebensphilosophie kennen, die mehr denn je Entsagungen und Selbstdisziplin forderte, ja mit der bemühten Härte und Strenge ihrer Ansprüche warb.5
Für seine persönlichen Bedürfnisse passte die Stoa ideal: Unter allen Umständen das tun, was man tun musste, und für Lohn und Erfolg fest auf die göttliche Weltregierung vertrauen. Mochte Marcus auch als Spielball ins höchste nur denkbare Spiel geworfen sein, die innere „Meeresstille“ wartete auch hier auf den überzeugten Stoiker. Etwas Verdächtiges, ja Resignatives hat diese Haltung für moderne Augen; sie erlaubte es, viel zukünftige Angst zu ertragen, sie konnte aber auch auf Ängste antworten, die längst da waren, und der Stoiker nahm sich vorsorglich vieles, das ihm dann kein anderer mehr würde nehmen können. Marcus, der sich rückblickend in ernster Gefahr gesehen hatte, seinen Lesehunger mit Bergen an theoretischer Spezialliteratur zu stillen, „in die Hände irgendeines Sophisten zu fallen“, hatte die Lehre vom Wesentlichen entdeckt, die ihm mehr zusagte als Dialektik und Naturphilosophie. Wenn er den Bau der Welt studierte, dann als riesigen Organismus voll Werden und Vergehen, „denn die Gedanken daran reinigen vom Schmutz des Lebens am Boden“.6
Eine monarchische Philosophie war es auch. Wie eine letzte Instanz die Welt regierte, so auch deren höchste menschliche Organe, die Herrscher, im Kleinen. Die Stoa pries ihre endlosen Mühen glücklich und stellte einen langen Katalog von Prinzipien und Entscheidungshilfen bereit, denn sie war in der Monarchenzeit des Hellenismus entstanden. Sie blieb, so hoch sie die harmonisch aufeinander abgestimmte Gemeinschaft lobte, ein Studium der Einsamkeit und versprach das Ruhen in sich selbst und die Erfüllung der Existenz – von all den kleineren Tröstungen nichts. Der junge Mann, der sie einstudierte, war aber zum einsamen Leben nicht geschaffen. Die Nähe seines Adoptivvaters, mit dem er so viele Lasten teilen konnte, machte ihn überglücklich; auch ein Familienmensch war er wohl, wie wir sagen würden – seine Kinder liebte er mit Sicherheit, seine Frau höchstwahrscheinlich. Ohne diesen Trost hätte er sich sehr schwergetan.7
Ganz unterschiedliche Ausprägungen jener Lehre, zu der es ihn hinzog, begegneten ihm. Ein Rätsel bleibt ein Verwandter namens Commodus, der ihn unterwiesen haben soll. Tief und lange sollte ihn dagegen der Stoiker Apollonios von Chalkedon prägen. Die Begeisterung des Jugendlichen klingt noch in seiner Charakteristik nach. Jene Mischung aus Geduld, Direktheit und Umgänglichkeit, Ernst und Ernstnehmen, mit der Apollonios vorging, sollte Marcus auch später noch anziehen; seine Geldgier und Dreistigkeit gegenüber dem Kaiser – den der Philosoph nicht hatte aufsuchen wollen – scheint den Schüler wenig gekümmert haben. Unschätzbar war eine soziale Lektion: „Wie man scheinbare Gefälligkeiten von Freunden annehmen soll, ohne sich dadurch etwas zu vergeben oder sie ungerührt zu übergehen.“ Wahre Freundesdienste lagen auf ganz anderer Ebene, lehrte Apollonios, aber das befreie nicht davon, sich für Alltagsgefallen verbunden zu zeigen. Marcus’ Dienste an ihm waren die heißen Tränen, die er um den Lehrer weinte, und die Vergünstigungen für dessen Sohn.8
Dank solcher Lektionen erwarb sich Marcus unter den Altersgenossen, die mit ihm lernten, Freunde, die ihm ein Leben lang verbunden blieben – die angehenden Senatoren Seius Fuscianus und Aufidius Victorinus, Frontos späteren Schwiegersohn, die er zu Consuln machte, und zwei junge Ritter, die für uns bloße Namen bleiben. Einige, hieß es, fielen „ihres Lebenswandels wegen“ für hohe Ämter aus, aber reich beschenkt wurden auch sie. So war es beste römische Tradition.9
Nichts wissen wir von Basilides von Skythopolis, wenig über Cinna Catulus, der dem Namen nach aus bestem Haus stammte; dieser habe gezeigt, dass Marcus selbst grundlose Klagen eines Freundes ernst nehmen müsse, habe ihm Kinderliebe – auch dies ein bleibender Charakterzug – und Dankbarkeit für die eigenen Lehrer vorgelebt. Weit prägender sollte Iunius Rusticus werden, „den er verehrte und dessen Jünger er war, der sich in Frieden und Krieg hervortat, grunderfahren in der stoischen Lehre“; Marcus machte Rusticus als Kaiser zum Stadtpräfekten und beriet sich in allen wichtigen Fragen mit ihm. Hier war jemand, der Politik und Philosophie vereinte – auf der Höhe der Zeit. Es hätte anders sein können: Rusticus stammte von jenen stoischen Oppositionellen ab, deren Konsequenz etwas Knirschendes haben konnte. Aber dieser Mann machte Marcus auf den unprätentiösen Epiktet aufmerksam und festigte die Ansicht des Erben, „der Besserung und Pflege meines Charakters zu bedürfen“. Frühere Kaiser hatten Rusticus’ Vater oder Großvater hingerichtet; jener, der nun heranwuchs, sollte dem Philosophen Statuen setzen.10
Rusticus’ Lektionen leuchteten Marcus meistens ein, so herb sie waren. Der lern- und lesebegierige Junge, dem Fronto alle Mittel der Rhetorik an die Hand gab, wurde konfrontiert mit vorsätzlich kunstlosen Briefen und einer Absage an den Eigenwert von Rhetorik, Dichtung und selbst der zeit- und standesüblichen geschliffenen Ausdrucksweise im Gespräch – das alles sah sich auf eine Ebene mit leerem Prunk gestellt. So wesensfremd, wie die Selbstbetrachtungen beteuern, blieben dem Caesar derartige sprachliche Möglichkeiten nicht. Ohne Vorbehalt dagegen folgte er der Einsicht, „die Verbesserung und Pflege meines Charakters zu benötigen“ – oder „zu wünschen“. Dazu gehöre nicht, so Rusticus, vor großem Publikum Applaus zu suchen und Wohltaten zu verteilen, und einst sollte Kaiser Marcus seine Freigebigkeit reichlich dosieren. Wichtiger sei die Bereitschaft, einem Schuldigen bei dessen erstem Wunsch nach Versöhnung sofort zu verzeihen – Marcus hörte es gut. Der Rat, sich so informiert wie möglich zu halten und einer pompös vorgetragenen Meinung nicht vorschnell beizustimmen, fand beim Sohn des übergenauen Antoninus offene Ohren. Dennoch war er für den imposanten Querkopf Rusticus kein bequemer Schüler. Es kam mehrmals dazu, dass Marcus gegen ihn aufgebracht war; erleichtert fand er später, dass er „nichts Unangemessenes tat, was ich jetzt bereuen müsste“, etwa offiziell die Freundschaft zu kündigen, und dass es bei heftigen Wortwechseln blieb, vielleicht über die von Rusticus eingeforderte Radikalität, die sich mit dem Vorbild Antoninus’ und anderer nicht vertrug.11
Zu diesen Vorbildern zählte Claudius Maximus, dessen Verdienste in den Selbstbetrachtungen vor denen des Adoptivvaters erscheinen. Maximus verkörperte für den jungen Marcus dieselbe Disposition: eine wie transparent wirkende Persönlichkeit, die nichts verbarg oder zu verbergen hatte, Gefühlswallungen und schlechte Tage, Selbstzweifel oder Ratlosigkeit nicht kannte, ganz Selbstbeherrschung, ganz Tatendrang ohne Unmut. „Und dass alle ihm zutrauten, dass er so dachte, wie er es sagte, und dass er, was er tat, nicht zum Bösen tat“ – der Kaiser formulierte wie häufig so, dass die Tugend sich vom Träger schier zu lösen schien und als Forderung vor dem Autor stand. „Und dass sich nie einer getrieben fühlte, sich von ihm niedrig eingeschätzt zu glauben, und auch nicht wagte, sich für besser als ihn zu halten; und die auf gute Art witzige Redeweise.“ Diese von Rusticus abgewertete urbanitas kehrte in Maximus wieder, der seinerseits wohl ein erfahrener Politiker und Militär gewesen war.12
Aber Marcus’ mit Abstand wichtigster Lehrer sprach aus dem Grab zu ihm. Die Worte und das Vorbild des Phrygers Epiktet, der es vom Sklaven eines mächtigen Freigelassenen Neros zum Meister eines weiten Schülerkreises angehender Stoiker aus den besten Häusern Roms gebracht hatte, füllten – wenn die Selbstbetrachtungen ein Maßstab sind – den Geist dieses postumen Schülers bis zum Überlaufen. Dass neben einer Kurzversion, dem berühmten „Handbüchlein“, wenigstens die erste Hälfte der von Arrian, dem Statthalter und Historiker, aufgezeichneten acht Bücher über Äußerungen von Epiktet überlebt hat, ist ein großes Glück, auch weil Marcus allein einen falschen Eindruck von ihm vermitteln könnte. Wie eine Alarmglocke verkündete der ärmlich lebende Phryger ins Leben seiner hochmögenden Zuhörer hinein die Botschaft, die er zu verkünden hatte, und machte sie so unbequem wie möglich: „Was könnte man denken, dass dir noch fehlt? Du bist reich, du hast Kinder, vielleicht auch eine Frau dazu, und viele Sklaven, der Kaiser kennt dich, du hast dir in Rom viele Freunde gemacht, du erledigst deine Amtspflichten. …Was fehlt dir noch? … Du weißt weder, was Gott ist, noch was der Mensch ist, noch was gut oder böse ist.“ Und noch nach jahrelangen Studien schlug er ihnen die Schulbankmentalität um die Ohren, die Weisheit wie Hausaufgaben und Unterrichtsstunden äußerlich abarbeiten zu wollen.13
Nicht zu Unrecht ist gesagt worden, längere Lektüre der Selbstbetrachtungen mache trübsinnig: Entsagung, Ernst, Aushalten und gelegentlich ein mitleidiges Lächeln für menschliche Eitelkeiten füllen die Seiten, vorgetragen im unerbittlich geduldigen Ton eines viel älteren Bruders oder Vaters; dazwischen mischt sich die etwas düstere Hoffnung auf ein Ende aller Mühen. So der Kaiser; ganz anders Epiktet, der Freigelassene. Mit einer robusten, bissigen Fröhlichkeit wirbt er für die Bekehrung seiner Umgebung zur allen natürlichen Vernunft, spießt Rückfälle und Absurditäten auf, spielt den Zuhörern den Unfug, den er beobachtet hat, und die möglichen Ernstfälle ihrer Gesinnung wie im Theater vor. Trocken konnte und wollte Epiktet die stoischen Klassiker nicht aufnehmen, denn ihn selber riss noch nach Jahrzehnten die Begeisterung über die innere Freiheit und das wahrhaftige Leben hin, zu denen er, selbst noch ein Sklave, als Schüler des Musonius Rufus gefunden hatte. Er sah sich im Dienst der einzigen Philosophie, die das Versprechen des Glücklichseins einlösen könne, und spürte sich mit leidenschaftlicher Liebe den Göttern verbunden – oder noch lieber dem einen, die Welt regierenden Gott oder auch einer in allem wirkenden Weltordnung; genug, dass er wusste, seine Liebe habe Ziel und Antwort. Epiktet machte sich den Spaß, im Schwung der Begeisterung das Schimpfwort „Sklave“ nach links und rechts zu verteilen; wer frei sein wollte, wusste ja, was er zu tun hatte. Geschenkt wurde dem, der sich ändern wollte, in dieser strahlenden, energischen Lehre nichts, im Gegenteil; seine Freiheit kam aus dem Verzicht. 14
Die Rigidität dieser gewinnenden Vorträge scheint Marcus, wenigstens als Erwachsenem, nicht einmal völlig gereicht zu haben. Einer der letzten Einträge der Selbstbetrachtungen lautet: „Auf welche Art verwendet die herrschende Vernunft sich selbst? Darin steckt nämlich alles. Das übrige, sei es Teil unserer Grundentscheidung oder nicht, ist Totes und Rauch.“ Die von Epiktet gelehrte „Grundentscheidung“ aber grenzte alles, worauf der Mensch Einfluss haben kann, als das einzig Wichtige von der Vielzahl gleichgültiger Dinge ab. An ihr hing definitionsgemäß das Lebensglück. Auch das also war Marcus nicht existentiell genug. Ein Glück außerhalb ständiger Aktivität gab es für ihn nicht mehr, ein Glück außerhalb seiner selbst schon gar nicht. „Grabe nach innen. Drinnen ist die Quelle des Guten, die sich immer zu Tage bringen lässt, wenn du immer gräbst.“ „Zieh dich in dich selbst zurück. Die lenkende Vernunft hat die Natureigenschaft, sich selbst genug zu sein, während sie das Richtige tut und eben dadurch die innere Ruhe hat.“15
Abb. 4: Der Caesar Marcus, gegen 150? (Neapel, Museo Nazionale Archeologico).
Selten hatte sich ein angehender Senator, geschweige denn ein künftiger Kaiser so tief in die Philosophie versenken dürfen wie dieser. „Und während er den Amtsgeschäften seines Vaters beiwohnte, um sich zur Lenkung der Staatsgeschäfte auszubilden, verfolgte er mit brennendem Eifer seine Studien“, so Marcus’ Vita. Die Ergebnisse waren dazu angetan, alle Vorurteile der traditionellen römischen Erziehung zu bestätigen. Derselbe, der Tischsitten und öffentliche Erwartungen mit Füßen trat, schoss im Anspruch, wie er äußerlich zu erscheinen habe, über jede Norm hinaus, die in der Zeit vor dem statuenhaften Kaiserbild der Spätantike galt. „Auch der Körper muss fest werden und darf sich nicht zerstreuen, ob in Bewegung oder im Anhalten. Denn wie sich im Gesicht etwas von der Vernunft zeigt, die es verständig und wohlgestalt erhält, dergleichen ist auch vom Körper insgesamt zu verlangen. Das alles ist aber in ungezwungener Weise zu beachten“ – sosehr es Zwangscharakter hatte, er durfte sich nicht zeigen. Das alles schien ein abgehärtetes, einsames Leben anzustreben, wie es Epiktet an den kynischen Philosophen voll Bewunderung beschrieben hatte. Doch wimmelte jenes Loblied von Warnungen, wie tragikomisch ein sozial eingebundener Möchtegern-Kyniker mit seinem groben Mantel und hartem Bett dastehen müsse, und das ostentative Wassertrinken, „nur um Wasser zu trinken“, war schon gar nicht Epiktets Fall.16
Mit dem Essen, besonders wenn es reichlich oder regelmäßig sein sollte, würde Marcus zeitlebens kämpfen; als Beispiele körperlichen Leidens nannte er in späteren Jahren „Übermüdung, Fieberhitze und Appetitlosigkeit“. In Verbindung mit der merkwürdigen Härte, die er gegenüber eigenen Anforderungen – vor allem denen des Körpers – an den Tag legte, ähnelt sein Verhalten etwa seit dem elften Jahr, als er demonstrativ im groben Gewand leben und auf dem nackten Boden schlafen wollte, gewissen Auffälligkeiten der Moderne. Ferndiagnosen, erst recht von Laien über fast 1900 Jahre hinweg, sind bedrohlich fehleranfällig und schon angesichts unserer miserablen Kenntnisse vom Innenleben antiker Kinder und Jugendlicher verbietet es sich, Krankheitsmerkmale heutiger Befunde oder Theorien in die Quellen hineinzulesen. Dennoch lohnt es sich, das lebenslange Dilemma, wie wichtig Marcus es nahm, dass alle Belange seines Körpers unwichtig seien, und vor allem seine karge Ernährung näher zu überprüfen. Man wird ihn im modernen Sinne chronisch essgestört nennen dürfen.17
Was heutige Magersüchtige, Extremfälle solchen Leidens – unter denen Jungen nicht fehlen – auszeichnet, zeigt manche Parallelen zu Marc Aurel: das Demonstrative und dabei langfristig Selbstzerstörerische des Verhaltens; die Ablehnung des eigenen Körpers mit Versuchen, dessen Triebansprüche zu beherrschen und zu übertönen; die hypnotische, machtvolle Wirkung der Entsagung als Erfolgserlebnis, gelegentlich sogar verbunden mit dem Gefühl einer „höheren, überlegenen Erkenntnis“, der Einsamkeit inmitten „ihres Willens zum Leben wegen“ primitiver Menschen, denen der Asket gleichwohl Gutes tun will. Hinter solchem Verhalten steht das Kalkül, an jemanden, der sich selbst unter jedes Minimum reduziert, könne niemand mehr Ansprüche stellen, und wer sich alles verweigere, sei über jeden denkbaren Vorwurf erhaben. Das essgestörte Kind kontrolliert seinen Körper, um sich – wohl aus Angst vor einer Auslieferung an äußere Mächte – zu beweisen, dass es sein Leben doch selbst in der Hand hält. Hauptsächlich gilt das paradoxe Kontrollbedürfnis dem Hunger, ist er ja der Appetit schlechthin; die Sexualität verfällt ebenso der Ablehnung, weil sie dem Anspruch, niemanden zu benötigen, zuwiderläuft. Therapeuten diagnostizieren eine starke nach innen gerichtete Aggression und unterstellen eine subjektive Überforderung im Verhältnis des Jugendlichen zu seiner Familie. Im Idealfall gelingt am Ende die Akzeptanz der eigenen Unvollkommenheit und des Bedürfnisses nach Genuss. Für nicht geheilte Fälle typischer ist die soziale Vereinsamung, die depressiv stimmt und zur Aufbesserung des Selbstwertgefühls immer neue, suchtartige Diätschübe auslösen kann.18
Die Auslöser heutiger Essstörungen sind wie diese selbst so vielfältig, dass jeder Versuch einer Festlegung rein spekulativ bleibt. Allein in der Aufzählung einer betroffenen Mutter träfen auf Marcus neben dem Tod eines Verwandten die Trennung von Geschwistern, ein Wohnungswechsel und Wechsel der Hausgemeinschaft wie auch das Ende der elterlichen Ehe zu; der Verlust des Vaters ist nur der augenfälligste Kandidat. Marcus’ eigene Belastbarkeit, seine Erziehung, seine Folgsamkeit und Willensstärke oder -schwäche sind lauter wesentliche und unbekannte Größen. Moderne Essgestörte sind häufig überangepasste, scheinbar problemlose Kinder, die mit sich unzufrieden sind; vielfach begünstigt Perfektionismus und das Gefühl, versagt zu haben, den Ausbruch der Krankheit. Bei Jungen vermutet man eine überstarke Identifikation mit ihrer Mutter und das Ringen mit ihr – die asketischen Schlafwünsche, über die Domitia Lucilla mit ihrem Sohn verhandelte, kämen als Teil einer solchen verdeckten Rebellion infrage, schon wegen der hohen Energie, mit der Marcus sie von Anfang an verfolgte. Für die spätere, als schwächlich gewertete Konstitution könnte dasselbe gelten: „Aus Nahrungsmangel“, so schilderte noch Julian den vergöttlichten Leib Marc Aurels, „war sein Körper äußerst durchscheinend und durchsichtig wie reinstes, klarstes Licht.“ Allerdings verzichtete Marcus auf Sport als Mittel, sein Gewicht zu senken. Ein typisches Verhalten hingegen, die seelische ‚Diät‘, sich bedrohliche Gefühle zu untersagen – Aggression ebenso wie Lust – lässt sich quer durch die Biographie des künftigen Kaisers verfolgen.19
Sprechend könnte eine Bemerkung sein, die dem Erwachsenen in seinen Dank an die Götter einfloss. Nicht nur verriet er Freude, dass er stets reich genug gewesen war, Bedürftigen zu helfen – was mit Sicherheit nur Mitglieder der oberen Stände meint –, sondern auch darüber, „dass mich selbst ein solcher Mangel, etwas von einem anderen annehmen zu müssen, nie getroffen hat“. Diese Dankbarkeit für eine materiell gesicherte Existenz – samt der dahinter lauernden Angst vor Erniedrigung – klingt so authentisch, wie sie der reinen stoischen Lehre zuwiderlief, und so bereitwillig die Selbstbetrachtungen Epiktets abschätzige Verkleinerungsform „das bisschen Körper“ für den Angelpunkt von Marcus’ Ängsten übernahmen, kein einziges Mal erscheint „das bisschen Besitz“, das Epiktet fast ebenso häufig aussprach.20
Marcus’ zurückhaltender Ernst bildete nur eine erste Schicht, hinter der sich in jenen Jahren rasche und erstaunliche Wandlungen vollzogen. Ein kostbares Zufallszeugnis ist der Briefwechsel mit seinem lateinischen Rhetoriklehrer Fronto, einem der gefragtesten Anwälte Roms und ehemaligen Consul. Nach dem sensationellen Fund bald nach 1800 stellte sich Enttäuschung ein – es steckte wenig hohe Politik darin, nicht einmal Kultur, mehr Hausaufgaben, das Lob von Lieblingsautoren, Höflichkeitsbriefe aus den Ferien oder einer Sitzung. Es fällt daher leicht, das Aufschlussreiche daran zu übersehen.
Fronto war nur einer von mehreren Lehrern des Jugendlichen. Zweifellos gab es mit den übrigen vergleichbare, etwas verhaltenere Korrespondenzen, der Hausaufgaben wegen und aus Höflichkeit. Marcus wollte kaum je ohne Vorbehalt sein Herz ausschütten, doch sich mitteilen wollte er. Mochten die Antworten der Lehrer überzogene Schmeicheleien enthalten, sein eigenes Schreiben war Bestätigung für ihn. Darauf deutet bei aller Vorsicht Frontos Lob für Marcus’ Gewandtheit hin, seine Erlebnisse in eigene Worte zu kleiden, und das Vergnügen des Prinzen, wie geheißen nach dem überraschenden Ausdruck zu suchen. Ob er sich nun in der eigenen Sprache eine Welt erschuf oder ein Versteck, die freie Verfügung über sie war in dieser Zeit des strukturierten Wortes eine soziale wie eine private Notwendigkeit.
Zum Zeitstil gehörte der Humor, spätestens seit Ciceros Briefen ein geschätztes Element der Privatkorrespondenz. Marcus übte sich darin, Esprit in zwei Sprachen zu verraten; auf Kosten der senatorischen, erst recht der kaiserlichen Würde sollte dies dem Stilideal zufolge aber auch nicht gehen. Gefordert war eine distanzierte Nähe, gelöst, aber weltverbunden, zugänglich, nicht zudringlich. Dafür, dass es Marcus zum Weltbewegenden und Tiefernsten zog, meisterte er dies ausgezeichnet, doch sollte der Kaiser den Briefton gegenüber den meisten Adressaten noch um einiges hinter die ruhige Diktion eines Antoninus zurücknehmen. In der Korrespondenz mit Fronto aber brachen zeitweise ganz andere Töne durch. Kurz nachdem sie die gemeinsamen Studien aufgenommen hatten, begann Marcus schwärmerische Leidenschaft für seinen Rhetoriklehrer zu äußern. Seine Briefe legten Fronto das Herz zu Füßen: „Ich aber, ich weiß nicht, wo mein Mut geblieben ist“, schrieb er dem fernen Erkrankten; „nur das weiß ich, er hat sich zu Dir auf den Weg gemacht – ich weiß nicht, wohin.“ All das in wohlkomponierter Form, Mal um Mal.21
Die Gelassenheit wie die Liebesbeteuerungen der Fronto-Briefe geben uns schwere Deutungsarbeit auf. Wie Frontos Wortwahl für andere Freundschaften zeigt, war Überschwang damals guter Ton, einschließlich immer neuer Variationen von „lieben“ und seinesgleichen. So hatte Marcus den Vorteil, in die ausufernden Anreden der Zeit – „mein Teuerster, mein bester Freund Fronto“, „bester Freund, Ausnahmemensch, liebster Lehrer“ – unmerklich den vollen Ernst eines verliebten Jugendlichen zu legen, wenn er wollte; dabei kann er nach Niederschrift sogar der gefasstesten, lockersten Passagen immer noch die Nächte durchweint haben. Die Einsamkeit mit seinen Gefühlen und innersten Gedanken hatte er früh gelernt.22
Nicht allein er war in einer bedauernswerten Lage. Fronto hing mit Vater- und Lehrergefühlen an seinem künftigen Herrscher, beide verheiratete Leute. Zu mehr als den unter Freunden und Standesgenossen obligaten Küssen würde es nie kommen, doch wie sollte er den Caesar hindern, mit etwas herauszuplatzen, das später zwischen ihnen stehen würde? Wie ihn andererseits zurückstoßen? Und wenn der Hauptstadtklatsch eine Zweideutigkeit ihrer Beziehung aufspießte, würde Antoninus sich sein eigenes Urteil über Frontos Diskretion und Schonung bilden – und eines Tages der Kaiser Marcus auch. Grund genug, um als Objekt solcher Liebe nicht nur geschmeichelt zu sein.23
Nach dem Zeugnis der Briefe setzte Fronto darauf, dass die Not eines Tages von selbst enden werde. Den ohnehin ‚liebevollen‘ Briefstil nahm er nicht zurück, ließ aber in Adressen wie „meinem Herrn“, domino meo, den Abstand zwischen beiden einfließen: Marcus blieb der Schüler – und zugleich der Ranghöhere. Über die Konvention mit ihren Superlativen hinaus gab es wenig Nahrung für Leidenschaft; er sei schon erobert, suggerierte Fronto, um sich eben dadurch der Falle zu entziehen, mit der Zeit auf Anfrage immer mehr Gefühle bekennen zu müssen – er spendete viel Lob, aber nicht die ersehnte Liebe. So schonend diese Methode sich ausnimmt, sie wirkte auf einen verletzlichen Jugendlichen zweifellos als Enttäuschung, vielleicht als Kälte. In den Selbstbetrachtungen fehlt die ganze Episode natürlich, schon wegen Marcus’ Abkehr von seiner eigenen Schwärmerei für einen Mann, ein Zug, der ihm später wesensfremd erschien. Bald sollte der Tag kommen, an dem der junge Caesar mit dem, wofür der Rhetor stand, brach, und hierzu war ein Vorwurf, begründet oder nicht, sehr willkommen. Radikalkritik als Instrument der Selbstfindung Jugendlicher trifft heutzutage hauptsächlich die Eltern; wo das nicht möglich ist, kann und konnte eine ältere Autoritäts- und Vertrauensperson als Stellvertreter dienen. Solche Idole sind nun einmal Werkzeug; am Ende ihrer Brauchbarkeit werden sie teilweise oder vollständig verabschiedet, so nützlich und nötig ihre Strahlkraft war.24
Fronto reagierte wünschenswert heftig auf das erste Signal – als der Thronfolger dem Rhetor anscheinend und nicht ganz originell erklärte, laut Platon sei die Redekunst eine ethisch minderwertige, weil dem Missbrauch offene Angelegenheit und die Philosophie stehe höher. Frontos erhaltene Replik weist verletzt darauf hin, ohne Einkleidung argumentierten nur die gröbsten Klötze und sicher nicht der große Wortkünstler Platon selber oder doch sein Sokrates. Das richtige Mittel zum richtigen Zweck sei gefordert. „Darum handelt es sich eigentlich bei dem, was Du für Heimlichtuerei, für unaufrichtig, für leisetreterisch, für wahrer Freundschaft völlig unangemessen hältst.“25
Endgültig blieb an diesem Favoritensturz die bekräftigte Wahl der längst gefundenen Richtschnur, der Philosophie. Als Lehrer und als Freund hatte Fronto noch viel zu geben und tat es auch; die Zuneigung, die ihm erwidert wurde, war aufrichtig. Aber dem, wofür er stand, einen mehr als nur ‚beruflich‘ nötigen Platz unter Marcus’ Prioritäten zu erkämpfen vermochte er nicht. Sein Hauptgegner in diesem Ringen hieß mit aller Wahrscheinlichkeit Rusticus, zu dessen bleibendem Vermächtnis der angehende Philosophenherrscher die Aversion dagegen, „ermahnende Schwatzreden zu halten“, ebenso zählte wie „das Abstehen von Rhetorik, Dichtung und geschliffener Redeweise“, forciert einfache Briefe und „die Ansicht der leer Daherredenden nicht so schnell zu teilen“. Dies war das Dogma; mit dem zurückgesetzten Fronto wird man finden, dass der Nacheiferer Epiktets durchaus mit einigen Tropfen rhetorischen Öls gesalbt war und in seiner Schlichtheit ganz kunstvoll wirkte. Übrigens hatte der Meister das radikale Entwerten der Redegabe als Feigheit gebrandmarkt. Als bleibende Lehre Frontos bezeichneten die Selbstbetrachtungen lediglich, „wie tyrannisch der Neid, die Undurchschaubarkeit und die Verstellung sind“, eventuell ein Rückblick auf Frontos düsteres Bild vom Adoptivgroßvater Hadrian, „und dass meistens die bei uns so genannten Patrizier reichlich lieblos sind“.26
Marcus’ Platon-Anleihe gegen Fronto speiste sich aus gründlichem Wissen. Sextus von Chaironeia, der hochgelehrte Neffe des großen Plutarch, brachte ihm das platonische System mit gedanklicher Klarheit nahe und verkörperte zugleich jene bedingungslose Umgänglichkeit mit den schwierigsten Zeitgenossen, die Marcus an seinem Ersatzvater Antoninus liebte und bewunderte. Diese Haltung, hinter der ein anhänglicher Charakter auf Freundschaften wartete, war für Marcus’ Denken der Inbegriff jenes „Lebens in Übereinstimmung mit der Natur“, das die Stoa zu lehren versprach. Auf ähnliche Weise wurde Claudius Severus zum Exempel, der Marcus im Alter nicht so weit voraus war wie andere: Der Politiker aus kleinasiatischer Familie mit besten Beziehungen, der es 146 zum Consul brachte, war zugleich Anhänger des Aristoteles – sein Sohn, auch er philosophisch interessiert, sollte eines Tages Marcus’ Tochter heiraten. Stärker als die Lehren des Peripatos prägte sich Severus’ Gesprächspartner dessen Hang zu unbedingter Konsequenz ein, sei es auch um den Preis eines Streits mit Freunden – oder des Lebens. Auffälligerweise waren es unter den Vorbildern dafür wieder die Stoiker, der jüngere Cato, der Caesarmörder Brutus und die Radikaloppositionellen der letzten Generationen, Thrasea Paetus und Helvidius Priscus, die Marcus im Gedächtnis behielt; alles führte ihn letzten Endes zu ‚seiner‘ Philosophie zurück. Sie – oder er – war zu stark, um sich andere Einflüsse nicht unterzuordnen und dienstbar zu machen, wenngleich dankbar.27
Umgekehrt schreckte er nicht davor zurück, die tradierte Lehre abzuändern. Die klassische und mittlere Stoa hatten die Natur des Menschen zwischen Körper und vernünftigem Geist zweigeteilt gesehen, Epiktet hatte nochmals eingeschärft, dass man nichts auf der Welt zu fürchten habe als die Irrtümer aus dem eigenen Innern. In Marcus’ Selbstbetrachtungen jedoch begegnen nun drei Bestandteile: Körper (sōma), Seele (psychē) und Geist (noũs, lógos). Die Indizien sind stark, dass dies seiner Selbstwahrnehmung entsprach; weitreichend sind die Folgerungen. Der Intellekt, der den Göttern und ihrer Lehre gegenüber offen war, hatte nun statt nur eines Untergebenen und potentiellen Gegners gleich zwei, und die Widerstände der Seele, bei der Angst, Zweifel und zahlreiche weitere Gefühle angesiedelt waren, musste er mehr fürchten als die wenigstens stummen Triebe und Ansprüche des Körpers allein. Noch gab es die Neuplatoniker und die Gnosis nicht, die den Verstand überhaupt als etwas in den Körper Versprengtes behandeln würden, aber Marcus – dessen Schrift diese Denker hochschätzen sollten – hätte ihr zugespitztes Modell sehr gut verstanden, das den Körper zum Grab, den Geist zum gottgesandten Retter der Seele machte, die in der Materie festklebte, von deren Feindseligkeit förmlich infiziert. Und aus der Zukunft drohte dem gespaltenen Ich weiteres Unheil, wenn es nicht jederzeit weit vorausblickte: „Betrachte niemals je das als nützlich für dich, was dich einmal zwingen wird, dein Wort zu brechen, deine Scham fahrenzulassen, jemanden zu hassen, zu beargwöhnen, zu verwünschen, ihm etwas vorzuspielen, nach etwas zu verlangen, für das es Wände und Vorhänge braucht.“ Nichts als innere Klarheit und Transparenz, ständige Arbeit an sich konnte das sichern.28
Ein eigenwilliger, aber seinen Mitmenschen angenehmer Charakter stand am Ende dieser Selbstbildung, soweit sie je zu Ende war. Ernst war weiterhin das Wort, das den Späteren für den ganzen Menschen Marc Aurel stand, aber sie bestanden darauf, es sei respektheischender Ernst im besten römischen Sinn, gravitas, ohne dunkle Schatten gewesen, so wenig man den fertigen Marcus je Späße machen hörte. Zugänglich sei er weiterhin geblieben, dazu „geradlinig ohne etwas Brüskierendes, zurückhaltend ohne Menschenscheu, ohne Finsternis ernsthaft“. Als er ins Licht der Öffentlichkeit trat, schien er fertig entwickelt und bereit für den erstaunlichen Kraftakt, dass er „alle Tage seines Lebens der gleiche war und sich in keiner Weise änderte“.29