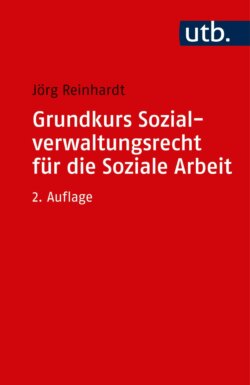Читать книгу Grundkurs Sozialverwaltungsrecht für die Soziale Arbeit - Jörg Reinhardt - Страница 9
Оглавление1 Grundbegriffe
1.1 Verwaltung
Die Verwaltung ist die Exekutive im Sinne der klassischen Staatstheorie, die von den drei Staatsgewalten Legislative (Gesetzgebung), Judikative (Rechtsprechung) und eben der Exekutive (Verwaltung) ausgeht. Aufgabe der Verwaltung ist der Vollzug und die Durchsetzung der Gesetze.
Da das staatliche und gesellschaftliche Zusammenleben in nahezu allen Bereichen durch normative Regelungen geordnet ist, sind die staatlichen und kommunalen Behörden mit der Umsetzung von Bestimmungen aus den verschiedensten Rechts- und Lebensbereichen befasst. Diese reichen vom Baurecht über das Arzneimittel- und Polizeirecht bis hin zum Sozialhilfe- oder Straßenverkehrsrecht.
Angesichts dieser enormen Aufgabenvielfalt wird grundsätzlich unterschieden zwischen der Leistungsverwaltung und der Eingriffsverwaltung: Die Eingriffsverwaltung dient der Durchsetzung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, indem sie Bürgerinnen und Bürgern konkrete Verhaltensvorgaben macht (z. B. eine bestimmte Art des Bauens vorschreibt, Demonstrationen untersagt, Lärmschutzauflagen durchsetzt etc.) und damit zwangsläufig hoheitlich, d. h. „von oben“, in die Rechts- und Freiheitssphäre der Bürger eingreift.
Beispiele
Weitere Beispiele für die Eingriffsverwaltung sind polizeiliche Maßnahmen (z. B. ein Platzverweis, die Ingewahrsamnahme oder die Feststellung von Personalien); ordnungs- und sicherheitspolitische Schutzmaßnahmen (z. B. Baustopps, Badeverbote, Gewerbeuntersagungen); ausländerrechtliche Maßnahmen (z. B. Ausweisung, Abschiebung) oder eingreifende Jugendhilfemaßnahmen (z. B. Inobhutnahme, Heim- und KiTa-Aufsicht).
Die Verwaltung hat aber nicht nur den Auftrag zur Durchsetzung von Regeln und Verboten, sondern sie erbringt auch verschiedenste Leistungen für die Bürgerinnen und Bürger. Diesen Teilbereich behördlicher Aufgaben bezeichnet man als Leistungsverwaltung.
Beispiele
Beispiele für die Leistungsverwaltung sind die Wasser- und Elektrizitätsversorgung; Müllabfuhr; Krankenhausversorgung; Förderung kultureller und sportlicher Angebote; familienpolitische Leistungen; öffentlicher Personennahverkehr; Kindertagesbetreuung; Versorgung mit Schulen und Hochschulen; Wirtschaftsförderung; Arbeitsförderung; Grundsicherung; Sozialhilfe etc.
Die Sozialverwaltung hat den Auftrag zur Umsetzung der sozialen Leistungsgesetze, d. h. der zwölf Bücher des SGB und der zugehörigen Gesetze nach § 68 SGB I. Sie ist damit „klassische“ Leistungsverwaltung, denn sie erbringt gemäß § 11 SGB I Sozialleistungen in der Form von Dienstleistungen (z. B. Arbeitsvermittlung, Erziehungsberatung), Sachleistungen (z. B. Hilfsmittel für kranke und behinderte Menschen) und Geldleistungen (z. B. Grundsicherung, Unterhaltsvorschuss, Elterngeld, BAföG oder Opferentschädigungsrenten).
1.2 Verwaltungsrecht
Das Verwaltungsrecht regelt die hoheitliche Tätigkeit der öffentlichen Verwaltung gegenüber dem Bürger. Es ist deshalb – neben dem Staatsorganisations- und Verfassungsrecht sowie dem Strafrecht – Teil des öffentlichen Rechts. Hoheitliche Tätigkeit bedeutet dabei nicht zwingend, dass eine Behörde nur eingreifende Maßnahmen trifft: Auch die Entscheidung über Leistungen ist hoheitlich, denn auch die Leistungsverwaltung erfüllt staatliche Aufgaben in einem Über- / Unterordnungsverhältnis gegenüber dem Bürger (Kap. 3.1). Damit gehört auch die Leistungsverwaltung zum öffentlichen Recht.
Innerhalb des weiten Feldes des Verwaltungsrechts unterscheidet man das allgemeine Verwaltungsrecht (Kap. 1.2.1) und das besondere Verwaltungsrecht (Kap. 1.2.2).
1.2.1 Allgemeines Verwaltungsrecht
Für die hoheitliche Tätigkeit der Verwaltung gelten bestimmte, letztlich auf das Rechtsstaatsprinzip zurückgehende Grundsätze, die von so grundlegender Bedeutung sind, dass sie für alle Verwaltungsbereiche in gleicher Weise gelten müssen. Diese Grundsätze sind Gegenstand des allgemeinen Verwaltungsrechts. Hierzu gehören etwa der Gleichbehandlungsgrundsatz und das Willkürverbot (Art. 3 GG), aber auch grundlegende Vorgaben für ein faires und rechtsstaatliches Verwaltungshandeln wie das Recht des Bürgers, vor negativen Verwaltungsentscheidungen angehört zu werden. Zudem sind zentrale Begriffe (z. B. die Definition des Verwaltungsakts und des öffentlich-rechtlichen Vertrags) sowie elementare Verfahrensfragen (etwa diejenige, ob auch Minderjährige oder juristische Personen Anträge stellen und an einem Verwaltungsverfahren beteiligt sein können) im allgemeinen Verwaltungsrecht geregelt.
Die Verfahrensvorgaben des allgemeinen Verwaltungsrechts, die von den Bundesbehörden (z. B. dem Zoll oder der Bundespolizei) zu beachten sind, sind bundesrechtlich geregelt, nämlich im Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG), dem Verwaltungszustellungsgesetz (VwZG) und dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz (VwVG) des Bundes. Im Bereich der Landesbehörden und der Kommunen haben dagegen die Länder die Organisationshoheit (Art. 83 GG). Diese haben deshalb eigene Landesverwaltungsverfahrensgesetze (z. B. in Bayern das Bayerische Verwaltungsverfahrensgesetz, in Nordrhein-Westfalen das VwVfG NRW, in Thüringen das Thüringer Verwaltungsverfahrensgesetz) sowie landesrechtliche Regelungen zur Zustellung von Schriftstücken und der zwangsweisen Durchsetzung von Regelungen erlassen (z. B. das Bayerische oder das Thüringer Verwaltungszustellungs- und Vollstreckungsgesetz; in Nordrhein-Westfalen das dortige Landeszustellungsgesetz und das VwVG NRW). In diesen Landesgesetzen ist das allgemeine Verwaltungsrecht für die Behörden der Länder und der Kommunen geregelt.
Für die Anwendung des Bundes- oder Landesverwaltungsverfahrensrechts kommt es also nicht darauf an, ob ein Bundes- oder ein Landesgesetz vollzogen wird; entscheidend ist ausschließlich, ob eine Bundes- oder eine Landesbehörde tätig wird!
Beispiele
Wird der Zoll tätig, dann ergeben sich die allgemeinen Bestimmungen zum Verfahren aus dem Verwaltungsverfahrensgesetz des Bundes (VwVfG), denn die Zollbehörden sind Bundesbehörden. Die Zustellung von Bescheiden hat gemäß dem Verwaltungszustellungsgesetz (VwZG) und die Vollstreckung, also die Durchsetzung von Regelungen der Zollbehörden, nach dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz (VwVG) des Bundes zu erfolgen. Handelt dagegen eine Landes- oder eine Kommunalbehörde (etwa die Ausländerbehörde, das Bauamt, die Polizei oder das Ordnungsamt), dann hat diese die allgemeinen Verwaltungsgesetze des Landes zu beachten, in Bayern also das Bayerische Verwaltungsverfahrensgesetz sowie das Bayerische Verwaltungszustellungs- und Vollstreckungsgesetz.
1.2.2 Besonderes Verwaltungsrecht
Da die Verwaltung höchst unterschiedliche Tätigkeitsfelder abzudecken hat, benötigt sie bereichsspezifisch unterschiedlich ausgestaltete Verfahren, um jeweils auf sinnvollem Wege zu praktikablen Ergebnissen zu kommen. Naturgemäß werden für eine erfolgreiche polizeiliche Tätigkeit andere Verfahrensbestimmungen sinnvoll sein als für das Pflegekinderwesen, das Baurecht oder die Krankenhausplanung. Würden alle Verwaltungsbereiche nach denselben Kriterien arbeiten, wären häufig kaum passgerechte Verfahren zu erwarten. Daher gibt es eine Vielzahl von Gesetzen mit fachspezifischen Sondervorschriften und Spezialregelungen, die nur für bestimmte, abgegrenzte Verwaltungsbereiche gelten. Diese Sondervorschriften sind niedergelegt im besonderen Verwaltungsrecht.
Beispiele
Beispiele für Vorschriften des besonderen Verwaltungsrechts sind etwa die Bestimmungen im Zusammenhang mit der Erteilung einer Baugenehmigung in den Baugesetzen des Bundes und der Länder, die Voraussetzungen für die Niederlassungserlaubnis eines Ausländers nach dem AufenthG, die Regelungen über lebensmittelrechtliche Verbote oder die Zulassung von Arzneimitteln im Arzneimittelrecht.
Gemäß dem juristischen Grundsatz „lex specialis vor lex generalis“ geht das besondere Verwaltungsrecht dem allgemeinen Verwaltungsrecht vor. Bei der Gesetzesanwendung ist daher zunächst immer zu überlegen, ob für einen konkreten Fall spezialgesetzliche Bestimmungen existieren. Ist dies der Fall, dann hat die Verwaltung diese zu berücksichtigen. Gibt es dagegen keine Sonderregelungen, dann (und nur dann!) darf die Verwaltung auf die Bestimmungen des allgemeinen Verwaltungsrechts zurückgreifen.
Übersicht 1
Allgemeines und besonderes Verwaltungsrecht
Beispiel
Das Gaststättengesetz ermöglicht, dass jederzeit Auflagen zum Schutz von Gästen, in der Gaststätte Beschäftigten oder Anwohnern getroffen werden können (§ 5 GastG). Diese Regelung ist vorrangig gegenüber der allgemeinen Möglichkeit im jeweiligen Landesverwaltungsverfahrensgesetz, Auflagen zu erlassen (z. B. Art. 36 BayVwVfG).
1.3 Sozialverwaltungsrecht
Das Sozialrecht ist derjenige Teil des (Leistungs-)Verwaltungsrechts, welcher die Sozialleistungen regelt (§ 1 Abs. 1 SGB I). Es ist gesondert von den übrigen die Verwaltung betreffenden Gesetzen im Sozialgesetzbuch und dessen Nebengesetzen (das sind alle in § 68 SGB I genannten Gesetze) niedergelegt. Das Sozialverwaltungsrecht regelt die hoheitliche Tätigkeit der Sozialbehörden. Das sind die Behörden, die das SGB und seine Nebengesetze vollziehen. Auch im Sozialrecht unterscheidet man allgemeines und besonderes Sozialverwaltungsrecht.
1.3.1 Allgemeines Sozialverwaltungsrecht
Das allgemeine Sozialverwaltungsrecht und das Sozialverwaltungsverfahren sind vor allem im SGB X geregelt; wichtige allgemeine Grundsätze (z. B. behördliche Auskunfts- und Beratungspflichten oder Mitwirkungspflichten von Antragstellern) finden sich aber auch im SGB I. Die Vorschriften des Sozialverwaltungsrechts gelten dabei unabhängig davon, ob eine Sozialleistung durch eine Bundesbehörde oder die Landessozialbehörden erbracht wird (die nach § 1 Abs. 1 S. 2 SGB X erforderliche Anwendbarkeitserklärung ist für alle wichtigen Bereiche des Sozialrechts erfolgt).
Zu sehen ist aber, dass das Landesrecht ergänzende Vorschriften zum Sozialverwaltungsrecht enthalten kann. Das Bundesrecht verweist an einigen Stellen sogar ausdrücklich auf die gesetzlichen Bestimmungen der Länder, etwa bei der Bestimmung der zuständigen Leistungsträger für das Wohngeld (§ 26 Abs. 2 SGB I) und die Jugendhilfe (§ 27 Abs. 2 SGB I), der Kindertagesbetreuung (§ 26 SGB VIII) oder beim Schutz von Kindern und Jugendlichen, die (teil-)stationär außerhalb der eigenen Familie betreut werden (§ 49 SGB VIII). In den einzelnen Bundesländern finden sich die entsprechenden landesrechtlichen Bestimmungen vor allem in deren Ausführungsgesetzen zum Sozialgesetzbuch.
Beispiele
In Bayern gibt es ein Gesetz zur Ausführung des Sozialgesetzbuchs (AGSG). Andere Bundesländer haben zu einzelnen Büchern des SGB jeweils gesonderte Ausführungsgesetze erlassen, z. B. das hessische Ausführungsgesetz zum SGB XII (HAG-SGB XII), das Landesausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern zum SGB II (AG-SGB II) oder das Bremische Gesetz zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (BremAGKJHG).
Aus dem Föderalismus können sich somit auch im Bereich des Sozialrechts gewisse – meist nur geringfügige! – Unterschiede in den einzelnen Bundesländern ergeben.
Abgesehen von den landesspezifischen Zuständigkeitsregelungen und einigen Bestimmungen des SGB I sind die Verfahrensregelungen im allgemeinen Verwaltungsrecht des Bundes, der einzelnen Länder sowie im SGB X aber weitgehend identisch.
1.3.2 Besonderes Sozialverwaltungsrecht
Die fachbereichsspezifischen Sondervorschriften und Spezialregelungen, die nur in Bezug auf einzelne Sozialleistungen gelten, finden sich in den Büchern II bis IX und XI bis XII des SGB sowie in den in § 68 SGB I genannten Nebengesetzen (z. B. dem BAföG, dem Wohngeldgesetz, dem Adoptionsvermittlungsgesetz etc.).
Beispiele
Bspw. sind die einzelnen Leistungen der Kranken- und Pflegeversicherung, die Voraussetzungen für eine KiTa-Betriebserlaubnis nach dem SGB VIII, die Regelungen zur Feststellung des Pflegegrades oder einer Behinderung etc. zum besonderen Sozialverwaltungsrecht zu rechnen.
Aus diesen Gesetzen können sich besondere Bestimmungen für das Verfahren ergeben (z. B. Regelungen zur Zuständigkeit von Behörden, Schriftformerfordernisse für Anträge oder besondere Mitwirkungspflichten von Antragstellern). Diese Sonderregeln gehen den allgemeinen Bestimmungen des SGB X und des SGB I vor (§ 37 SGB I).
Beispiele
• Nach § 6 Abs. 2 S. 2 i. V. m. Abs. 1 S. 1 SGB VIII kann das Jugendamt ein ausländisches Kind in Obhut nehmen, wenn es sich tatsächlich in Deutschland aufhält. Diese Sonderregelung verdrängt die allgemeine Regelung in § 30 SGB I, wonach die Vorschriften des SGB an sich nur anwendbar sind, wenn Ausländer ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland haben.
• Es stellt sich die Frage, ob und in welcher Form ein BAföG-Antrag zu stellen ist. Der Grundsatz im allgemeinen Verwaltungsrecht (§ 18 SGB X) lautet, dass die Verwaltung „von Amts wegen“ tätig wird, also ohne dass ein Antrag erforderlich ist. Zudem gilt der Grundsatz der Formfreiheit (§ 9 SGB X). Für die Ausbildungsförderung gibt es jedoch besondere Bestimmungen im BAföG und somit in einem Sondergesetz des besonderen Verwaltungsrechts: Laut § 46 Abs. 1 S. 1 BAföG setzt die Leistung einen Antrag voraus, der in schriftlicher Form zu stellen ist. Da das BAföG dem allgemeinen Verwaltungsrecht vorgeht (§ 37 SGB I), sind §§ 9 und 18 SGB X nicht anwendbar; es ist ein schriftlicher Antrag erforderlich.
Auch das SGB IV enthält allgemeine Vorschriften. Da diese jedoch ausschließlich für die Sozialversicherung gelten (§ 1 Abs. 1 SGB IV), ist das SGB IV im Vergleich zum SGB I und dem SGB X als „fachspezifisch“ und damit als Teil des besonderen Sozialverwaltungsrechts einzuordnen.
Eine besondere Rolle im System der einzelnen Bücher des SGB spielt darüber hinaus das SGB IX. Dieses enthält erst seit 2018 spezielle Sozialleistungen für behinderte und chronisch kranke Menschen. Es sieht aber auch einige besondere Verfahrensregelungen vor, etwa in Bezug auf die Zuständigkeitsklärung (§ 14 SGB IX) oder die Bewilligung eines persönlichen Budgets (§ 29 SGB IX).
Die einzelnen Bereiche des Verwaltungsrechts sind in Übersicht 2 zusammenfassend dargestellt. Auch im besonderen Sozialrecht gibt es aber die Möglichkeit, dass die Bundesländer ergänzende landesrechtliche Regelungen schaffen (Art. 72 Abs. 1 i.V.m. Art. 74 Abs. 1 Nr. 7 GG).
Übersicht 2
Allgemeines und besonderes Verwaltungsrecht (2)
Fall 1: Der Antrag auf Wohngeld
Die Alleinerziehende A beantragt per E-Mail Leistungen nach dem Wohngeldgesetz (WoGG) bei der dafür zuständigen Behörde.
a) Die Wohngeldstelle besteht auf einen schriftlichen Antrag. Zu Recht?
b) A ist sich nicht sicher, ob sie das Wohngeld auch dann erhält, wenn sie eine Wohnung gemietet hat, die ihren Großeltern gehört. Außerdem beabsichtigt ihr Freund, der relativ gut verdient, zu ihr in die Wohnung zu ziehen. Hat sie einen Anspruch auf Beratung zu diesen Fragen gegenüber der Wohngeldstelle?
c) Die Wohngeldstelle antwortet A per Mail, dass ihr Antrag abgelehnt wird. Ist das rechtlich zulässig?