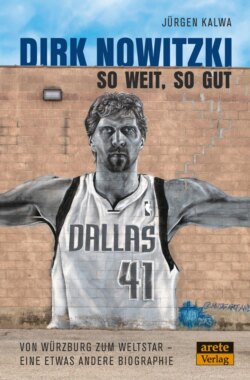Читать книгу Dirk Nowitzki - So weit, so gut - Jürgen Kalwa - Страница 10
Оглавление2. Kapitel
Der Traktor-Faktor
Wie Don Nelson mit einem Geniestreich an einem Tag gleich zwei Spieler nach Dallas holte, die später als wertvollste Spieler der Liga Geschichte machen sollten: Dirk Nowitzki und Steve Nash. Ihre großen Erfolge erlebte er jedoch nur aus der Ferne.
Kongeniale Partner: Steve Nash und Dirk Nowitzki im Dezember 2001. (imago/Zuma Press)
Drüben auf der anderen Seite des riesigen erloschenen Vulkans verströmt das tropische Milieu der Insel eine Stimmung, die den meisten Besuchern vom Festland verborgen bleibt. Die biegen nämlich fast alle mit ihren Mietwagen gleich an der Ausfahrt vom Kahului Airport nach Westen ab, fahren durch die Ebene, in der sich einst riesige Zuckerrohrplantagen ausbreiteten, und landen kurz darauf in einem dieser modernen Hotelkästen direkt am Meer. Dort, wo man Maui etwas genommen hat, was es ganz sicher mal besaß: einen ureigenen Charme.
Der Charme des Ostens auf der anderen Seite des Vulkans ist allerdings ebenfalls Geschmacksache. Der Post-Hippie-Stil aus der Dose, der die fade Nutzbauten-Architektur dekoriert, hat fast alles im hawaiianischen Archipel im Griff. So auch hier.
Die Atmosphäre allerdings wird von Leuten geprägt, die sich bewusst in dieser Gegend niedergelassen haben, weil sie ein paar vernünftige Gründe dafür haben. Zum Beispiel, dass man näher an den Zentren von Verwaltung und Politik ist und man hier, wo bis 2000 eine Zuckerraffinerie lief, ein Gefühl von Zusammenhalt kennt.
Wer hier hängen bleibt – Surfer und Künstler und eine besondere Sorte von Prominenten, die keinen Wert darauf legen, sich auf den Gossip-Seiten wiederzufinden, also Musiker wie Willie Nelson und Kris Kristofferson und der Schauspieler Woody Harrelson – müssen bei ihrem ersten Besuch jene „verrückte leichte Schwingung“ gespürt haben, die die New York Times mal ausgelotet hat. Offensichtlich wollten sie mitschwingen. Denn dies ist der Landstrich der Freigeister, zweite Heimat der etwas Abgedrehten.
Es ist exakt das Milieu, von dem sich Don Nelson angezogen fühlte. Und so hat er in Paia unweit vom Strand mit den Millionen aus seinen Einkünften als Basketballtrainer das größte Haus weit und breit gebaut. Man muss nur die hohen Schiebetüren der riesigen Glasfassade öffnen und wird von der sanftwarmen Brise des Pazifischen Ozeans umsäuselt.
Gleich nebenan stehen zwei Mietshäuser, die ihm ebenfalls gehören. Nicht weit weg befindet sich das mit mehreren Läden ausgestattete Geschäftsgebäude – Shops of Paia –, in dessen Keller der Zigarrenliebhaber sein Raucherzimmer und einen Raum für seine Pokerabende mit Freunden eingerichtet hat.
Das Kontrastprogramm dazu befindet sich oben in den Wolken, an einem der Abhänge des 3000 Meter hohen Haleakala, wo die Temperaturen niedriger sind und die Aussicht auf das Meer schlichtweg atemberaubend. Dort hat sich Nelson auf einem nicht ganz einfach zugänglichen Stück Land eine Villa bauen lassen, die Gästen und Freunden der Familie vermietet wird. Für den Entwurf gab er dem Architekten freie Hand. Weshalb der glaubt, dass er da oben etwas ganz Besonderes hinbekommen hat: „Einen Ausläufer von Dons Persönlichkeit. Er verfügt über eine sehr solide, stabile Präsenz. Aber er ist jemand, der auch außerordentlich aus sich herausgeht.“
Ein Mann, der auf einer Rinder- und Schweinefarm in Michigan im sogenannten Mittleren Westen aufwuchs und der nun auf einer abgelegenen Insel mitten im Pazifik ein bisschen Monopoly spielt. Wenn auch ganz ohne Opernplatz oder Schlossallee.
Wenn wir über Dons Persönlichkeit reden wollen, dann müssen wir allerdings ehrlicherweise ein wenig ausholen. Heute, im Alter von 78 Jahren, gilt er hauptsächlich als eigenwilliger ewiger Basketball-Geek. Ein „Lifer“, wie man in der NBA sagt, der zunächst als Profi fünfmal die Meisterschaft der National Basketball Association gewinnen konnte und der für seine Leistungen von seinem langjährigen Club, den Boston Celtics, mit einer dieser typischen amerikanischen Respektsgesten geehrt wurde. Man zog feierlich seine Trikotnummer 19 aus dem Verkehr und hisste das Stofftuch mit seinem Namen unter die Decke des Boston Gardens. Bei den Celtics, dem erfolgreichsten Team der NBA-Geschichte, hatte sich Nelson einen formidablen Ruf als „sixth man“ erarbeitet, als der Mann, der gezielt vom Trainer in der späteren Phase einer Begegnung von der Bank aus ins Spiel geschickt wird, um den Druck auf die Einwechselspieler des Gegners zu erhöhen.
Der 1,98 Meter große Basketballprofi war schon damals erfindungsreich. Er entwickelte zum Beispiel eine eigenwillige Ein-Hand-Technik für seine Freiwürfe und kam damit auf eine brauchbare Trefferquote.
Als Trainer allerdings war er noch sehr viel einfallsreicher. Und das war gut so. Als er noch selbst in kurzen Hosen über den Platz joggte, hatte die NBA ganze neun Clubs und war ziemlich übersichtlich. Im Laufe der Jahre vollzog er jene Expansionsströmung mit, die die Liga auf 30 Clubs aufblähte und den Blick der Verantwortlichen auf Spieler von anderen Kontinenten öffnete. Denn das Mutterland der Sportart, die Ende des 19. Jahrhunderts von einem kanadischen Sportlehrer namens James Naismith in Neu-England erfunden worden war, produzierte angesichts der Erweiterung einfach nicht mehr genug Erster- Klasse-Talente am Fließband.
Nelson hat in diesem System wie kaum ein anderer reüssiert. Er wurde dreimal als „Coach des Jahres“ ausgezeichnet und arbeitete sich auf den ersten Platz in der Tabelle der Trainer mit den meisten Siegen vor.
Aber seine Ideen wurden auf dem Spielfeld nie richtig belohnt. Alles, was er in der Arbeit mit seinen Spielern bei den Milwaukee Bucks, den Golden State Warriors, den New York Knicks und den Dallas Mavericks zu erreichen imstande war, war die Qualifikation für die Conference Finals. Und das auch nur ein einziges Mal. Gewöhnlich war spätestens eine Runde vorher Endstation. Man muss sich das mal vorstellen: Einer der besten Männer seines Fachs hat es nicht mal zu einer Teilnahme an der Finalserie geschafft. Und deshalb natürlich auch nicht zu einem offiziellen Besuch beim amerikanischen Präsidenten im Weißen Haus.
Diese vergleichsweise bescheidene Bilanz hat ihn jedoch nicht genervt. Als Kontrastprogramm und Ausgleich zog er sich zwischendurch immer wieder auf seine Insel zurück. Er begann dort seinen Tag meistens mit einer Runde Golf und beendete ihn mit ein paar Glas Bier und zog dabei genüsslich an einer teuren Zigarre. Das Getriebe der NBA auf dem amerikanischen Festland, Minimum fünf Flugstunden entfernt, schwappte in solchen Phasen nur noch aus dem Fernsehen an ihn heran. In Gestalt von Live-Übertragungen, die wegen des Zeitunterschieds auf Maui nachmittags laufen.
Innerhalb der Liga war er zwar den meisten Entscheidungsträgern aus dem Blick entschwunden, aber nicht aus dem Sinn. Anfang 1997 zum Beispiel stöberte ihn Frank Zaccanelli auf, der kurz zuvor mit zwei weiteren Investoren die Mavericks gekauft hatte.
Das Team gehörte zu jener Zeit sportlich zum Schlechtesten, was die NBA zu bieten hatte. Man brauchte einen Mann mit einer Vision und mit der Bereitschaft, Tabula rasa zu machen.
„Wir hatten gehört, dass er in Hawaii wirklich zufrieden und nicht so richtig an einem neuen Job interessiert sei“, erzählte Zaccanelli später. „Aber als wir uns näher gekommen sind, erwies sich das als komplett falsch. Er war eben ein Lifer.“
Nelson fühlte sich mit 57 herausgefordert, doch noch einmal über alles nachzudenken. Über sein Leben abseits von der Stressmaschine Basketball und seinen Ehrgeiz, aus einem scheinbar hoffnungslosen Fall einen Meisterschaftsanwärter zu machen. Das Angebot war ein Posten als General Manager und ein mit 7,5 Millionen Dollar dotierter Fünf-Jahres-Vertrag.
Kaum in Texas angekommen, machte er sich mit harten Bandagen an die Arbeit. Er modelte den Kader komplett um und trennte sich von den vier besten Korbschützen der Mannschaft, darunter von Spielmacher Jason Kidd. Das war „eine der chaotischsten Phasen, die je ein Team mitgemacht hat“, charakterisierte Mike Fisher im Fort Worth Star-Telegram den brutalen chirurgischen Eingriff.
Daniel Düsentrieb hatte ein neues Laboratorium gefunden, aber die Chemie vor Ort als „giftig“ eingestuft. Er benutzte damals eine Allegorie aus der Landwirtschaft, um seine Vorgehensweise zu erklären: „Das war ein absoluter Schlamassel. Wenn eine Scheune derartig versaut ist, dann machst du zuerst das sauber, was am meisten stinkt.“
Die gesamte Reinigungsmaßnahme dauerte ganze dreizehn Tage und sorgte für den Arbeitsplatzwechsel von insgesamt sechzehn NBA-Spielern, die von einem Tag auf den nächsten in anderen Trikots zu spielen hatten. Es war nur eine Frage der Zeit, bis auch Trainer Jim Clemons seinen Job verlor und Nelson selbst den Posten übernahm – nach den ersten sechzehn schwachen Spielen der Saison 1997/98.
„Ich wollte keine Leute um mich herum haben, die nicht da sein wollten“, lautete sein Motto. Vermutlich wollte er keine Menschen mit Allüren und keine Quertreiber, die ihm die Lust an der Arbeit vermiesen würden.
Nelson kokettierte gegenüber Mitbesitzer Ross Perot jr., dass er ihn wahrscheinlich innerhalb von einem oder zwei Jahren herauswerfen würde, als sich die beiden über den Vertrag einig geworden waren. „Gottseidank ist das nicht passiert“, gab er zu, nachdem ein neuer ambitionierter Investor, der 42-jährige Mark Cuban, den Club gekauft hatte und die Mannschaft besser geworden war. „Aber ich war sicher ein paar Mal sehr nahe dran. Ich habe mich reingehängt. Und nun erleben wir, dass die Mannschaft das mit Erfolgen zurückzahlt. Das ist das Beste daran.“
Wenn man sich mit Nelsons in Dallas produziertem Nachlass an die Welt beschäftigt, von denen die drei wichtigsten alle mit dem Buchstaben N anfangen – Nowitzki, Nash und „Nellie-Ball“ – fühlt man sich unweigerlich an all das erinnert. Weil bereits in diesen drei Worten sein Grundverständnis für das Spiel deutlich wird.
Man nehme „Nellie-Ball“, eine kreative, risikofreudige Methode, die herkömmlichen Konventionen des Basketballs einfach mal zu durchbrechen. Eines Spiels, bei dem von Natur aus die ganz langen Kerle so gut wie immer unbeholfen und staksig wirken und langsam unterwegs sind, aber hochnützlich sind, wenn es darum geht, den Luftraum zu dominieren. Weshalb sie möglichst nahe an den Korb kommandiert werden, während die Kleinen die Bälle verteilen sollen und aus der Distanz werfen.
„Nellie-Ball“ war das Abenteuer, gegen dieses arbeitsteilige Konzept eine Taktik zu stellen, bei der er ohne jede Scheu gegen die großgewachsenen Typen von mehr als zwei Metern vom Scheitel bis zur Sohle kleine, wieselflinke Männer auf den Platz schickte und denen anordnete, aufs Gaspedal zu treten. Einen echten Center gibt es in diesem Schema nicht mehr, weil der nur die gesamte Mannschaft langsamer machen würde.
Nelson entwickelte und perfektionierte diesen Stil zum ersten Mal in seiner Zeit bei den Golden State Warriors Ende der achtziger, Anfang der neunziger Jahre, wo er mit den drei All-Stars Tim Hardaway, Mitch Richmond und Chris Mullin eine Gruppe von Ballkünstlern beieinander hatte, denen die begeisterten Anhänger einen reizvollen Spitznamen verliehen: „Run T-M-C“. Eine Anspielung an eine damals sehr erfolgreiche Rap-Gruppe namens Run DMC.
Eine andere Kreation von Don Nelson ist „Hack-a-Shaq“, eine Defensivtaktik, bei der man einen Spieler nur aus einem Grund foult: um ihn schlichtweg an die Freiwurflinie zu zwingen. Er hatte sich diese Taktik ausgedacht, um Dennis Rodman (damals bei den Chicago Bulls) in Verlegenheit zu bringen. Aber erst als er die Methode auf den riesigen Center Shaquille O’Neal anwendete, der im Laufe seiner erfolgreichen Karriere vor allem eine konstante Schwäche besaß – er verfehlte die Hälfte seiner Freiwürfe – bekam das Kind seinen Namen.
Um freiwurfschwache Spieler öffentlich vorzuführen und dadurch möglichst nervös zu machen, ließ Nelson seine Mavericks solche Gegner auch in Situationen foulen, in denen sie den Ball gar nicht in der Hand hatten. Der Vorteil eines solchen Konzepts lag auf der Hand: Statt zwei oder drei Punkte pro Angriff zu kassieren, konnten die Mavericks auf diese Weise die Ausbeute auf das reduzieren, was der wurfschwache Gegner an der Freiwurflinie zustande brachte. Außerdem verlangsamte man so das Tempo der anderen Mannschaft in Phasen, in denen sie dynamisch in Fahrt gekommen war.
Der Nachteil: Spieler aus dem eigenen Kader durch das Ansammeln von Fouls der Gefahr der frühen Disqualifikation auszusetzen. Es war also ein zweischneidiges Schwert, aber offensichtlich scharf genug. Denn die Taktik wurde irgendwann von anderen Trainern kopiert und nötigte die obersten Etage der NBA dazu, sich Gedanken über eine Regeländerung zu machen. Wozu es schließlich auch kam. Solche bewussten Fouls gegen Spieler, die nicht im Ballbesitz sind, werden seitdem in den letzten, oft entscheidenden Minuten eines Spiels damit geahndet, dass das betroffene Team einen anderen als das wurfschwache Mannschaftsmitglied die Freiwürfe ausführen lassen kann.
Der Hang von Nelson zum kreativen Experiment ähnelte oft dem eines Pokerspielers, der ahnt, wie gut oder schlecht die anderen bluffen, und der sich ständig darüber Gedanken macht, wie man aus dem unberechenbaren Stapel auf dem Tisch irgendetwas herausziehen kann, was einem am Ende die meisten Chips einbringt.
Ein Hang, durch den man sich auch schon mal massiv verzockt. Anfang der neunziger Jahre in Golden State zum Beispiel verschätzte sich Nelson auf besonders dramatische Weise. Da musste er, weil er dem Club unbedingt ein Talent wie Chris Webber sichern wollte, vor der Draft 1993 den Orlando Magic einen Spieler – Anfernee Hardaway – und drei Erstrunden-Draft-Picks geben.
Was er im Tausch dafür bekam, entwickelte sich zu einem regelrechten Desaster. Webber und er gerieten schon bald in Fragen der Taktik und des Positionsspiels aneinander. Das Selbstbewusstsein des Spielers war vermutlich unter anderem einem Faktor geschuldet, der erst 1998 ausgeräumt wurde. Der Tarifvertrag der Spielergewerkschaft mit der Liga ließ es bis dahin nämlich zu, dass Clubs hochgehandelten Nachwuchsspielern enorme Summen hinterherwarfen, auch wenn so etwas auf purer Spekulation beruhte und die Bezahlung weit über dem der älteren Profis lag. Diese Situation stärkte das schnöselige Selbstbewusstsein von Typen wie Webber ganz erheblich. Der sollte dann auch im Laufe seiner Karriere mehr als 170 Millionen Dollar brutto verdienen, das Doppelte von dem, was Michael Jordan im Rahmen seiner Arbeit bei den Chicago Bulls und in Washington einzunehmen in der Lage war.
Nur ein Jahr später hatte Nelson genug. Es blieb ihm nichts anderes übrig, als sich von Webber zu trennen. Zum Glück fand er mit den Washington Bullets (heute Wizards) einen Abnehmer, der ihm im Wechsel nicht nur einen Spieler – Tom Gugliotta – sondern drei Erstrunden-Draft-Picks abgab. So kostete das Abenteuer den Club im Grunde zwar nichts, Nelson hingegen sehr viel – ein gutes Stück seiner Reputation als Prognostiker von Talenten. Wohl auch deshalb verlor er bei seinem nächsten Club, den New York Knicks, schon nach wenigen Monaten einen rasch aufkeimenden Machtkampf und kündigte mitten in der Saison trotz positiver Bilanz sang- und klanglos.
Er hatte schließlich Maui als Rückzugsoption. Tagsüber Golfspielen und nachts Pokern mit seinem Freund Willie Nelson – das wirkte wie ein attraktiver Plan.
Doch dann suchte ihn Frank Zaccanelli auf und unterbreitete ihm seine Offerte.
All das sollte man wissen, um zu verstehen, wie dem Pokerspieler Don Nelson am 24. Juni 1998, dem Draft-Tag, mit seinen riskanten Manövern einer der größten Geniestreiche in der Geschichte der NBA gelang. Seine Lust, aufs Ganze zu gehen, bescherte den Dallas Mavericks die Nachwuchsprofis Dirk Nowitzki und Steve Nash, die beide später als wertvollste Spieler der Liga ausgezeichnet wurden. Beide ausgestattet mit einem unkonventionellen Verständnis von ihrer Rolle auf dem Platz. Und jeder in seiner Entwicklung auf unterschiedliche Weise Zögling eines Mannes, der nie den Glauben an ihr Talent verlor.3
Dieser Mann hatte im Vorfeld jenes Abends durchaus deutlich signalisiert, dass er sich für Dirk Nowitzki interessierte, aber sich dann kurz vor der Entscheidung öffentlich mit deutlichen Äußerungen zurückgehalten. Nelson führe bekanntermaßen Leute gerne an der Nase herum, warnte die Dallas Morning News vier Tage vorher und spekulierte: „Viele General Manager sind überzeugt, dass dies Teil eines machiavellistischen Plans ist, der Dirk Nowitzki nach Dallas bringt.“
Machiavellistisch bedeutet im englischen Sprachraum: die Anwendung von List und Doppelzüngigkeit in der Staatskunst oder im allgemeinen Verhalten. Aber die Zeitung und der Rest der Welt mussten noch ein paar Tage warten, um herauszufinden, was Don Nelson in diesem Moment tatsächlich aus dem Ärmel ziehen würde, nachdem ihm die schlechte vorausgegangene Saison einen relativ guten sechsten Draft-Platz beschert hatte.
Er entwickelte in dieser Zeit nämlich einen Plan, um ordentlich mit dem Pfund zu wuchern, das er in der Hand hielt.
Wir unterhielten uns vor ein paar Jahren unter anderem über die Frage, weshalb er damals von seinen Entscheidungen so unglaublich überzeugt war:
„Stichwort Dirk Nowitzki. Sie haben sich enorm bemüht, ihn – einen damals gerade mal 20 Jahren alten Basketballer aus Deutschland – 1998 nach Dallas zu holen. Wieso waren Sie so sicher, dass aus ihm etwas wird?
DON NELSON: „Sein Arbeitseifer. Er kam als erster in die Halle zum Training. Abends hat er noch mehr trainiert. Abgesehen davon war er einfach der talentierteste Jugendspieler, den ich je gesehen habe. Er konnte rebounden, werfen, sich unter dem Korb gut in Stellung bringen. Ein außerordentlich beweglicher Basketballer. Und das mit 2,13 Metern.“
„Sie haben am selben Tag, als sie Nowitzki gedraftet haben, im Rahmen eines Spielertausches Steve Nash nach Dallas geholt. Der wurde später zweimal MVP, Nowitzki einmal. Stört es Sie, dass kaum jemand weiß, was für eine Spürnase für Talente Sie hatten?“
DON NELSON: „Du bist bei so etwas nie der einzige. Du hast einen kompletten Stab, der scoutet. Allerdings: Wenn es um Entscheidungen geht, traue ich mir selbst immer mehr als anderen. Ich habe nach dem Ende jeder Saison und vor jeder Draft hunderte von Stunden damit zugebracht, Spieler zu analysieren. Aber im Fall von Steve Nash hatte mein Sohn Donnie den Hauptverdienst. Der hatte ihn, ehe ich ihn in Dallas verpflichtete, bei den Phoenix Suns erlebt. Als zweiten Mann hinter Jason Kidd. Er hat mir gesagt, Nash ist besser als Kidd. Ich habe ihm das geglaubt.“
Er erkannte früher als andere Nowitzkis Potenzial: Don Nelson. (imago)
Jahre später, nachdem er vom Club kaltgestellt wurde und an seine alte Wirkungsstätte bei den Golden State Warriors zurückkehrte, musste er erleben, dass ihm Mark Cuban nicht besonders dankbar für seine Leistung war. Der Eigentümer der Mavericks verklagte den Ex-Trainer und behauptete, der hätte den spektakulären Erfolg der Warriors gegen Dallas in der ersten Play-off-Runde nur deshalb zustande gebracht, weil er Betriebsgeheimnisse besaß und eingesetzt habe. Abgesehen von der kuriosen Vorstellung, wonach das Wissen eines Basketballtrainers dem Club gehört, bei dem er arbeitet, war ziemlich klar, um was es in der Auseinandersetzung wirklich ging. Man hatte sich im Streit getrennt. Nelson verlangte 6,5 Millionen Dollar an ausstehenden Gehaltszahlungen, aber war damit auf normalem Weg nicht durchgedrungen und hatte ein Schiedsgericht eingeschaltet. Cubans Retourkutsche wirkte im Vergleich dazu nachtragend und infantil.
Das Gericht erkannte irgendwann die Rechtmäßigkeit von Nelsons Anspruch an, entschied auf eine Zahlung von 6,3 Millionen Dollar und eine Überweisung von weiteren 500.000 Dollar, um Nelsons Anwaltskosten zu übernehmen. Was die Beweisaufnahme produzierte, kam mit Verspätung 2009 an die Öffentlichkeit. Es enthüllte, wie die Beziehung zwischen Cuban und Nelson zerschlissen war. Im Mittelpunkt niemand anderer als der Star der Mannschaft: Dirk Nowitzki.
Ausgangspunkt für die Reibung war eine Situation von 2003 gewesen, als sich Nelson weigerte, im sechsten Spiel der Finalserie der Western Conference gegen die San Antonio Spurs, Nowitzki einzusetzen. Der hatte sich in einem voraufgegangenen Spiel eine Knieverletzung zugezogen. Cuban hingegen verlangte, angeblich nach Konsultation mit dem Teamarzt, den Würzburger trotzdem aufzustellen. Ohne ihn verloren die Mavericks das Spiel und die Serie.
Nelson erklärte im Schiedsgerichtsverfahren, weshalb er der Forderung seines Arbeitgebers nicht nachgekommen sei: Er habe als Spieler selbst eine ähnliche Verletzung erlitten und sich deshalb Sorgen gemacht, dass ein Einsatz Auswirkungen auf die weitere Basketball-Karriere von Dirk Nowitzki haben könnte. „Ich wollte diesen jungen Spieler nicht wegen eines einzigen Spiels einem solchen Risiko ausliefern. Egal wie wichtig dieses Spiel in diesem Moment auch gewesen sein mag.“
Von da an wurde Nelson bei Beratungen über Verpflichtungen von Spielern bewusst ausgeschaltet. Das Kuriose an der Situation: Auf seinen Sohn Donn – Spitzname Donnie – , den er nach Dallas gebracht und in der Position des für personelle Entscheidungen Verantwortlichen installiert hatte, wirkte sich das alles überhaupt nicht aus. Der arbeitet auch heute noch bei den Mavericks. Seit 2005 in der Position des General Managers.
Aber zurück zum Draft-Abend von Vancouver, an dem sich Don auf die Kompetenz seines Sohnes verließ. Mit ihm sind nämlich zwei weitere Namen verknüpft, die nicht mit dem Buchstaben N anfangen. Beide gelten heute nur noch als Randfiguren in der Biographie von Dirk Nowitzki. Denn genau genommen hatte die Episode, in der die beiden eine Rolle spielten, keinen unmittelbaren Einfluss auf den Werdegang des Basketballers aus Würzburg.
Aber erwähnen muss man die beiden Männer trotzdem. Denn sie tauchen immer wieder in einer Geschichte auf, die scheinbar so plastisch und rund klingt: In ihr wird nämlich immer so getan, als hätten an diesem Abend die Milwaukee Bucks die Chance gehabt, den von ihnen gedrafteten Dirk Nowitzki zu behalten, den sie aber an die Mavericks im Tausch gegen einen anderen Spieler abgegeben hatten. Diese Aktion gilt kurioserweise als einer der krassesten Fehlgriffe in der Geschichte der NBA-Trades. Tatsächlich ist nur eines an dieser Episode wirklich interessant: Sie ist grundfalsch. Ein Ammenmärchen. Oder wie man heute gerne sagt: eine urban legend.
Der Name des Mannes, der in diesem Märchen immer als angeblicher Hauptversager genannt wird, lautet Bob Weinhauer. Der amtierte 1998 als General Manager der Milwaukee Bucks. Ein guter Bekannter von Don Nelson übrigens und jemand, der schon mal in dessen Gästehaus direkt am Ozean in Maui Urlaub gemacht hat und dort den Sonnenuntergang genoss: „Es ist wunderbar. Eine komplette Seite besteht aus Glas und öffnet sich zum Swimmingpool. Und man sieht dahinter den Strand. Du öffnest die Tür, und es kommt eine frische Brise herein.“
Der zweite Name ist nicht minder wichtig, aber gilt eher als tragische Nebenfigur. Dabei handelt es sich um einen jungen Basketballspieler aus Detroit, den Weinhauer damals unbedingt verpflichten wollte und dies auch tat: Robert Traylor. Ein wuchtiger, großer Typ, der schon in seiner Jugend mit einem plakativen Spitznamen versehen wurde: „Tractor Traylor“ – ein Wortspiel, das von einem Journalisten der Detroit News erfunden worden war.4
Weinhauer hatte in seiner Karriere einen sehr guten Lauf gehabt – zunächst als Assistent und Protegé des Dream-Team-Trainers Chuck Daly, als College-Coach in Pennsylvania und Arizona und als Assistenztrainer in der NBA, dann als Head Coach bei den Philadelphia 76ers, Atlanta Hawks und Minnesota Timberwolves. Zwischen 1994 und 1997 lag seine erfolgreichste Karrierephase. Damals war er Chefmanager der Houston Rockets. Das Team gewann in dieser Zeitspanne gleich zweimal die NBA-Meisterschaft.
Seine Vita hat allerdings selbst unter Basketballkennern keinen bleibenden Eindruck hinterlassen. Es gab bis vor kurzem nicht mal eine Wikipedia-Seite über ihn. Und die enthält bis heute keine Korrektur jener immer wieder gern erzählten Sottise über den „einseitigsten Trade in der Geschichte der NBA“, wie Weinhauers Tauschgeschäft am Draft-Tag 1998 von dem angesehenen amerikanischen Sportautor Dave Zirin auf der Webseite der Zeitschrift The Nation mal genannt wurde.
So mancher stieß ins gleiche Horn. Der Manager der Milwaukee Bucks habe, so hieß es etwa im Juni 2011 auf der Online-Seite der Wochenzeitung Die Zeit, kurioserweise in einem Eishockey-Artikel („Das deutsche NHL-Finale“ 5), „Dirk Nowitzki für Traylor verramscht“.
Die reinen Fakten sind übrigens unbestritten: Getauscht wurde damals der schon erwähnte Robert Traylor, ein mit vielen Vorschusslorbeeren versehener Power Forward von der University of Michigan, der in seinem letzten Jahr im College-Basketball im Schnitt etwas mehr als 16 Punkte pro Spiel erzielt und zehn Rebounds produziert und es zwei Monate vor der Draft auf die Titelseite des Magazins Sports Illustrated geschafft hatte, gegen den weithin unbekannten Dirk Nowitzki und einen ebenfalls nicht besonders hoch eingeschätzten Amerikaner namens Pat Garrity, dessen Vertragsrechte sich Milwaukee auf dem 19. Draft-Platz gesichert hatte.
Auf diese Weise – rein formal betrachtet über einen Umweg – kam der Würzburger nach Dallas. Und Traylor – ein Mann mit dem „süßen Charisma eines sanften Riesen“ (Zirin) – landete in Milwaukee. Aber ein wichtiges Detail wird in solchen Nacherzählungen gerne unterschlagen: Nelson wollte Nowitzki von Anfang an und niemand anderen – aber er wollte dafür nicht seinen sechsten Draft-Platz nutzen. Weinhauer wiederum wollte immer nur Traylor, aber hatte Angst, dass er ihn mit seinem neunten Draft-Platz nicht mehr bekommen würde.
Der Spieler hatte gerüchteweise mit NBA-Profis in Detroit trainiert und die, so hörte man, im Zweikampf regelrecht vernascht. Kein Wunder, dass man bei den Bucks besorgt war, diesen Wunschkandidaten an Draftplatz 9 nicht mehr zu bekommen, weil ihn jemand anderer weggeschnappt hätte.
Nur deshalb ging Weinhauer auf den Handel mit dem an Platz sechs ziehenden Nelson ein. Ein Projekt, das übrigens nie zustande gekommen wäre, wenn Traylor zu diesem Zeitpunkt bereits von einem der Teams auf den Plätzen eins bis fünf ausgewählt worden wäre.
Doch es lief wie geplant. „Das war alles so abgesprochen“, hat Don Nelson seitdem mehrfach betont. „Wir hätten dieses Geschäft auch nicht gemacht, wenn sie nicht die Spieler ausgewählt hätten, die wir haben wollten.“ Das Arrangement wurde vor der Draft offiziell wie vorgeschrieben an die Liga gemeldet. Allerdings wusste die interessierte Öffentlichkeit nichts davon und tappte am Draftabend deshalb lange im Dunkeln.
„Um Viertel nach sechs hatten wir alles zusammen und dann mussten wir warten und dafür sorgen, dass es auch genauso passiert“, erinnerte sich Weinhauer später.
Der war am Draft-Abend mehr als zufrieden: „Wenn wir jetzt in den Krieg ziehen müssten, könnten wir uns mit jedem messen“, sagte er. Kommentatoren wie Dan Shanoff von Sports Illustrated lobten: „Die Bucks haben es richtig gemacht, dass sie ’98 den vermarktbaren und talentierten Robert Traylor gestohlen haben.“
Dessen Verpflichtung galt nicht nur als hervorragender Schachzug. Der Tausch mit Dallas wirkte auf manche derart einseitig, dass der Eindruck entstand, Weinhauer habe Nelson und die Mavericks regelrecht übervorteilt. Ausgerechnet jener Bob Weinhauer, der im Kontrast zu Nelson nie sehr gerne auf Risiko gegangen war.
Noch ein Jahr später gab die harsche Bewertung der Daily News in Los Angeles die Standardsichtweise über jenen Draft-Deal wieder, nachdem sich Milwaukee im Unterschied zu Dallas für die Play-offs qualifiziert hatte: „Was an Don Nelson ist eigentlich dümmer? Dass er Traylor ausgewählt hat oder dass er ihn für Dirk Nowitzki eingetauscht hat?“ Den Milwaukee Bucks bescheinigte die Zeitung damals: „Zum Glück sind sie den deutschen Import an Dallas losgeworden.“
Die Realität sah schon bald ganz anders aus. Und mit ihr änderte sich – ungerechtfertigterweise – auch die Bewertung eines Mannes wie Bob Weinhauer.
Denn acht Jahre nach dem Draft-Tag stand Dirk Nowitzki mit den Mavericks zum ersten Mal in der Finalserie. Weitere fünf Jahre später war er Meister. Demgegenüber zeigte Robert Traylor nie das, was ihm Experten prophezeit hatten und was Weinhauer in ihm gesehen hatte. Er spielte nur ein paar Jahre in der NBA und wanderte von Club zu Club. Er erzielte dabei nicht mehr als einen Karriereschnitt von fünf Punkten und vier Rebounds pro Begegnung und kam zwischendurch auch noch mit dem Gesetz in Konflikt. Im November 2006 entdeckten Ärzte, dass er eine zu große Herzklappe hatte und operierten ihn. Er versuchte anschließend sein Glück in Spanien, in der Türkei und auf Puerto Rico, wo er im Mai 2011 – ein paar Wochen ehe Nowitzki den Titel gewann – überraschend an Herzversagen starb. Er wurde 34 Jahre alt und in seiner Heimatstadt Detroit beerdigt.
So traurig dies ist, die urban legend von der angeblichen Fehlleistung der Milwaukee Bucks war damals schon eine Weile im Schwange. Was unter anderem daran lag, dass Weinhauers Vertrag im Sommer 1999 nicht verlängert wurde. Das wirkte rein oberflächlich später so, als hätte ihn die Clubführung dafür abgestraft, dass er Nowitzki nicht verpflichtet hatte.
Tatsächlich lag der Fall ganz anders. Als er aus dem Amt gescheucht wurde, galt die Weitergabe des Würzburgers an die Mavericks noch immer als kluges Manöver. Mit anderen Worten: Das eine hatte mit dem anderen überhaupt nichts zu tun.
Obendrein: Verantwortliche NBA-Manager werden gewöhnlich nicht daran gemessen, ob ihre Prognosen eintreffen oder nicht. Denn diese Leistungsprojektionen bewahrheiten sich selten genug. Man kann Draft-Tableaus aus jedem Jahr nehmen und wird feststellen, dass viele Spieler, die am Draft-Tag hoch gehandelt wurden, nicht das eingelöst haben, was sich erfahrene Manager und Trainer von ihnen versprochen haben. So brachten aus dem Pool von 1998 mal gerade zwei Basketballprofis im Laufe ihrer Karriere als Leistungsträger ihrer Teams NBA-Titel nach Hause: Dirk Nowitzki (gezogen an Platz 9) und Paul Pierce (gezogen an Platz 10) von den Boston Celtics, die sich damals ebenfalls sehr stark für Nowitzki interessierten.6 Die größte Enttäuschung: der auf Platz 1 von den Los Angeles Clippers gezogene nigerianisch-britische Diplomatensohn Michael Olowokandi.
Weshalb aber verlor Weinhauer ein Jahr nach der Tauschaktion mit Dallas eigentlich seinen Posten? Weil er im Sommer 1999 wichtige Leistungsträger nicht an den Club binden konnte und weil der von ihm selbst angestellte Trainer George Karl hinter den Kulissen um mehr Einfluss auf Personalentscheidungen antichambrierte. Die Sterne standen schlecht. Weinhauers Arbeit – die Bucks hatte 1999 zum ersten Mal seit 1991 wieder die Play-offs erreicht – galt als nicht gut genug. Und die Hoffnung auf den hochgepriesenen Traylor fiel langsam, aber sicher in sich zusammen.
Mit Nowitzki hatte das alles ganz und gar nichts zu tun.
Aber einige Fragen blieben offen. Und so beschloss ich irgendwann, mich auf die Suche nach Bob Weinhauer zu machen.