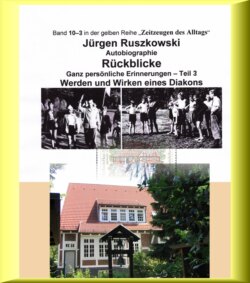Читать книгу Vom Werden eines Diakons - Rückblicke - Teil 3 - Jürgen Ruszkowski - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Auf dem Rüttelrost – das erste Jahr im Rauhen Haus
ОглавлениеMir wird eine Unterkunft zusammen mit sieben weiteren Brüdern unter dem Dach im 4. Stock des Hauses „Goldener Boden“ zugewiesen. Ich nenne diese Bude scherzhaft „Massengrab“.
„Massengrab“ – 8-Betten-Zimmer
Haus „Goldener Boden“ um 1954 – Altenheim
Mein erster Job ist der eines Trümmerjünglings. Die Kriegsfolgen sind 1954 in Hamburg noch allenthalben stark sichtbar, obwohl schon sehr viel wieder neu aufgebaut worden ist. In Hamburg-Hamm gibt es noch Nissenhütten, halbrunde Wellblechbaracken, als Notunterkünfte für Ausgebombte. Am Horner Weg, direkt neben dem Rauhen Hause, lagen bis kurz vor meinem Eintritt noch die Gleise der Trümmerbahn, die den Bauschutt an den Stadtrand befördert hatte.
„Wie eine Insel des Friedens, so liegt das Rauhe Haus inmitten der Großstadt Hamburg. Im weiten Park rings um den Teich finden wir die Häuser, von alten Linden umgeben.“
So formuliert der damalige Prospekt der Diakonenanstalt des Rauhen Hauses.
Das Rauhe Haus war bei einem Bombenangriff im Juli 1943 wenige Wochen nach der Räumung durch die Innere Mission von Brandbomben fast vollständig vernichtet worden.
Das Haus ‚Tanne’ beherbergte in den 1950er Jahren die Verwaltung
Im Obergeschoss wohnte der Vorsteher
Da die meisten Häuser nach der Enteignung durch den Staat für eine geplante SS-Heimschule leer standen, war niemand da, der die Brandbomben rechtzeitig hätte löschen können.
Das Haus ‚Anker’ beherbergte unten rechts die Krankenstube, oben wohnte Füßinger.
Von den 28 Anstaltsgebäuden waren bei Kriegsende nur noch vier erhalten, nämlich die Häuser „Tanne“, „Anker“, „Schönburg“ und „Kastanie“.
Haus „Schönburg“ in den 1950ern – inzwischen durch einen Neubau ersetzt
Diese Übersichtstafel über die Kriegsschäden hing in der Eingangshalle des Hauses „Ora et Labora“
Das Rauhe Haus war durch den Krieg arm geworden. Der Neuaufbau wird zu einem nicht unwesentlichen Teil durch den unermüdlichen Arbeitseinsatz der hauptamtlichen Diakone und der Diakonenschüler ermöglicht.
Der Autor beim Steineklopfen
Haus „Goldener Boden“ vor und nach dem Wiederaufbau
Haus „Johannesburg“ vor und nach dem Wiederaufbau
Neu erbaut oder wiederhergerichtet sind bereits die „Johannisburg“, der „Goldene Boden“ und „Ora et Labora“ mit dem noch kleinen Wichernsaal und fragmentarisch die alte Schule mit der Küche im Keller, Speisesaal im Hochparterre und Wohnräumen für zwei Jungenfamilien in den Obergeschossen. Eine Holzbaracke am Teich ersetzt die „Fischerhütte“.
Holzbaracke am Teich – die „Fischerhütte“
Das Haus „Bienenkorb“ ist im Bau.
Auch das „alte Rauhe Haus“ war im Kriege zerstört worden.
Die restlichen Steine berge ich zusammen mit den Brüdern Lothar Schulz und Udo Pütt. Füßinger will sie später mal bei einem eventuellen Wiederaufbau mit verwenden.
Bergung der Trümmer des alten Rauhen Hauses:
von rechts: Jürgen Ruszkowski – Lothar Schulz – ? ausgetreten ? – Udo Pütt
Mehrere Fassaden der ausgebrannten alten Häuser im Anstaltsgelände stehen am Beginn meiner Ausbildungszeit noch und werden von uns Diakonenschülern eingerissen: Ein Seil wird an einem oberen Fenstersims befestigt, etliche Männerarme packen zu und mit „Hau Ruck“ und einer Staubwolke geht die Mauer zu Bruch. Ich sammle die Steine in eine Schubkarre und fahre sie zu einem hohen Haufen zusammen. Ein Brett wird angelegt und mit Kraft geht es mit der Karre bergan. Mit einem Hammer bewaffnet darf ich Tag um Tag, Woche um Woche, von morgens bis abends die Steine vom alten Mörtel befreien. Mein Weg führt also aus dem Sanatorium übergangslos und direkt hinein in härteste Knochenarbeit.
Abends bis 22 Uhr und sonntags Telefonwache im Haus „Tanne“
Abends und am Sonntag darf ich anschließend bis 22 Uhr Telefonwache an der Zentrale im Haus „Tanne“ machen und alle eingehenden Gespräche vermitteln.
Die Führung der Diakonenanstalt des Rauhen Hauses betreibt die Strategie, den Weizen von der Spreu zu trennen. Wer zu leicht befunden wird, fällt durchs Rüttelrost! Nur handverlesene Männer sollen Diakon werden. Eine harte Schule zum Beginn der Diakonenausbildung ist daher oberstes Gebot. Beim Abbruch der Trümmer der alten Schlosserei (dort befinden sich jetzt die Unterrichtsräume der Fachhochschule) stehe ich an der Rutsche für die Trümmersteine, um diese abzukarren. Dabei geht mir folgendes Bild durch den Kopf: Die Steine werden heil oben in die Rutsche geworfen. Wenn sie unten ankommen, sind sie vom gröbsten Mörtel und Dreck gereinigt, schon durch die Reibung und den Zusammenprall. Aber nicht alle kommen unten heil an. Ein Teil geht entzwei und ist nicht mehr zu gebrauchen. Ebenso ist es mit den jungen Brüdern. Durch die harte Schule in der ersten Zeit fallen alle Illusionen ab. Etliche stehen diese Zeit nicht durch. Sie gehen wieder. Die Austrittsquote liegt zeitweise bei 50%! Ich bin jedoch durch Gerhard Luckow darauf vorbereitet, dass ich mit einer harten Prüfung meiner Dienstbereitschaft rechnen muss und habe eine starke Motivation mitgebracht. - Später entroste ich wochenlang den das Gelände des Rauhen Hauses umgebenden Gitterzaun und streiche ihn neu an. So viel und so schwer wie in dieser Zeit im Rauhen Haus habe ich bisher noch nie gearbeitet, aber ich gewöhne mich daran. In einem anderen Beruf hätte ich nie so engagiert zugepackt, hier lerne ich das freudige Arbeiten nach Luthers Mönchsmotto: Auch die Arbeit der Magd im Kuhstall kann Gottesdienst sein. Ora et labora! Getreu dem Wahlspruch der Diakonissen nach Wilhelm Löhe:
„Was will ich? Dienen will ich. Wem will ich dienen? Dem Herrn in Seinen Elenden und Armen. Und was ist mein Lohn? Ich diene weder um Lohn noch Dank, sondern aus Dank und Liebe; mein Lohn ist, dass ich darf.“
Wenn etwa dieser Diakonissenspruch von einigen Diakonenschülern schon seinerzeit kritisch hinterfragt oder das Choralversfragment „Gott soll’n wir billig loben“ spöttisch zitiert wird, so kann ich diese damals für mich blasphemische Haltung nicht nachvollziehen. Der frühere Leiter der Höheren Fachschule, Peter Stolt, bemerkt dazu:
„Über das Phänomen Brüderschaft ist nur richtig zu urteilen, wenn spirituelle Traditionen mit berücksichtigt werden. Für jede Kommunität ist „disciplina“ ein hoher Wert, so hart die Novizen darunter leiden mögen. Die Sache konnte unter patriarchalischen oder faschistischen Vorzeichen Entstellungen erleiden; es sind Schwachpunkte aufweisbar. Doch blieb für die Ära der Brüderschaft, die Anfang der 1970er Jahre endete, nicht wenig vom ursprünglichen, heilsamen Sinn kommunitärer disciplina erhalten: Arbeit an sich selbst, Zurückstellung des Ich-Willens unter dem aufmerksamen Blick für andere.“
Ich bekomme zu Beginn der Ausbildung ein Taschengeld von 20 DM monatlich. Drei Jahre später, im Sommer 1957, werden es schon stolze 35 DM sein. Davon muss ich Zahnpasta, Friseur, hin und wieder Fahrgeld und Kleidung bestreiten. Meine Eltern unterstützen mich aus der DDR, indem sie mir Unterwäsche und Socken schicken. Aus amerikanischen Kleiderspenden, die das Rauhe Haus zum Anerkennungsentgelt von ein bis zwei Mark je Stück zum Aussuchen anbietet, decke ich mich mit Schlafanzügen, Hosen und einmal sogar mit meinem späteren Hochzeitsanzug, einem abgeschabten schwarzen Kellneranzug, ein. Unterkunft und Verpflegung stellt das Rauhe Haus. Der versicherungspflichtige Wert beträgt 1957 monatlich 72 DM. Meine Wäsche wird auch kostenfrei gewaschen und gepflegt. Geldprobleme habe ich in meinem Leben, auch bei geringem Einkommen, nie. Über einige Notgroschen verfüge ich immer. Eine asketische Grundeinstellung bringe ich mit. Begierde auf Luxus ist mir stets fremd. Einigen Mitbrüdern ist meine Lebenseinstellung zu „karg“ und „kleinkariert“. Genuss ohne Reue zuzulassen lerne ich erst Jahrzehnte später mühevoll von meiner Frau.
Das erste Jahr im Rauhen Haus
Ich führe während der Ausbildungszeit über Jahre hinweg Tagebuch, nicht regelmäßig und oft mit größeren Unterbrechungen. Diese Aufzeichnungen sind in der Sprache des 19-22jährigen Jünglings in der seinerzeitigen Gedanken- und Erlebniswelt verfasst. Ich habe sie mit nur geringfügigen redaktionellen Änderungen hier wiedergegeben, weil sie große Aussagekraft über mein damaliges Befinden haben. Als ich sie nach Jahrzehnten wieder lese, bin ich selber über manche Passagen erstaunt. Ihre Lektüre nach meiner Pensionierung gibt mir auch den Impuls, mir über meinen gesamten Lebensablauf Rechenschaft abzulegen und diese Autobiographie als Selbstreflexion zusammenzutragen. Als Opa kann ich meinen Nachkommen damit aus vergangenen Zeiten erzählen und ein Stück Zeitgeschichte verständlich machen und vielleicht auch einigen Freunden aus jenen Jahren gemeinsame Erlebnisse in Erinnerung rufen. Den Anstoß, diese alten Aufzeichnungen aus dem verstaubten Karton im Keller auszupacken, liefert das Referat des Professors und Konrektors der Fachhochschule des Rauhen Hauses, Wolfgang Braun, anlässlich des 25jährigen Jubiläums der Fachhochschule und der darauf folgenden Leserbriefreaktionen der Brüder Lothar Borowski, Norbert Mieck, Gert Müssig, Horst Schönrock, Erhard Schübel, und Peter Stolt, im Boten der Brüder- und Schwesternschaft, in denen auch dazu aufgerufen wird, die Ereignisse der damaligen Zeit aufzuarbeiten und zu hinterfragen, solange noch Zeitzeugen leben.
Der Prozess des Suchens, des Ringens mit sich und der Umwelt, der langsamen Reifung des jungen Diakonenschülers wird in diesen Tagebuchaufzeichnungen deutlich:
Am 19. Juli 1954 notiere ich: „Die Zeit verrinnt wie im Fluge. Über drei Monate bin ich schon im Rauhen Haus und rechne mich bereits zum Stammpersonal. Ich habe mich eingelebt und kenne die guten und auch die schlechten Seiten der Anstalt. Ideal kann das Rauhe Haus gar nicht sein, denn nichts Menschliches ist vollkommen, aber das ist eine Selbstverständlichkeit. Wie sagt doch August Füßinger?: „Es menschelt überall!“ Jedenfalls fühle ich mich hier ganz wohl. Einiges ist natürlich auch zu bemängeln. Vor allem fehlt mir die geistliche Gemeinschaft unter den Brüdern. Wir auf unserer Stube, überhaupt in unserer Klasse, kommen gut miteinander aus. Es ist doch meistens mehr Kameradschaft als Bruderschaft. Es gibt aber auch einige Brüder, bei denen man wirklich etwas von Bruderschaft spürt. Das Rauhe Haus erscheint mir zu wenig als Anstalt der Kirche, zu wenig Werk der Gemeinde Jesu Christi. Es nennt sich „christliches“ Internat, ist jedoch durch und durch traditionelle konservative autoritäre Verwahr- und Drillanstalt. Vor allem darf ich selber nicht abstumpfen, verknöchern und verkalken! Ich muss mir die jugendhafte Frische erhalten, die ich aus der Jugendarbeit mitgebracht habe, ebenso die Selbstzucht und vor allem muss ich festhalten am Bekenntnischristentum, das uns im Osten geschenkt wurde. Kein Glaube ohne Tat und keine Tat ohne Glauben!“