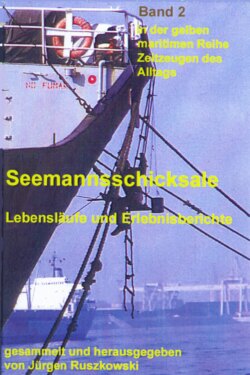Читать книгу Lebensläufe und Erlebnisberichte ehemaliger Fahrensleute - Jürgen Ruszkowski - Страница 5
ОглавлениеJohannes Hubert: Beginn einer Karriere – Schiffsjunge auf großer Fahrt
1894 wurde ich konfirmiert und aus der Schule entlassen. Im Juli sollte dann für mich das große Erlebnis meines jungen Lebens stattfinden, meine erste Reise. Zu dieser Zeit hatte mein Vater seine Schiffe noch nicht verkauft, und ich sollte meine seemännische Ausbildung auf den väterlichen Schiffen erhalten. Mein Vater hatte seinen Dreimastschoner AXEL in Hamburg liegen mit Stückgutbeladung für Pernambuco in Brasilien, und auf diesem Schiff wurde ich als Schiffsjunge angeheuert. Die Besatzung bestand aus acht Mann.
Noch heute weiß ich genau, aus welchen Sachen meine Ausrüstung bestand: drei Wollhemden, drei Unterhosen, vier Paar Wollstrümpfe, ein Sonntagsanzug, zwei Arbeitsanzüge, zwei Schals, ein Paar Seestiefel, ein Paar Schuhe, ein Paar Hausschuhe, ein Ölmantel, eine Ölhose, ein Südwester, eine Matratze, zwei Wolldecken, Kleinigkeiten, wie Seife, Zahnbürste etc. Das war alles. Diese Ausrüstung kostete etwa 300 Mark. Nun fing auch ich an zu verdienen und bekam im Monat 12 Mark Heuer. Voller Erwartung trat ich meine erste Seereise an, und wie jeder Junge träumte ich von wilden Abenteuern. Der Kapitän hatte seine Frau und zwei Kinder an Bord, die diese Reise mitmachten. Es gibt später noch allerlei von dieser Reise zu erzählen. Bis Glückstadt wurde unser Schiff von einem kleinen Schlepper "GOLIATH" geschleppt, dann wurden die Segel gesetzt, und mit eigener Kraft segelten wir bis Cuxhaven, wo der Lotse von Bord ging. Unter vollen Segeln fuhren wir dann durch die Nordsee, am 2. August 1894 passierten wir Dover und segelten mit gutem Wind durch den englischen Kanal.
Im Ozean machte ich aber schon die erste Bekanntschaft mit schweren Stürmen, wir mussten die Segel bergen und mit kleinen Segeln weitersegeln. Das oberste Segel, Royal genannt, musste vom Schiffsjungen - das war ich - festgemacht werden. Also rauf, sich mit Füßen und Beinen festhaltend, mit den Händen arbeiten. Es ist gar nicht so leicht, wie es aussieht, denn bei Sturm liegt ein Schiff wahrlich nicht ruhig in der See, und oben spürt man die Schwingungen bedeutend stärker als unten. Die Reise ging so weiter, bis wir den NO Passatwind 35°Nord antrafen. Der Wind blies dort mit einer Stärke von Beaufort 8. Man kann ihn gut ausnutzen, da er bei SSW-Kurs von achtern kommt.
Nach 30 Tagen wurde der Äquator passiert, natürlich kam dort auch Neptun an Bord, um die übliche Taufe vorzunehmen. Wer noch keinen Taufschein hatte, wurde erst einmal ordentlich eingeseift, mit einem großen Holzmesser rasiert und dann "sanft" unter Wasser gedrückt. Damit war die Taufe vollzogen, und Neptun überreichte den Taufschein. Für mich war es mit meinen eben 14 Jahren ein Erlebnis.
Ende September 1894 kamen wir nach einer 35tägigen Reise in Pernambuco (das heutige Recife) an. Die Freude war sehr groß, denn nun gab es endlich wieder frisches Fleisch, Gemüse usw., denn das ewige Salzfleisch, Salzspeck und der Klippfisch hingen uns schon zum Halse heraus. Nach den üblichen Formalitäten durften wir an Land. Es war angenehm, mal wieder festen Boden unter den Füßen zu haben.
Leider währte der Urlaub nicht lange, denn die Ladung musste gelöscht werden. Dies bedeutete damals eine echte Schinderei, denn alles musste mit Handwinden rausgedreht werden. Früh um sechs hieß es "Alle Mann an Deck!" und bei 30° C im Schatten war dann die Arbeit eine Qual. Wenn um 12 Uhr Mittagspause war, haute man sich irgendwo in eine schattige Ecke, um etwas auszuruhen. An Essen dachte niemand, man hätte doch keinen Bissen heruntergekriegt. Um ein Uhr ging es dann weiter bis abends um sieben. Anschließend musste dann noch das ganze Schiff geschrubbt werden. Das Schiffsdeck wurde außerdem ständig nass gehalten, um ein Austrocknen der Planken zu verhindern. Den Achtstundentag gab es damals noch nicht. Kam man aber endlich todmüde in die Koje, ließen einem die Moskitos keine Ruhe, von den Ratten ganz zu schweigen. Drei Wochen hatten wir im Hafen zu tun, nur der Sonntag gehörte uns. Dass wir uns die ganze Woche darauf freuten, kann man wohl verstehen.
Am 1. Oktober war das Schiff leer. Es wurde mit Sandballast aufgefüllt, und weiter ging es zum nächsten Ziel Macao, etwa 1.000 Seemeilen von Pernambuco entfernt. Acht Tage dauerte die Fahrt. Macao war damals ein kleiner Hafen mit 500 Einwohnern, samt und sonders Eingeborene außer einem 70jährigen Hamburger, der dort eine kleine Bierwirtschaft betrieb. Da Macao keine Kaianlagen hatte, mussten wir auf Reede bleiben. Genau an meinem 15. Geburtstag wurde mit Laden begonnen. Es sollten 100 Tonnen Salz und 1000 Ballen Baumwolle übernommen werden. Zwei Tage brauchten wir erst einmal, um den Sandballast loszuwerden. Der Einfachheit halber wurde er einfach über Bord geschaufelt. Insgesamt 10 Tage brauchten wir also, um die Ladung aufzunehmen. Abends war die Luft dick von den Moskitoschwärmen, so dass man nicht atmen konnte, ohne diese Insekten zu schlucken. Diese Plage war manchmal nahezu unerträglich, aber man war ja jung, da nahm man das alles ohne viele Worte als Tatsache eben hin.
Schiffbruch vor Brasilien
Am 27. Oktober lichteten wir frühmorgens die Anker, setzten die Segel, und bei einer frischen Brise kamen wir gut vorwärts. Nach 12 Seemeilen hatten wir offenes Wasser erreicht, aber vor dem tiefen Wasser war noch eine Barre (Sandbank) zu passieren. In deren Höhe stieß das Schiff durch die Dünung durch und sprang infolge der starken Stöße auf die Sandbank und schlug leck. Wir gaben Notsignale, d.h. wir schossen einige Raketen ab, die gottlob an Land gesehen wurden. Nach einiger Zeit kam ein kleiner aus Holz gebauter Schlepper, der uns - nachdem wir ein Teil der Ladung über Bord geworfen hatten - nach Macao zurückbrachte. Der Rest der Ladung ging an den Ablader zurück. Die anschließende Besichtigung des Schadens ergab, dass das Schiff nicht mehr reparaturfähig war. AXEL sollte nun verschrottet werden, und wir saßen in Macao, auf Nachricht wartend, was weiter geschehen sollte. Im November wurde die gesamte Besatzung bis auf den Kapitän, dessen Familie, den Koch und mich als Schiffsjunge abgemustert und über Pernambuco nach Hause geschickt.
Für uns Zurückgebliebene fing nun eine langweilige Zeit an. Es wurde gefischt, gefischt und nochmals gefischt. Ein Tag verging wie der andere. Ging das Geld aus, wurde etwas vom Inventar verkauft, ansonsten warteten wir auf ein Wunder, das uns in die Heimat zurückbringen würde. Weihnachten verlief ruhig und still, in der Sehnsucht in der Heimat zu sein.
Im Januar 1895 stellte sich an Bord ein erzählenswerter Zwischenfall ein. Der Kapitän war gerade an Land gegangen, als wir - der Koch und ich - aus der Kajüte des Kapitäns lautes Schreien hörten. Wir rannten hin und sahen die Frau des Kapitäns sich vor Schmerzen windend. Sie hatte eine Fehlgeburt, und da an Bord keine andere Hilfe war, mussten wir Hebammendienste leisten. Der Koch eilte los, um den Kapitän zu suchen und einen Arzt zu finden. In dieser merkwürdigen Situation musste ich 15jähriger Bengel der Frau behilflich sein. Ich hätte nie gedacht, dass zu einer Seemannsausbildung auch Wöchnerinnenhilfe gehört. Erst nach zwei bangen Stunden kam der Kapitän und brachte einen Arzt mit. Alles war aber inzwischen gut abgelaufen, und zu meiner Erleichterung wurde ich von meinem Posten abgelöst. Die Frau des Kapitäns erholte sich bald wieder, und alle waren heilfroh, dass sie wieder wohlauf war. Immer noch waren wir in Macao, und niemand wusste, wie lange wir dort noch aushalten mussten.
Da traf uns im Juli ein schwerer Schicksalsschlag. Unser Kapitän erlag einem Herzschlag. Es war gegen Abend, als er starb. Wegen der großen Hitze konnte die Beerdigung nicht lange hinausgeschoben werden, d. h. es musste schnell gehen. Der Arzt kam an Bord und stellte die Sterbeurkunde aus. Holz für einen Sarg gab es in dem Nest nicht, also mussten wir an Land aus Kisten, in denen Streichhölzer verladen wurden, einen Sarg zimmern. Damit er nicht gar so armselig aussah, nagelten wir schwarzen Stoff auf das Holz.
Es war fast Mitternacht, als wir mit einem Kanu zum Schiff zurückruderten. Als wir den Sarg per Flaschenzug fast an Bord gehievt hatten, fiel uns der Deckel runter, und da er aus sehr dünnem Holz war, zersplitterte der Deckel in tausend Stücke. Abermals fuhren wir los und besorgten uns das Material, um einen neuen Deckel zu zimmern. Nachdem uns das gelungen war, betteten wir unseren toten Kapitän in diesen primitiven Sarg. Uns war recht schwer ums Herz, denn wir mochten ihn gern. Seine Familie tat uns so leid, weil sie ihren lieben Toten in fremder Erde lassen musste.
Um sechs Uhr morgens ruderten wir dann mit einem kleinen Boot und unserer traurigen Last in die Nähe des Friedhofes, eine Strecke von gut 10 Kilometer. Wir mussten mit dem Sarg dann noch zwei Kilometer durch Wüstensand. Weil wir immer wieder einsackten, verfielen wir dauernd in Trab. Es waren jeweils sechs Träger, und wir mussten uns wegen der großen Anstrengung oft abwechseln. Auf dem Friedhof mussten wir feststellen, dass die von uns mühsam ausgeschaufelte Grabstätte wieder eingefallen war. So musste bei 40° C die Arbeit nochmals getan werden. Drei weitere Boote mit "Leidtragenden" kamen noch, sicherlich weitgehende Neugierige, denn so viele Leute kannten wir in dem fremden Land gar nicht. Einen Pastor gab es natürlich nicht, so musste ich zur Abwechslung mal den Pastor ersetzen, die Trauerrede halten und das Vaterunser sprechen. Nach der Zeremonie meinte der Koch, dass unser guter Kapitän auch ein Kreuz auf sein Grab bekommen sollte. Wir hatten denn auch bald ein paar Balken aufgetrieben und zimmerten ein Kreuz. Wir hatten gut drei Wochen mit dem Einschnitzen der Inschrift zu tun. Sie lautete:
Hier ruht in Gott, fern von der Heimat
Kapitän Heinrich Lünstedt aus Bützfeld
geboren am 12. März 1859 - gestorben am 15. Juli 1895
Dieses Kreuz brachten wir dann eines Tages zum Friedhof und waren froh, dass unser "Alter" wenigstens ein Grabmal hatte, wenn auch nur in Form eines einfachen Holzkreuzes, das wir mit umso mehr Liebe gezimmert und geschnitzt hatten. Frau Lünstedt quartierte sich an Land ein, von wo sie mit ihren Kleinen am 20. Juli via Pernambuco nach Hamburg zurückkehrte. Nun waren der Koch und ich alleine an Bord zurückgeblieben. Im Laufe der Zeit lernten wir allerlei Menschen kennen. Wir wurden auch oft von dem Ablader eingeladen, einem Kaufmann, der mit meinem Vater in Geschäftsbeziehungen stand und nebenbei Plantagen und Salinen besaß. Er hatte einen Sohn von 10 Jahren und eine Tochter von 14 Jahren. Hier geschah es, dass ich zum ersten Mal mein Herz verlor.
Die erste Liebe
Eines Tages hatte ich einen kleinen Unfall und wurde bei der Familie Herculanum sechs Wochen lang aufgenommen, gepflegt und verwöhnt. Besonders die kleine Elisabeth bemühte sich sehr um mich. Da war es kein Wunder, dass ich mich in sie verliebte und fest entschlossen war, sie eines Tages zu heiraten.
Elisabeth's Eltern mochten mich auch gerne, sie hätten mich am liebsten gleich dabehalten. Ich sollte dann später ins Geschäft einsteigen und es übernehmen. Dass ich für den Plan Feuer und Flamme war, wer könnte das nicht verstehen, aber...
Nach sechswöchigem Aufenthalt bei meinen liebenswürdigen Gastgebern war ich "leider" wieder gesund und musste wieder an Bord zurück. Wir besuchten uns dann noch monatelang gegenseitig. Ich hatte schon nach Hause geschrieben, dass ich in Macao bleiben und Elisabeth Herculanum heiraten wolle. Da hatte ich aber ganz schön ins Fettnäpfchen getreten. Meine Eltern werden schön gewettert haben, jedenfalls hatte Vater an seinen Kapitän Peters geschrieben, der in Pernambuco die WILHELMINE löschte, dass er sich um den verliebten Sohn in Macao kümmern möge. Es wurde wieder Weihnachten und Neujahr 1896.
Am 10. Februar 1896 kam unerwartet Kapitän Peters in Macao an, und ich war über den Besuch ziemlich erstaunt. Schnell stellte sich heraus, dass er Order von meinem Vater hatte, die AXEL zum Abwracken zu verkaufen und mich nach Hause zu befördern. Nun hieß es Abschied nehmen, es flossen endlos Tränen, aber es half nichts, ich musste mit. Bis alles erledigt war, wohnte ich noch mit Kapitän Peters in einem Hotel, d. h. das was man dort so Hotel nannte. Hängematten und drunter liefen Schweine, Hühner und Gänse herum. Über meine Erlebnisse in Macao wusste die Drestedter Familienchronik vor einigen Jahren folgendes zu berichten:
„...Aus fernen Häfen trafen Briefe und Telegramme in Cranz ein, die über Schiff und Ladung sowie Besatzung berichteten und so die Familie immer mit der fernen Welt verbanden. Dabei trafen nicht immer gute Nachrichten ein, und als eines Tages der Kapitän der AXEL aus Macao meldete, dass das Schiff leckgesprungen sei und nicht mehr repariert werden könne, war guter Rat teuer. Es fehlte nicht an Landhaien im internationalen Hafenviertel der "Portugiesischen Kolonie", die jetzt ein Geschäft witterten und nun das Wrack für ein Taschengeld erwerben wollten. Versicherungen, die den Verlust eines Schiffes ersetzten, hatten noch ihre Tücken. So machten sich auf Weisung von Jan Hubert der Kapitän und seine Leute daran, das Schiff in eigener Regie abzuwracken und die einzelnen Teile selbst zu verkaufen.
Es wäre auch alles gut abgelaufen, wenn die AXEL alleine draufgegangen wäre. Aufregender muss es jedoch gewesen sein, als in Cranz die Kunde eintraf, dass auch das Herz des kleinen Johannes leck gesprungen war, und der sein eigenes Lebensschiff nun in den Hafen der Liebe steuern wollte. Hannes war Leichtmatrose auf der AXEL und der Sohn von Jan Hubert. Für solch eine Fahrt schien aber Hannes seinem besorgten Vater noch nicht erfahren genug, und zum Abwracken war er ihm zu schade. Vater Jahn wird damals recht bekümmert gewesen sein... Seine väterlichen Anweisungen an Kapitän Peters (Kapitän Lünstedt war inzwischen in Macao gestorben), wenn nötig die Hilfe des deutschen Konsuls in Anspruch zu nehmen, (Hannes war ja erst 17 Jahre alt und alles andere als mündig) brauchten nicht verwirklicht werden. Johannes kam mit eigener Kraft wieder flott und segelte vor vollem Wind nach Hause, wo er wie ein verlorener Sohn empfangen wurde. Seine dunkle Schöne wird ihn bald vergessen haben, aber für Johannes blieb dieses Macao für sein ganzes Leben mit dem romantischen Zauber der Südsee und mit jugendlicher Schwärmerei verbunden, deren Erinnerungen ihn auf den vielen Fahrten begleiteten. Er soll aber nie mehr mit leckgesprungenem Herzen in fremden Häfen vor Anker gegangen sein." - Soweit die Familienchronik...
Als Leichtmatrose Richtung Heimat
Mit einem kleinen Passagierdampfer fuhren wir nach Pernambuco, und dort wurde ich als Leichtmatrose mit 35 Mark Heuer auf der WILHELMINE, ein Schwesterschiff der AXEL angemustert. Nun konnte die Arbeit wieder losgehen, und bei 40° Hitze mussten Stückgüter gelöscht und Sandballast geladen werden. In Pernambuco herrschte außerdem noch die Pest, aber wir blieben davon verschont. Auf vielen anderen Schiffen war die gesamte Besatzung dieser furchtbaren Epidemie zum Opfer gefallen. Wir aber fuhren nach Mosseiro weiter, 1200 Seemeilen von Pernambuco entfernt. Man musste, um den Hafen zu erreichen, noch viele Kilometer einen Fluss befahren und waren bald vom Urwald umgeben. Da aber auch noch eine Flaute eintrat, mussten wir unser Schiff festmachen, und zwar wurde es an einem Urwaldbaum vertäut. Nun hieß es, auf die nötige Brise zu warten, und es dauerte zehn Tage bis wir endlich den Ladeplatz erreichten. Kamen wir mal wieder wegen zu großer Flaute nicht weiter, kletterten wir von Bord und schlugen uns im Urwald das nötige Holz, um unseren Ofen in der Kombüse in Gang zu halten. Viele Schlangen gab es da, Kobras usw., mit denen man natürlich nicht gerne in Berührung kommen wollte, denn früher hatte man noch nicht das Gegengift, das uns bei einem eventuellen Biss hätte retten können.
Eines Morgens, wir hatten gerade unsere Segel zum Trocknen aufgehängt, wäre es beinah passiert, dass so eine Natter ihr Opfer gefunden hätte, und das wäre ich gewesen. Vorne auf dem Klüverbaum lag das Klüversegel, und ich sollte es wieder festmachen. Als ich es auseinander schlug, kam doch eine große Kobra direkt vor mir hoch. Ich konnte nicht zurückweichen, denn die Schlange versperrte mir den Weg. Ich schrie laut um Hilfe, und der Lotse, der gerade an Bord war, hörte meinen Schrei und ahnte nichts Gutes. Er kam gleich mit einer Handspake angerannt, schlug auf die Schlange ein und traf sie zum Glück, so dass sie über Bord fiel, und so war mein Leben gerettet. Dieses unheimliche Reptil war sicherlich nachts über das Festmachertau an Bord gekommen.
Im Hafen luden wir Salz. Es wurde von Eingeborenen auf ihren Köpfen in Körben an Bord getragen. Die Moskitoplage war kaum auszuhalten. Wir waren selbst nur noch ein einziger Mückenstich. Unsere Salzladung war für Brasilien bestimmt. Dort wurden mit dem Salz Ochsenfleisch und Felle eingepökelt.
Am 26. März 1896 wurden die Trossen losgemacht, und flussabwärts machten wir uns auf den Weg nach Rio Grande del Sul und Porte Allegro. Auf dem Fluss fuhren wir mit Wassersegeln. Das sind Segel, die unter Wasser gesetzt werden. Der Strom läuft dann dagegen an und treibt das Schiff vorwärts. Gerade noch vor Dunkelheit erreichten wir die freie See, ein Glück, denn sonst hätten wir noch eine Nacht den Kampf mit den Moskitos aufnehmen müssen. In den dunklen Nächten war es so finster, dass man nicht einmal das Ufer erkennen konnte. 3600 Meilen dauerte die Fahrt, bis wir in Rio Grande ankamen. Auf See blieb es bei dem ewigen Einerlei, Wache schieben und was es sonst so am Tage an Bord zu tun gab.
Das Wetter war einigermaßen gut, da konnten wir uns dieses Mal nicht beklagen. Im Hafen war es mit dem Zoll genau so, wie es heute noch ist, jeder Winkel an Bord wurde untersucht. Das Löschen der Ladung dauerte neun Tage, es waren nur 150 Tonnen, aber wir mussten ja alles alleine bewältigen, dabei die mörderische Hitze und kein Sonnensegel.
Am 21. Mai fuhren wir weiter nach Porto Allegro. Dort war das Wetter schlecht, es wehte ein Sturm von Windstärke 11, aber wir kamen doch glücklich an. Wir hatten nur ein paar kleine Beschädigungen an Bord. Die Stadt war sehr schön, meist von Deutschen aufgebaut und um 1896 zirka 20.000 Einwohner stark. Es war dort immer eine große Begebenheit, wenn ein deutsches Schiff einlief, und der Besuch von Deutschen nahm dann auch kein Ende. Jeder wollte von der alten Heimat etwas hören, und man war jeden Tag bei einer anderen deutschstämmigen Familie eingeladen, die einen auch sehr verwöhnte. Diese Zeit ging uns natürlich viel zu schnell vorüber, und der Abschied von unseren Landsleuten fiel uns meistens schwer.
Unsere Ladung bestand nun aus Fleisch, und die Reise ging nach Rio de Janeiro. Über diese Stadt will ich nichts weiter berichten, man hat schon so viel darüber geschrieben, dass sich jeder eine Vorstellung machen kann. Für uns gab es in Rio sowieso nur viel Arbeit, und die Salzladung machte uns so viel zu schaffen, so dass der Zuckerhut uns auch nicht trösten konnte. Unser Schiff segelte anschließend nach Buenos Aires. Hier gab es wieder Salz, denn wir sollten Felle laden. Es ging dann etwa 70 Seemeilen den Rio Plata flussaufwärts nach Freibentos. Es war ein kleines Nest, wo nur Liebig's Fleischextrakt hergestellt wurde. Wir luden dort Hörner und Hornspitzen als Unterlagen für die Häute. Damit die Häute nicht mit Holz und Eisen in Berührung kamen, wurden die Hörner hochkant aufgestellt, dicht an dicht. Die Fleischextraktfabrik war ein Großbetrieb. Es wurden im Jahr 180.000 Büffel geschlachtet und verarbeitet. Fleisch gab es in rauen Mengen, und wir haben auch feste reingehauen.
Nachdem wir unsere Hörner endlich verladen hatten, hieß es weitersegeln und zwar einen Fluss hinauf, Paraguay hieß er, ein Nebenfluss des La Plata. Das Segeln macht auf Flüssen einige Schwierigkeiten, denn wenn Flaute war, musste man sofort ankern. Acht Tage brauchten wir, um in Paysandu anzukommen. Dort wurden die Häute verladen, wieder so ein Kapitel für sich. Es ist wohl das schlimmste an Arbeit, was einem begegnen kann. Die Häute wurden im Raum verstaut und dann mit Pökel übergossen. Unser Arbeitszeug war nach einer solchen Beladung vollkommen unbrauchbar geworden und Hände und Füße von der Salzlake aufgerissen. Nach getaner Arbeit sprang man erst einmal über Bord, um das quälende Brennen an Händen und Füßen loszuwerden, aber eine reine Freude war das auch nicht, denn im Wasser konnte man Überraschungen erleben. Ich machte eines Tages die unliebsame Bekanntschaft mit einer "Seeschlange". Wir nannten die Dinger so, es sind wohl die Zitteraale gewesen, bei deren Berührung man einen ziemlichen elektrischen Schlag bekommt. Ich spürte die Berührung noch tagelang hinterher, musste auch einige Tage das Bett hüten, weil ich Fieber von der Berührung bekommen hatte.
In der Nähe von Paysandu war eine deutsch-schweizerische Ansiedlung, wo ungefähr 200 Menschen lebten, die Ziegenzucht betrieben. Es gab dort wohl einige Tausende von Ziegen. Fruchtbares Weideland verschaffte ihnen so einigen Wohlstand. Wir wurden oft von den Siedlern eingeladen. Sie holten uns am Schiff mit ungesattelten Pferden ab. Es hieß draufsteigen, und los ging es im Galopp. So habe ich dann auch reiten gelernt. Ziegenmilch konnten wir trinken, soviel wir wollten. In Schläuchen gaben sie uns noch Milch mit an Bord. Drei Wochen lagen wir da, und es war eine schöne Zeit, bis es eines Tages plötzlich so unsichtig wurde, es sah aus, als wälzten sich dicke Wolkenberge heran. Uns war ganz komisch zumute, und wir konnten es uns nicht erklären, bis dann in der sich verdunkelnden Sonne klar wurde, dass ein Heuschreckenschwarm von erschreckendem Ausmaß über unser Schiff hinweg auf die Siedlung zukam. Jedes Insekt war etwa fünf Zentimeter lang. Es regnete förmlich in Strömen Heuschrecken. Alles, aber auch alles, was gewachsen war, wurde in ganz kurzer Frist von den Tieren aufgefressen, kein Halm blieb stehen. Die ganze Siedlung war damit vernichtet, denn es gab kein Futter mehr für die vielen Ziegen. Bei uns an Deck lagen die Insekten zehn Zentimeter hoch. Die Siedler hatten im Nu alles verloren, was sie sich in jahrelanger Arbeit aufgebaut hatten. Sie mussten alles verlassen und weiterziehen. Uns fiel der Abschied von den lieben Menschen sehr schwer, aber helfen konnten wir ja auch nicht. 20 Ziegen brachten die Siedler uns noch an Bord, damit wir auf der Reise Frischfleisch hatten. Wenn wir dann irgendwo flussabwärts eine fruchtbare Gegend passierten, kletterten wir an Land, um uns Futter für unsere Milchspender zu besorgen.
In Buenos Aires besorgte unser Kapitän erst einmal Frischproviant, denn nun sollte die Heimreise angetreten werden mit dem ersten Anlaufhafen Antwerpen. Am 12. Oktober segelten wir über den Ozean der Heimat zu. Über zwei Jahre war ich nun schon unterwegs, und aus dem kleinen Schiffsjungen war inzwischen ein kräftiger Kerl geworden. Die Reise lief auch gut an, mit der Verpflegung waren wir die drei ersten Wochen auch zufrieden, denn der frische Proviant schmeckte natürlich gut. Leider hielt er nicht länger vor, denn Kühlschränke gab es ja noch nicht, und nach drei Wochen mussten wir dann doch wieder nach altem Rezept den eisernen Bestand verbrauchen. Dann sah unser Menü so aus:
montags – Erbsen mit Salzfleisch
dienstags – Salzfleisch mit Bohnen
mittwochs – Salzfleisch mit Erbsen
donnerstags – Konservenfleisch (genannt "tote Franzosen")
freitags – Salzspeck mit Bohnen
sonnabends – Pflaumensuppe mit Stockfisch
sonntags – "Tote Franzosen" mit getrockneten Kartoffeln.
Der Stockfisch vom Freitag musste am Tag vorher erst mit einem Holzhammer bearbeitet werden, damit er einigermaßen weich wurde. Das Brot war von der langen Reise inzwischen Hartbrot geworden, und wenn man es morgens essen wollte, musste man es erst ausklopfen, damit die unzähligen Kakerlaken herausfielen.
Am 23. November 1896 sahen wir dann zum ersten Mal wieder Land, und bald waren wir im englischen Kanal. Durch die Nordsee hatten wir guten Wind, am 2. Dezember erreichten wir Vlissingen und am 3. Dezember Antwerpen. Auf den frischen Proviant freuten wir uns im Augenblick am meisten. Wir fielen darüber her wie die Wölfe und konnten nicht genug davon bekommen.
Am nächsten Tag, d. h. abends, ging es an Land. Wir hatten alle Vorschuss bekommen und hatten somit Geld in der Tasche. Das erste Ziel war das "Siebenmädelhaus", das einige der älteren Besatzungsmitglieder schon kannten. Es war eine kleine Wirtschaft, und der Wirt hatte sieben Töchter, eine schöner als die andere. Da wurde dann gezecht, getanzt und gesungen, und wir Seeleute waren natürlich ausgelassen wie noch nie, denn wir hatten endlich wieder Land unter den Füßen. Um Mitternacht war für uns viel zu früh Feierabend, und wir konnten am nächsten Tag die Zeit nicht abzuwarten, bis wir unsere Heuer wieder ins "Siebenmädelhaus" tragen konnten. Man muss die Freizeit im Hafen ja auch ausnutzen, das ist nun mal Seemannsbrauch.
Für meine weitere Zukunft hatte ich mir schon einen schönen Plan zurechtgelegt. Ich wollte nämlich als Matrose auf einem englischen Vollschiff anmustern, hauptsächlich, um dort die englische Sprache richtig zu erlernen. Als ich aber meinen Kapitän von diesem Plan unterrichtete, war er empört und wollte erst einmal mit meinem Vater darüber sprechen. Telefon gab es noch nicht, also musste erst einmal hin und her geschrieben werden. Mein Vater verlangte, ich solle erst einmal nach Hause kommen. Meine Enttäuschung war groß, aber das Machtwort des Vaters musste respektiert werden. Da aber das Schiff nicht nach Hamburg fuhr, wurde der Sohn per Bahn nach Hause verfrachtet.
Wieder daheim
Die Freude, alle meine Angehörigen nach so langer Zeit wieder zu sehen, war dann aber auch groß, denn ich war immerhin 30 Monate nicht mehr zu Hause gewesen. Die erste Nacht konnte ich nicht einschlafen, und ich sagte meiner Mutter, sie müsse erst einmal ein paar Eimer Wasser gegen das Fenster schütten, damit ich das Gefühl hätte, noch auf dem Schiff zu sein. Die ganze Familie freute sich, dass ich zum Weihnachtsfest zu Hause sein konnte, und ich fand es auch schön. In Cranz war großer Silvesterball, den ich natürlich nicht versäumen durfte. All die kleinen Mädels, die ich noch von der Schulbank her kannte, freuten sich, dass sie mit dem weitgereisten Hannes tanzen konnten. Sie wunderten sich, dass ich tanzen konnte und wollten unbedingt wissen, wo ich es gelernt habe.
So verging die Zeit bei Muttern ganz zufriedenstellend, aber es zog mich wieder in die weite Welt. Ich suchte mir ein Schiff, wo ich als Matrose anmustern konnte, schon wegen der Heuer, da gab es nämlich den enormen Verdienst von 45 Mark monatlich. Aber ich hatte kein Glück, denn es brach ein Streik aus, und so musste ich notgedrungen noch zu Hause bleiben, denn als Streikbrecher wollte ich auch nicht gerne fahren.
Es war damals ein ganz besonders strenger Winter. Este und Elbe waren zugefroren, und man konnte ganz bis nach Blankenese rüberlaufen. Um sich die Zeit zu vertreiben, legten wir wieder wie früher Quabbenangeln aus, denn ganz ohne Beschäftigung konnte man doch nicht sein. Als aber Ende Februar der Streik zu Ende war, ging ich sofort zu unserem Heuerbaas und musterte am 1. März 1897 auf der „THEKLA“, dem größten Segelschiff, das wir in Deutschland hatten an. Die Reise ging zur Westküste Südamerikas, um Kap Horn herum.
Auf See zu neuen Ufern
Die Thekla war ein Vollschiff, d.h. ein Schiff mit drei voll getakelten Masten, die 60 Meter hoch waren. Sie konnte 4000 Tonnen laden und hatte 42 Mann Besatzung. Am 4. März 1897 ging die Reise los, zwei Schlepper zogen die THEKLA elbabwärts. Wir machten gute Fahrt durch die Nordsee und passierten am 6. März Dover. Bei der Insel Wright drehte der Wind, wir mussten drei Tage auf der Stelle kreuzen und kamen nicht weiter. In Cardiff wurden wir am 16. März von zwei Schleppern an unseren Liegeplatz gebracht. Wie immer folgte die übliche Zollrevision, aber es wurde selbst nach vierstündigem Suchen nichts gefunden, und das Schiff wurde freigegeben.
Zwölf Tage dauerte es, bis wir unsere Ladung gepresster Kohle an Bord hatten, dann reisten wir weiter durch den Bristolkanal in den Atlantik. Bei gutem Wetter machten wir eine prima Fahrt, zeitweise 17 Knoten, also mehr, als unsere größten Passagierdampfer leisten konnten. Zur Ruhe kamen wir nicht viel, und unsere Arbeitszeit dauerte 14 bis 16 Stunden am Tag. Heute würden sich die Leute schönstens bedanken, wenn man ihnen solche Arbeitszeiten zumuten würde, dabei wurden Überstunden nicht etwa besonders vergütet. Als wir in der Nähe des Äquators waren, bemerkte der Kapitän, dass das Schiff ziemlich steif war, d. h. wir hatten zu viel Ladung im Unterraum. 200 Tonnen Kohlen mussten wir nun aus dem Unterraum ins Zwischendeck bringen, um so Abhilfe zu schaffen. Die Arbeit nahm sechs Tage in Anspruch, und bei der Äquatorhitze war es eine verteufelt anstrengende Arbeit. Durch den Teergehalt in der Presskohle, brannte uns die Haut bald am ganzen Körper, und es gab dabei viele wunde Stellen.
Am 1. Juli 1897 begannen furchtbare Stürme, sie machten uns viel zu schaffen, und Schlaf bekam man kaum noch, denn wenn auch Wachablösung war, die Freiwache musste immer zupacken, wenn die Segel festgemacht werden mussten. Kap Horn ist eben Kap Horn. Wenn man bei so stürmischen Wetter aus seiner Koje kam und an Deck ging, kam es nicht selten vor, dass man gerade in einen Brecher lief und buchstäblich schwimmen musste, obgleich man noch nicht über Bord gegangen war. Die Seen waren oft unvorstellbar hoch. Wir haben, um ungefähr 2.400 Seemeilen zurückzulegen, vom l. Juni bis 15. Juli gebraucht, das sind 45 Tage. Um Kap Horn herum zu fahren, war damals eine gefährliche Sache, der Seegang dort ist nicht zu beschreiben, aber man singt ja heute noch manches Lied, das von Kap Horn handelt.
Zu allem Unglück wurde auf dieser Reise auch noch der Koch krank. Er konnte seinen Dienst nicht mehr versehen, und ausgerechnet ich musste nun sein Amt übernehmen, dabei verstand ich genau nichts von der Kocherei. Nach dem schon früher beschriebenen Wochenplan musste ich nun mein Heil versuchen, die täglichen Mahlzeiten durften ja nicht ausfallen. Also erst mal Erbsensuppe mit Salzspeck. Das war schon ein Kapitel für sich, denn so lange ich die Erbsen auch auf dem Feuer hatte, sie wurden einfach nicht weich. Irgendwo musste ich aber mal aufgeschnappt haben, dass man mit Natron die Hülsenfrüchte weich bekommt, aber wo sollte ich an Bord Natron herholen? – Ich dachte schon mit Schrecken an all die Lästermäuler, wenn die harten Erbsen aufgetischt würden und überlegte hin und her, wie ich mich da aus der Schlinge befreien könnte. Schließlich dachte ich bei mir, dass Soda doch eigentlich auch gehen müsste. Ich organisierte mir gleich ein ganzes Pfund, und das wanderte dann in meinen Kochtopf. Nach ganz kurzer Zeit wurden die Erbsen auch butterweich, und die Mahlzeit schmeckte vorzüglich und wurde auch restlos vertilgt. Aber am Abend dann, oha – oha... Die Lauferei nahm kein Ende, ich habe mich vorsichtshalber gar nicht sehen lassen, denn die ganze Wut galt mir, dem Vizekoch, aber ich konnte doch diese durchschlagende Wirkung nun wirklich nicht voraussehen. Jedenfalls konnte sich niemand über schlechte Verdauung beklagen.
Im Laufe der Zeit lernte ich dieses Küchenhandwerk einigermaßen, war aber heilfroh, als nach einigen Wochen der Koch sein Amt wieder übernehmen konnte. Ich war glücklich, endlich wieder Seemann sein zu können, und die Besatzung war ebenso froh, nicht mehr Opfer meiner Kochkunst sein zu müssen.
Am 1. Juli hatten wir die Sturmgrenze überschritten und nach langer Zeit mal wieder Gelegenheit, uns etwas zu pflegen, d.h. uns mal gründlich zu waschen. Inzwischen hatte unser Körper schon eine richtige Salzschicht bekommen, denn wenn es nicht gerade einmal regnete, war keine Möglichkeit vorhanden, sich mit frischem Wasser zu waschen, und das Seewasser ist auf lange Sicht scheußlich. Das Trink- und Kochwasser durfte zum Waschen nicht genommen werden.
Im August 1897 kamen wir in Iquique an, einer kleinen Stadt mit zirka 10.000 Einwohnern, ein furchtbar eintöniges Nest, wo kein Baum und kein Strauch wuchsen. Trinkwasser musste aus Valparaiso geholt werden, denn in Iquique regnete es das ganze Jahr nicht. Wasser war daher eine Kostbarkeit, und man musste sehr sparsam damit umgehen. Im Hintergrund von Iquique war viel Gebirge, und dort wurde Salpeter gewonnen. So luden auch alle Segler, die diesen Hafen anliefen, Salpeter. Unsere Kohlenladung wurde von der eigenen Besatzung in Prähme verladen, eine schwere Arbeit, denn fast immer waren 40 Grad Hitze. Abends war man dann pechschwarz vom Kohlenstaub. Zum Waschen bekamen wir dann nur drei Eimer Wasser für 36 Mann. Wer zuerst kam, hatte natürlich Glück, bei dem letzten lief das Wasser kaum noch durch die Finger, so dick war es von dem Dreck geworden.
Manchmal hatte man auch Glück an Bord. So wurde ich mal vom Kapitän ausgesucht, als sein Gigmann zu fahren. Die Gig war das Boot, mit dem der Kapitän immer an Land fuhr, wenn wir auf Reede lagen. Wenn man so ein Pöstchen erwischt hatte, brauchte man nur auf das Boot aufpassen, es natürlich sauber halten und immer bereit sein. Jeder Kapitän wollte selbstverständlich den anderen ausstechen und mit seinem Boot angeben. Ich musste immer fein in Schale sein. Die Sachen lieferte der Käptn, blaue Hose, weißes Hemd und weiße Mütze. Der Kapitän hatte auch eine Schappkiste an Bord, das war eine Kiste, deren Inhalt aus lauter Dingen bestand, welche die Seeleute gebrauchen konnten und die der Kapitän ihnen verkaufte. Sicher hat er daran manche Mark extra verdient. Man konnte so allerlei einkaufen, nur Alkohol durfte er nicht ausgeben, das war zu gefährlich. Aber den besorgten wir uns heimlich an Land. Offiziell war es natürlich streng verboten, aber wo ein Wille ist, ist auch ein Weg, da kannten wir uns aus. Wir besorgten uns beim Schiffshändler einen Schlauch, den ließen wir mit Alkohol füllen, banden ihn uns um den Bauch und warteten, bis der Kapitän außer Sicht war, dann ließen wir den Schlauch an einer Leine über Bord gehen und holten uns den Segen, wenn die Luft wieder rein war, aufs Schiff zurück.
Als wir am 1. August seeklar waren, wurde uns von den Amerikanern, Engländern, Norwegern, Schweden, Dänen, Italienern und Franzosen, die damals die besten Segelschiffe hatten, drei shares gegeben, d. h. drei Hurras für die THEKLA. Die ganzen Mannschaften mussten dann antreten, und mit Hallo wurde eine gute Reise gewünscht. Das war immer recht feierlich, heute macht man das nicht mehr. Morgens bei Tagesanbruch wurden die Trossen gelöst und die Anker gelichtet. Mit Schlepperhilfe ging es dann aus dem Hafen. Nochmals drei Shares von jedem Schiff, das wir passierten, und dann waren wir auch bald im freien Wasser. Alle Segel wurden gesetzt, und bei schönem Wetter und frischer Brise segelten wir südwärts Kurs Kap Horn. Im September passierten wir wieder Kap Horn, das Wetter war stürmisch, bei Orkan aus Südwest, doch der Wind kam von achtern, da machten wir trotzdem noch gute Fahrt. Die Seen brachen mittschiffs über Deck, das Deck wurde überhaupt nicht mehr trocken. Heilfroh waren wir alle, als wir dann Kap Horn hinter uns hatten, es ist doch eine verteufelte Ecke.
Ende September wurde das Wetter dann viel ruhiger, und es wurde auch bedeutend wärmer. Sogar der ersehnte Regen kam, wir konnten die Regensegel aufspannen und so das kostbare Nass auffangen. Wir sehnten uns auch danach, uns mal mit Regenwasser waschen zu können.
Im Oktober war dann wieder der Äquator fällig, aber wir hatten keine Brise und kamen nur langsam vorwärts. Die Hitze machte uns auch wieder Kummer und weit und breit keine Regenwolke zu sehen. Endlich nach zehn Tagen bekamen wir wieder Wind, und so konnte die Fahrt weitergehen. Langsam musste man nun daran denken, das Schiff sauber zu machen, denn die Heimat muss man im besten Kleid begrüßen. Das ganze Deck musste mit Sand und Steinen geschrubbt werden, und man lag dabei den ganzen Tag auf den Knien. Es musste aber auch alles blitzen und blinken, ehe aufgehört wurde, nirgends durfte ein Rostflecken zu sehen sein, denn jeder Kapitän will ja möglichst das sauberste Schiff haben, wenn er im Heimathafen ankommt.
Nach einer schönen Reise über den Atlantik kamen wir am 1.12.1897 morgens in Falmouth an und bekamen dort Order, nach Nordenham zu fahren. In Falmouth wurde aber erst mal frischer Proviant eingekauft, es war auch die höchste Zeit, denn fast die ganze Besatzung hatte Skorbut bekommen. Es fehlten eben die Vitamine.
Im englischen Kanal hatten wir westliche Winde und passierten bald Dover. In der Nordsee hatte dann Neptun noch mal feste aufgeblasen, und wir mussten vor der Weser beidrehen. Es herrschte eine bittere Kälte, alle Segel waren steif gefroren, und wir brauchten sechs Stunden, um die Obermarssegel festzumachen. Es war eine schwere Arbeit, aber das kann nur der verstehen, der es selbst einmal machen musste.
Am nächsten Tag flaute es etwas ab, es kamen zwei große Schlepper (WOTAN und GOLIATH), die uns in Schlepp nahmen. Wir alle waren überglücklich, endlich einmal wieder Heimatluft zu atmen, und am 7. Dezember 1897 nachmittags um 5 Uhr machten wir unser Schiff am Pier in Nordenham fest.
Endlich war Feierabend. Abends, wie sollte es wohl anders sein, wurde sich landfein gemacht und dann nichts wie los. Die zwei Wachleute, die an Bord bleiben mussten, taten uns wohl leid, aber wer hat, der hat. Zu lange waren wir fern der Heimat, nun wollten wir erst mal wieder etwas erleben. Die Wirte waren damals auch schon auf Draht, sie wussten, dass die Seeleute nach einer langen Reise nicht geizig waren. So hatte auch der Wirt in Nordenham in weiser Voraussicht eine Musikkapelle bestellt und alle Mädchen von Nordenham eingeladen. Sie kamen aus Nordenham und Umgebung, und so wurde dann fleißig das Tanzbein geschwungen und manches Glas getrunken.
Am 9. bekam ich meine Heuer ausbezahlt und fühlte mich als Krösus, denn für neun Monate bekam ich 405 Mark. Vormittags musterte ich dann auf dem Seemannsamt ab, dann wurde die Seekiste gepackt, und ab ging es zu Muttern. Große Freude natürlich zu Hause: Der Hannes ist wieder im Land. Ich war eben in Cranz und besonders bei den kleinen Mädchen sehr beliebt. Der Silvesterball in Cranz wurde nicht ausgelassen, bis morgens gefeiert, schnell eine Mütze voll Schlaf und Neujahr weitergemacht. Geld hatte ich ja nun, und früher war die Mark auch mehr wert als heute, wenn auch nicht so viel verdient wurde.
Asien
Bis zum 15. Januar 1898 blieb ich zu Hause und musterte dann als Matrose auf der "GERDA" an. Diese Reise sollte mich nach China führen, d. h. China, Japan, Indien und zurück. Am 17. musste ich an Bord sein. Der Dampfer war 3.000 Tonnen groß, für Fracht und Passagiere eingerichtet, konnte 60 Passagiere erster Klasse mitnehmen, außerdem in den Zwischendecks noch 300 Personen. Diese Klasse war hauptsächlich für Kulis gedacht, die von Singapore nach Hongkong, Schanghai und zurück wollten.
Die Besatzung bestand aus 42 Mann, darunter 20 Chinesen, die als Heizer und Trimmer verwendet wurden und noch ihre Zöpfe trugen. In Hamburg wurden für die Reise Stückgüter geladen. Am 20. verließen wir ungern den Heimathafen. Das Wetter war gut, aber die Elbe hatte viel Eis. Im Kanal wehte frischer Ostwind, und so kamen wir gut vorwärts. Am 24. mittags kamen wir in Le Havre an, dort wurde der Rest der Ladung übernommen, und am 27. fuhren wir weiter.
Am 3. Februar passierten wir Gibraltar, und weiter ging es durch das Mittelmeer nach Port Said, wo wir am 12. ankamen. Hier wurden dann erst mal die Bunker wieder aufgefüllt, denn wir mussten ja Brennstoff für die weite Fahrt über den Indischen Ozean nach Indien haben. Die Fahrt durch den Suezkanal dauerte ungefähr 16 Stunden, und wenn andere Schiffe entgegenkamen, musste man erst noch - z. B. am Bittersee - warten, bis die entgegenkommenden Schiffe das Fahrwasser passiert hatten. Im Roten Meer gab es dann zur Abwechslung mal wieder einen Sturm von Windstärke 12. Der Sturm kam von der Sahara und unser Schiff war in kurzer Zeit von dem Wüstensand bedeckt. Wir hatten dort so um 50 Grad Hitze, und dabei mussten wir noch die Kohlen laden und die Kohlen, die z. T. noch an Deck untergebracht waren, in die Bunker schaufeln. Dass wir dabei gefroren haben, kann man nicht behaupten. Am nächsten Tag flaute der Sturm aber ab, und am 24. passierten wir Aden. Mit voller Fahrt ging es durch den indischen Ozean, und am 4. März kamen wir an Ceylon vorbei. Unseren ersten Hafen Penang liefen wir am 12. März 1898 an, wo dann ein Teil unserer Ladung gelöscht wurde. Singapore erreichten wir am 14., und auch dort wurde etwas Ladung zurückgelassen. Dann wurden die Zwischendecks zur Übernahme von etwa 400 Kulis in Ordnung gebracht. Viel Umstände wurden da aber nicht gemacht. Sie mussten sich selber ein Lager suchen, und auch um die Verpflegung mussten sie sich selber kümmern. Sie aßen aber auch nur ihren Reis.
Die Fahrt nach Hongkong wurde am 18. März fortgesetzt. Abends wurden die Luken zum Zwischendeck abgeschlossen, damit die Kulis keine Überfälle auf die Besatzung machen konnten, und wir wurden mit Gewehren ausgestattet. Die Dampfschläuche wurden an Deck angebracht, und wenn sich nun Zwischenfälle ereignet hätten, wären wir auf alles vorbereitet gewesen. In der damaligen Zeit kam es nämlich häufig vor, dass sich Seeräuber unter die Kulis mischten, die dann im geeigneten Moment die Besatzung überfielen und das Schiff kaperten. Wir hatten Angst genug, dass uns so etwas auch einmal passieren könnte und standen deshalb klar zum Gefecht. Morgens wurden die Luken wieder aufgemacht und erst mal nachgesehen, ob nicht während der Nacht Kulis gestorben waren. Das kam häufig vor. Wir fanden auch zwei Tote, aber von deren Sachen war nicht ein Stück mehr da, natürlich wusste niemand, wo die Sachen geblieben waren. Am nächsten Morgen gab es wieder Tote. Sie wurden dann in Segeltuch eingenäht und ins Meer versenkt. Wir kamen dann aber – Gott sei Dank - ohne weitere Zwischenfälle in Hongkong an, dort kümmerte sich die Polizei darum, dass die Kulis von Bord kamen. Diese Kulis waren Arbeiter, die sich für zwei Jahre nach Singapore verdungen hatten und nun in ihre Heimat zurück fuhren. Die Zwischendecks nachher sauber zu machen, war einfach ekelhaft, so viel Schmutz auf einmal gab es sonst nicht. Es ist einfach nicht zu beschreiben.
Shanghai liefen wir am 1.April 1898 an, eine richtige Chinesenstadt, sehr schmutzig, die Menschen zerlumpt gekleidet, für uns ein ungewohntes Bild. Wir blieben nicht lange, denn am 3. April ging es weiter nach Kobe (Japan). Dort kamen wir am 8.4. an, und die Beladung unseres Schiffes konnte sofort beginnen. Dieses Mal nahmen wir Reis über. Kobe ist eine schöne saubere Stadt, ganz das Gegenteil von Shanghai, aber leider blieben wir hier nur zwei Tage, zu wenig Zeit, um viel zu sehen, aber auch damals hieß es schon "Zeit ist Geld".
Nach einer Tagesreise landeten wir in Hiogo, dort war es aber auch nett, und besonders die hübschen Geishas hatten es uns angetan. Wirklich süß sind die. Aber wir mussten leider weiter, dieses Mal nach Jokohama. Diese Stadt ist wohl die schönste Japans, und wir deutschen Seeleute waren dort auch sehr willkommen. Kaum hatte das Schiff festgemacht, als auch schon die fliegenden Händler an Bord kamen. Sie packten gleich ihre Ware aus und fingen einen schwunghaften Handel an. Das ganze Deck sah wie ein Laden aus, man konnte rein alles bekommen: Teeservice, Vasen, Figuren etc... Wir wurden von unseren älteren Kollegen, die schon öfter hier waren, erst mal aufgeklärt, wie so ein Kauf zu handhaben sei, und dann ging der Handel los. Am ersten Tag muss man noch nicht kaufen, nur handeln. Erst kurz vor der Ausfahrt, wenn die Händler Angst bekommen, nichts mehr los zu werden, kann man kaufen, denn dann zahlt man höchstens noch den vierten Teil dessen, was sie am ersten Tag forderten. Ich kaufte mir ein Teeservice, ganz dünnes Porzellan, es sollte erst nach unseren Geld Hundert Mark kosten, aber ich bekam es für 9,50 Mark: 12 Tassen und Teller, Kannen, Milchkannen und verschiedene kleine Schalen. Das Service ist heute noch da, und z. Z. liebäugelt mein Sohn damit, aber... Außerdem erstand ich noch zwei große Vasen, die sollten erst 80 Mark kosten, aber ich zahlte dann 5 Mark dafür. Eine der Vasen existiert noch, die hat mein Sohn bekommen. Dass die Händler schrecklich lamentierten und behaupteten, die Käufer ruinierten sie, gehört zum Geschäft, sie verdienen sicher noch genug an der Ware.
Unser Schiff war inzwischen voll beladen, bis auf einen Raum, der für Bunkerkohle frei bleiben musste. Am 15.April 1898 morgens dampften wir weiter nach Moji. Die Fahrt dauerte nur vier Stunden, dort nahmen wir die Kohlen über, die wir für die Reederei nach Shanghai bringen mussten. Wir lichteten am 17. April die Anker, um Kurs auf die Heimat zu nehmen. In Singapore konnten wir noch einmal an Land gehen, und natürlich, wie sollte es auch anders sein, wurde dort noch einmal groß eingekauft. Der Kapitän hatte sich auf Schleierschwänze spezialisiert. Da musste auf Deck erst mal ein Aquarium gebaut werden, und dann kamen etwa 4.000 Schleierschwänze und 500 Teleskopfische hinein. Die Fische waren sehr wertvoll und in Hamburg ein begehrter Artikel, der einen großen Nebenverdienst versprach. Jeder an Bord kauft nun irgendein Viehzeug: Affen, Schlangen, kleine Wildtiere wie Leoparden etc. Das ganze Zwischendeck sah aus wie ein Zoo. Wir hatten unterwegs unseren Spaß an all den Tieren. Der Zimmermann fuhr diese Strecke schon seit zehn Jahren, und er gab uns die besten Ratschläge, besonders welche Tiere sich zum Verkauf in Hamburg am besten eigneten. So musste eine Schlange wenigstens zehn Fuß lang sein, sonst hatte sie keinen Wert für die Käufer, und man konnte sie dann nicht loswerden.
Die Hitze im Hafen war sehr groß, und wir waren heilfroh, als wir endlich in See stechen konnten. Am 16. Mai 1898 waren wir in Suez, es folgte die übliche Fahrt durch den Kanal nach Port Said. Weitere Stationen der Fahrt waren am 24. Mai Gibraltar, am 2. Juni Ouessant, und am 3. Juni kamen wir in Le Havre an, wo wir die für Le Havre bestimmte Ladung löschten. Hatten die Tierhändler erfahren, dass ein Schiff aus Singapore im Hafen lag, waren sie nicht mehr zu halten, sie stürmten das Schiff und wollten alles aufkaufen, was wir von dort mitgebracht hatten. Selbst Hamburger Händler waren dem Schiff entgegengefahren, um nur die ersten zu sein. Wir waren aber ja auch nicht von gestern, wir wussten genau, dass Hagenbeck besser bezahlte, und so hielten wir unsere Schätze zurück. Vor dem Aquarium hatte der Kapitän sogar eine Wache aufgestellt, denn die Händler wären in ihrer Wut fähig gewesen, das Wasser zu vergiften, denn sie ärgerten sich sehr, dass sie uns nicht übers Ohr hauen konnten. Wachmann für die Fische war ich dieses Mal und bekam vom Kapitän 10 Mark dafür. Das war damals ein Batzen Geld, und ich freute mich sehr darüber.
Am 6. Juni fuhren wir durch den englischen Kanal und durch die Nordsee der Heimat entgegen. Im Hamburger Hafen machten wir am 9. Juni 1898 die Leinen fest, die Heimat hatte uns wieder. Vier Monate und 24 Tage hatte die Reise gedauert. Ich hatte viel von der Welt gesehen, aber auch viel arbeiten müssen, denn vor 60 Jahren wurde es uns nicht so leicht gemacht wie heute. Die seefahrende Jugend glaubt es nur nicht und ist überzeugt, dass sie heute mehr leisten muss. Unsere ersten Besucher an Bord waren natürlich die Händler. Ich verkaufte meine Schlange für 80 Mark und meinen Affen für 40 Mark. An den beiden Tieren hatte ich 110 Mark verdient, das war vielleicht ein Geschäft!
Nun musterte ich wieder ab, und mein nächster Weg führte mich wie immer nach Cranz. Schönes Geld hatte ich verdient, und das Goldgeld sah auch viel wertvoller aus, man konnte so schön damit klimpern. Ich hatte zwar an Heuer nur 264 Mark verdient, fühlte mich aber reich. Mein Vater holte mich am Cranzer Dampfer ab und war ausnahmsweise einmal sehr spendabel, er gab einen Grog aus. So etwas wurde früher besonders hoch angerechnet. Ich war sehr stolz, mit meinem Vater zusammen im Gasthaus zu sitzen und Grog zu trinken. Nach dieser Reise folgte wieder ein unfreiwilliger Heimaturlaub, denn man streikte mal zur Abwechslung wieder und zwar sechs Wochen lang, aber auch diese Zeit ging vorüber, und ich musterte bei Laisz an.
Vollmatrose auf der "PAMELIA"
PAMELIA nannte sich das Schiff, 3.000 Tonnen Ladefähigkeit hatte es. Es war als Bark getakelt, d. h. zwei volle Masten mit Rahsegeln und ein Mast mit Gaffelsegel. Am 21. Juli 1898 erfolgte die Anmusterung als Vollmatrose mit 60 Mark Heuer im Monat. Unser Schiff hatte 24 Mann Besatzung und fuhr nach Santos (Brasilien). Nun hieß es wieder von Hamburg Abschied nehmen, und am 26. Juli passierten wir Dover. Im Kanal hatten wir Gegenwind, und im Atlantik waren die ersten Tage stürmisch, und dauernd mussten die Segel los- und festgemacht werden. Unser Kapitän war dazu noch ein sehr unfreundlicher, herrischer Mann und bei der Besatzung denkbar unbeliebt. Das Essen ließ zu wünschen übrig, also schmeckte die Arbeit auch nicht. Fünf neue Täuflinge hatten wir am Äquator, die Taufe war für die, die diese Prozedur schon kannten, immer wieder eine Gaudi.
Am 10. September erreichten wir Santos, und dort mussten wir acht Tage bleiben, weil wir das Entladen nur mit eigenen Leuten schaffen mussten, außerdem waren noch drei Mann ausgerückt, denen es an Bord nicht mehr gefiel. Der Kapitän war darüber schrecklich aufgeregt, setzte Himmel und Hölle und die Polizei in Bewegung, um die Ausreißer wieder einzufangen. Nach fünf Tagen hatte die Polizei die Ausreißer auch tatsächlich in Sao Paulo, einer deutschen Siedlung in der Nähe von Santos, aufgegriffen und an Bord gebracht. Das Donnerwetter war nicht von schlechten Eltern, aber die Leute waren zu verstehen, denn an Bord war es wirklich fast nicht auszuhalten.
Damals war Sao Paulo eine Siedlung von 3.000 Einwohnern, heute ist Sao Paulo eine Großstadt. Von deutschen Familien wurde ich oftmals eingeladen. Sie holten mich dann mit Pferden ab, bis zur Siedlung musste man dann noch 30 Kilometer reiten. Das Essen bei den Siedlern war nach dem ewigen Schlangenfraß an Bord geradezu ein Festgeschenk, und ich langte feste zu. Die Ansiedler mochten mich wohl gerne leiden, sie versuchten wenigstens, mich zu überreden, bei ihnen zu bleiben. Sie versprachen sogar, mich zu verstecken. In den schönsten Farben malten sie mir die Zukunft aus, aber ich konnte mich doch nicht entschließen, meine geliebten Schiffsplanken zu verlassen. Auf der PAMELIA brauchte ich ja auf Dauer nicht zu bleiben. Die Siedler bedauerten meinen Entschluss sehr, mir fiel der Abschied von ihnen gar nicht leicht, aber ich war nun einmal Seemann. Wer weiß, vielleicht hätte ich wirklich dort einmal mein Glück machen können, denn die Stadt hatte in den darauffolgenden Jahren einen enormen Aufstieg.
Mit Sandballast und einer Ladung Mate setzten wir unsere Reise fort und waren am 28. September in Valparaiso. Die See war gut, und so kamen wir schnell bis Kap Horn. Da es Frühling war, hatten wir meistens gutes Wetter und konnten innerhalb der Falklandinseln gehen und dadurch einen ziemlichen Weg abschneiden. Kap Horn passierten wir am 13. Oktober 1898 bei ganz klarem Wetter, es war das einzige Mal, dass ich Kap Horn richtig gesehen habe. Man bleibt sonst immer in ziemlich respektvollem Abstand von dieser berüchtigten Ecke. Der Kap-Horn-Fahrer sagt immer, wenn er gut ums Kap Horn kommt, hat er Glück gehabt oder der liebe Gott hat geholfen. Der Wind war südlich, und so segelten wir mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von zehn Kilometern nach Valparaiso, wo wir am 24. Oktober eintrafen.
Iquique, das 830 Seemeilen weiter war, mussten wir auch noch anlaufen. Unser Schiff wurde dort zwischen all den großen Schiffen im Hafen vertaut, vorne beide Anker ausgeworfen und hinten an einer Boje festgemacht. 18 Schiffe aller Nationen waren im Hafen, um Salpeter zu laden, denn etwas anderes gab es dort nicht. Bis zum 10. Dezember 1898 dauerte es, bis wir unser Schiff beladen hatten, denn es waren zu viele Schiffe da, da hieß es Schlange stehen.
Das Auslaufen aus dem Hafen von Iquique beschrieb ich schon einmal, und so wurden wir auch dieses Mal mit drei Hurras auf die Reise geschickt, eine Reise, die für uns immer die schönste war, denn es ging Kurs Heimat und in diesem Fall sogar direkt nach Hamburg. Genau am heiligen Abend passierten wir Kap Horn, der Wettergott bescherte uns einigermaßen gutes Wetter (es war dort gerade Sommerzeit), und so konnten wir das Christfest mit Kaffee und Kuchen, den wir „Panzerplatten“ nannten, feiern. Zum Abschluss spendierte der Kapitän wahrhaftig noch einen Grog. Er hatte auch wohl so etwas wie Weihnachtsstimmung, sonst hätte das bestimmt nicht passieren können. Sogar das Essen war in diesen Tagen bedeutend besser als gewöhnlich, es gab für jeden Mann ein halbes Pfund Schinken, Kekse aus Dosen und Butterkuchen. Den aber verstand der Koch nicht zu backen, es wurden immer wieder Panzerplatten. Silvester um 24 Uhr gab es Punsch und wieder brach ein neues Jahr an, eines von den vielen meiner langen Fahrenszeit.
So langsam mussten wir daran denken, unser Schiff wieder auf Hochglanz zu polieren. Da wurden die Farbtöpfe herausgeholt, denn auf der Elbe musste das Schiff wie eine Luxusjacht aussehen. Den Äquator hatten wir schon hinter uns gelassen, am 24. März 1899 passierten wir Lizard, die SW-Ecke Englands. Zwei Tage vor Lizard kletterten wir schon auf den höchsten Mast (60 Meter hoch), um auszugucken, ob bereits Land in Sicht sei. Wer zuerst Land sah, bekam ein paar Schnäpse. Auf einmal schrie einer: "Land in Sicht". Endlich mal wieder Land zu sehen, das war schon ein Erlebnis. Am 2. April 1899 waren wir glücklich wieder in Hamburg, und Hannes musterte so schnell wie möglich ab, mit 450 Mark Heuer in der Tasche. In Cranz wurde ich schon erwartet, aber ein Seemann kann nicht lange rasten und lange an Land zu bleiben ist nicht Seemannsart.
Mit Passagieren nach Levante
Also musterte ich wieder auf einem anderen Schiff an. Es war die "PERA", ein Fracht- und Passagierdampfer, der 80 Fahrgäste mitnehmen konnte und Tourenfahrten nach der Levante machte. 60 Passagiere fuhren mit, als am 26. April 1899 die Reise losging. Das Wetter war gut und die Gäste guter Laune, in der Hauptsache deshalb, weil sie noch nicht seekrank waren. Der Dampfer lief bei gutem Wetter 13 bis 14 Kilometer, das war in der damaligen Zeit eine sehr große Fahrt.
Am 28. April kamen wir in Le Havre an. Früh um sechs Uhr kam dann die schwarze Gang an Bord. Schwarze Gang war ein anderer Name für den Zoll, der ja bei Auslandsreisenden ein ungern gesehener Gast ist. Sie fanden aber nichts, vielleicht waren aber auch die Verstecke zu gut, wer kann das heute noch wissen. Das meiste unserer Ladung war für Griechenland bestimmt und zwar für Patras, Korinth, Piräus, Athen und Saloniki, der Rest der Ladung ging nach Smyrna und Konstantinopel, Rumänien, Konstanza, Odessa und Batum. Das Schiff war wunderbar eingerichtet und damals eines der besten Schiffe Deutschlands. Bei Kap Finistere und Gibraltar wurden Flaggensignale gegeben, die Nachrichten wurden dann an die Reederei weitergeleitet. Drahtlose Telegrafie gab es ja an Bord noch nicht, heute ist das alles selbstverständlich.
Am 12. Mai 1899 waren wir dann in der Nähe von Algier, zwei Tage später sahen wir Malta, und da es gerade Tag wurde, konnten wir die Insel gut sehen. Die Passagiere waren natürlich alle an Deck, sie wollten für ihr Geld auch etwas haben. Wir fuhren deshalb auch ganz dicht an Malta vorbei. Durch den griechischen Archipel ging die Fahrt dann weiter, und abends waren wir in Patraa. Einen Tag hatten wir dort Aufenthalt, durch den Kanal von Korinth dampften wir nach Korinth. Der Kanal ist an einigen Stellen so eng, dass sich zwei Schiffe nicht begegnen können. Dass aus Korinth die Korinthen kommen, weiß inzwischen wohl jedes Kind, und so ist es auch nicht verwunderlich, dass wir dort Korinthen und Rosinen als Ladung übernahmen. Die Gegend ist wunderschön, und da wir an einem Sonntag dort waren, hatten wir auch Gelegenheit, mal an Land zu gehen und einen Ausflug in die Umgebung zu machen. Mit einem Eselsgespann kamen wir wieder zurück, übrigens wurde die Ladung auch mit Eselgespannen an Bord gebracht.
Die Fahrt ging am 21. Mai 1899 weiter und zwar nach Piräus, der Hafenstadt von Athen. Wir kamen abends an, blieben dort aber ein paar Tage länger, weil wir dort unsere Hauptladung löschen mussten. Hier haben wir in unserer Freizeit herrliche Ausflüge gemacht. Wir waren in Athen und Umgebung, alles wurde besichtigt, die Altertümer bestaunt, und wir waren sehr beeindruckt von all den Sehenswürdigkeiten. Aber auch die Bewohner dieses Landes sahen uns gern als ihre Gäste, und wir wurden häufig eingeladen. Die Bevölkerung war überhaupt sehr deutschfreundlich. Unsere Ladung bestand hauptsächlich aus Südfrüchten, und wir versorgten uns auch damit. Viele Fahrgäste stiegen hier aus, sie wollten länger in diesem schönen Land bleiben. Wir hatten aber immer noch 31 Passagiere an Bord.
Am 23. Mai machten wir uns auf den Weg nach Saloniki. Auch dort holten wir Südfrüchte an Bord, und am 27. Mai 1899 kamen wir nach Smyrna, dem Teppichland. Hier war nun wieder Gelegenheit, kleine Nebengeschäfte zu machen. Ich habe mir dort einen Teppich eingehandelt, wo der aber später geblieben ist, weiß ich nicht mehr, sicher habe ich ihn versilbert. Die Fahrt durch die Dardanellen war herrlich, wie es wohl immer besonders schön ist, wenn man etwas zum ersten Mal sieht. Konstantinopel ist eine einzig schöne Stadt und beeindruckte uns sehr. Die Bauten machten auf uns einen großen Eindruck, und wir hätten gerne einmal gewusst, wie es hinter den Haremsmauern aussah.
Von der Reederei aus wurden verschiedene Feste auf unserem Schiff gefeiert. Viele Damen und Herren, die in Konstantinopel ansässig waren, wurden eingeladen, und es ging dann an Bord hoch her. Wir erlebten das aber nur als Zaungäste, denn noch waren wir ja nicht Kapitäne, und bis dahin war es noch ein weiter Weg. Wir hatten aber auch so unseren Spaß.
Durch den Bosporus setzten wir unsere Reise fort. Die Durchfahrt war sehenswert, all die herrlichen Bauten, prunkvollen Paläste mit märchenhaften Gärten. Wir schauten uns bald die Augen aus dem Kopf. Haremsdamen konnten wir aber nirgends entdecken, die interessierten uns nun mal ganz besonders. In Konstantinopel blieben wir nur vier Stunden, am 5. Juni 1899 verließen wir Odessa und fuhren weiter nach Batum. In Konstantinopel hatten uns alle Passagiere verlassen, wir waren nun wieder nur Frachtdampfer. Batum am Schwarzen Meer wird die russische Riviera genannt. Die Gegend ist aber auch wunderschön, und es gab viel zu sehen. Heute nach sechzig Jahren sind mir alle meine Reisen noch so gegenwärtig, als hätte ich sie erst gestern erlebt. In Hamburg kamen wir am 24. Juni 1899 an. Der Hannes musterte gewohnheitsgemäß mal wieder ab, aber dieses Mal für längere Zeit, denn jetzt musste ich erst mal die Navigationsschule besuchen, denn mein Ziel war ja, ein waschechter Kapitän zu werden. Der häufige Schiffswechsel war aber früher üblich, das hatte nichts mit Unbeständigkeit zu tun.