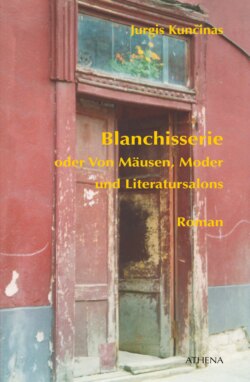Читать книгу Blanchisserie oder Von Mäusen, Moder und Literatursalons - Jurgis Kuncinas - Страница 6
2
ОглавлениеDie Einwohner von Žvėrynas haben eine ganz andere Mentalität als die von Užupis. Allein mit der Zusammensetzung der Nationalitäten sind die Unterschiede nicht zu erklären, und sie sind in den meisten Fällen nicht besonders leicht zu erkennen, aber jeder sieht auf den ersten Blick, dass Užupis herzlicher und aggressiver ist: mehr Element, mehr vergossenes, tollwütiges Blut und mehr unvorhergesehene Naturkatastrophen. Drei Jahre gingen ins Land, und niemand hatte eine Ahnung, wohin Wojciech Zakszewski hatte verschwinden können, ein tüchtiger Metzgermeister und Oberhaupt einer frommen Familie. Keine Blutflecken, gar nichts. Ein Oberst aus der Baltasis skersgatvis gestand, zusammen mit zwei Streifenwachen die Tat begangen zu haben, und erschoss sich. Warum hatte er das bloß getan, für so ein Vergehen wäre er doch fast ohne Strafe davongekommen! Sowohl der Mossad als auch die Siguranca verliehen ihm nach seinem Tod Orden, und das KGB errichtete den Grabstein, ein nettes Beispiel für Zusammenarbeit. Genauso nett lebten in der verlassenen Druckerei und Grafikwerkstatt von Gajauskas, gleich am Tor zum Bernhardinerfriedhof, Katzen und Ratten zusammen.
Dafür ist die Geschichte von Žvėrynas irgendwie konsequenter, aus welchem Blickwinkel auch immer betrachtet. Oder vereinfacht gesagt: Žvėrynas ist wie unzerstörbares Glas. Und Užupis ist ganz anders: Es ist wie ein unerreichbares Ziel. Die beiden düsteren, heruntergekommenen und in sich abgeschlossenen Stadtviertel werden nicht nur durch die unzuverlässige Buslinie 11 miteinander verbunden, sondern auch durch den Regen, das Telefon, sexuell übertragbare Krankheiten, menschliche Mystik, Lieblosigkeit und nur selten auch durch Gefühle.
In Užupis erschreckte der Eierkopf Kolja mit seiner Militäruniform die Mädchen, indem er versuchte, ihnen unter die Röcke zu greifen, wenn er ihnen in Fischläden, Kurzwarenhandlungen oder anderswo begegnete. Einmal rutschte er auf einem vereisten Gehsteig aus, schlug sich den Schädel ein und sah einige Stunden lang erstaunt in den Himmel, bis ihn einige Säufer auf einen Schlitten legten und in die damals noch existierende Leichenhalle von Užupis schleppten. In Žvėrynas lebt dafür der Bettler Kromelninkas mit der schiefen Schulter. Sommers wie winters läuft er mit einem dicken Wollmantel herum, mischt sich nirgends ein und drängt sich niemandem auf. Wenn irgendwo Suppe ausgeschenkt wird, dann lässt sich Kromelninkas seinen Litereimer aus Blech füllen, nimmt ihn mit auf den Hof mit dem Unterstand der Zivilverteidigung und schlürft die Suppe auf dem niedrigen Dach. Ich habe ihn einmal nach Kolja gefragt, aber nein, den hat er nicht gekannt. Kromelninkas wohnt in einem kleinen Verschlag, und kürzlich hat er einen litauischen Pass bekommen, aber in welches Land kann man damit schon fahren?
In beiden erwähnten Stadtvierteln gibt es ungefähr gleich viele Poeten, Künstler und Musiker. In Užupis steht die Kunstakademie, und in Žvėrynas befinden sich das philosophische und das juristische Institut, aber die Kollektive arbeiten nicht zusammen, und die beide Parteien haben tatsächlich nur deshalb noch keinen Krieg gegeneinander geführt, weil sie nie aneinander gegrenzt haben. Die Migration von Žvėrynas nach Užupis und umgekehrt ist auffallend gering, aber es lohnt sich nicht, daraus irgendwelche Schlussfolgerungen zu ziehen, und ich glaube auch nicht an Untersuchungen, denen zufolge die Bewohner von Užupis flachere Schädel und stärker herabhängende Unterlippen haben sollen als die Bewohner von Žvėrynas. Das sind Phantasien, und den »Baltischen Untersuchungen« habe ich noch nie getraut.
Die jährlichen Niederschlagsmengen und die Temperaturen in den beiden Stadtteilen unterscheiden sich so gut wie gar nicht, und der allgemeine Zustand der Kanalisation, der Wasserleitungen und anderer Errungenschaften der Zivilisation ist sowohl auf der einen als auch auf der anderen Seite fast gleichermaßen beklagenswert, nur sticht einem in Užupis das Elend stärker ins Auge, denn dort sorgen die Künstler mit allen ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln dafür, dass sich auf keinen Fall etwas verändert.
Weder in Užupis noch in Žvėrynas gibt es anständige Bordelle oder gute öffentliche Toiletten, sieht man einmal von den Botschaften, den Einfamilienhäusern oder den Missionen in der KGB-Siedlung an der Krivių gatvė in Užupis oder in dem an der Nėris gelegenen Komponistenviertel in Žvėrynas ab. Verschlägt es einen an einen solchen Ort, kann man sich sicher und musikalisch erleichtern und sich an einem schwedischen Wasserhahn der Marke »Gustavsberg« die Hände waschen, aber in Užupis gibt es einen solchen Luxus nur in dem Café gegenüber von der »Blanchisserie«.
In Žvėrynas fühle ich mich sicherer. Užupis kann ich auf sonderbare Art nicht leiden, aber es steht mir näher, denn dort habe ich Blut gespuckt und Galle hochgewürgt, dort bin ich als Fledermaus geflattert und einsam und verlassen gestorben. Žvėrynas finde ich gemütlicher, besonders wenn ich dort sitze und mein Pfeifchen schmauche. Manchmal ärgere ich mich insgeheim über die frei herumlaufenden Hunde und die frei herumlaufenden Frauen, die sich immer wieder mitsamt ihrer Oberweite über mein niedriges Fensterbrett hängen und fragen: »Gibt es hier Ratten? Gibt es hier Mäuse?« Und dann platzen sie ganz unverblümt heraus: »Hast du ein Präservativ?« Onega Mažgirdas würde so eine Frage nie stellen, und auch die Schottin Dolores Lust nicht, Grand Trix verwendet grundsätzlich keine Gummis, und Nabė … na, wechseln wir lieber das Thema.
Nach meiner Rückkehr aus dem sonnigen Suvalkija war mir in Žvėrynas an den endlos langen Sommerabenden traurig zu Mute, aber wäre ich in Užupis nicht mindestens genauso niedergeschlagen gewesen? Na also. Auch an diesem Spätnachmittag war ich traurig. Als ich endlich ausgeschlafen hatte, öffnete ich das Fenster im Erdgeschoss und betrachtete die Pfützen auf dem Hof, das ungepflegte Gras und Pirštinė, die sich über das Gurkenbeet beugte. Ich torkelte auf den Hof hinaus, legte mich auf die harte Bank und nickte wieder ein; auch Nachbar Jakovas hatte sich dort bereits zu seinem Mittagsschläfchen niedergelegt.
Als ich wieder erwachte, war es noch nicht dunkel, aber es herrschte schon eine abendliche Stimmung wie in dem romantischen Gedicht von Maironis »Abend auf dem Vierwaldstätter See«. Jemand hatte mir eine große Tasse Tee gebracht, und ich wusste, was das für ein Tee war: Er kam aus Hamburg, hieß »Cliffield tea«, stammte angeblich aus Ceylon, und auf der weißen Packung war ein blaues Segelschiff abgebildet, doch war ich mir ziemlich sicher, dass es nicht die Teeblätter transportierte. Ich wusste, wer die Tasse gebracht und zwischen den Wegerichblättern auf den Boden gestellt hatte, denn ich gab immer großzügig »Teegeld«; in Žvėrynas hat sich dieser Brauch seit Čechovs Zeiten gehalten, obwohl der große Dichter Čechov nie in Žvėrynas gewesen ist. Selbst schuld, sicher hätten ihm der gesunde Kiefernwald und die Datschen gefallen, überhaupt das ganze zaristisch-kleinstädtische »Zverinec« mit seinen Holzhäusern; nach Užupis hätte er dagegen bestimmt keinen Fuß gesetzt. Auch Turgenev hätte sich hier wohl gefühlt, Gercen und Dobroljubov bestimmt auch, denn im Grunde ihres Herzens waren sie ehrbare Adlige und Kleinstädter und liebten ihr russisches Zarenreich und damit auch Žvėrynas mit schmerzlicher Inbrunst.
Ich würde noch ein wenig an meinem Tee nippen, und vielleicht würde es mir auch gelingen, über den Abend in Žvėrynas auf dem Vierwaldstätter See zu berichten. Ja, vielleicht würde es mir gelingen.
Ein ausgelaugtes, aufgedunsenes und zu einem weichen Lappen zerkochtes Teeblatt schwappte zusammen mit einem kleinen Schluck des schwarzen Getränks in meine Mundöffnung, schlüpfte am Gaumen vorbei, stürzte unwiederbringlich in meinen Schlund und stieß schließlich in der vollständigen Finsternis meines Magens auf Grund. Ein schwarzes, weiches Blatt, in Ceylon gewachsen und um die halbe Welt bis zu meinen Lippen gereist, wenn auch kaum mit diesem blauen Segelschiff, ein kleines Teeblatt, das möglicherweise den Keim einer tropischen Infektionskrankheit in sich trug. Zum Beispiel Amok? Der trat in einem von hundertdreiundzwanzigtausend Fällen auf, nur nicht bei Zigeunern, denn die hatten im Laufe der Jahrhunderte Immunität erworben. Juden und Polen erwischte der Amok dafür umso häufiger, und als Allerletzte wurden auch die Litauer Opfer der Raserei, und daran waren weder Ceylon noch Indien schuld. Ich selbst genoss lange Zeit aufgrund meiner Armut, meiner Enthaltsamkeit und meines guten Willens Schutz, und darum blieb ich auch diesmal unbeschadet mit meiner Tasse Tee unter dem alten Flieder sitzen; die Bildungskommission garantierte mir dieselbe Immunität wie den Zigeunern, und darum konnte ich in aller Ruhe diesen Abend auf dem Vierwaldstätter See genießen, obwohl ich regelrecht spürte, wie ein Amokerreger in meinem Körper umhertrieb.
Ich blieb also gesund, aber meine arme Nabė kam plötzlich von irgendwoher gestürzt und wand sich neben mir inmitten der Schwertlilien, Disteln, Sumpfdotterblumen und Hundskamille. Sie hatte jede Menge Relanium, Elanium, Tisercin und Brom geschluckt und Rizinusöl, Wermut und lauwarmes Wasser mit Soda hinterhergespült, und nun reinigte sich der Körper der Unglücklichen von all den Tranquilizern, dem Amok und der Hoffnungslosigkeit: Aus allen Öffnungen und Spalten ihres flachen Körpers quollen Schaum, Geifer und bitterer Schweiß hervor, und ihre Chancen standen nicht gut, aber es gab sie noch.
Ich stand wie angewurzelt da und bewunderte ihre Grazie und ihre vornehme Hoffnungslosigkeit, während die Ärmste irgendetwas Unartikuliertes ohne Versmaß lallte, wie eine Hafenhure lachte und biedermeierliche Repliken von sich gab. Ich schreckte davor zurück, an sie heranzutreten und sie zu berühren, denn der Erreger waberte überall in der Luft herum, also setzte ich mich stattdessen auf einen Klotz neben dem Holzschuppen, und die Teetasse schlug gegen meine Zähne, obwohl es nicht kalt war. Aus Nabės Mund quollen Flüche in die Pfütze, in den Flieder und in die Blumen, und mit ihnen stürzten Wassermolche und Kröten heraus, die durch den Beifuß und die Hanfpflanzen krochen. Dann öffneten sich Nabės Poren, und gelbe Wespen und grüne Schmeißfliegen stürzten sich auf den hervorquellenden salzigen, dampfenden Höllenschweiß. Nabė läuterte sich und wurde heiterer, und die Welt glaubte zwar weder ihr noch ihren Poetismen und ihrer Infantilität, gewährte ihr aber die Gelegenheit, sich zu reinigen. Als sich aber schließlich aus ihrem Körper eine große schwarze Katze absonderte und mit einem Satz in den niedrig hängenden Wolken verschwand, zitterte mir die Tasse in den Händen, doch Nabė seufzte auf und fiel in sich zusammen wie der dünne Luftschlauch eines Sportrads – pschschsch!
Rasch holte ich aus dem Schuppen einen sauberen Kartoffelsack, stopfte das arme Mädchen hinein, nahm einen stabilen Haken und hängte den Sack an eine kräftige Metallstange; die Nachbarn klopften an ihr sonst ihre Teppiche aus, manche auch ihre Mädchen. Der Haken hielt die achtundvierzigeinhalb Kilogramm von Nabės Fleisch und Knochen mühelos aus, und Nabė zappelte zwar weiter, aber ihre Bewegungen wurden allmählich schwächer, und der Sack schaukelte nur noch leicht. Nur ein blauschwarzes Haarbüschel ragte heraus, dazu ein Gesicht, bleich wie das eines Pierrots, und ein Hals, dünn wie der einer Flasche: Der »Lorbeer der Künste« ähnelte jetzt eher einer zur Mast aufgehängten Gans.
»Meine liebe Nabė«, murmelte ich und rauchte genüsslich weiter, obwohl ich wusste, dass sie mich noch nicht verstehen konnte. »Meine liebe Nabė, ich habe für dich einen Salon in Užupis gefunden, aber du wirst ihn kaum benötigen. Du wirst es auch im Sack gut haben. Du liebst doch Poeten, Philosophen, Türken und Griechen … Schaukle ein wenig im Sack … Schau, auch Maironis hat auf einem schwankenden Kahn auf dem Vierwaldstätter See gedichtet, und du tust es in einem Sack, ach ja.« So murmelte ich und beruhigte mich allmählich wieder. Der alte und trotzdem wunderbare Kartoffelsack würde ihr Sicherheit garantieren, wie die stählerne Tür einer Kunstkammer ihren Schätzen, und ich streichelte die Stelle, wo der Ausbeulung nach zu urteilen das Gesäß der Bakkalaureatin sein musste.
Von den Wolken, die sich über Žvėrynas und dem Vierwaldstätter See zusammengebraut hatten, wehte wieder eine frische Brise. Der Sack mit Nabė schwang hin und her wie ein Ahornblatt im Wind oder wie ein aus dem Takt geratenes Uhrenpendel. Und als der Wind wieder nachließ, geschah das Wunder: Nabė erholte sich! Sie streckte die Zunge heraus, die von der Kälte ganz schwarz geworden war, und verzog fürchterlich das Gesicht, hörte aber auf zu fluchen, und die letzte Kröte, die von ihrer Zunge herab ins Gras fiel, war schon nicht mehr am Leben. Das Gift hatte Nabės Körper freilich noch nicht verlassen, denn als sie ihre Augen zusammenkniff und in meine Richtung spuckte, fiel der grüne Geifer auf ein dunkelblaues Klettenblatt herab und brannte dort ein Loch hinein, groß wie ein 5-Centas-Stück oder das Auge eines Käuzchens. Ich blickte hindurch und sah den Vierwaldstätter See, den traurigen Hof in Žvėrynas und die ganze übrige Welt, doch bald vergaß ich Lelešius, seine Tochter, Petručijo, Gvido, Nataša, Kapitän Milošas und den Wirt Markas Aurelijus, denn die Welt unter Nabės Sack erwachte zu gärendem Leben, geriet in Bewegung und brodelte wie junger Wein, wenn er warme Blasen wirft. Genau deshalb reiste mein Teeblatt mit dem harmlosen Amokerreger bereits durch den Mastdarm, verdaut und ungefährlich. Ich würde das allen einmal wünschen.
Der Sack hörte auf zu schaukeln. Nabė öffnete ihre geröteten schrägen Augen einen Spalt weit und sah sich um: »Schau!«, rief sie plötzlich. »Schau!« Seit dem vorletzten Dreikönigstag duzte sie mich nämlich, damals hatte sie mich zum ersten Mal giftig angezischt und »Schuft« genannt, und schon damals hatte sie mich zum Objekt ihrer furchtbaren Wahnsinnsliebe erkoren, der Ausdruck stammte übrigens von ihr. »Schau doch!«, rief sie jetzt. »Siehst du es?«
Ob ich was sah? Also schaute ich. Auf dem Vierwaldstätter See erschien ein blaues Segelschiff, genau wie das, das den Tee aus Ceylon transportiert. Auf ihm saß der nüchterne Maironis und weinte leise. Der Sänger, der Prälat. Die Vision war so klar, dass ich den Sack mit Nabė schaukelte und unbewusst Paul Valéry deklamierte:
Einst, auf der Weite des Ozeans
(frag nicht, wo das war!),
vergoss ich ein Glas alten Weins
in die kalten Abgründe des Nichtseins
Maironis kam näher, und Nabė, diese fürchterlich kurzlebige Schriftstellerin unserer Tage, wurde immer schwerer, ich konnte es richtig spüren. Zwar baumelte sie noch zwischen Himmel und Erde, aber ihre Formen, ihr Geruch und ihr Gewicht wurden immer irdischer und klarer, auch wenn die Formen noch etwas unproportioniert waren, ihr Atem nach Algen roch und sich über das Gewicht noch keine Aussage treffen ließ. Dennoch wurde sie immer kräftiger, und wer sich noch an seine Pubertät erinnert, der weiß, wie furchtbar diese Zeit ist: die Pickel, die Unwissenheit, die Abscheu vor dem eigenen Körper, die ersten Bartstoppeln oder Menstruationen, die klugen Ratschläge und der Spott der Erwachsenen, die die Hölle der Pubertät bereits hinter sich haben, sowie der Spott und die zweideutigen Anspielungen der Gleichaltrigen …
Ich band den Sack auf und holte Nabė herunter, und da saß sie nun nackt auf der Bank, die knochigen Hände zwischen den schlanken Schenkeln, eine lebendige Kopie von Munchs »Pubertät« und Vorbild für einen Abituraufsatz zu dem Thema »Die pubertierende Poetin auf dem Vier-Verhüterli-See«. Sie zerquetschte eine Mücke, die sich bereits voller Blut gesogen hatte, und auf ihren Fingern blieb ein kleines Bluttröpfchen zurück. In diesem Augenblick sprossen ihr pechschwarze Schamhaare, und sie pubertierte direkt vor meinen Augen und in Gegenwart meiner gesamten Nachbarschaft. Der Wasserwerkswächter, seine Frau, stoisch wie die heilige Katharina von Siena, der beinlose Schuster Stanislovas, die jungen Geschäftsleute Ruslan und Natalija, der Traumatologe Elegijus und die Schneiderin Pirštinė mit ihren schwarzen Knopfaugen, all die alteingesessenen Bewohner von Žvėrynas hielten ihre Fahrräder an und starrten sie mit großen Augen an.
Nabė veränderte sich mit atemberaubender Geschwindigkeit. Plötzlich quoll poetisch-silbisches Blut aus ihrem Mund, sie furzte holperige »Vers libres«, kicherte zufrieden und ähnelte immer mehr einer unglücklichen, aber würdigen Poetin. Sie schwoll im Takt mit der vergänglichen Welt an, schlug schleimige Triebe aus, und ihr Körper frohlockte und kümmerte sich weder um den tränenreichen Maironis, noch um die Österreicherin Ingeborg oder um Heinrich Heines »Lyrisches Intermezzo«. Nabė reifte weiter, ja, sie behauptete sogar, bereits herangereift zu sein, aber um was für einen Preis! Es schien, als würde sie gleich vor Stolz platzen, und die Vorahnung von Ruhm dröhnte und toste wie Magma durch ihre Eingeweide.
In ihrer Kindheit, hatte sie mir einmal zaghaft erzählt, habe sie mit einer Freundin gespielt, sie seien am Strand. Sie waren allein, zogen sich aus, legten sich der Länge nach auf eine Matte, zogen Strohhüte und Sonnenbrillen an und bräunten sich unter der Lampe, während sie in zerfledderten Modezeitschriften herumblätterten.
»Wie alt wart ihr?«, hatte ich gefragt.
»Ich war zwölf, das Nachbarsmädchen dreizehn, und ihr Bruder kapierte noch gar nichts.«
»Was für ein Bruder?«
»Na, sie hatte ihren Bruder dabei, aber der war noch ein Baby.«
»Was hat er nicht kapiert?«
»Na … Wir haben miteinander gefummelt, aber nicht mehr, glaub das bloß nicht! Und wehe, du erzählst es weiter!«
»Warum sollte ich? Lass gut sein, ihr habt die Erwachsenen nachgeäfft, ihr habt euch nach ihrem verdammten Leben gesehnt.«
Ich wollte Nabė wieder in den Sack stopfen, aber es half nichts, sie passte schon nicht mehr hinein. Da kam mir ein guter Gedanke: Ich suchte nach ihrem Pfropfen, zog ihn hinaus, und die Luft entwich unter lautem Zischen aus Nabės Körper, und so hängte ich sie auf und schloss den Sack mit zwei Wäscheklammern. Ihre Überheblichkeit war leider geblieben, und bedauerlicherweise hatte sie bereits einen Punkt erreicht, an dem Ruhm und Niedertracht Hand in Hand gingen. Maironis weinte auf dem blauen Segelboot am Horizont, Ingeborg deklamierte laut »Undine geht«, und Nabė, die Quasibakkalaureatin, hing an der Metallstange wie ein Teppich, den ein nachlässiger Besitzer hatte hängen lassen.
»Man sollte die Polizei benachrichtigen«, sagte die Pania versöhnlich und ging weg, um in ihrem Garten Unkraut zu jäten. Ich rief die Wache an und schilderte die Lage. Milošas war persönlich am Apparat, hörte mir ruhig zu und trompetete dann fröhlich: »Ach, du bist es! Ich habe deine Stimme erkannt! Das geschieht dir recht! Ist sie vorbestraft? Aha, aha. Ich kann dir nicht helfen, wir essen gerade zu Abend, und danach liest der Boss aus seinem ›Neuen Sonettkranz‹ vor, da herrscht Anwesenheitspflicht, und ich kann unmöglich fehlen … Hör zu, vergiss diese Automatik. Gut, ich halte dicht. Wir treffen uns irgendwann im ›Ambasada‹, tschüss!«
In der Zwischenzeit hatte Nabė mit ihren scharfen Nägeln den mürben Stoff des Sacks aufgerissen, schob ihren dünnen Arm bis zum Ellbogen heraus und bald darauf auch den zweiten; sie hatte immer noch zwei. Sie klatschte mit ihren pergamentenen, perlmutternen Händen und begann zu schaukeln, ruhig und würdig, freiwillig und vorsätzlich. Jetzt begehrte ich sie.
Die Nachbarn hatten genug von diesem Spektakel, obwohl es kostenlos war, und zerstreuten sich. Dafür torkelte der betrunkene Maurer der fünften Kategorie Zepas Išganytojas auf dem Weg zu unserem Plumpsklo an uns vorbei, machte kurz Halt und knöpfte hastig seine Arbeitshosen auf. Seine Knie zitterten bereits vor Ungeduld, aber trotzdem überhäufte er mich mit Vorwürfen: »Warum machst du das? Warum quälst du unschuldige Tiere?« Er hielt Nabė für eine Katze. »Sind sie keine Geschöpfe wie wir? Kitzle sie, und sie lachen. Erschrecke sie, und sie weinen!« Zepas Išganytojas stampfte mit dem Fuß auf, aber da ertönte es auch schon wie fernes Donnergrollen. Er konnte sich nicht mehr beherrschen, flüchtete wie von der Tarantel gestochen in das Klohäuschen, schloss sich rasch ein, und während er bereits über der offenen Kloake hockte, rief er: »Lass sofort die Katze frei, hörst du!« Er stampfte noch einmal auf eines der fauligen Bodenbretter, und wieder rollte der Donner, aber diesmal schon etwas matter.
Was sollte ich tun? Ich musste an Rudyard Kiplings Werk »Der Schmetterling, der stampfte« denken, so viel Kunst und Literatur heute Abend, und mit dem gesamten Hof und dem Himmel als Publikum! Die Situation war unerfreulich, daran war nicht zu rütteln.
»Bleiben Sie sitzen, wo Sie sind!«, rief ich auf die kalkverschmierte Tür zu, die von der Besatzungszeit her immer noch den russischen Buchstaben »Ž« für »Frauen« trug. Zepas Išganytojas – allein der Geheimdienst MGB kannte seinen echten Vor- und Nachnamen – furzte nur noch schwach und rief nicht mehr den Effekt von Kiplings Schmetterling hervor, bevor er tatsächlich vorübergehend verstummte.
Eigentlich hatte ich durchaus vorgehabt, Nabė herunterzuholen, mochte sie in den glitschigen Hanf- und Wegerichpflanzen herumliegen! Aber dieser Teufelsbraten fühlte sich in dem Sack inzwischen ganz in seinem Element und hatte mitnichten vor herauszukriechen, schließlich hatte sie es dort warm und gemütlich. Also reckte und streckte sie sich, schlief ein und schnarchte sogar ein bisschen, eine Zikade des Nordens in einem Hof in Žvėrynas!
Zepas Išganytojas hockte immer noch hinter der Tür mit dem russischen »Ž«, offenbar dachte er ernsthaft über etwas nach.
Der letzte Zuschauer war meine Frau Terezija, die ihren üblichen Gogel-Mogel mixen und sich noch einmal die Haare waschen wollte. Sie wusch sich mindestens zweimal am Tag die Haare, das hatte ihr Krishna im Traum geraten, außerdem wurden angeblich auch die Gedanken durch das Shampoo aufgeschäumt und erhellt. Wenn Terezija die anständige Vertreterin der mitteleuropäischen Mentalität und Lebensart war, dann hätte man Nabė mit einem Menschen vergleichen können, der als Säugling von Wölfen aus einem mittelasiatischen Dorf geraubt und in einer Bärenhöhle gesäugt worden war und dem die Menschen erst später Sprechen und Essen mit dem Löffel beigebracht hatten. Jetzt schnarchte diese Wölfin wie eine Zikade, und ich blieb allein mit dem schlafenden Raubtier zurück. Die Yacht von Maironis näherte sich unendlich langsam, vielleicht hatte der Wind gedreht?
Aus dem Klohäuschen ertönten noch ein paar heftige Fürze von Zepas Išganytojas, als wolle er daran erinnern, dass er noch am Leben sei, aber da zog schon ein kräftiger Mann meine Aufmerksamkeit auf sich, der auf den Hof getorkelt kam. Er trug einen dichten Bart und eine ärmellose Zeltstoffweste, und auf einer der vielen Taschen war ein Abzeichen mit der Aufschrift »Human right« aufgenäht, auf dem zwei kräftige Hände Ketten zerrissen. Der Menschenrechtsbeauftragte für ganz Žvėrynas und Užupis also, ein bekannter Künstler, Chirurg und Wohltäter. Er war ganz offensichtlich angetrunken und bestimmt nicht nur mit zornigen Worten gegen die Unterdrücker gewappnet, sondern auch mit einer anständigen Mauserpistole. Zum Glück schnarchte Nabė immer noch und schaukelte weiter in ihrem Sack, und der Human-Right-Aktivist interessierte sich kaum für sie. Er war versöhnlich aufgelegt, zog eine angebrochene Flasche Wein hervor und deklamierte ein wenig aus seinem neuesten Opus, bevor er sich aufs Gras warf und ebenfalls einschlief.
Ich sehnte mich danach, allein zu sein, die Ereignisse und die Lage in Žvėrynas in Gedanken an mir vorbeiziehen zu lassen und vielleicht auch unter irgendeinem Vorwand Grand Trix aufzusuchen, die auf der anderen Straßenseite lebte, und mich nach den Seufzern von Leonardo Cohen zu erkundigen, aber Pustekuchen! Der Menschenrechtsaktivist schnarchte so laut, dass selbst noch in der Treniotos gatvė die Elstern aus ihren Nestern emporflatterten und Nabė im Schlaf zu sprechen begann.
»Schatz«, brabbelte sie, »warum liebst du mich so furchtbar? Warum? Weshalb hast du mir damals diese Clips nicht gekauft? Oder diese Jeans?«
Es bot sich folgendes Bild: Von dem jungen Ahornbaum fielen goldene Maikäfer auf Nabė und auf den schlafenden Kämpfer für Menschenrechte herab, und Zepas Išganytojas kam endlich aus dem Klohäuschen heraus und verkündete lautstark im Vorbeimarsch: »Die Tschetschenen haben gerade Gudermes eingenommen!«
»Geh kacken!«, wollte ich ihm entgegnen, doch da fiel mir ein, dass er das schon getan hatte.
Nabė schlug ihre Augen auf, drehte sich im Sack um und begann, mit ihren mandelförmigen Augen den Himmel zu betrachten, der rötlich gefärbt war wie eine halbreife Pflaume. Eine Fregatte nahm die Yacht von Maironis unter Beschuss, und die in der Ferne hallenden Schüsse weckten Ksaveras, das war dieser Menschenfreund und Kämpfer, und er begann, mit herzzerreißender, hoch erhobener Stimme von der Lage in den Gefängnissen der Republik zu erzählen: »Wie Ratten pfercht man die Häftlinge dort zusammen und wirft ihnen Abfall vor!« Dann murmelte er ganz unvermittelt, dass er morgen gar vorhabe, Tibet vom verbrecherischen chinesischen Joch zu befreien, und bat mich, ihm sieben Litas und eine Automatik zu borgen. Ich zuckte zusammen, als ich dieses Wort vernahm, aber er winkte ab und erzählte bereits irgendetwas über die Gesundheit eines Poeten, den er soeben besucht habe und der auf Schmerz spezialisiert sei, und über seinen Familienstand. Ich solle ihm helfen, am besten mit Tee und Tabak, was ich davon hielte? Ksaveras war wirklich ein universell begabter Mensch, und so legte er mir seine Ansichten über die Anhänger von Smetonas, von Landsbergis und von Erlickas dar, erläuterte seine unerschütterliche Auffassung über Leberzirrhose und die Rolle der »Sergeanten« im Krieg der Literatur, beklagte sich über die skandalöse Ignoranz der Akademie der Wissenschaften gegenüber seinen Werken, und am Ende rief er so laut »ich will Bier«, dass sogar Nabė zusammenzuckte.
»Was ist denn das da?«, fragte Ksaveras erstaunt, als er den zappelnden und strampelnden Sack bemerkte.
»Ach, nichts«, antwortete ich. »Ich habe mir da so ein merkwürdiges kleines Tierchen gezähmt. Und falls du es schon so genau wissen willst: Hier ist der Abend in Žvėrynas auf dem Vierwaldstätter See.«
»Gut«, erwiderte Ksaveras. »Darum kümmere ich mich später.« Und er verlangte so heftig nach Bier, dass ich Pirštinė in den 24-Stunden-Laden schickte. Er kippte zwei Flaschen in einem Zug hinunter und schlief wieder ein, während sich Nabė aus dem Sack herauswand, unverschämte Forderungen erhob und Flüche gegen Türken, Berliner, Philosophen und überhaupt gegen all jene vom Stapel ließ, die sie jemals kennen gelernt hatte. Ich überlegte, ob ich sie zur Polizeiwache bringen und mitsamt dem Sack durchs Fenster werfen sollte, mitten in das Sonettkränzlein hinein, aber das Polizeikollektiv würde über einen solchen Streich wohl kaum in Begeisterungsstürme ausbrechen. Da bekam ich eine gute Idee: Ich würde sie als Paket verschicken! Und so versah ich den Sack notdürftig mit Aufklebern »Par Avion«, »Mit Luftpost«, »By Air Mail« und »Express«, um ihn tags darauf aufzugeben. Das Postamt war nicht weit, und ein bekannter Flieger würde schon am nächsten Morgen zum Vierwaldstätter See fliegen, hin zur ewigen Poesie. Ein Wasserflugzeug konnte auch auf den Wellen landen, wenn es welche gab, weich, wie eine Glucke auf ihren Eiern, und es würde auf dem Rückflug den weinenden Maironis mitbringen und vielleicht auch irgendeinen litauischen Kulturattaché in der Schweiz, der bewegte dort ohnehin nichts …
Nabė, die das Gehör einer Wölfin hatte, musste meine Gedanken vernommen haben, denn sie begann zu winseln und versprach, gehorsam zu sein, jetzt, überall und immerdar, aber von solchen Versprechen hatte ich mir schon mehr als genug anhören müssen, und so ließ ich mit voller Lautstärke »Radio Free Europe« laufen.
Saulius Tomas machte leicht näselnd und übertrieben gleichgültig irgendwelche Ausführungen über die Lage der Männerklos in den Flughäfen der Welt und erzählte, wie man auf den Fliesen der Pissoirs die Bilder von Fliegen in Lebensgröße habe aufdrucken lassen. Daraufhin sei allmählich der an solchen Orten übliche Uringeruch verschwunden, denn die Mehrzahl der Reisenden habe nicht mehr auf den Boden gepinkelt, sondern unbewusst versucht, den Urinstrahl auf das fette Insekt aus der Klasse der Zweiflügler zu richten. Wie man das in unserem Bretterhäuschen hätte bewerkstelligen sollen, überstieg meine Phantasie, aber da wurde Saulius Tomas von Mikas Drundzilas abgelöst, der in schrillem Falsett dasselbe vortrug wie bereits zuvor der Maurer Zepas Išganytojas: Die Tschetschenen hatten tatsächlich Gudermes eingenommen!
Was soll’s, dachte ich, morgen müssen sie es ja doch wieder zurückgeben. Und Mikas sang kein Wort über »Human right«, dessen Vertreter zu meinen Füßen schnarchte, jetzt im Tenor, wie Noreika in jungen Tagen. Und Nabė gaffte in den Himmel und schwieg.
Da kam aus den Lüften eine gewöhnliche Stadttaube mit einem Zettel im Schnabel herangeflogen. Eine Nachricht von Grand Trix, wie immer rätselhaft, sanft und doch deutlich. Und wie es meistens der Fall war, zitierte sie, diesmal meinen verehrten Gottfried Benn:
Aber wisse:
Ich lebe Tiertage. Ich bin eine Wasserstunde.
Des Abends schläfert mein Lid wie Wald und Himmel.
Meine Liebe weiß nur wenig Worte:
Es ist so schön an deinem Blut.
Welch wunderbare Worte, besonders dieses »es ist so schön an deinem Blut«! Triksė geizte sonst nämlich mit Komplimenten, und meistens sagte sie zu mir nur: »O. k., du liebst mich.« In diesem Zeitalter war sie nicht vulgär, aber wenn Sie wüssten, wie sie im Mittelalter war … Und was hatten wir da? Aha, ein Post scriptum: »Was ist denn da auf deinem Hof los? Das ist ja richtig unheimlich! Mein Vater hat sich beklagt, dass du irgendein Tier quälst?! Grand.« Zepas Išganytojas war der echte Vater von Grand Trix; direkt nach den Ereignissen in der Tschechoslowakei hatte er diesen zarten Schößling gepflanzt, ohne selbst zu wissen, dass sie in Wirklichkeit schon lange unter dem Dach der Welt lebte.
Ksaveras versuchte, Caruso nachzuäffen und kurze Zeit später Luciano Pavarotti, aber sehr dilettantisch und lächerlich. Nabė schnaubte nur und hielt sich ihren breiten Mund mit der knochigen Faust zu, aber ihre Augen funkelten immer noch vor Zweifel und vor Hass auf mich. Maironis war im Laufe der Zeit von einem Prälat zu einem Filibuster geworden, begann zurückzuschießen, und die Fregatte entkam feige; Nabė wiederum pulte die »Express«- und die anderen Aufkleber von dem Postsack herunter und kreischte, dass es alle hätten hören können, aber nur die zu Botendiensten verdonnerte Taube lauschte erstaunt. Ich schob ihr einen Litas mit dem Bild der Kapelle von Palūšė in den Schnabel, klatschte mit den Worten »Flieg, du Gesprenkelte, kauf ein Milky Way!« in die Hände, und der Vogel erhob sich schwerfällig und flatterte in die Richtung vom Kiosk »Marlen«.
Nabė kreischte immer noch. »Du Schuft! Ich fliege nirgendwohin, ich will nicht, so leicht wirst du mich nicht los, was hast du mir früher versprochen? Wie kannst du es wagen? Was für ein Recht hast du?« Und so ging es in einem fort weiter.
Panta rhei, dachte ich, alles fließt. Bis zu dem verhängnisvollen Ausspruch »du Schuft« an jenem Dreikönigstag hatte mich Nabė immer nur mit »Herr Dozent« und »Sie« angesprochen, zumindest am Anfang, als ich sie in Ethik, Ästhetik und Etikette unterrichtete. Sie war eine aufmerksame, höfliche Zuhörerin, die sich alles rasch einprägte, was sie aufschrieb, aber sie war vor allem praktisch in dem Sinne veranlagt, dass ihr praktische Arbeiten besonders gut gelangen. Ich erklärte ihr die Widerstandsfähigkeit der Materie, gab ihr eine Einführung in die Gnoseologie und veranstaltete Seminare über Anatomie und Sexualtechniken. Sie kam regelmäßig, zumindest während des ersten Semesters, eine eifrige, pflichtbewusste Studentin, die stets ihre Hausaufgaben erledigte, selbstständig arbeitete und freiwillig weiterführende Literatur las. Auch in Bezug auf ihre Lebensweise war sie anspruchslos: Sie aß wenig, ging in abgetragenen Kleidungsstücken und schminkte sich zugegebenermaßen ungekonnt und geschmacklos, hielt sich aber an die Körperhygiene. Peinlich wurde es vor allem dann, wenn sie mehr als zwei Gläser trank, denn dann wurde sie unberechenbar und verfiel in Hoffnungslosigkeit und kindische Hysterie. Warum hatte ich bloß nicht schon früher daran gedacht, dass ich so einen wunderbaren Sack hatte?
Einen Salon brauchte sie damals noch nicht, sie lebte bei einer Feldscherin, die gerade aus dem Schlachtfeld in den Reservedienst übergewechselt war, eine gottesfürchtige alte Frau, die sich schon längst nicht mehr mit illegalen Abtreibungen abgab, sondern wahrhaftig christlichen Werten huldigte. Die Alte lebte im Stadtteil šnipiškės, hielt stumme Kanarienvögel und züchtete Geranien. Jeden Abend kochte sie einen Gemüsebrei für Nabė, der die Poetin fast in den Wahnsinn trieb und sich entsprechend häufig in ihrer Lyrik widerspiegelte. Als die Alte aber zu allem Überfluss auch noch ihre sämtlichen Blumentöpfe in Nabės schmalem Kämmerlein aufbaute (ich hatte sie dort mehrmals besucht und gesehen, wie aus den Wurmlöchern in der Decke das Holzmehl herabrieselte), bekam die gute Nabė die Panik und begann mit Macht, nach einer neuen Bleibe in Užupis zu suchen. Sie sagte, sie brauche viel Platz, damit all ihre Gäste bei ihr verkehren könnten, sowohl ihre Trunkenbolde, Letten, Türken, Philosophieschüler und Poeten als auch der Eigentümer des kleinen Gutes von Karolinava, der außerdem gleichzeitig in Ostberlin und in švenčionėliai residierte.
Sie brauchte Erfahrungen, die es aufzuschreiben lohnte, und so zwang ich sie als ihr gestrenger Lehrer, Glistik, Slang, Pomologie und Autodiktat zu studieren, und nahm sie mit zu Vernissagen, wo sie sich leider meistens betrank. Manchmal fuhr der Bildhauer des »Ei des Philosophen« mit uns in den »Europapark«, wo Nabė zielstrebig auf eine verrückte, performancebegeisterte Fee mit schlechten Zähnen zusteuerte, die einen unauslöschlichen Eindruck auf sie machte. Später überraschte ich die beiden mit geröteten Gesichtern beim gemeinsamen Rollschuhlaufen im Sereikiškių parkas, Arm in Arm, mit einer Flasche Wein und einer Schachtel Nüssen in den Händen. Ich sah, wie sie ihre Lektionen vorbereiteten und Verse und Aufsätze verfassten, weil sich die Performancekünstlerin als Kunstwissenschaftlerin betätigte, aber was konnte ich ausrichten! Ich befürchtete freilich, dass Nabė von der Fee schwanger werden könnte, in schöpferischer Hinsicht natürlich nur, aber ich wurde nicht gefragt, und so begann die Kunstwissenschaftlerin, sie Versbildung zu lehren; was dabei herauskam, weiß ich nicht.
Heilige Mutter Gottes, in der Folgezeit setzte ich alle Hebel in Bewegung, dass sich Nabė vervollkommnete und sich Kenntnisse aneignete, die sie mit der Praxis in Einklang bringen konnte, und sich nicht nur auf ihr angeborenes Talent verließ! Ein paar Tage lang riss sie sich denn auch zusammen, vertiefte sich mal in Nietzsche, mal in das »Lyrische Intermezzo«, aber bald begann sie wieder, ihren Launen zu frönen, und vertraute mir an, sie sei der Nabel der Welt – »ich bin doch die beste Poetin von Litauen, nicht wahr, das meinst du doch auch?« – oder sie murrte über den Schlangenfraß, den sie gründlich über hatte, lebte sie doch immer noch bei Zuzana Janson, dieser Feldscherin und Trägerin der Tapferkeitsorden »Za otvagu« und »Virtuti militari«.
Ich selbst hatte in der Zeit genug eigene Sorgen! So hatte ich einem ernsthaften Menschen fest versprochen, verlorene Adelsdokumente zurückzubeschaffen und eine Familienhymne zu komponieren, weiter musste ich mich um jeden Preis mit einem Aufsatz an einigen Spöttern rächen, die Klotür mit dem unerträglichen russischen Buchstaben »Ž« übermalen, die diplomatischen Beziehungen zu der Familie von Maurer Zepas Išganytojas in Ordnung bringen, mich gegen FSME impfen lassen, die Abschiedsfeier für eine Rattenfängerin in den Ruhestand organisieren und außerdem noch einen Bericht für Herrn Jagello schreiben, von dem noch die Rede sein wird.
Während ich also in Gedanken an diese nicht allzu lang zurückliegende Vergangenheit versunken war, fing Nabė wieder an, wegen Appartements in Užupis zu jammern, und klagte, sie ertrage definitiv keine Geranien mehr. Pupkis & Co. wollten die Blumen schon »Spießerflor« nennen, aber sie bezeichnete sie trotzdem als Geranien, weil Wolfgang Borchert die Erzählung »Die traurigen Geranien« geschrieben hatte. Einmal schleppte sie eine schlaffe Geranie mitsamt Blumentopf heran, und Terezija trug die Blume arglos ins Freie, damit sie Licht und Sonne bekomme, aber ein heftiger Platzregen zerschmetterte sie unwiederbringlich und für alle Zeiten. Die Blume starb bei Sonnenuntergang, und Nabė richtete drohend die Faust gen Himmel und rief: »Das verzeihe ich dir nie!«
Ich hörte ihr Gequieke schon gar nicht mehr und freute mich fast, dass Zepas Išganytojas wieder auf dem Hof erschien, zusammen mit seiner leiblichen Tochter Grand Trix. Sie lebte auf den Färöern und tauchte nur gelegentlich in Žvėrynas auf, darum war unsere Beziehung Ende des zwanzigsten Jahrhunderts auch so fragmentarisch. Triksė hatte einen Färinger geheiratet, einen trägen Jungen mit Augen wie ein Fisch oder ein Seehund, und Zepas unternahm gerade eben wieder den Versuch, sie zur Scheidung zu bewegen und mit mir zu vermählen, einem Menschen ohne feste Anstellung, festen Wohnsitz, festes Lebensziel oder feste Einkünfte. Zu genau diesem Zweck also kamen die beiden auf unseren Hof, und Triksė blinzelte mir freundlich lächelnd zu: Wir wussten beide, dass Bemühungen dieser Art diesmal fruchtlos bleiben würden, aber ihr gefielen solche Paarungsaktionen immer.
Ich führte Zepas noch einmal meine desolate finanzielle Lage vor Augen, aber der Maurer wiederholte zum tausendsten Mal »Armut ist keine Schande!« und machte schon den Mund auf, um ein Gedicht von B. B. aufsagen, das einem seiner Kollegen anlässlich des Heiligabends gewidmet war: »Was der Zimmermann in jener Nacht zu Jesus sagte«.
Triksė stand auf den Fliederblättern, betrachtete mal Nabė, mal ihren Vater und mal mich, und ich sah, wie sie in diesem Augenblick uns alle drei nicht leiden konnte. Sie knurrte etwas in einem färöischen Dialekt durch die Nase, das an das Husten eines kranken Schafs erinnerte, und rieb ihre hübschen Hände an ihre eng anliegenden Hosen aus Leopardenfellimitat. Auch Zepas sah alles, aber er hatte sich daran gewöhnt, solchen Dingen keine Aufmerksamkeit beizumessen. Er nieste, entschuldigte sich und sagte geradewegs heraus: »Sie will ein Kind von dir.«
»Gar nicht wahr«, brummte Triksė, »überhaupt nicht.«
»Jetzt?«, fragte ich erstaunt.
»Natürlich jetzt«, brauste der Maurer auf. »Hesekiel ist doch nach Frankreich gefahren, um Karriere zu machen.« Hesekiel war Triksės neuer Mann, der Färinger.
»Worum geht es?« Ich hatte nicht gleich verstanden.
»Bist du taub?«, fragte Zepas zornig. » Wir machen unsere Einfahrt neu. Bald wird der Kies gelegt, klar? Wir sind nicht arm, und wir haben keine Schulden.«
»Ich will doch gar nicht«, murrte Triksė.
»Nein«, entgegnete ich fest. »Heute wird nichts daraus, Zepas, ganz bestimmt nicht. Warten wir auf die nächste Erbsenblüte.«
Inzwischen war Ksaveras wieder erwacht und begriff überhaupt nichts. Er betrachtete uns alle mit trübem Schlafwandlerblick, dann winkte er uns zu und taumelte auf die Straße. Nabės Augen wanderten derweil wie irre von Zepas zu mir und von mir zu Triksė. Ihre Augen blitzten. Sie hatte immer einen Hang zum Experimentieren gehabt, und jedwede Neuigkeit faszinierte sie, drastische erst recht. »Na los, heirate sie, du Schuft!«, brüllte sie. »Und dann adoptiert mich, ich will auf die Färöer!«
Triksės Reaktion überraschte mich. Sie nickte weise und sagte: »Gut, ich adoptiere sie, aber ohne dich zu heiraten. Und dann verheirate ich sie mit einem Seehund oder mit einem Elch, in Ordnung?«
Ich hätte wahrscheinlich nachgegeben, aber ich musste an Trivialliteratur und Seifenopern denken, wo alle vergleichbaren Fälle mit Blutschande, Einweisung in die Psychiatrie, Tod durch Erhängen oder wenigstens mit Zähneknirschen und zur Unzeit geborenen Kindern endeten. »Wisst ihr was«, sagte ich so ruhig wie möglich, »ihr beratet euch hier und überlegt euch alles ganz genau, aber ich muss jetzt gehen.«
Die färöische Maurertochter konnte sich das Lächeln nicht mehr verkneifen, weil Nabė schon versuchte, sie mit »Mami« anzureden, und ich zog ab zur Malonioji gatvė; ich hatte versprochen, im Obdachlosenasyl »Sechsundsechzig« zu spielen und bei der Gelegenheit einen Krug Bier mit frischem DDT zu trinken, ein bei Selbstmördern beliebtes Getränk.
Ich verlor zweieinhalb Litas, warf mit gespieltem Entsetzen die Arme hoch und wollte gerade aufstehen, um zu gehen, hatte aber zuvor wie üblich noch eine Auseinandersetzung mit Mogila, dem Obmann des Bettlerverbandes. Es ging um Kleinigkeiten: Er bot mir an, mir meine Spielschulden zu erlassen, wenn ich im Gegenzug dreißig Bettler über die weißrussische Grenze schmuggelte. Sie wollten nämlich alle unbedingt in ihre Heimat zurück, weil Litauen sein Bettlerkontingent ausgeschöpft habe und keine anständigen Almosen mehr gewährleisten könne, während Weißrussland soeben sein Gesetz zur Einschränkung der Bettelei aufgehoben habe.
»Nein«, sagte ich ruhig, »ich bringe niemanden hinüber. Die Leute finden ihren Weg nach Hause allein, wenn das Blut sie ruft! Nehmen Sie meine zweieinhalb Litas, ich gehe nach Hause.«
Oh, wie böse Mogila da wurde! Er verkündete, dass ich keinen Fuß mehr hierher zu setzen brauche, und auch seine Kollegen überhäuften mich mit Vorwürfen, wie undankbar ich in Wirklichkeit sei, wo sie mich doch zu Sowjetzeiten immer aufgenommen hätten! Ihrem Obmann stieg der Blutdruck, und er brüllte, er habe schon seit ein paar Tagen nirgends »Kalikas«-Tabletten gegen Gonorrhö erhalten, müsse darum beim Pissen vor Schmerz heulen und könne nicht einschlafen, und ich, dieser xxx von einem xxx, wolle ihm nicht einmal diesen kleinen Dienst erweisen!
Solche Reden vermochten mich nicht zu erschüttern. Ich hatte schon oft genug solche Gruppen über die Grenze gebracht, und das jedes Mal mehr oder weniger für einen Gotteslohn, nein, das hatte ich nicht nötig. Ich empfahl, den Vertreter von »Human right« von Žvėrynas und Užupis anzurufen, aber da hieß es nur, den Ratschlag könne ich mir sonst wohin stecken, sie könnten auch auf legalem Weg von hier verschwinden, aber wer würde dann die »Kalikas« und »Narkota« herüberbringen? Natürlich begleiteten mich dann die wütenden Flüche und Steinschauer der Bettler, aber zum Glück waren sie bereits so mit DDT abgefüllt, dass sie erbärmlich schlecht zielten.
Während ich die Straße entlangschlenderte, hoffte ich voller Inbrunst, den Hof angenehm leer vorzufinden. Dann würde ich mich ein Stündchen unter den wilden Birnbaum legen, in aller Ruhe mit Terezija über Spanien, das Land ihrer Träume, den schönen Krishna, ihren jüngeren Bruder Varnas, den man in einen Raben verwandelt hatte,[5] und den Speiseplan von morgen reden, und vor dem Einschlafen würde ich noch ein bisschen in den Werken von irgendeinem Thomas lesen, zum Beispiel von Aquin, Moore, Venclova, Kondrotas oder Mann …
Aber hatte sich’s was! Auf der Bank, die ich mir als Ruheplätzchen auserkoren hatte, saß schon wieder jemand, der etwas von mir wollte! Diesmal war es der Provinzpoet Gediminas Pietaris, ein höflicher und geduldiger Mensch, der wie gebannt meinen knauserigen Worten lauschte. Was sollte man noch sagen, er war Vorsitzender von Sąjudis und der führende Poet seines Bezirkes. Das Problem war nicht, dass er aus Rukla kam oder dass er mich so spät besuchte, sondern es war eine liebe Not mit seinen Versen: Sie waren schlimmer als Werbetexte!
Pietaris kauerte auf der Bank und hielt eine prall gefüllte Aktentasche zwischen den Knien. Seine sich lichtende Stirn leuchtete weithin, und er nahm die Sonnenbrille auch in der Dämmerung nicht ab. Er ähnelte mehr Jaruzelski als Zbigniew Cybulski, nur die Figur fehlte ihm, sowohl politisch als auch künstlerisch. Ich wollte ihm das schon sagen, aber aus einer Wolke blinzelte der Seefahrer Maironis herab und flüsterte: »Sei nachsichtiger …«
Ja, dachte ich, durch Zorn verbessert man die Qualität der Kunst auch nicht. Außerdem waren in dieser Aktentasche bestimmt nicht nur Manuskripte …
Pietaris bemerkte meinen Blick, öffnete die Schnallen der Tasche und gestattete mir einen Blick in ihr Inneres. Ich erblickte Kognak, Gläser, Honig und Nüsse. Nicht schlecht. »Lassen Sie das alles hier«, befahl ich ihm. »Ich versuche noch heute Nacht, alles durchzulesen, und gebe Ihnen morgen Bescheid. Aber meine Antwort wird nicht unbedingt positiv ausfallen! Wissen Sie, Gediminas, es hängt ja nicht nur von mir ab …«
Der Poet sprang auf. »Ich verstehe ganz ausgezeichnet. Aber es ist alles schon anderswo besprochen und abgestimmt worden, und man bräuchte nur ein paar einleitende Worte von Ihnen. Hier steht alles über Litauen, Margiris, Rainiai, Klepočiai und Kalanta …«
»Was für grausige Ereignisse und Orte! Viel Feuer und Blut«, meinte ich, und er stimmte mir lebhaft zu. »Sollte ich nicht mehr da sein«, warnte ich ihn, »teilt Ihnen meine Frau Terezija meine Meinung mit.« Und ganz unverschämt fügte ich hinzu: »Ach, und übrigens, Gediminas, leihen Sie mir doch hundert Litas, ich bin völlig abgebrannt.«
Jede Arbeit verlangt ihre Entschädigung, und er übergab mir einen mit dem Bildnis von Daukantas geschmückten Hunderter. »Gute Nacht und bis bald!« Oh unglückliches Vaterland …
Irgendein Teufel ritt mich, noch einen Blick in den Hof von Zepas Išganytojas zu werfen, warum auch immer. Höchstwahrscheinlich waren es die heftigen Lachsalven, das tierische Gewieher, das Gekreisch und andere Geräusche, die von dort ertönten. Ich erkannte Nabės Mezzosopran: So quieken Schlafmäuse, wenn man ihnen auf den Schwanz tritt! In der Tat, Triksė schor sie wie ein Lamm mit einer stumpfen färöischen Schafschere, und daneben standen Zepas, seine Frau und der von seiner Reise zurückgekehrte Hesekiel, der offizielle Schwiegersohn von Zepas Išganytojas. Unter einem Hocker lagen ein paar leere Schnapsflaschen, und Nabė war bereits sternhagelvoll, ein Palastschäfchen mit einem Pagenschnitt. Kein Teilnehmer dieses Happenings bemerkte, dass sich in den Höhen die Wellen des Vierwaldstätter Sees rollten … Ach was, Wellen, nicht einmal auf mich wären die Leute aufmerksam geworden, hätte ich nicht Nabės schlanken Hals gepackt und gefragt: »Wer hat dich so entstellt?«
»Hau ab! Meine Mutti hat mir die Haare geschnitten, hau ab!«
Zepas schaltete das Radio ein, und Saulius Tomas erzählte von den jüngsten Ereignissen auf dem Balkan und in Tibet und erwähnte auch die geballten Anstrengungen von »Human right«, Israelis und Palästinenser miteinander zu versöhnen. In seiner Stimme bemerkte ich die bekannte, leicht versteckte Ironie. Maironis’ Kahn mit dem diplomatischen Korps war überhaupt nicht weit weg.
Triksė, die Berufsmutti, kämmte mit einem güldenen Kamm Nabės Borsten und flüsterte: »Mein armes Töchterlein, willst du Suppe?«
»Bloß keine Gemüsesuppe! Ich will Borschtsch mit Fleisch!«, kreischte Nabė hysterisch und ging mit Triksė ins Haus.
Zepas trat an mich heran, zog aus der Brusttasche vierhunderttausend paraguayanische Guaraní hervor und sagte ohne jede Spur von Angeberei: »Siehst du? Wir sind nicht arm. Es liegt ganz und gar in deinen Händen.«
»In seinen Hosen, meinst du wohl!«, brüllte Nabė durch das Fenster und verschluckte sich an einem knorpeligen Stück Schaffleisch.
Über die Veranda kam die Tochter von Kacas getorkelt, die vollkommen nüchterne, dafür aber hochschwangere Katze Zabna; auch Katzen blieben nicht von der Pubertät verschont. Man hätte das Dachfenster zunageln sollen, dachte ich verstimmt, warum hatte niemand rechtzeitig daran gedacht! Für mich gab es hier nichts mehr auszurichten, und die Guaraní lockten mich nicht, schließlich hatte ich gerade hundert Litas für eine Konsultation erhalten.
Aber auch der Schlaf wollte sich nicht einstellen. Der Mond hielt sich hinter einer dicken Wolke versteckt, und es war vollkommen finster. Die Menschen in Žvėrynas und in Užupis zündeten Kerzen an und der liebe Gott die Sternelein, nur dass niemand sie sah. Diese Menschen, dachte ich, ach, diese Menschen! Die einen spielten noch mit Würfeln, die anderen lagen schon in ihren Betten und sprachen ihr Abendgebet, andere wiederum zogen durch die Wälder über die Grenze, der eine auf die eine Seite, der andere auf die andere. Die einen bereiteten sich auf Operationen oder auf die Jagd vor, andere waren von der Freiheit und ihrer Arbeit zu Tode erschöpft und liebten ihre Frauen. Nur wir am Ufer des Vierwaldstätter Sees, auf der Seite von Žvėrynas, warteten auf die Rückkehr des Künstlers Maironis mit seiner Kunstschmuggelware. Unter dem Jasmin schlief der erschöpfte Zepas Išganytojas, nachdem er meine unechte Frau und deren noch unechtere Tochter umarmt hatte. Welch seliges Bild: er in der Mitte und die beiden Frauen auf jeweils einer Seite, wer weiß, was Jesus in dieser Nacht zu dem Maurer gesagt hätte? Ich kehrte in meinen Hof zurück, zum wievielten Mal heute? Der Wind hatte sich beruhigt, von Ribiškės und Riovonys ertönte das Gedröhn der russischen Streitkräfte herüber, nicht weit entfernt knallte ein vereinzelter Schuss, und ein fröhlicher Schrei ertönte: »Hab ich’s nicht gesagt? Du hast schon wieder nicht getroffen!«
Ich schnitt Grünfutter für šerifas und Džeris, die beiden Hofhunde, goss die Zucchini und die Selleriepflanzen und begann, vor lauter Langeweile aus einem Büschel vorjährigen Hanfes eine Schnur zu flechten. Ich wäre bei dieser Beschäftigung vielleicht sogar eingeschlafen, denn Terezija lag schon längst in ihrem leichten Dienstschlaf, aber aus einem Wolkenzipfel kroch eine Laterna magica heraus, erhellte meine kleine Mohnplantage, die für den Weihnachtskuchen vorgesehen war, und ich erkannte klar und deutlich, wie vier Halbwüchsige meinen Schatz verwüsteten!
Ich hätte von mir aus nichts unternommen, aber in diesem Moment kam der Maler Golosačius angeschneit, um sich Tee zu borgen. Vielleicht habe ich noch gar nicht erwähnt, dass er nur bei Mondschein malt und dann unbedingt Tee trinken muss. Schweigend sperrten wir die jugendlichen Banditen ein, Golosačius gab ein gewaltiges Geschoss aus seiner hinteren Düse ab, und sofort erhoben die Kinder ihre Hände zum Mond; ihre Tatzen zitterten wie die von Kätzchen. Nachdem wir die Gefangenen zur ewigen Ruhe in den Schuppen von Schuster Juodvalkis eingeschlossen hatten, besprachen wir kurz den Fall. Golosačius führte ein professionelles Verhör durch, und dabei stellte sich heraus, dass die Dreizehnjährigen die Kinder von Philosophen und Gewerbetreibenden waren. Der Maler schlug ihnen vor, sie in das Vivarium von Užupis zu deportieren, aber die Jungen boten ein so hohes Lösegeld an, dass sich der alte Maestro erweichen ließ und einen von ihnen probeweise auf freien Fuß setzte: »Wenn der hier nach einer Stunde zurückkommt, dann lasse ich alle frei!«
Der Knabe kehrte nach einer Viertelstunde mit der Schweizer Uhr seines Vaters zurück, »Papa hat sechs Stück, der merkt das gar nicht«, mit einer Schachtel Zigarren, einem Päckchen Darjeelingtee von den Hängen des Himalaja und einem Mobiltelefon, das ich bekam, weil Golosačius keine Tasten drücken konnte. Als wir sie freiließen, flüsterte der Maestro: »Hoffentlich machen sie sich noch möglichst oft über deinen Mohn her!«
Ich warf dem Maler einen finsteren Blick zu, bot ihm aber an, die Nüsse und den Kognak von Pietaris zu probieren. Auch Zepas Išganytojas kam angetorkelt, als er den Schnaps witterte, und wir tranken schweigend und gemächlich. Es schien, als sei alles gesagt, die heilige Nachtruhe senkte sich herab, und schon fiel mir der Kopf auf die Brust, als plötzlich das Heulen einer Sirene ertönte.
Wahrscheinlich wieder ein Luftangriff, schoss es mir durch den Kopf, aber als wir alle auf die Straße stürzten, zeigte sich, dass dem nicht so war: Vielmehr verkündete eine gnadenlose Alarmanlage, dass ein Autodieb versucht hatte zuzuschlagen. Dieser machte so viel Lärm, dass er fast das Heulen der Sirene übertönte, und kurz darauf erschien Milošas mit seinem Sondereinsatzkommando. Es stellte sich heraus, dass kein anderer als der tobsüchtige Färinger Hesekiel, der Schwiegersohn von Zepas, versucht hatte, die alte Rostlaube zu stehlen! Wo hatte er bloß seinen Verstand gelassen? Gerade frisch angekommen hatte er sich bei seinen Schwiegereltern noch nicht einmal richtig die Füße gewärmt, und schon, schwuppdiwupp, saß er fest!
Aus den moosbewachsenen Holzhäusern von Žvėrynas tauchten verschlafene Frauen auf, die einen in Spitzennachthemden oder im Negligee, die anderen mit Büßerhemden oder nur mit eilig übergeworfenen Tüchern, und auch ein paar Männer in Unterhosen mischten sich unter die Schaulustigen. Alle wollten mit eigenen Augen einen Blick auf einen Autodieb erhaschen, schließlich war den meisten von ihnen bereits das Auto gestohlen worden, und trotzdem hatten sie noch nie einen lebenden Dieb gesehen. Niemand hatte deshalb Mitleid mit Hesekiel, höchstens die sehr gottesfürchtigen unter den Frauen. »Das geschieht dir recht, Hesi!«, verkündete sein Schwiegervater Zepas Išganytojas so laut, dass es alle hörten. »Jetzt bist du geliefert.«
Hesi fluchte auf Färöisch, Russisch und Polnisch, aber Milošas gab dem Dieb einen solchen Schlag auf seinen nach Fisch stinkenden Mund, dass er ihn sofort wieder schloss. Alle ergingen sich in Lobsprüchen für den Kapitän.
Nachdem Hesekiel nach Lukiškės abtransportiert worden war, stellte sich heraus, dass bei dem alten Ford alle vier Räder sowie Motor und Steuerrad fehlten und von all seinen Organen nur noch die Alarmanlage funktionierte: Hesi war einem Autogespenst auf den Leim gegangen!
»Ich verstehe trotzdem nicht, warum er das gemacht hat«, sagte der alte Karäer aus der Poškos gatvė. »Jetzt bekommt er zwei Jahre aufgebrummt. Mindestens!«
Ich zog mit dem Karäer und mit Golosačius ins »Ambasada«, das soeben aufgemacht hatte, um den Kognak des Poeten Pietaris alle zu machen, und wir bewirteten damit auch die Nutte »Lokomotive GT«, die uns als Gegenleistung ihre Atlashöschen und ihren gelben Gewerbeschein zeigte, den einzigen in ganz Žvėrynas. Der Karäer und Golosačius zankten sich um sie, während ich hinüber zu einer Bank ging, um ein paar Worte mit Maironis zu wechseln, der gerade wieder herangesegelt kam. Er meinte: »Ach, im Jenseits erwartet einen nichts Gutes, mein Freund, die Riesen schnarchen immer noch! Und was passiert zurzeit in unserem geliebten Litauen?« Sein Kahn schwebte auf Federwölkchen dahin. Der Vierwaldstätter See glitt in alle vier Himmelsrichtungen davon, und das Drama ging seinem Ende zu …
Als ich auf meiner Bank erwachte, sah ich im Dachbodenfenster Terezija. Sie lächelte immer noch und war schon dabei, sich die Zähne zu putzen, ihre Haare zu waschen, Kaffee aufzubrühen und mit einem Psychiater zu telefonieren, da einige Dinge bei ihrem Mann, also bei mir, ganz und gar nicht schlecht stünden: Mein Harn sei hell, ich hätte optimistische Halluzinationen, und die Peristaltik sei befriedigend. Ich hörte im Halbschlaf ihre unzusammenhängenden Sätze, hatte aber nicht die Absicht, mich einzumischen. »Willst du Kaffee?«, rief Terezija durch das Fenster. »Mit oder ohne Zucker?«
Was hatte ich jetzt für eine Lust auf Kaffee! Mit Zucker, Sahne, Milch, Zitrone, Eis und Nüssen! Wir tranken den Kaffee in der Mansarde. Ein klarer Morgen zog herauf. Terezija lächelte, erzählte mir aber diesmal nicht, was sie geträumt hatte. Auf ihren Händen hockten kleine Vögelchen, schrillten irgendetwas und flogen wieder davon. Während wir beim Kaffee saßen, schrillte auch noch das Telefon. Ich nahm den Hörer ab und hörte: »Du Schuft! Wenn morgen kein Bericht da ist, lasse ich dich im Keller einsperren, bist du verrottest!« Das war natürlich Wachtmeister Jagello, und ohne zu antworten legte ich den Hörer auf.
Aber es schrillte noch einmal: »Hier spricht Professor Kalibatas aus Užupis, können Sie mich hören? Passen Sie gut auf, mein Herr! Im Keller eines Hauses in der Baltasis skersgatvis in Užupis, wo Sie in den Achtzigerjahren dieses Jahrhunderts gewohnt haben, habe ich Ihre Abhandlung über ›Glis Glis‹ gefunden, stellen Sie sich das mal vor!«
Ich war richtig verblüfft, dass das Ding wieder aufgetaucht war, es war ein Jugendwerk von mir. »Herr Professor«, stieß ich keuchend hervor, »ich schlafe nicht, ich war nur gerade mit Maironis unterwegs, legen Sie bloß nicht auf! Wo stecken Sie gerade? Ich mache mich sofort auf den Weg!«
Terezija sah mich voller Bedauern an, aber ich war bereits in Lelešius’ Bauernrock geschlüpft und zwängte mich in die Stiefel, schließlich war völlig ungewiss, wann ich wiederkommen würde! Vorsichtshalber flüsterte ich Terezija ein Geheimwort ins Ohr, das nur die Einwohner von Užupis verstehen. Sie steckte mir mit tränenerfüllte Augen meine Mauserpistole in die Rocktasche und murmelte: »Ich kann nicht mehr …«
Ich schwang mich auf das Fahrrad von Zepas Išganytojas, das noch auf dem Hof stand, und pedalte mit voller Kraft in Richtung Užupis. Ein paar verirrte Kugeln pfiffen an meinen Ohren vorbei, aber Kapitän Milošas war auch diesmal schlecht im Zielen.