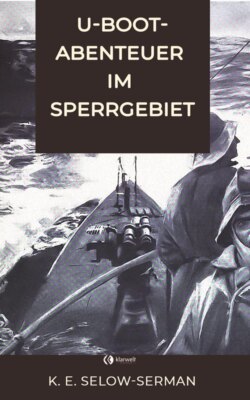Читать книгу U-Boot-Abenteuer im Sperrgebiet - K. E. Selow-Serman - Страница 4
Die U-Bootsfalle
Оглавление„Nu will ick dir aber mal wat verklaren. Hör bloß mit din dammeligen Quatschen up, sonst hang ick di mol fif Minuten öwer Bord. Du bist ja'n gräsigen Kirl“, schnauzt der Obermatrose Tönjes den Matrosen Lehmann aus Berlin an, der seine erste Fahrt auf „U 217“ macht; trotzdem spinnt er ein Seemannsgarn, als hätte er jahrelang schon nichts anderes getan als im Sperrgebiet ein Schiff nach dem anderen versenkt.
Seit einigen Tagen liegt das Boot auf der südlichen Anmarschstraße zur Irischen See auf Lauer. Mehrere Schiffe sind ihm bereits zum Opfer gefallen. Gegen schweren Nordwestwind war „U 217“ von Helgoland ausgelaufen und hatte seinen Weg mühsam nordwärts um Schottland herum genommen. Oft schien es, als ob es überhaupt nicht weiterginge, so schwer haute das kleine Fahrzeug in die See ein. Wachoffizier und Rudergänger mussten mit Leinen festgebunden werden, um nicht durch die unablässig über den Turm hinweg jagenden schweren Brecher über Bord gerissen zu werden. Jeden Augenblick zitterte das ganze Boot unter dem krachenden Aufschlagen der Tiefenruder. An einigen Stellen platzten Nieten los, das Geländer verbog sich, ein Stück der Beplattung hatte sich bereits losgearbeitet.
Und erst im Innern! Den Leuten war es fast unmöglich, den tollen Bewegungen ihres Fahrzeuges zu folgen. Wieder und wieder stand der Kommandant vor der Überlegung, zu tauchen, um dem Geschüttle und Geschlingere durch Aufsuchen der ruhigeren Tiefe zu entgehen. Der elektrische Antrieb aber ist kostbar. Vor einigen Tagen erst hatte Deutschland die Gewässer rings um England als Sperrgebiet erklärt, wer konnte wissen, welche Gegenmaßregeln die Engländer ergriffen hatten. Jeder Augenblick konnte das Tauchen für unbestimmt lange Zeit erfordern: da hieß es, die elektrische Kraft voll aufgespeichert zu halten.
Als hätte die deutsche Bekanntmachung die See reingefegt, so zeigt sich kein Schiff in der weiten Nordsee. Selbst die so gewinntüchtigen Norweger sind verschwunden: anscheinend brauchen sie noch Zeit zur Überlegung, wie sie sich möglichst ungefährdet nach England durchschleichen können. Noch vor wenigen Wochen — kaum vierzehn Tage sind es — bei der Rückkehr von der letzten Fahrt, sah es hier etwas anders aus. Kein Tag verging, der nicht mehrere Rauchfahnen oder die hellen Segel skandinavischer Schiffe in Sicht brachte, — jetzt sind selbst die Fischer verschwunden. Wie ausgestorben liegt die See. als wenn sie ausschließlich nur den deutschen U-Booten und den Möwen gehörte. So weit das Auge auch zu blicken vermag, überall heben sich die schweren grünlichgläsernen Wellenberge aus der See, weißer Gischt züngelt herauf, krachend brechen sie in das Tal hinab. Tagelang. Immer das gleiche, eintönige und doch so gewaltige Bild. Bis endlich „U 217“ zwischen den Shetlandsinseln und der Nordküste von Schottland steht.
Hier scheint besseres Wetter zu kommen. Zusehends verschwindet der Gischt, der Seegang nimmt ab. Die ersten feindlichen Streitkräfte werden gesichtet: einige Fischdampfer, die als Bewachungsfahrzeuge ihren so unangenehmen Dienst versehen.
Ein unbemerktes Vorbeikommen über Wasser ist unmöglich. So wird hier also zum ersten Mal getaucht, um das Gejagtwerden zu vermeiden; würden die Kerle drüben doch sofort die Anwesenheit deutscher U-Boote melden und ihnen einige Zerstörer auf den Hals hetzen.
In der Nacht wird die Straße zwischen den Orkneys und Shetlandsinseln passiert. An Backbord tauchen in der Ferne einige Lichter, anscheinend Leuchtfeuer, auf. Stunden später, im Grauen des anbrechenden Morgens, liegt das Boot auf südlichem Kurs und strebt dem ihm zugewiesenen Operationsfelde. der nördlichen Biscaya und dem Westausgang des Kanals, zu.
Trotzdem die lange Dünung des Atlantik noch ziemlich hoch läuft, ist hier doch ein erträgliches Fahren. Zwar ist das Deck selbst noch nicht begehbar, auf dem Turm aber lässt es sich schon aushalten. Auch die unangenehme Kälte ist weicheren, aus Süden wehenden Winden gewichen. Seit die Südküste Irlands querab liegt, ist dann auch die See so ruhig geworden, dass die dienstfreie Mannschaft sich an Oberdeck gründlich auslüften kann.
Im Schutz des Turmes hocken sie dicht aneinandergedrängt, und Orje Lehmann, der Berliner Flunki, wie er nach wenigen Tagen schon genannt wird, erzählt. Wie er einen ungeheuren Cunarder nach dem andern versenkte, einen voll beladenen Munitionsdampfer gegen den Himmel fliegen machte, dann wieder schildert er in glühenden Farben den Untergang eines Transportdampfers und berichtet, wie Tausende von Khakimännern im Wasser herumkrabbelten, bis er schließlich mit einem wohlgezielten Torpedoschuss ein englisches Großkampfschiff erledigt. Grade aber als es kieloben wegsacken will, wird er in gröblicher Weise von Tönjes unterbrochen.
Seit zehn Minuten schon, während die Khakimänner nach Lehmanns Schilderung in rechts abmarschierenden Sektionskolonnen den Weg nach unten antreten, kribbelt es dem in den Fingern. Als dann aber schließlich der englische Überdreadnought sich in seine Bestandteile auflöst, legt er zornentbrannt los. Von allen Seiten wird der unglückliche Lehmann mit den liebevollsten Bezeichnungen zugedeckt. Während er noch überlegt, wie er sich am schleunigsten verdrücken könnte, kommt schon die Erlösung in Form einer dicken Rauchwolke, die soeben vom Turm gemeldet wird. Im Westen, eben über der Kimm, taucht die dunkle Fahne auf.
Im Nu springt die Gesellschaft, die sich im Schutze des Turmes recht wohl gefühlt hatte, hoch und starrt nach der angegebenen Richtung. Die Gläser des Brückenpersonals haben das Fahrzeug, dessen Masten soeben über der Kimm erscheinen, erfasst und lassen es nicht mehr aus dem Gesichtsfeld. Der Wachoffizier ist auf das Brückengeländer geklettert, um einen möglichst hoch gelegenen Ausblick zu haben.
„Melden Sie dem Kommandanten: „In West-Südwest ein Dampfer, der auf uns zuhält. Anscheinend ein Frachtdampfer; hohe Aufbauten fehlen.“
Noch ist das letzte Wort nicht verhallt, als der Kommandant, der in seinem Raum bereits gehört hat, dass ein Schiff in Sicht sei, aus dem Turmluk heraufkommt.
Es ist zwei Uhr nachmittags. Die Strahlen der Februarsonne, die nahezu über dem Dampfer steht, lassen die Umrisse des Schiffes, das sich nur langsam über die Kimm heraufschiebt, vorläufig undeutlich erkennen. Ein breiter Schiffsrumpf nur, mit ungewöhnlich niedrigem Schornstein und ebenso niedrigem Mast sind auszumachen.
„Das scheint ja ein ganz besonderer Vogel zu sein“, wendet sich der Kommandant an seinen Offizier, der bei dem schlingernden Boot einen nicht gerade leichten Stand auf dem Geländer hat, „den wollen wir uns doch etwas von der Seite besehen.“
Mit großer Fahrt läuft „U 217“ ab, bis die Umrisse des Dampfers klar hervortreten. Ein Tankdampfer von ungefähr 3000 Tonnen. Fast am Heck steht der Schornstein, davor der weiße Aufbau der Brücke. Drei Viertel des Schiffes liegen vor den Kesseln. In riesigen Tanks bergen sie das für die englische Flotte so kostbare Heizöl.
Die Nationalität des Schiffes ist auf die fast sieben Seemeilen betragende Entfernung noch nicht zu erkennen. Schließlich ist das aber auch ganz gleichgültig. Der Bursche drüben führt unbedingt Bannware an Bord und befindet sich zudem hier im Sperrgebiet. Lange, viel zu lange für die U-Boot-Leute, die sich mit jedem bewaffneten feindlichen Schiff herumschlagen mussten, hat es ja gedauert, bis die deutsche Regierung sich endlich entschloss, die ihr zu Gebote stehenden Seekriegsmittel uneingeschränkt anzuwenden. Der Verlust dieses Schiffes muss von den Engländern noch bitterer empfunden werden als jede andere nach ihren Häfen bestimmte Ladung. Schon vor Beginn des Krieges ist die englische Admiralität immer mehr zur Ölfeuerung übergegangen. Die Linienschiffe der Queen-Elizabeth-Klasse. die neuesten Schlachtkreuzer. Dutzende von kleinen Kreuzern und Zerstörern sind für reine Ölfeuerung eingerichtet. Fast vierzehn Tage könnten ihre neuesten Kreuzer und Zerstörer mit dem Brennstoff fahren, der dort herangeschleppt wild.
Es ist nicht ausgeschlossen, dass er ein Geschütz führt: muss doch die englische Admiralität trachten, sich diese Schiffsklasse, an der ohnedies großer Mangel herrscht, möglichst zu bewahren. Also Vorsicht!
Tiefbeladen zieht der Tankdampfer ahnungslos seinen Kurs nach England zu. Etwa sechstausend Meter noch sind die beiden Fahrzeuge voneinander entfernt, als auf „U 217“ ein Feuerstrahl aufblitzt. Weißlicher Pulverdampf zieht seitwärts, Sekunden später schlägt direkt vor dem Bug des Engländers die Granate ein. Eine zweite heult dicht über die Brücke hinweg. Das genügt. Der Kapitän scheint nicht so harthörig wie so manche seiner Landsleute zu sein. Er stoppt unverzüglich, zischend strömt weißer Dampf aus der Vorkante des Schornsteinrandes. Zwei Boote werden gefiert. Stoßen ab und rudern hastig nordwärts der irischen Südküste zu, die sich wie ein dunkler Strich aus der See hebt. Anscheinend von seiner Besatzung völlig verlassen, liegt der Dampfer leicht schlingernd in der Dünung.
In dieser Gegend aber ist äußerste Vorsicht am Platze. Zu oft schon hat englische Hinterlist, auf die Harmlosigkeit der Deutschen rechnend, die meuchlerischsten Überfälle gewagt. Traue einer dieser Bande!
Getaucht kommt „U 217“ heran. Durch das Sehrohr wird der Bursche von allen Seiten beäugt. Kein Geschütz ist zu sehen, kein Lebewesen scheint an Bord: nur in tausend Meter Entfernung etwa die beiden Boote, die schleunigst dem Land zustreben. Um das Schicksal des Schiffes scheint sich kein Mensch drüben bekümmern zu wollen.
Zwischen der Besatzung, die sich immer weiter entfernt. und dem Schiff taucht „U 217“ auf. Eben gibt der Kommandant den Befehl: „Sprenggruppe klar machen“, als schmetternd an vier Stellen gleichzeitig auf dem harmlosen Tankdampfer die Reling außenbords herunterschlägt. Unmittelbar darauf spritzen aus den Öffnungen Feuerstrahlen auf, krachend fegen die Granaten heran . . . in Turm und Oberdeck. U-Bootsfalle.
Instinktiv fast gellt schon beim Herunterklappen der Reling der Ruf „Schnelltauchen“ in die Zentrale, und mit einem Satz springen die aus der Brücke Befindlichen durch den Lukdeckel in das Boot“. Mit dumpfem Schlage klappt er zu, Sekunden darauf steckt „U 217“ die Nase weg. Noch einige Treffer dröhnen gegen die gepanzerte Turmwand, dann schließt sich das Wasser über dem Boot, zwölf Meter. In Sicherheit!
Hier können ihm die kleinkalibrigen Granaten der U-Bootsfalle nicht mehr gefährlich werden. Tatsächlich verstummt der Lärm der berstenden Granaten. Kaum aber ist das beruhigende Gefühl des Geborgenseins eingetreten, als ein Krach, wie wenn ein schwerer Hammer dröhnend gegen Eisen schlägt, und unmittelbar daraus ein zweiter an der Bordwand erklingt. Das Licht erlischt, einzelne Leute stürzen zu Boden und werden wirr durcheinander geschüttelt. Kommandos gellen durch die Räume, die in tiefem Dunkel liegen. Unverzüglich aber haben die Leute sich aufgerappelt und ihre Tauchstation eingenommen. Schon flammt auch der Schein der Reservebeleuchtung auf.
„Beschädigungen melden!“
An einigen Stellen werden Wassereinbrüche von Schusslöchern, die durch Granatsplitter verursacht sind. gemeldet: bedeutend unangenehmer aber sind die Störungen, die durch die Wasserbomben entstanden sind. Die beiden Boote müssen sofort, nachdem die Falle das Feuer eröffnete, verabredungsgemäß umgekehrt sein und zwei Bomben geschleudert haben. Die Akkumulatoren haben gelitten: besonders gefährlich scheint, dass die Tiefensteuerung nicht mehr einwandfrei arbeitet. Durch Gegenmaßnahmen, die so oft geübt sind, versucht die Besatzung das Boot unten zu halten — umsonst. Von Sekunde zu Sekunde wächst die Gefahr . . . Es heißt hinauf um jeden Preis . . . Zum Glück können die Tanks ausgeblasen werden.
In zweitausendfünfhundert Meter Entfernung von der U-Bootsfalle stößt der Turm über die Oberfläche empor Im gleichen Augenblick aber fegen auch schon wieder die englischen Granaten ringsherum. Tauchen ist nicht mehr möglich, es heißt das Artilleriegefecht aufnehmen, den Kampf bis zum bitteren Ende auskämpfen.
Die Geschütze sind besetzt. Kaum ist die Entfernung eingestellt, als jetzt auch von „U 217“ die ersten Geschosse hinübersausen und berstend einschlagen. Die Dieselmotoren arbeiten einwandfrei. Um sich möglichst aus dem Bereich der feindlichen Granaten zu bringen, läuft das Boot ab und vergrößert die Entfernung zwischen sich und dem Feinde.
Hinüber und herüber fegen die Geschosse. Der Dampfer trifft das verhältnismäßig kleine Ziel nicht mehr, umso besser aber funken die beiden Nummern Eins an den Geschützen in die hochragenden Bordwände hinein. Drüben muss es schon böse aussehen.
Während an Oberdeck ununterbrochen die Verschlüsse klirren und die Schüsse schnell aufeinander folgen, sind im Innern alle Hände fieberhaft tätig, die Schäden nach Möglichkeit zu beseitigen: das Dringendste ist das Dichten des Turmes, um die Zentrale, die durch Geschoßtreffer und die Wasserbomben am schwersten gelitten hat, wieder instand zu setzen Tatsächlich gelingt es den vereinten Kräften auch, den Turm mit Bordmitteln wenigstens notdürftig abzudichten. Dann werden die übrigen Gefechtsstörungen je nach ihrer Wichtigkeit und soweit es hier eben angängig ist, beseitigt. Glücklicherweise ist von der Mannschaft niemand ausgefallen. Die glänzende Durchbildung der ganzen Besatzung macht sich bei dieser Arbeit geltend. Jeder weiß, dass es ums Leben geht, dass von der zuverlässigen Arbeit des Einzelnen das Schicksal des Bootes und damit sein eigenes abhängt. Nirgends eine Überstürzung oder ängstliches Hasten.
Etwa fünfzig Hektometer liegt der Tankdampfer ab. immer noch im Feuer des Bootes, das er mit seinen Geschützen aber nicht mehr erreichen kann, als plötzlich von Steuerbord Feuer auf „U 217“ eröffnet wird. Ein neuer Feind!
Durch den Kanonendonner herbeigelockt, kommt ein Kleiner Kreuzer heran. Durch die beiden Schornsteine und die niedrige Form der Aufbauten entpuppt er sich als einer der während des Krieges neu erbauten Zerstörer der Foxglove-Klasse, ein Gegner, der deutschen U-Booten nicht ganz ungewohnt ist. Schon mehrere dieser Gattung haben daran glauben müssen. An Geschwindigkeit ist er den über Wasser fahrenden Booten nicht überlegen, bedeutend gefährlicher aber ist die Zahl seiner Geschütze. Allerdings scheint es mit seinen Schmeißbüchsen nicht weit her zu sein. Immer näher an ihn heran rücken die Geschoßaufschläge des U-Bootes. Durch Zickzackfahren versucht er auszuweichen . . . umsonst. Schmetternd schlagen Zwei Granaten bei ihm ein. Die Sache wird brenzlich. er bringt sich aus dem Bereich der gefährlichen Geschütze.
Mit Südkurs fährt „U 217“ weiter. Allmählich kommt die U-Bootsfalle aus Sicht. Leider kann ihr und ihrer Besatzung der so reichlich verdiente Lohn nicht mehr werden. Eine Genugtuung aber haben die Deutschen: viel von der kostbaren Ladung bringen die nicht heim. Ununterbrochen strömt das Heizöl aus den zahlreichen Schusslöchern, und der Weg bis zum Hafen ist weit.
Tiefer sinkt im Westen die Sonne. Der Foxglove-Kreuzer hat dem U-Boot nachgedreht und kommt wieder heran. Scheint britischem Seemannsdünkel das klägliche Ausrücken vor dem kleinen Gegner doch zu jämmerlich? Freilich, die Deutschen sind auf der Hut Auf siebzig Hektometer eröffnet der Engländer das Feuer . . . er trifft nicht. Nach wenigen Minuten aber sitzt bei ihm ein deutscher Einschlag. Er hat genug. Schleunigst dreht er ab, gibt die Verfolgung auf und kommt mit einbrechender Dunkelheit aus Sicht.
Fast sechs Stunden hat die Besatzung ununterbrochen gearbeitet, an Erholung aber ist vorläufig nicht zu denken. Jetzt heißt es, das Boot unbelästigt vom Gegner so weit herzurichten, dass es wieder tauchfähig wird und den Marsch nach der Heimat, der durch die feindlichen Linien führt, antreten kann.
Tiefdunkel liegt die Nacht über dem Meere. Weitab nordwärts wischen Lichtstrahlen über die See. In regelmäßigem Abstand leuchten sie auf, verschwinden. Feindesland!
Kaum zwanzig Seemeilen ab stampft das kleine deutsche Boot gegen die lange Dünung des Ozeans an. Kein Lichtschimmer dringt nach außen, nichts verrät, dass hier deutsche Seeleute mit zusammengebissenen Zähnen arbeiten. Ein Wille nur beseelt sie alle: Der Morgen muss sie klar finden zu neuem Kampf.