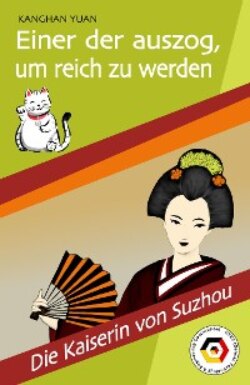Читать книгу Einer der auszog, um reich zu werden - Kanghan YUAN, Peter Kruse - Страница 8
Eine Brust am Morgen vertreibt alle Sorgen
ОглавлениеMein Wecker zeigt ein Uhr morgens im Januar 2014. Trotz der frühen Stunde fühle ich mich wohl, denn eine heiße Plastikwärmflasche wärmt meine Füße und meine Frau Hong liegt neben mir.
»Hong« bedeutet »Rot«. Viel hat mir Hong über ihre Geburt bisher nicht erzählt, aber die Farbe Rot war zum damaligen Zeitpunkt, als ihre Eltern noch als Beamte und Parteimitglieder für die chinesische Regierung gearbeitet hatten, sehr bedeutend und wurde daher mit dem Namen ihrer Tochter verewigt.
Hong ist mit ihren 1,60 Metern Körpergröße fast zwanzig Zentimeter kleiner als ich, hat eine gute Figur und ihre Stimme klingt etwas tiefer als die der meisten Chinesinnen. Aber sie verwahrt sich dagegen, dass es sich um eine Raucherstimme handelt, denn sie hat nie geraucht. Ihre Erklärung ist ungleich interessanter, denn sie führt die stimmliche Rauheit auf ihre Kindheit zurück, in der sie tagsüber von ihrer Mutter getrennt bei Verwandten gewesen war, da ihre Eltern während der Kulturrevolution unzählige Stunden auf dem Feld gearbeitet und lange Wege dorthin zurückgelegt hatten. Offenbar fehlte Hong die mütterliche Zuneigung, was sie durch andauerndes Schreien unmissverständlich kund tat und so Heiserkeit provozierte.
Glücklich zu sein ist das Wichtigste, habe ich gestern Abend noch zu meiner Frau gesagt. Und das versuche ich täglich umzusetzen. Ich lebe seit Mitte des letzten Jahres in Taicang, einer kleineren chinesischen Stadt im Norden von Shanghai. Je nach Tageszeit kann man die Metropole mit dem Auto in ein oder zwei Stunden Fahrtzeit erreichen. Trotzdem war ich in den vergangenen drei Tagen nicht zuhause, denn ich bin zurzeit beruflich sehr eingespannt. Zwei Tage lang habe ich meine Lieferanten besucht, ihre Werke besichtigt und dabei Verbesserungsvorschläge gemacht, Wichtiges notiert und Vorlagen ausgefüllt. Zudem war ich gestern noch im Büro der Asienzentrale in Shanghai.
Heute wird es nicht besser, denn ich muss schnellstens die Kosten von Einkaufsteilen kalkulieren und die Entscheidungsfindung für die anstehenden Vorstandssitzungen in der deutschen Hauptniederlassung vorbereiten. Hierzu arbeite ich mit den leitenden Einkäufern der einzelnen Warengruppen zusammen.
Im Moment bin ich als Kostenreduzierer im Einkauf bei der Firma Schluckauf eingestellt, die in Shanghai, Taicang und Anting agiert, und habe einen üblichen lokalen Arbeitsvertrag wie die hier lebenden Chinesen auch. Aber ich war clever und habe neben der Übernahme der Wohnungsmiete auch einen Mittelklassedienstwagen von Shanghai-Volkswagen mit Chauffeur herausgehandelt, mit der Begründung, mich dann besser auf meine Arbeit konzentrieren zu können. Um selbst in China ein Fahrzeug lenken zu dürfen, muss man extra einen chinesischen Führerschein machen, denn weder der deutsche noch ein internationaler Führerschein gelten hier. Für Chinesen in Deutschland ist das wesentlich einfacher, zumindest für das erste halbe Jahr, denn hierfür genügt ein vom Notar beglaubigter chinesischer Führerschein. Da sag noch einer, die Deutschen wären bürokratisch.
Da ich vor sechs Jahren den chinesischen Führerschein gemacht habe – bei Vorlage des deutschen Führerscheins wird übrigens nur die Theorie-Prüfung verlangt –, weiß ich, dass die Prüfungsfragen den deutschen sehr ähnlich sind, aber dennoch unterscheiden sich die Verkehrsregeln. Den Arbeitgebern ist das bewusst, und da sie ihre Mitarbeiter lieber bei der Arbeit in ihren Firmen als bei langwierigen Diskussionen mit den chinesischen Behörden sehen, akzeptieren sie solche extravaganten Wünsche. Als Ausländer in China muss man wissen, dass man nicht nur bei einem Unfall, sondern auch bei generellem Kontakt mit der Polizei meist auf sich alleine gestellt ist, was sich durch sprachliche Hürden oft als sehr zeitintensiv erweist. Das musste ich bereits mehrfach am eigenen Leib erfahren, so zum Beispiel in meiner früheren Firma, für die ich ab 2008 in Shanghai und Suzhou gearbeitet hatte, aber ich will noch nicht zu viel verraten, erst einmal der Reihe nach.
In meiner jetzigen Firma habe ich zwei Büros, eins in Shanghai und eins im Produktionswerk in Taicang. Da ich neu bin, sind mir meine Aufgaben und die Prozessabläufe noch nicht ganz klar. Vor allem weiß ich nicht, welchen Nutzen ich für die einzelnen Chefeinkäufer eigentlich habe, denn mein Team und ich werden erst spät in den Arbeitsablauf eingebunden. Ob absichtlich oder nicht sei einmal dahingestellt, doch so gerate ich unter Druck, rechtzeitig gute Arbeitsqualität an die Zentrale zu liefern.
Als Hong vor ein paar Tagen zu ihren Eltern nach Suzhou gefahren war, war ich noch unterwegs gewesen. Die Stadt Suzhou mit ihren etwa zehn Millionen Einwohnern liegt ungefähr zwei Busstunden westlich von Taicang in der Nähe des drittgrößten Binnensees der Volksrepublik mit dem Namen Tai-See und wird wegen ihrer vielen Kanäle auch liebevoll »Venedig des Ostens« genannt. Die gute Anbindung durch Schnellzüge, Autobahn und Kaiserkanal lässt Suzhou in der Riege der schnellwachsenden Städte des modernen Chinas, den sogenannten Boomtowns, mitspielen. Auch im Ranking um die ältesten Städte im Yangtze-Becken steht diese Stadt mit ihrer mehr als zweitausendfünfhunderjährigen Geschichte recht weit oben und gilt als Wiege der Wu-Kultur, die mit der Gründung der Stadt durch den legendären König Helu von Wu begann. Gern erinnere ich mich an die fantasievolle Geschichte, die meine Frau mir mal erzählt hat, denn ihr Familienname ist Wu und sie nimmt diese Zusammegehörigkeit als Anlass, sich als Kaiserin von Suzhou zu bezeichnen. In einem kleinen Ort im Bereich Suzhou trugen alle den Nachnamen Wu und einst wurde Jingniang Wu, ein von dort verschlepptes Mädchen, von Kaiser Song, einem tapferen, mutigen Krieger, gerettet. Der Weg zurück zum Dorf war weit und die beiden hatten während der Reise eine Affäre, aus der ein Baby hervorging … Hongs Ur-Großmutter. Glücklicherweise weigerte sich Kaiser Song trotz der Drohungen des Vaters, Jingniang Wu zu heiraten, und so behielt dieser Familienzweig den Nachnamen Wu. Allerdings haben sich Kaiser Songs Gene, besonders die kämpferischen Erbanteile, auch ohne Namensänderung durchgesetzt und machen mir bisweilen zu schaffen.
Nun zurück zur wahren Geschichte der Stadt. Seit Urzeiten als Zentrum von Handwerk und Handel bekannt bekam Suzhou einen besonderen Aufschwung mit der Fertigstellung des Kaiserkanals, der längsten von Menschenhand erbauten Wasserstraße der Welt, die auf diesem Weg Bejing mit Hangzhou über etwa zweitausend Kilometer miteinander verbindet. So gelang es Suzhou, sich als »Seidenhauptstadt« durchzusetzen, aber auch neben der Seidenproduktion die Fortschritte der Hightech-Industrie bis in die heutige Zeit nicht zu vernachlässigen. Touristen zieht es eher in die sehenswerte, Wolkenkratzer freie Altstadt, denn hier ist die maximale Bauhöhe von Gebäuden noch immer auf vierundzwanzig Meter beschränkt. Einige Stadtparks haben es sogar geschafft, ins UNESCO-Weltkulturerbe aufgenommen zu werden. Das große Los ist ein hùkǒu aus dieser Altstadt, ein »eingetragener ständiger Wohnsitz« von unschätzbarem Wert, den kein Inhaber wie die beneidenswerte Hong jemals aufgeben würde, auch bei einem Umzug nicht. In Deutschland hängt man eher nicht an einem Hauptwohnsitz und lässt sich als Student mit Gutschein gespickten kleinen Gefälligkeiten auch gern mal von einem Wechsel überzeugen.
Im Suzhous Norden haben Hongs Eltern vor einigen Jahren zu erschwinglichen Preisen ein Reihenhaus gekauft und sind dort eingezogen. Seit der Eröffnung einer Metrostation im letzten Jahr ganz in der Nähe sind die Immobilienpreise drastisch gestiegen. Wertsteigerung par excellence – welch Glück für die Familie.
Die Zeit ohne mich war Hong wohl zu einsam, daher machte sie sich auf den Weg zu ihren Eltern. Wobei die Sehnsucht wohl mehr am elterlichen Verwöhnprogramm und nicht so sehr an meiner Abwesenheit lag. »Der Vorteil des Daseins als Einzelkind liegt darin, dass die Eltern einen von morgens bis abends mit Essen und Trinken verwöhnen«, erzählte mir Hong in ihrer unverblümten Art. Im elterlichen Heim gehört Hong ein Arbeits- und Schlafbereich in ruhiger Lage in den obersten Stockwerken, getrennt von ihren Eltern, die sich meist im Wohnzimmer und der Küche aufhalten.
Aufgrund der Lage im Inneren der Wohnsiedlung ist es besonders nachts recht ruhig und es lässt sich gut leben. Ein paar Pflanzen schmücken die Treppe zur Terrasse, mehr Garten gibt es nicht. Über die Terrasse, die ein kleiner Hund namens »bingjiling« bewacht, und die Bewohner freudig bellend begrüßt, erreicht man durch die Eingangstür direkt das Wohnzimmer. Meine Schwiegeeltern haben ihren Hund auf Deutsch Eiscreme genannt, weil er so gerne das kalte Element schleckt, und gut erzogen, so daß er auch ins Haus darf.
Kaum hat man das Haus betreten, tauscht man Straßenschuhe gegen Hauspantoffeln, denn Schmutz und Dreck sind auch in einem chinesischen Haushalt nicht gern gesehen. In Deutschland befänden wir uns nun im Erdgeschoss, aber in China hat man diese Etage einfach übersprungen und betritt durch die Eingangstür grundsätzlich den ersten Stock. Dann wird wie auch in Deutschland üblich aufwärts gezählt und in den höheren Ebenen finden wir die Küche, das elterliche Schlafzimmer und Hongs Räume, die seit unserer Heirat auch irgendwie auch mir gehören. Li Gengnan, mein Schwiegervater, leistet sich neben dem Schlafzimmer einen Kalligrafie-Raum, in dem er, wie der Name vermuten lässt, seinem Hobby der Kalligrafie frönt. Allerdings gleicht dieser Raum trotz Schreibtisch und Bürostuhl mehr einem Atelier als einem schnöden Büro, denn ursprünglich war er ein Balkon, der durch Überdachung und Rundumverglasung zum Wohnraum umfunktioniert wurde. Statt Computer, Drucker, Tastatur und Maus ist der Schreibtisch mit Schreibpinsel, Stangentusche, Reibstein und Papier bestückt, um der seit Jahrtausenden geltenden chinesisches Tradition gerecht zu werden. Ein paar Lehrbücher runden das künstlerische Ambiente ab.
Hong und ich lernten uns vor zwei Jahren in Suzhou kennen, als ich von Shanghai beruflich dorthin umziehen musste. Der deutsche Pfarrer in Shanghai hatte zwischen uns vermittelt, damit ich bei der Wohnungssuche nicht allein auf weiter Flur stand. Damals hatte sie noch bei ihren Eltern gewohnt, an der Universität Suzhou Rechtswissenschaften unterrichtet und die Professoren unterstützt. Die Arbeit wurde relativ schlecht bezahlt, sie bekam 5.000 RMB im Monat, einschließlich aller Versicherungen und Steuern bei zwei Tagen Anwesenheit pro Woche. Renminbi mit der Abkürzung RMB ist die chinesische Volkswährung und wird auch Yuan genannt. Die fünftausend RMB sind umgerechnet knapp sechshundertfünfzig Euro, was man nicht gerade als großzügiges Einkommen ansehen kann. Allgemein werden Beamte im Vergleich zu Angestellten in der Privatwirtschaft schlechter bezahlt, wen wundert es da, dass einige auf Korruption zurückgreifen.
Trotz des geringen Verdienstes drängten Hongs Eltern darauf, diese Stelle nicht aufzugeben, um den Pensionsanspruch aufrechtzuerhalten, denn die Pensionen für Staatsbedienstete werden in China wiederum gut bezahlt. Um mich bei meinem Vorhaben unterstützen zu können, hat Hong auf Antrag eine unbefristete Pause an der Universität genehmigt bekommen.
Nach den Lieferantenbesuchen und einer Unterhaltung am Mittag mit meinem Chef im Büro habe ich mich von meinen Schwiegereltern bewirten lassen und bin dann mit Hong nach Hause gefahren.
Meine Schwiegermutter Wu Meilan hatte die Vermittlung unserer Doppelhaushälfte übernommen und Li Gengnan hatte den Kontakt zum Makler hergestellt. Bei dieser Aktion wurde mir klar, dass ich ohne Beziehungen in China nicht weit komme oder für jede Kleinigkeit teuer zahlen muss.
Auch in punkto Benennung spart man nicht, denn während in Deutschland doch eher pompöse ausladende Gebäude als Villen bezeichnet werden, gibt es in China neben freistehenden Villen auch Doppelhaus- und Reihenhausvillen.
Unser gemietetes Haus liegt wie sieben weitere Villen in einer kleinen, ruhigen Wohnanlage mit Pförtner abseits der Hauptstraße, hat einen kleinen Garten und ist erst acht Jahre alt.
Das sind schon alle Vorteile, denn die Fenster sind nur einfach verglast und eine Fußbodenheizung wie im Haus meiner Schwiegereltern sucht man hier vergebens. Übrigens ist es südlich des Changjiang-Flusses, im Westen als Yangtze bekannt, nicht üblich, dass Häuser mit Heizungen ausgestattet sind, denn aufgrund von Sparmaßnahmen und der Tatsache, dass in dieser Region selten Temperaturen unter null Grad Celsius herrschen, hat die chinesische Regierung in den 1950er Jahren dies so festgelegt. Aber jeder weiß, dass selbst zehn Grad plus nicht besonders kuschelig sind. Also gibt es drei Möglichkeiten. Nummer 1: frieren – nicht erstrebenswert. Nummer 2: Fußbodenheizung, wenn man es sich leisten kann wie Hongs Eltern. Nummer 3: Klimaanlagen, die auch heizen können.
Glücklicherweise haben wir Nummer 3 in unserem Haus zur Verfügung, was Hong am gestrigen Abend gleich ausnutzte, als wir im kalten Inneren unserer Behausung angekommen waren. Während sie zusätzlich noch Tee kochte, trug ich meine Reisetasche in mein Arbeitszimmer im dritten Stock. Die Teezubereitung ist eine Kunst und wird manchmal regelrecht zelebriert. Traditionell wird Tee durch einen Aufguss aus Blättern der Teepflanze hergestellt, aber Hongs Eltern verwenden zusätzlich auch andere Pflanzenteile wie Knospen, Blüten, Früchte und dergleichen. Während ich Grünen oder Kräutertees bevorzuge, liebt Hong Früchtetees. Interessanterweise wird Schwarzer Tee in China als Roter Tee bezeichnet. Sogar Gelber Tee ist ein Bestandteil der Teelisten, allerdings hat er den Weg in den Großhandel noch nicht gefunden, da er lange Zeit nur im Geheimen auf kleinen Inseln hergestellt wurde.
Vor Weihnachten flogen Hong und ich nach Deutschland, wobei ich eine Woche unserer Reise nutzte, um in der Zentrale von Schluckauf in Ingolstadt zu arbeiten. Jeden Morgen joggten wir gemeinsam vor dem Frühstück durch die Stadt und auf beleuchteten Wegen in Parkanlagen. Dabei stellten wir fest, dass die frische und kalte reine Luft eine Wohltat im Gegensatz zu der Luft in China war. Anschließend fuhren wir zu meinem Vater und meiner Schwester nach Oberfranken in den nördlichsten Zipfel Bayerns, um dort ein paar Tage zu bleiben, Hong evangelisch taufen zu lassen und kirchlich getraut zu werden.
Im Juni 2013 sind wir auf dem chinesischen Standesamt in Nanjing getraut worden und haben auch dort alle notwendigen Unterlagen bekommen. Hong war es wichtig, zu unserer ausladenden Hochzeitsfeier in China ihre ganze Verwandtschaft einladen zu können und somit das Gesicht zu wahren, daher feierten wir letzten Oktober im großen und teuren Stil in Suzhou. Die Wortwahl ist hier ernst zu nehmen, da über dreihundert Gäste geladen waren und alle in Hotels untergebracht und kaiserlich bewirtet wurden. Ich bin meinen Schwiegereltern noch immer dankbar, dass sie die komplette Finanzierung übernommen haben, denn das hätten Hong und ich uns niemals leisten können. Natürlich musste ich auch sämtlichen Anverwandten vorgestellt werden, da bot die Feier eine sehr gute Gelegenheit. Ich hielt eine Rede auf Chinesisch, für die ich lange vorher geübt hatte. Mein amerikanischer Chef von Schluckauf und ein reiselustiges befreundetes Ehepaar aus Deutschland, die ich eingeladen hatte, waren sichtlich beeindruckt. Da meiner Verwandtschaft die Reise nach China zu strapaziös war, versprach ich, auch in Deutschland eine Feier zu geben. Obwohl ich schon seit fünf Jahren in China lebe und arbeite und vorher einige Volkshochschulkurse besucht hatte, reichen meine Chinesisch-Kenntnisse noch immer nicht, um mich mit allen fließend unterhalten zu können. Zudem gibt es in China, wie in Deutschland auch, viele Dialekte, und der Suzhou-Dialekt meiner Verwandtschaft ist für mich gänzlich unverständlich.
Zwischen den Jahren trafen Hong und ich uns mit meinem Sohn Daniel aus erster Ehe und mit einigen alten Freunden, da mir die Verbindung zu diesen Menschen in Deutschland wichtig ist. Silvester feierten wir in Bietigheim, einer Kleinstadt in der Nähe von Stuttgart, wo ich seit Jahren ein Apartment vermiete. So nutzten wir gleich die Gelegenheit, die Mieter zu besuchen und am traditionellen Silvesterlauf durch die Stadt teilzunehmen.
Als ich vor vielen Jahren dort in einer französischen Firma als Lieferantenentwickler arbeitete, schloss ich mich einer Laufgruppe an, die für Zehn-Kilometer- bis Halbmarathon-Läufe trainiert. Obwohl ich die Teammitglieder nur einmal im Jahr sehe, haben wir noch guten Kontakt. Zum Glück konnte ich Hong von den gesundheitlichen Vorteilen dieses Sports überzeugen. Da sie früher in der Schule Staffel gelaufen ist und darin auch gut war, wie sie mir erzählte, war das auch nicht allzu schwierig.
So ein gedanklicher Ausflug lenkt sehr schön von den alltäglichen Notwendigkeiten ab. Gestern musste ich mich dazu zwingen, endlich mein Büro aufräumen, um gut gewappnet ins neue Arbeitsjahr zu starten. Zur Belohnung schaltete ich später am Abend den Fernseher ein und stellte mit einigem Verdruss fest, dass kein einziges Programm zu sehen war. Etwas hilflos wandte ich mich an meine Frau, die mir ohne Umschweife erklärte, dass es nicht sinnvoll sei, die monatliche Fernsehgebühr zu zahlen, wenn man im Ausland unterwegs ist und kein chinesisches Fernsehen empfangen kann. Hongs Logik ist manchmal sehr speziell. Einem Deutschen würde nie einfallen, seinen Fernsehanschluss bei vorübergehender Abwesenheit zu kündigen, wobei das in Deutschland ohnehin schwierig sein dürfte. Aber bei allem Unverständnis bin ich doch stolz auf meine Frau, die mitdenkt und unnötige Kosten vermeiden möchte.
Doch gestern Abend war die Fernsehrechnung immer noch nicht bezahlt, also blieb uns nichts anderes übrig, als eine alte DVD anzusehen. Dazu tranken wir einen speziellen Tata-Tee, eine pulvrige Mischung mit natürlichem Geschmack verschiedener Kräuter wie Tulsi (indischer Basilikum), Brahmi (Feenkraut), Kardamon und Ingwer, den ich letztes Jahr von einer Dienstreise aus Indien mitgebracht hatte.
Hong ist sehr impulsiv und wechselt oft unvermittelt die Themen, so dass es mir manchmal schwerfällt, ihren Gedankengängen zu folgen. Vielleicht liegt es auch daran, dass sie etwa zwanzig Jahre jünger ist als ich. Auch in diesem Augenblick blieb sie sich treu, als sie während des Films plötzlich fragte: »Was sind deiner Meinung nach die häufigsten Geschenke, die männliche Chinesen einander schenken?«
Ich wunderte mich nicht über diese weithergeholte Frage und tippte auf Wein, Bücher und Tee. Doch ich lag falsch.
»Wein, Armbanduhren und Reisen«, korrigierte mich Hong.
Bei den Frauen war ich nicht besser dran. Meine Vermutung war Essen, Reisen und DVDs, doch meine Frau belehrte mich eines Besseren und nannte Blumen, Armbanduhren und Wein. Gut, zur Kenntnis genommen.
Wir schauten weiter den Film »Der Teufel trägt Prada« und – passend dazu – begann eine kurze Diskussion über Geld und Reichtum, die mit Hongs nicht sehr geistreichem Statement »Lieber reich und gesund als arm und krank« endete.
Trotz der nächtlichen Stunde begab ich mich ins Arbeitszimmer, um meinen Laptop einzurichten und meine E-Mails zu lesen. Eine Nachricht sprang mir ins Auge: Eine Bank sandte mir Übersichten zu meinen Investmentfonds und zu meinem Entsetzen erkannte ich, dass eine der Geldanlagen deutliche Wertverluste erlitten hatte. Ich erinnerte mich an die E-Mail eines Verwalters aus Australien vor einiger Zeit, der mich darüber informierte, dass eine Firma Konkurs angemeldet hatte und er nun mit der Prozessabwicklung beauftragt worden war. Natürlich hatte ich mich daraufhin gleich bei meinen beiden britischen Finanzberatern Alan und Michael aus Shanghai gemeldet, aber sie schickten eine Entwarnung: Meine Geldanlage sei nicht betroffen.
Hong kam zur Tür herein und stocherte ein bisschen herum, frage dies und das, suchte wohl das Gespräch. Ich nutzte die Chance und bat sie um Rechtsberatung.
»Meine australischen Fonds sind ins Bodenlose gefallen, aber meine Finanzberater versicherten mir, die Geldanlage sei gegen Wertverluste geschützt. Das heißt, wenn im schlimmsten Fall kein Geld erwirtschaftet werden sollte, bekäme ich zumindest mein angelegtes Kapital zurück. Da der Fond von der Deutschen Bank verwaltet und von einer der ältesten australischen Fondsgesellschaften aufgelegt wird, könne ich auch weiterhin Vertrauen haben. Aber nach der heutigen Nachricht traue ich dem nicht mehr.«
»Falls die Firma in Australien doch pleitegehen sollte, könntest du zumindest die Finanzberater-Firma in Shanghai verklagen. Doch zuvor müsstest du dich nach einem anderen Berater umsehen, der die Verwaltung der Fonds offiziell übernimmt. Privatpersonen dürfen nicht unmittelbar Geschäfte mit Finanzinstituten abwickeln«, klärte mich Hong auf und bot mir weitere Hilfe an, wenn ich alle relevanten Unterlagen zusammengesucht hätte. Mit der Deutschen Bank hatte sie schon ihre Erfahrungen gemacht, denn als Hong in Deutschland gelebt hatte und eines Tages Geld bei eben diesem Kreditinstitut abheben wollte, erklärte man ihr anhand ihrer Kontoauszüge, das kein Geld mehr verfügbar wäre. Hong war sich sicher, ihr Konto nicht bis zum letzten Cent geleert zu haben, und ihr Kampfgeist war geweckt. Akribisch wie ein Detektiv agierte sie und deckte letztendlich alles auf. Teilnahmelisten bestätigten, dass Hong die Abhebung in Frankfurt nicht hatte durchführen können, weil sie nachweislich im Unterricht in Bonn gesessen hatte, um für die Zugangsprüfung zur Erlangung der Hochschulreife zu büffeln. Zum damaligen Zeitpunkt hatte sie in einer WG mit zwei Arabern und einer Chinesin gewohnt. Die Chinesin, die natürlich die chinesischen Schriftzeichen perfekt beherrschte, hatte Hongs Daten kopiert und so mit Hilfe der gefälschten Unterschrift ihre Identität am Schalter in der Frankfurter Filiale vorgetäuscht. Wie für Asiaten Europäer alle gleich aussehen, fällt Deutschen bei asiatischen Menschen eine Unterscheidung schwer, so dass der Schwindel nicht aufflog. Da Hong keine Unterstützung seitens der Deutschen erfuhr, musste sie sich alles allein erarbeiten und erreichte tatsächlich die Erstattung des gestohlenen Geldes. Zudem war sie nun so gut vorbereitet, dass sie problemlos die Zulassungsprüfung bestand.
Bevor ich meiner Frau ins Bett folgte, musste ich mich noch schnell über die aktuellen Aktienkurse informieren. Momentan laufen die Kurse noch bis Mitternacht über den Ticker. Alles im Minus. Ich hörte die Worte meiner Finanzberater: Kein Grund zur Besorgnis, das kann ja mal passieren, ich brauchte nur etwas Geduld und müsste warten, bis sich das Blatt wendete. Ich ging auch ins Bett, doch so leicht wollte sich keinen Schlaf einstellen.
Hong dreht mir den Rücken zu. Mit meiner Linken umfasse ich ihre linke Brust, die genau in meine Hand hinein passt.
Schon in meiner Hochzeitsrede in Deutschland nach der kirchlichen Trauung habe ich klargemacht, dass es mir gar nicht so wichtig ist, ob chinesische Frauen der Statistik nach die kleinsten Brüste auf der Welt haben. Im Gegenteil: Wie bereits erwähnt passt die Brust meiner Frau genau in meine Hand und so fühle ich mich am wohlsten, etwas anderes möchte ich gar nicht.
Mit den Brüsten meiner Frau in den Händen überlege ich, was in China alles anders ist als in Deutschland. Wenn ich das Gartenschloss links herum drehe, schließt es zu, rechts herum geht es auf. Will ich warm duschen, muss ich blau aufdrehen, bei kalt rot. Für Weihnachten werden die Kirchen gelb geschmückt, in Deutschland weiß. Bei Konferenzen zwischen Beamten und Firmenvertretern wird in China viel geschmeichelt und umgarnt, in Deutschland eher über Zahlen, Daten und Fakten geredet. In China sind WeChat und Weibo in, im Westen Twitter und Instagram. Wenn die Börse rot zeigt, steigen die Kurse, bei Grün geht es bergab.
Mittlerweile ist es sechs Uhr morgens. Draußen zwitschern schon die Vögel. Ich glaube, so etwas wie »Gib mir Schokolade« zu verstehen. Das geht eine ganze Zeit so. Muss das eine Nacht gewesen sein! Was hat der Vogel nur getrieben? Daraufhin zwitschert ein anderer Vogel. Es klingt nach »Fladenbrot …«
Hong hat sich wohl erkältet, denn sie hat in der Nacht stark gehustet, jetzt schläft sie still. Draußen herrschen Temperaturen um die zehn Grad Celsius. Dank der Einfachverglasung und den dünnen Wänden ist es innen auch nicht wärmer. Meine sparsame Hong hat die Klimaanlage nicht über Nacht laufen lassen. Zudem haben Küche und Bad keine Klimaanlage. Beste Voraussetzungen für eine Erkältung.
Aber Hong dementierte das mit folgender Erklärung: »Als ich noch klein war, hatten wir im Haus meiner Eltern gar keine Heizung, da war ich abgehärtet, denn im Kalten zu leben und zu arbeiten und mit dem Wintermantel auf der Couch zu sitzen, ist bei uns ganz normal. Aber nach einem vierjährigen Aufenthalt in Deutschland vor einigen Jahren war ich nicht mehr abgehärtet genug gegen die schmutzige Luft und habe mir gleich eine Lungenentzündung zugezogen, kaum dass ich wieder in China war. Der Arzt hat sie noch vorgestern beim Abhören identifizieren können.«
Hong hat in Deutschland sehr gutes Deutsch gelernt. Zudem beherrscht sie die Fachausdrücke für Beschimpfungen und Gossensprache nahezu perfekt. Daher unterhalten wir uns mehr auf Deutsch als auf Englisch oder Chinesisch. Sehr zu meinem Leidwesen, denn ich hätte mich lieber auf Chinesisch unterhalten. Doch dazu fehlt mir die Praxis und Hong die Geduld. Als ich sie einmal fragte, woher sie die saloppe deutsche Umgangssprache kannte, meinte sie, sie hätte täglich die Bildzeitung gelesen, die wäre in Deutschland am billigsten. Ein Grinsen stahl sich auf mein Gesicht: Ob es wohl in China auch ein Pendant zur deutschen Bildzeitung gab?
In meinem Arbeitsumfeld benötige ich kein Chinesisch und für den privaten Alltag habe ich Hong, daher ist der Druck, diese doch etwas kompliziertere Sprache zu erlernen, nicht besonders hoch. Arbeitsalltag … mit einem Mal muss ich an meine zurückliegende, anstrengende Arbeitswoche denken. Noch gestern Mittag saß ich im Büro meines amerikanischen Chefs in Shanghai und habe mit ihm Pläne für die Verbesserung der Headcount-Situation geschmiedet. Mein Chef beklagte sich, man habe ihm das Budget drastisch gekürzt und das Geld anderen zugeschoben. Er wüsste nicht einmal mehr, wie er die Löhne zahlen sollte, von den Kosten für Headhunter, die alte und erfahrene Hasen mit ins Boot holen sollen, ganz zu schweigen. Und was würde aus den Stipendien für begabte chinesische Studenten, die man nach ihrem Studium einstellen möchte?
»Ja dann …«, meinte er schließlich resigniert, »… dann müssen wir wohl alle dieses Jahr den Gürtel etwas enger schnallen«.
Einen Tag davor war ich zum »Global Sourcing Board«, einer Telefonkonferenz mit der Zentrale in Deutschland, eingeladen worden. Leider hatte man vergessen, mich im Voraus darüber zu informieren, so dass ich nur noch eilig das Nötigste zusammengetragen konnte und nachts im Hotel eine Kalkulation erstellen musste. Zum Glück wurde ich rechtzeitig fertig, obwohl die an mich geschickten Lieferscheine alle auf Chinesisch waren. Hier kamen mir meine fachlichen Chinesisch-Kenntnisse zugute.
Kurz darauf erhielt ich eine Mail auf Deutsch mit der Bitte um rechtzeitige Übersetzung derjenigen ins Englische und Chinesische. Ein deutscher Manager würde bereits am folgenden Tag zu einem chinesischen Lieferanten reisen und brauchte Unterstützung, um notwendige Daten für die anschließende Kostenkalkulation auf Englisch und Chinesisch zu erfragen. Ich leitete die Mail gleich zum Übersetzen an eine deutschsprechende chinesische Mitarbeiterin im Shanghai-Büro weiter, stellte jedoch auf der gestrigen Autofahrt zum Büro fest – nochmal zur Erinnerung, ich fahre nicht selbst, ich habe einen Chauffeur –, dass dies nicht erledigt worden war. Mir blieb daher nichts anderes übrig, als die Mail selbst zu übersetzen. Das ging auch aus meiner Sicht ganz gut, denn mein Fachvokabular beherrsche ich auf Englisch und auch leidlich auf Chinesisch.
Allerdings konnte ich die Datei nicht im Auto absenden und musste warten, bis ich im Büro war. Es war schon nach neun Uhr morgens. Zum Glück hatte sich keiner beschwert. Ich wunderte mich ein weiteres Mal darüber, warum hier alles immer auf den letzten Drücker geschehen musste. Man konnte schließlich davon ausgehen, dass die Reiseplanungen nicht erst seit vorgestern feststanden. Und warum sprechen die deutschen Manager eigentlich kein Englisch? Schließlich sind wir doch ein internationales Unternehmen. Oder sind sie einfach zu faul und wollen die Arbeit von anderen erledigt haben? Als ich mich bei einem anderen deutschen Kollegen im Büro darüber aufregte, meinte der nur, dass sowieso alle Mails immer auf Deutsch geschrieben würden. »Warum sollen sich auch Deutsche auf Englisch unterhalten? Einmal hat ein neuer Kollege genau dies versucht durchzusetzen. Er war unter den Deutschen nicht sehr beliebt und hat nach kurzem die Firma wieder verlassen«, erzählte er noch.
Ein weiteres Thema bei meinem amerikanischen Chef war die kostensparende Zusammenlegung mehrere Büros in einem höhergelegenen Stockwerk. Hierdurch könnte eine ganze Etage aufgegeben werden, aber mein Büro würde dann komplett gestrichen werden. Ich benötigte das ja nicht, klärte mich mein Chef auf, denn ich sei sowieso die meiste Zeit außer Haus, bei Lieferanten oder bei Treffen mit Einkäufern in meinem Büro in unserem Fertigungswerk in Taicang.
Ich machte ihn darauf aufmerksam, dass das Management-Team schwerlich zusammenhalten und an einem Strang ziehen könnte, wenn ich weitab in Taicang säße und auch an den Teambesprechungen, die meinem Chef so am Herzen lagen, nicht mehr teilnehmen könnte. Wenige Stunden später hatte ich mein Büro in Shanghai wieder.
Meine Frau war stolz auf mich, weil ich für meine Sache gekämpft hatte. Als ob ich sonst nicht kämpfen würde … Ich tue alles, um Fuß zu fassen. Auch morgen ist wieder Arbeit angesagt. Es ist zwar Sonntag, aber aufgrund der Feiertags-Politik in China wurde dieser Sonntag als offizieller Arbeitstag festgelegt. Generell arbeiten die Büroangestellten wie in Deutschland von Montag bis Freitag, die Arbeitszeiten sind gesetzlich geregelt und dürfen vierundvierzig Stunden in der Woche nicht überschreiten. In Ausnahmefällen kann auch an Wochenenden und Feiertagen gearbeitet werden, mit dem Unterschied, dass Überstunden mit mindestens hundertfünfzig Prozent des Lohnes vergütet werden müssen. Sollte Arbeit an Wochenenden nötig sein und nicht anderweitig ausgeglichen werden können, dann steigt der Zuschlag auf mindestens zweihundert Prozent. Bei Arbeit an Feiertagen müssen sogar mindestens dreihundert Prozent gezahlt werden.1 Inwieweit das auch so gehandhabt oder durch Sonderregelungen umgangen wird, bleibt allerdings offen.
Zu den elf gesetzlichen Feiertagen kommen je Dauer der Betriebszugehörigkeit noch fünf bis fünfzehn Urlaubstage, die wie im Westen zeitlich frei gewählt werden können. Feiertage, die auf ein Wochenende fallen, werden sozusagen nachgeholt, was wie in diesem Jahr zu einer erheblichen Verlängerung der freien Zeit führen kann. Nächstes Wochenende beginnt das Chinese New Year, gern auch mit CNY abgekürzt, das neue Jahr nach dem chinesischen Mondkalender. Normalerweise gibt es hierfür drei gesetzliche Feiertage, aber da das Fest direkt an einem Wochenende liegt, wurden diese beiden Tage hinten dran gehängt. Um diese zusammenhängende Zeit noch etwas zu verlängern, wurden der morgige Sonntag und der erste Februarsamstag kurzerhand vom Staat als Arbeitstage festgelegt und aus drei Feiertagen werden sieben. So kann man auch bequem die langen Entfernungen in China überwinden, um ein paar Tage mit der Familie verbringen zu können.
Mir ist der Arbeitssonntag ganz recht, denn ich selbst habe die Einkäufer unter Druck gesetzt und Einladungen zu Meetings rausgeschickt.
Rückblickend waren die ersten Wochen des noch nicht sehr alten Neuen Jahres sehr stressig, denn nicht nur beruflich, auch privat war einiges los. Vor ein paar Tagen waren Hong und ich beim monatlichen AHK-Treffen, dem Treffen der deutschen Auslandshandelskammer, in Shanghai. Dort habe ich zum ersten Mal die neue evangelische Pastorin getroffen, die nun für den Großraum Shanghai zuständig ist. Die Metropole hat ihr eine kleine Kirche im westlichen Qingpu-Distrikt zugeteilt – daher nenne ich sie Qingpu-Kirche –, in der sie die Gottesdienste der chinesischen evangelischen »Drei Selbst Kirche«, so die offizielle Bezeichnung, abhält. Interessanterweise ist Religion, egal welcher Art, in China ein heikles Thema, da sie sich nicht so gut mit der staatlichen Philosophie verträgt. Mittlerweile gibt es offiziell anerkannte Religionen, die allerdings strikten Anweisungen des Staates unterliegen, dazu gehören Katholizismus, Protestantismus, Buddhismus, Taoismus und Islam. Anhänger anderer Religionen werden auch heute noch verfolgt.
Bereits im 13. und 14. Jahrhundert hatten Katholiken erste Versuche der Missionierung angestrengt, sind aber gescheitert. Vor etwa zweihundert Jahren kamen die ersten protestantischen Missionare nach China und hatten mäßigen Erfolg, aber einige ließen sich doch überzeugen, so dass die Mitgliederzahl, wenn auch anfangs sehr langsam, aber stetig wuchs. Fünf Jahre nach Gründung der Volksrepublik China wurde allem zum Trotz die jetzige evangelische Kirche unter dem Namen »Drei Selbst Kirche« gegründet.
»Wie ist dieser Name zustande gekommen?«, wollte ich von Hong wissen.
»Während der Kulturrevolution hat jeder seine Religion verheimlicht, auch Buddhas wurden vernichtet und stattdessen Mao-Bilder aufgehängt. Wenn du überleben möchtest, musst du mit der kommunistischen Partei kooperieren. So hatte die evangelische Kirche nur die Möglichkeit, sich von der westlichen Organisation zu lösen und sich nicht mehr davon beeinflussen zu lassen. Die Kirche bekam Kirchengebäude und hauptamtliche Mitarbeiter, allesamt Parteimitglieder. Selbst entscheiden, selbst finanzieren, selbst ausbreiten – das ergibt die drei Selbst im Namen der Kirche.«
Die aktuellen Mitgliederzahlen sind schwer zu erfassen, da es neben den staatlich anerkannten Kirchen auch unzählige nicht registrierte Gemeinden gibt. Man geht davon aus, dass etwa ein bis sechs Prozent der chinesischen Bevölkerung Christen sind.2 Im Gegensatz zu Deutschland mit fast sechzig Prozent im Jahr 2013 – Katholiken und Protestanten halten sich hier in etwa die Waage – ist das doch ein sehr geringer Anteil der Gesamtbevölkerung.3 Dabei darf man allerdings nicht vergessen, dass Deutschland im Vergleich zu China eine sehr geringe Einwohnerzahl hat. Legt man die angenommenen sechs Prozent chinesischer Christen zugrunde, deckt sich diese Anzahl mit der Gesamtbevölkerung Deutschlands … Also doch kein so kleiner Anteil.
Auch den katholischen Pastor Peter Kreuz, den wir von früher kennen, haben wir beim AHK-Treffen getroffen. Die katholische Kirche heißt »CCPA, Chinese Catholic Patriotic Association«. Diese musste sich vom Papst lossagen, um in China offiziell anerkannt zu werden. Das ist bei diesem Glauben, der den Papst als sein kirchliches Oberhaupt ansieht, nicht gerade eine Kleinigkeit.4
Peter Kreuz arbeitet nun in Anton Rebes Unternehmen und hatte diese Firma auf seiner Visitenkarte stehen. Er hatte sich hierzu nicht äußern wollen. Ich weiß jedoch, dass ausländische Priester in China keine Arbeitserlaubnis und somit kein langfristiges Visum bekommen, weil sie nicht für die chinesischen Kirche arbeiten. Sie müssen bei einer legalen Firma in China angestellt sein und tragen aus Dank und für Werbezwecke deren Visitenkarte mit sich herum.
Hong hat CNY schon durchgeplant, sie möchte es mit ihrer ganzen Verwandtschaft verbringen. Natürlich werde ich mich dann auch wieder auf Chinesisch oder besser gesagt auf Suzhounesisch mit der ganzen Familie unterhalten, wobei das für mich sehr anstrengend werden wird, da sie zwar mein Chinesisch verstehen, ich aber ihr Suzhounesisch nicht. Trotzdem freue ich mich immer wieder, dass ich als Laowai, die chinesische Bezeichnung für Ausländer, so herzlich in der Familie aufgenommen worden bin. Das ist in China keine Selbstverständlichkeit, da die chinesische Gesellschaft Fremden gegenüber generell misstrauisch gesinnt ist. Die Geschichte lehrt uns, dass sie dazu leider auch allen Grund hat.
Jeder wollte ein Stück vom chinesischen Grund und Boden, was dem einen mehr, dem anderen weniger gut gelang. Die Quintessenz des 1. Opiumkriegs Mitte des 19. Jahrhunderts war die Abtretung Hongkongs an Großbritannien, beim 2. Opiumkrieg wenige Jahre später mischte zusätzlich Frankreich mit und letzten Endes wurde der Opiumhandel legalisiert und China konnte sich nicht mehr gegen internationale Handelsbeziehungen wehren. Chinas Wirtschaft brach ein und mit der Vormachtstellung in Asien war es vorbei, aber auch das war den Großmächten nicht genug. Nun standen Großbritannien, Russland, Japan, Frankreich und Deutschland im Wettstreit miteinander um die größten Bissen bei der Aufteilung Chinas.
Zu jener Zeit befand sich die Qing-Regierung in einer schweren finanziellen Krise. Da ihre Jahresbruttoeinnahmen bei Weitem nicht ausreichten, die Ausgaben zu decken, sah sie sich gezwungen, Geld bei den westlichen Ländern zu leihen und ihre Seezolleinkünfte zu verpfänden. Dadurch gewannen die Großmächte die Kontrolle über Chinas Finanzen, gründeten Bankniederlassungen, über die sie ihre Kapitalexporte abwickelten und Banknoten ausgaben. So konnten sie die chinesische Finanzwirtschaft manipulieren. Allein in den fünf Jahren nach 1895 bauten sie in China knapp eintausend Fabriken. Sie dominierten den Eisenbahnbau, den Schiffstransport und den Bergbau.
Erstaunlicherweise spielten die USA bis Ende des 19. Jahrhunderts überhaupt keine Rolle bei Eroberung Chinas, doch das sollte sich ändern. Der Vorschlag der USA, der amerikanischen Großmacht gleiche Vorteile und Chancen auf dem chinesischen Markt einzuräumen, wurde unblutig akzeptiert und so setzten sich auch die Amerikaner in China immer mehr fest.
In den 1930er Jahren konnte China in Widerstandskämpfen gegen Japan endlich punkten und Japan musste einsehen, dass es mit der Alleinherrschaft über Asien nicht klappte. Im zweiten Weltkrieg verbündete sich China mit den Alliierten und gemeinsam zwangen sie Deutschland, Italien und Japan in die Knie.5
Nun genug der Unannehmlichkeiten. Die bevorstehenden Feiertage nehme ich zum Anlass, wieder mehr Chinesisch üben zu wollen, am besten auf dem Notebook, das ich Hong zu Weihnachten geschenkt habe. Ach herrje, bald ist ja auch wieder Valentinstag …
Als hätte sie meine Gedanken gelesen, ist Hong aufgewacht und kommt zu mir gekrochen. Um das Haus herum pfeift der Wind bei etwa 14 Grad, drinnen wie draußen. Vor ein paar Tagen war es schon mal kälter. Hong hustet wieder, vielleicht sollte ich ihr zu einem Arztbesuch raten.
Das neue chinesische Jahr steht im Zeichen des Pferdes. Um den Ursprung der zwölf Tierkreiszeichen ranken sich viele Legenden und Volkssagen, wobei die heute mehrheitlich verwendete Tierauswahl und deren Reihenfolge gerade bei vielen ethnischen Minderheiten Chinas nicht übernommen wurde. In einer weitverbreiteten Legende ließ Kaiser Xuanyuan unter allen Tieren verlauten, dass zwölf Tiere seine kaiserliche Leibwache bilden sollten. Da es sich um einen begehrten Posten handelte, setzten die Tiere teils rabiate Mittel ein, um andere auszustechen und sich so den besten Platz zu sichern. Dieser unfaire Kampf legte letztendlich die Reihenfolge der Tiere fest. Laut einer anderen Legende wurde ein Tag in Zwei-Stunden-Zyklen unterteilt und die Auswahl und Rangfolge der Tiere ergab sich aus deren aktivster Zeit während dieser Zyklen.6.
Hong ist in einem Pferdejahr, das sich alle zwölf Jahre wiederholt, geboren, daher trägt sie jetzt rote Unterwäsche, denn nach chinesischem Glauben soll das die bösen Geister vertreiben oder zumindest milde stimmen. Ein chinesischer Freund hat mir einmal erzählt, dass das Jahr des Pferdes kein gutes Jahr wäre, da nur halb so viele Kinder geboren würden wie im Jahr des Drachen. Ob das wirklich stimmt, weiß ich nicht. Ich erzähle Hong besser nichts davon.
Aber in gewissem Sinne ist das nachvollziehbar, denn dem Pferdgeborenen wird Ruhelosigkeit, Bewegungsdrang und die Suche nach Abenteuern nachgesagt. Das Jahr des Pferdes wird demnach aufregend, quirlig, bisweilen wahrscheinlich auch stressig und hektisch und in der Liebe abwechslungsreich und überaschend. Daher scheint die Gelegenheit, sich längerfristig festzulegen, in diesem Jahr nicht gegeben zu sein. Aber da ich meine Frau ja bereits etwas länger kenne, bin ich daran gewöhnt. Ich muss nur darauf achten, ihr den Freiraum zu geben, den sie benötigt, und sie nicht einzuengen, denn Zügle lässt sie sich definitiv nicht anlegen. Da ich im Geiste ein moderner Mensch bin, sollte mir das nicht allzu schwerfallen. Wichtig für mich ist die Tatsache, dass das Pferd auch für finanzielle Sicherheit steht, denn die ist leider essenziell, auch wenn man das Materielle eher nicht auf die obersten Stufen seiner Lebenspyramide stellen sollte.
»Weißt du, dass viele Regierungschefs im Pferdejahr geboren sind: Merkel, Cameron, Hollande sowie auch der türkische Minister.«
Ich erwidere fröhlich, dass sie dann ja gute Chancen hätte, Premierministerin oder Regierungschefin zu werden.
»Aber nein, ein weiblicher Premierminister in China?«, rief sie. »Das ist unmöglich, also zumindest bis jetzt. In unserer Geschichte gab es ja auch nur männliche Kaiser. Bis auf die Kaiserin Wu Zhao, die aber beschuldigt wurde, ihren Gatten vergiftet zu haben, um an die Macht zu kommen.«
Nach dem Aufstehen jogge ich am Fluss entlang. Die Sonne schafft es nicht, sich durch die dicken Smogwolken hindurch zu kämpfen, und so sehe ich nur eine einzige graue Masse vor mir. Der Smog ist in den Wintermonaten am Schlimmsten. Was gibt es Bedrückenderes als China im Winter?, schießt es mir unwillkürlich durch den Kopf. Die mir entgegenkommenden Passanten schauen mich ungläubig an. Ob es daran liegt, dass ich Ausländer bin, oder daran, dass nur ein Wahnsinniger bei diesem Smog laufen würde? Wahrscheinlich an beidem. In diesem Augenblick beschließe ich, nach dem Chinesischen Neujahrsfest mit Hong zur Erholung nach Thailand zu fliegen.
Nach der Dusche im eiskalten Badezimmer gibt es Brunch. Dann werden Neujahrsgrüße verschickt und die E-Mails auf den Visitenkarten vom AHK-Treffen in LinkedIn, einer internationalen Networking-Website für Geschäftsleute, eingegeben. Man weiß ja schließlich nie, wofür diese Kontakte noch nützlich sein können. Abends gehen wir zur Apotheke, um Hustensaft und Tabletten zu kaufen und um nebenan Nudelsuppe zu essen. Da es unzählige Variationen von Nudeln gibt und der Geschmack auch sehr unterschiedlich ist, wird es nie langweilig und man könnte jeden Tag Nudeln essen. Sie schonen auch den Geldbeutel und machen lange satt. Einziger Wehrmutstropfen für mich ist die überall stark verbreitete Verwendung von Glutamat zur Geschmacksverstärkung, das ich als Europäer nur schlecht vertrage und Sodbrennen bei mir verursacht. Viele Restaurants wärmen nur gelieferte, vorgekochte Waren auf, so dass ich meinen Sonderwunsch „ohne Glutamat“ nur in Restaurants erfüllt bekomme, die ihre Speisen frisch zubereiten und so Einfluss auf die Zutaten nehmen können.
Nach unserem Nudelmahl bestehe ich darauf, in der Bäckerei noch ein paar Alkohol gefüllte Leckereien zu kaufen. Die werden zur Hälfte gleich zuhause verspeist, während ich einen neuen Film in den DVD-Player lege und Hong im Internet surft. Sie erzählt mir ein paar chinesische Witze auf Deutsch, die ich aber nicht witzig finde oder nicht verstehe.
Mit Nudeln und Nachtisch im Magen gehen wir ins Bett. Ich vergesse nicht, noch schnell ein Schnapsglas von meinem Kräuterwasser zu trinken, das mir Li Gengnan geschenkt hat. Nach TCM, der traditionellen chinesischen Medizin, stärkt das Getränk sowohl die Gesundheit als auch die Potenz des Mannes beträchtlich, man muss nur fest daran glauben. Hierzu werden sehr teure Zutaten wie zum Beispiel der Penis eines Hirsches oder besser der eines Schneehundes aus den Bergen verwendet. Aus diesen wird ein hochprozentiger Schnaps gewonnen und dann genüsslich getrunken. Einfach herrlich, diese traditionelle Medizin. Frauen dürfen da natürlich nicht ran, zu gefährlich, wegen der Potenz.
Die TMC insbesondere in Form von Akupunktur hat schon viele meiner Wehwehchen kuriert, an denen die Schulmedizin gescheitert ist. Auch Meditationsübungen wie Qigong habe ich mir angeeignet, um mein Qi in Einklang mit meinem Körper zu bringen und entspannter durchs Leben zu gehen. Daher bevorzuge ich die Atemübungen statt der Kampfsportarten, die auch den Qi-Fluss regulieren können.
Am 30. Januar, einem Donnerstag, komme ich wie gewohnt erst gegen sieben Uhr abends von der Arbeit nach Hause. Hong hat bereits ein hervorragendes chinesisches Abendessen mit westlichen Kräutern gezaubert.
»Du könntest ein Restaurant aufmachen!«, schmeichle ich ihr und gebe ihr einen Kuss.
»Ach ja, wo denn?«, fragt sie mich.
»Natürlich hier in China! Chinesisches Essen schmeckt den Chinesen sowieso am besten. Natürlich aber mit westlichen Kräutern, damit du dich von der Konkurrenz abhebst.«
Im Fernsehen läuft der Film »Australia«. Dieser ist noch lange nicht zu Ende, als wir beide schon aufgegessen haben. Hong steht auf, trägt die Teller in die Küche und spült ab. Ich mixe mir derweilen einen Cocktail und schaue den Film weiter.
»Heute müssen wir noch im ersten Stock sauber machen!«, ruft sie plötzlich aus der Küche. »Ich hab schon ewig für den zweiten gebraucht!«
Ich seufze, jetzt ist es wohl vorbei mit dem entspannten Abend. Nach chinesischer Tradition muss ein Haus am Tag vor Neujahr gefegt und geputzt werden, um sich selbst von den Lasten des alten Jahres zu befreien.
Ich füge mich, helfe ihr, die Stühle hochzustellen, und frage sie, ob sie noch einen zweiten Besen hätte. Darauf meint sie nur, ich käme eh immer erst, wenn die meiste Arbeit schon gemacht sei. Ich gehe leicht beleidigt wieder ins Wohnzimmer, doch der Film ist schon vorbei.
So begebe ich mich in mein Arbeitszimmer, mache meine Steuererklärung für das letzte Jahr fertig und schaue mir meine Aktienkurse an. Immer wenn ich auf steigende Aktien setze, habe ich das Gefühl, die Aktien gehen nach unten und umgekehrt. Werde ich das jemals begreifen?
Nun ja, morgen ist Silvester genauer gesagt CNY. Wir wollen noch heute eine preiswerte Urlaubsreise nach Thailand buchen oder sie zumindest besprechen, dann packen und morgen gleich nach meiner Arbeit zu Hongs Eltern fahren, um dort gemeinsam zu Abend zu essen. So will es die Tradition. Wir werden erwartet und alles ist für unsere Übernachtung vorbereitet. Das Neujahrsfest hat in China einen ähnlich hohen Stellenwert wie bei uns in Deutschland Weihnachten und gilt als das wichtigste Fest des Jahres.
Am folgenden Nachmittag verlassen wir unsere Wohnanlage in Taicang und verteilen Hongbaos als Neujahrsgeschenke. Hongbao setzt sich zusammen aus Hong für Rot, wie wir bereits wissen, und Bao für Tasche. In China ist es üblich, diese roten Taschen mit Geldscheinen zu füllen und zu verschenken, auch zu Geburtstagen und Hochzeiten. Hong erzählte mir einmal von einem Wanderarbeiter mit einer großen Familie, die ihn sehr oft zu Festivitäten einlädt. Von seinen sechzigtausend Renminbi Jahresverdienst hat er fünfzigtausend allein für Hongbaos ausgegeben. Tja, Familienfeiern in China können teuer werden und mit einer Absage kann sich niemand aus der Affäre ziehen, denn gezahlt werden muss trotzdem.
Der Pförtner unseres Compounds, wie Wohnanlagen in China genannt werden, bekommt einen Hongbao sowie auch mein chinesischer Fahrer, dem wir das Auto abnehmen, denn Hong will selbst fahren.
Als wir später alle in Suzhou am üppig gedeckten Tisch zusammensitzen, frage ich nach den Speisen, von denen mir einige unbekannt sind. Ich bin zwar schon einige Jahre in China, doch an einem so üppig gedeckten Tisch habe ich noch nie gesessen. Meistens bin ich mit Freundinnen über CNY in den Süden geflogen, um die Sonne und das Meer zu genießen, zuletzt 2012 mit Jasmine nach Bali, 2011 mit Fangfang auf die Philippinen, 2010 mit Shuming nach Malaysia und 2009 nach Yunnan mit meiner chinesisch Lehrerin, deren Namen ich bereits vergessen habe, aber ich kann mich noch gut daran erinnern, dass sie große Mengen Schnaps vertragen hatte. Auch die Jahre vorher war ich nach China gekommen, um Geschäftsleute während CNY zu treffen, denn das ist die beste Zeit für Geschäfte, da alle während der Feiertage viel Zeit haben.
Ich habe die Reisen damals bezahlt und dafür Spaß gehabt, aber seit ich Hong kennengelernt und geheiratet habe, bin ich fest in das chinesische Familienleben eingebunden. Das hat viele Vorteile, zum Beispiel wird zuhause gesünder gekocht als im Restaurant. In Restaurantküchen werden mehr billiges Öl und künstliche Geschmacksverstärker benutzt, auch wird Fleisch gefälscht, um damit mehr Geld zu verdienen. Hierzu wird zum Beispiel Schweinefleisch nach dem Schlachten „chemisch mariniert“ und als teureres Rindfleisch verkauft, um gute Renditen einzufahren7. Am heimischen Herd dagegen werden wertvolle Kräuter und Gewürze benutzt, alles ist echt und wird mit Liebe und viel Zeit zubereitet. Li Gengnan steht immer mehrere Stunden in der Küche und zaubert ein tolles Mahl, da geht es nicht um Kostenreduzierung, sondern um Geschmack.
Nun ist Zeit, ein paar Worte über meine Schwiegereltern zu verlieren. Beide sind pensioniert und genießen das Leben. Aufgrund ihrer gesunden, frischen Ernährung sind beide recht schlank, was für Wu Meilan von Vorteil ist, da sie ihre Zuckerkrankheit somit gut im Griff hat, obwohl sie in den letzten Jahrzehnten keinen Sport mehr getrieben hat. Li Gengnan dagegenen hat Gymnastik und Yoga in seinen alltäglichen Ablauf eingebunden, so dass er einen 1,75 Meter großen, muskulösen Körper vorweisen kann. Wu Meilan ist wie ihre Tochter etwa fünfzehn Zentimeter kleiner als der Mann im Haus.
Gespannt lausche ich Hongs Erklärungen zur Bedeutung der verschiedenen traditionellen chinesischen Gerichte auf dem Tisch.
»Der Fisch hier heißt Li Yu. Yu wird zwar Yü gesprochen, aber Yu geschrieben, bedeutet Fisch und klingt auf Chinesisch wie ›übrig‹, das heißt, im neuen Jahr wirst du viel übrig haben. Du wirst also reich werden.«
Das freut mich natürlich sehr, hoffentlich wird es wahr.
Nun deutet sie auf einen kleinen Kuchen aus Reis.
»Das ist Nian Gao. ›Nian‹ bedeutet ›Jahr‹ und ›gao‹ bedeutet ›Kuchen‹, aber auch ›hoch‹, was man auf das Gehalt beziehen kann. Du wirst also noch reicher.«
Ich liebe chinesisches Essen zu CNY.
Hong fährt fort: »Auch die mit Hackfleisch gefüllten Eier, die wir Dan Jiao nennen, tragen zur Vermehrung deines Reichtums bei, wenn du viele davon isst. Man sagt, man bekommt dann viele ›Jin Yuan Bao‹, das war unsere Währung während der Jin-Dynastie.«
Jetzt wird es mir langsam unheimlich, wohin mit dem vielen Geld?
Hong deutet auf eine mit gelben Bohnensprossen gefüllte Schüssel, deren Form an »Ru Yi« erinnere, einen Glücksbringer für Gesundheit. Na den werde ich nach dem üppigen Mahl sicher brauchen.
»Die kennst du aber doch, oder?«, stellt mich meine Frau mich auf die Probe. Ich folge ihrem Finger und erkenne »Rou Yuan«. Diese Fleischbällchen sind ein Zeichen für die Zusammenkunft der Familie am Frühlingsfest, ein weiterer Name für das chinesische Neujahr.
Ich bediene mich großzügig, doch Wu Meilan ermuntert mich, noch mehr zu essen, und befördert ungeniert immer mehr der Reichtum bringenden Speisen in meine Reisschüssel. Es gibt zwar unzählige Sorten Reis, doch in China wird immer der Klebereis verwendet, der mit Wasser in Reiskochern zubereitet wird.
Während des Abendessens dreht sich das Gespräch um die alljährlichen Familienfeierlichkeiten und um die Massenwanderung der Chinesen, die zu diesem Zeitpunkt einsetzt. Es gibt sogar eine eigene Bezeichnung hierfür: »Chun Yun«. »Chun« bedeutet Frühling, »Yun« steht für Transport, nicht sehr poetisch, aber es drückt genau das aus, was es ist. Während der Tage vor und nach dem chinesischen Neujahrstag drängeln sich um die achthundert Millionen Menschen in Chinas Züge, um in ihre meist weit entfernten Heimatstädte und Dörfer zurückzukehren. Für die Koordination und die Logistik ist das eine wahre Herausforderung.
Fahrkarten für diese Zeiten sind online schon innerhalb weniger Sekunden nach Erscheinen ausverkauft, so dass Wanderarbeiter ohne Internetzugang meist schlechte Chancen auf ein Ticket haben. Manche ergattern noch offizielle Fahrkarten ohne Sitzplatz, aber man sollte die Entfernungen hier nicht unterschätzen, die um ein Vielfaches größer als in Deutschland sind. Da kann eine Zugfahrt auch mal vierzig Stunden dauern, was ohne Sitzplatz nicht besonders bequem sein dürfte. Aber zum Glück blüht auch hier der Schwarzmarkt und die sogenannte »Gelbe-Ochsen-Gruppe« bietet Restfahrkarten an, allerdings zu überteuerten Preisen, aber was tut man nicht alles für die Familie.
Nach dem Frühlingsfest entspannt sich die Preispolitik um die Fahrkarten wieder, trotzdem bleibt die Lage während der Stoßzeiten vor allem für die vielen Leute mit wenig Geld dramatisch. Sie kommen meist nicht rechtzeitig heim, um mit der Familie zu Abend zu essen, und schaffen es auch nicht, wieder rechtzeitig zurück in die Stadt, in der sie arbeiten.
Nach dem Festessen bekommen Hong und ich von ihren Eltern ein kleines Goldstück mit einem Pferdekopf geschenkt, mit dem Hinweis, auch Hongs Kinder würden einmal so ein Goldstück erhalten. Es scheint ein Lockmittel zu sein, damit wir doch endlich Nachwuchs zeugen mögen und Hongs Eltern Enkelkinder großziehen können. Hong hat ihren Eltern vor einiger Zeit erzählt, dass Kinder bei dieser Luftverschmutzung nicht gesund aufwachsen könnten und sie lieber im Ausland Kinder haben möchte. War das der Grund für die neue Lockmittelstrategie ihrer Eltern?
Am ersten Neujahrstag bleiben die Chinesen meist zuhause, denn der Aberglaube behauptet, wer andere Familien besucht, dem fließt das Geld ab und geht zu diesen über. Und wer gibt schon gern Geld an andere ab? Bleibt man dagegen zuhause, wird das »Shou Cai« genannt, das Vermögen schützen und halten.
Trotzdem fahren Hong und ich mit der neuen Metrolinie, die zur Wertsteigerung des elterlichen Hauses beigetragen hat, in die Stadt, um dort im herrlichen Sonnenschein am Fluss spazieren zu gehen. Der Weg am Fluss ist eine Fußgängerzone, nur Einheimische fahren dort mit dem Elektro-Moped oder dem Auto in den engen Gassen. Die Bauern verkaufen ihre Waren hauptsächlich an Touristen, aber bei den kleinen Straßenständen können Hong und ich nicht widerstehen und gönnen uns Tofu-Suppe, gegrilltes Lammfleisch am Spies und Fladenbrot. Auf dem Rückweg fahren wir mit dem Boot durch den Kanal, nehmen die Metro und kommen so rechtzeitig wieder heim, wo wir von Hongs Eltern schon zum Abendessen erwarten werden.
Nach einer weiteren Übernachtung bei den Schwiegereltern besuchen Hong und ich ihre sehr alten Großeltern und die Kinder der Cousinen und Cousins und übereichen jedem einen Hongbao, denn es ist Tradition, dass Paare den Verwandten mit Kindern Geld schenken. Zum Glück wohnen alle in der Nähe und es sind nicht viele Besuche, denn die Wohnungen sind ungemütlich kalt.
Hongs Eltern haben bereits die Verwandten väterlicherseits, die bei unserer großen Hochzeitsfeier in China natürlich auch dabei gewesen waren, mit Hongbaos beschenkt, so können wir uns entspannt zurücklehnen. Hong knüpft an den Wink ihrer Eltern an und meint in ihrer überaus hervorstechenden Logik, solange wir keine Kinder hätten, gäben wir nur Geld aus, wenn wir aber welche hätten, bekämen wir auch wieder welches zurück.
Der zweite Neujahrstag hat noch eine weitere Bedeutung: Schwiegersohn-Tag. An diesem Tag sollte ich die Familie meiner Frau besuchen. Glücklicherweise bin ich ja bereits da, so dass dieser Punkt ohne größeren Aufwand schon abgehakt ist.
Am dritten Neujahrstag fährt Hong morgens mit mir und ihren Eltern zum Wetland Park am Taihu Lake. Wir gehen dort wandern und machen eine Bootsfahrt. Es regnet nicht, aber es hängt schwerer, kalter Nebel in der Luft. Nichtsdestotrotz wollen wir unseren Ausflug genießen und fahren weiter zu den heißen Quellen. Dort sind verschiedene Quellen unter einer riesigen beheizten Kuppel untergebracht und man kann in ihnen baden. Wir begeben uns zum Empfang, doch unsere Pechsträhne will nicht abreißen, denn wir erfahren, dass wir ohne Reservierung keine heißen Quellen zu sehen bekommen. Ich schaue meine Begleiter an … wer hatte diese nutzlose Idee?
Uns bleibt nichts anders übrig, als nach Hause zu fahren, ohne das warme Wasser genießen zu können. Aber mir ist das ganz recht, schließlich ist es sehr voll hier und Hong ist auch noch erkältet.
Auf der Rückfahrt am Nachmittag läuft plötzlich ein Hund auf die Straße vor unser Auto. Hong kann diesem Vierbeiner trotz roter Unterwäsche nicht mehr ausweichen und überfährt ihn. Das sei schon der zweite Hund in ihrem Leben, den sie auf dem Gewissen habe, jammert sie. Ihren eigenen Hund hatte sie damals nicht angeleint, deshalb war er weggelaufen und überfahren worden.
»Das kann kein gutes Jahr werden, wenn uns schon kurz nach CNY solch ein Unglück passiert! Wir sollten in diesem Jahr lieber keine Kinder bekommen!«, bemerkt sie mit einem Stirnrunzeln.
Ich muss ein Schmunzeln unterdrücken und werfe einen Seitenblick auf Hongs Mutter, die neben mir auf der Rückbank sitzt. Sie ist sichtlich nicht begeistert.
Wir stellen fest, dass die Plastikteile und Lampen an der Frontseite des Autos stark beschädigt wurden. Hoffentlich übernimmt die Versicherung den Schaden.
Normalerweise stehen in China wie auch auf der ganzen Welt die Frauen in der Küche. In Hongs Elternhaus sind die Rollen seit Jahrzehnten umgekehrt verteilt: Wie immer kocht Li Gengnan ein leckeres chinesisches Abendessen. Nach der Tradition dürfen dabei die kleinen runden Reiskuchen – der aufmerksame Leser kennt sie als Nian Gao – nicht fehlen.
Anschließend skype ich mit Daniel, denn ich habe Fragen zum Erstellen einer Homepage, die Daniel aus dem Stegreif beantworten kann. Sollte er auch, denn er studiert Medieninformatik in Augsburg und hat zwischen den Semestern für eine deutschen Firma Webseiten erstellt. Dieses Wissen kommt mir jetzt zugute. Ich nutze die Gelegenheit und frage nach einem gemeinsamen Urlaub in Thailand, den mein Sohn dankend ablehnt, es sei zu gefährlich dort, liest man ja überall. Hong meint dazu, Daniel sei mit der Welt verbunden und kenne sich aus. Im Gegensatz zu mir als Deutschem kritisieren Chinesen keine anderen Leute, sondern umschreiben alles positiv, um die Harmonie der Beziehungen aufrecht zu erhalten.
Ich bin anderer Meinung als Daniel, sage aber nichts. Mein Aufenthalt auf einer Ferien-Insel in Thailand vor ein paar Jahren war sehr schön und ich fühlte mich nicht gefährdet.
Ich habe mir ein Ziel ausgesucht und versuche, Hong davon zu überzeugen: »Was hältst du von einem Strandurlaub in Pattaya, einem großen Touristenort für Ausländer, zwei Autostunden südlich von Bangkok? Ich habe vor Jahren über Alan und Michael eine Wohnung dort angezahlt, doch das Projekt geht schon ewig nicht vorwärts. Wir erholen uns am Strand und machen einen Ausflug dorthin, damit ich mal nach dem Rechten schauen kann. Es lohnt sich auch für dich, denn die Wohnanlage liegt auf einem Berg mit Blick zum Meer.«
Hong ist mit meinem Vorschlag einverstanden, denn sie will auch sehen, wo ich mein Geld angelegt habe, und bucht nachts trotz Daniels Warnung den Urlaub in Thailand über ein chinesisches Reisebüro. Sie holt ihre Kreditkarte, um die Reisekosten zu überweisen, doch die Bezahlung klappt nicht. Hong schlägt wütend mit der Faust auf die Tastatur, als ob das ihr Problem lösen würde … Interessanterweise tut es das tatsächlich, denn beim erneuten Versuch läuft alles reibungslos. Ich nehme mir für diesen Urlaub die zehn Tage frei, die mir die Firma nach dem gesetzlichen Arbeitsgesetz für meine Heirat gegeben hat. Eigentlich hätte ich nur drei Tage bekommen dürfen, da ich schon einmal verheiratet war. Vielen Dank an die Personalabteilung, die das nicht bemerkt hat. In diesem Bereich sind die Chinesen sehr großzügig mit zusätzlich geschenkten Urlaubstagen, in Deutschland bekommt man im Allgemeinen einen Tag Sonderurlaub für die Hochzeit, den Rest muss man von seinem Jahreskontingent bestreiten. Aber der Staat macht das natürlich nicht ganz ohne Hintergedanken. Er erhofft sich davon, dass die Leute früh heiraten und Kinder zeugen, denn diese braucht China wegen der leeren Rentenkasse dringend.
Als ich am nächsten Morgen aufwache, muss ich an den chinesischen Kaiser im deutschen Dietfurt, nahe Eichstätt in Bayern, denken. Manchmal kommen mir solche spontanen Gedanken und ich erzähle Hong die Geschichte, wie sich die Dietfurter Bevölkerung unter der Mauer versteckt hat, als der Bischof von Eichstätt Steuern eintreiben wollte. „Feige wie die Chinesen“, schimpfte da der Bischof und seither regiert dort zum Spaß ein chinesischer Kaiser mit Konkubinen und Kutsche, nicht nur zum jährlichen Karneval.8
Draußen ist es jetzt kalt und nass, morgen soll es laut Wetterbericht wieder einmal schneien. Ich will eine Bank aufsuchen, um mein Erspartes zinsbringend anzulegen. Obwohl die chinesischen Banken auch an Feiertagen geöffnet haben, rät mir Hong von einem Bankbesuch vor dem ersten offiziellen Arbeitstag nach CNY ab, da die Zinsen erst ab diesem Tag berechnet werden.
Im nächsten Augenblick zieht sie schmerzvoll das Gesicht zusammen. Während ihrer Regel, die heute eingesetzt hat, leidet sie immer unter schweren Bauschmerzen. Aber sie steckt das gut weg und holt ihr Handy hervor, um mir eine neue App zu präsentieren, die angibt, wann die beste Zeit fürs Kinderzeugen ist … oder wann man besser vorsichtig sein sollte, wenn man noch nicht bereit für Kinder ist. Sie ist vollauf begeistert, da die Eintragungen in der App genau mit ihren Daten übereinstimmen.
Schon wieder dieses leidige Thema, schießt es mir durch den Kopf. Sie meinte doch, dieses Pferdejahr wäre nach dem Unfall mit dem Hund kein gutes Jahr zum Kinderkriegen! Zudem ist es verwunderlich, dass Hong nun doch über Kinder nachzudenken scheint, weil sie ja in China keine Kinder großziehen will. Ich werde herausfinden, ob meine Schwiegereltern dahinterstecken oder ob es ihr eigener Wunsch ist. Vielleicht fragt ja auch mal jemand mich …
In der Nacht zum fünften Tag nach Neujahr beginnt wieder ein ohrenbetäubendes Pfeifen der noch übrig gebliebenen Feuerwerkskörper zu Ehren des Gottes des Vermögens, um gebührend in dessen Geburtstag reinzufeiern. Als Europäer dürfte man sich jetzt über diese Gottverehrung wundern, da Religionen in China ja eher nicht so gern gesehen sind. Tatsächlich glauben viele Chinesen an Buddha und den Taoismus, in dem es viele verschiedene Götter gibt. Neben dem bereits erwähnten Gott des Vermögens kann man zum Beispiel auch einem Heiratsgott huldigen und der Guanyin-Pusa-Göttin9, die Kinder schenkt, zur Welt bringt und betreut.
In diesem Jahr fällt der Geburtstag meines Schwiegervaters genau auf diesen Tag, so dass wir zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen können, wie man so schön sagt. Welch ein Glück. Von Hong erfahre ich, dass jeder Chinese grundsätzlich entsprechend des Mondkalenders an CNY ein Jahr älter wird. So gesehen hat jeder Chinese zwei Geburtstage, aber bei der älteren Generation werden erst ab einem Alter von vierzig Jahren runde Geburtstage gefeiert. Die Jüngeren richten sich nach dem westlichen Kalender und begehen diesen Tag jedes Jahr am selben Datum.
Irgendwann stehe ich auf und checke meine E-Mails. Tatsächlich wurde mir am Neujahrstag aus Deutschland eine Nachricht mit der Bitte um eine Kalkulation geschickt und gestern kam eine Nachfrage, ob diese Kalkulation gemacht sei. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil, denn ich habe den Abwesenheits-Assistenten meines E-Mail-Programms mit der Bemerkung gefüttert, dass ich bis zum siebten Februar abwesend sein werde.
Meine Frau erscheint etwas verschlafen an der Tür und erinnert mich an den Geburtstag ihres Vaters, für den sie noch Blumen kaufen möchte. Natürlich fragt sie, welches Geschenk ich denn für meinen Schwiegerpapa hätte. Ich muss nachdenken, denn wenn ich ehrlich bin, habe ich das irgendwie verschwitzt. Dann fällt mir die graue Jacke aus Deutschland ein, die ich nicht mag, und will von Hong wissen, ob die es auch tun würde. Eigentlich braucht Li Gengnan eine Eieruhr und Eierbecher für die Küche, auch Flaschenverschlüsse fehlen. Das alles an diesem Feiertag noch zu besorgen, wäre an sich kein Problem, da in China gerade an Feiertagen viele Geschäfte geöffnet haben. Das wird von den Chinesen gern ausgenutzt, jedoch haben wir dafür keine Zeit mehr, denn die Geburtstagsfeier beginnt schon um elf Uhr mit einem gemeinsamen Mittagstisch. Widerwillig werfe ich mich in Schale, die aus meinem Geschäftsanzug mit Krawatte besteht, und fahre mit Hong zum Blumenladen um die Ecke. Nebelschwaden und die Reste der explodierten Knallkörper von der Nacht hängen noch in der Luft.
Als wir wieder bei den Schwiegereltern ankommen, sitzen schon einige Gäste im Wohnzimmer auf der Couch. Hong steckt mir noch schnell die roten Umschläge mit den Geldscheinen zu, die ich an die Kinder übergebe. Alle bedanken sich brav, dann fährt die Autokarawane los. Das Restaurant ist zwar gleich um die Ecke, aber man nimmt ja Rücksicht auf die älteren Leuten. Dass die Bequemlichkeit der restlichen Verwandtschaft auch keine geringe Rolle spielt, wird natürlich dezent verschwiegen. Hong und ich überreichen direkt im Restaurant den Blumenstrauß und die graue Jacke, denn es sollen ja alle mitbekommen, was wir schenken. Wie überall auf der Welt sind die Geschenke auch hier nicht an Regeln gebunden und hängen vom Vermögen ab. So freut sich ein Kind in ärmeren Familien über Stifte oder ein Buch, während die Geschenke in vermögenderen Familien preislich höher ausfallen. Ich setze mich meist über die übliche Vorgehensweise, die Geschenke erst auszupacken, wenn die Gäste gegangen sind, hinweg und frage, ob ich gleich hineinschauen darf. Ich finde es persönlicher, sich per Handschlag und nicht per Telefongespräch zu bedanken.
Es gibt eine weitere Regel, die uns Europäern befremdlich erscheint. In China ist traditionell jeder, der eingeladen wird, dazu verpflichtet ein Geschenk zu überreichen, auch wenn er nicht zu der Feier kommen kann. Vorsorglich wird insbesondere bei Geschenken an Kinder die Quittung mit dem Preis beigelegt, denn so können wir sicher gehen, dass wir, wenn wir später Kinder haben, ein Geschenk im selben Wert erhalten.
Drei Stunden lang spielen und schreien die Kinder, die Erwachsenen tanzen und singen leidenschaftlich Karaoke, was die mitgebrachten Flaschen Reisschnaps, die nun größtenteils geleert sind, sehr erleichtern. Die Reste des Essens werden eingepackt und mit nach Hause genommen.
Am Abend nutzen wir den Besuch von anderen Verwandten und Freunden, um weiter essen zu können. Im Anschluss spielen Hong, ihr Vater und zwei seiner Bekannten Mahjong, auf Chinesisch übrigens májiàng.
»Es ist verwunderlich, dass es ein Spiel für 4 Personen ist. Ist 4 nicht die Todeszahl, die man in China immer versucht zu vermeiden?«, frage ich Hong
»Es geht nur darum, dass nur eine gerade Anzahl von Personen spielen kann.«
Ich bin aus zwei Gründen Zaungast: Ich kenne die Regeln nicht und fünf sind einer zu viel bei diesem Spiel. Wang, einer der Bekannten, ist ein alter Armeefreund Li Gengnans aus der Zeit, als beide noch in Nordchina gedient haben. Er wohnt jetzt im Tempel in Suzhou, also ganz in der Nähe, und arbeitet als Fahrer in einer deutschen Firma, die ich auch kenne. Er ist Buddhist, isst also kein Fleisch, und lebt mit den Mönchen zusammen.
»Der einzige Unterschied zwischen Wang und einem Mönch sind die Haare. Der Mönch hat keine mehr«, bemerkt Hong belustigt.
Als Li Gengnan sich ein neues Bier aufmachen will, entdeckt er, dass es schimmlig ist. Der Grund ist schnell gefunden, denn eine Fliege wurde mit abgefüllt. Mit dem deutschen Reinheitsgebot wäre das nicht passiert!
Da das Zuschauen langsam langweilig wird, gehe ich ins Wohnzimmer und schaue mir die vielen Geburtstagsgeschenke an. Etwas ungewöhnlich für einen Deutschen, denn es gibt Kiwis, Äpfel und andere Obstsorten. Nüsse sind auch dabei, alles sehr hochwertig, teuer und hübsch verpackt. Ein zweiter Blumenstrauß ist auch dabei.
Hong gesellt sich zu mir und macht mich darauf aufmerksam, dass jetzt ein guter Zeitpunkt wäre, ihr das richtige Rückwärtseinparken am Bordstein beizubringen. Ich habe mir abgewöhnt, mich über Hongs Sprunghaftigkeit zu wundern und so gehen wir zusammen in die kalte Nacht hinaus und setzen uns in den alten VW Jetta von Li Gengnan. Ich erkläre ihr die einzelnen Schritte und es klappt gleich beim ersten Versuch. Hong ist begeistert und meint, ich könne Fahrlehrer werden.
»Ja klar, aber nur um schönen Frauen das Einparken beizubringen. Hey, was denkst du? Ist das eine Marktlücke?«, necke ich sie.
Sie stößt mich verärgert in die Seite, beginnt dann aber auch zu lachen und gibt mir einen Kuss.
Perfekt, denke ich, jetzt muss ich ihr nur noch Billardspielen und Tanzen beibringen!
Die Nacht war wieder sehr kalt. Am Morgen unter der Dusche warte ich vergeblich auf warmes Wasser. Dann dämmert es mir langsam. Wie auch im Westen steht die Farbe »rot« für warm, die Farbe »blau« für kalt. Das habe ich in meiner Schlaftrunkenheit nicht bemerkt, ich bin einfach noch nicht wach genug. Trotz allem gönne ich mir einen gedanklichen Ausflug in die Farbengeschichte Chinas. Bereits vor etwa zweitausend Jahren v. Chr. entstand im Daoismus die Theorie der Fünf Elemente, zu denen Holz, Feuer, Metall, Wasser und Erde zählen, wobei die Bedeutung dieser Elemente einem dynamische Wandlungsprozess unterliegen und so immer wieder anderen Merkmalen oder Eigenschaften zugeordnet werden. Zur Geburt der Theorie wurden die Elemente mit Himmelsrichtungen verknüpft und da es nur vier Himmelsrichtungen gibt, erhielt die Mitte auch einen Platz. Bis heute folgten unendlich viele Zuordnungen wie Formen, Jahreszeiten, der Mittsommer darf hier als Nummer fünf mitmischen, Planeten, Tiere und eben Farben. Sogar Geschmacksrichtungen sowie Lautäußerungen und Körperflüssigkeiten werden berücksichtigt. Aber nun zu den Farben. Feuer mit rot und Metall mit weiß/grau sind da für Europäer noch die logischen Verbindungen. Gelb als Erde ist noch halbwegs nachvollziehbar, bei Wasser mit schwarz und Holz mit (grün-)blau wird es da schon schwieriger. Die rote Farbe, wie wir ja bereits wissen, steht für Reichtum und Freude, daher findet die Regierung wohl auch Gefallen daran und nutzt sie ausgiebig. Auch Grün wird mit Reichtum assoziiert, aber auch mit Harmonie und Gesundheit, was uns Europäern nicht so weit hergeholt erscheint. Allerdings ist Vorsicht geboten, wenn ein grüner Hut ins Spiel kommt, denn der symbolisiert Seitensprung, Treulosigkeit und einen betrogenen Ehemann. Gelb steht für Neutralität und Glück und gilt als schönste und prestigeträchtigste Farbe, daher sind des Kaisers neue Kleider, und auch Paläste, Altäre und Tempel, nicht unsichtbar sondern gelb. Schwarz ist die Farbe des nördlichen Himmels und wurde als Farbe der Könige und als beständige Farbe verehrt. Neben Helligkeit und Reinheit wird Weiß auch mit Tod und Leiden in Verbindung gebracht und hauptsächlich bei Beerdigungen getragen.10
Zum Frühstück wartet »yan wo« auf mich, eine teure Spezialität der traditionellen chinesischen Medizin, in Deutschland unter dem Begriff „Schwalbennester“ bekannt. Wenn man bedenkt, dass es sich hierbei um getrockneten Schleim von Vögeln handelt, der mit heißem Wasser aufgegossen wird, wird man unweigerlich daran erinnert, dass gute Medizin angeblich nicht schmeckt. Der Preis schwankt abhängig von der Qualität, bei dem chinesischen Online-Auktionshaus Taobao werden fünf Gramm für knapp einhundertneunzig RMB, rund fünfundzwanzig Euro, angeboten. Ob es hilft, bleibt abzuwarten.
Aus einer Nachbarwohnung dröhnt laute Musik. Das Verhältnis meiner Schwiegereltern zu den Anwohnern ist recht gut. Die meisten sind Rentner oder Frauen, die zuhause arbeiten, man sieht und hört sich regelmäßig. Auch meine Frau hat hier viele Jahre gelebt und dadurch ebenso gute Beziehungen aufgebaut.
Am Frühstückstisch diskutieren wir gerade das Thema „Neuer CEO bei Microsoft“. Da es sich um einen Inder handelt, glauben die Chinesen, Indien habe nun das Silicon Valley erobert. Eins kommt zum anderen und auch der Kauf von neun Roboterfirmen durch Google wird angesprochen. Hong meint, Roboter werden in Zukunft auch kochen, putzen und sogar Kinder betreuen.
Ich zucke zusammen, denn das Wort „Kinder“ könnte bei meinen Schwiegereltern wieder eine neue Tirade zum Objekt ihrer Begierde namens „Enkelkinder“ heraufbeschwören. Bis zum Abendessen halten sie stillschweigend durch, dann bahnt es sich einen Weg an die Oberfläche. Aber diesmal bin ich gar nicht so böse darüber, denn ich erfahre etwas mehr aus der Lebensgeschichte meiner Frau. Hongs Entstehung war alles andere als ein romantischer Akt. Li Gengnan war beim Militär, so die altbekannte Geschichte, und als er einen Monat auf Heimaturlaub war, heiratete er ohne viel Federlesen. Kurz darauf war Wu Meilan mit Hong schwanger. Ganz genau genommen verdankt sie ihr Leben dem Parteiführer Mao Zedong, denn er sagte die Eroberung Taiwans kurz vor der Bestürmung ab und rief damit das Kriegsende aus. Alle, die sich bis dahin durchgekämpft hatten, blieben am Leben und so konnte sich Hongs Großvater um Nachwuchs kümmern. Aber damit waren die Glücksmomente der Familie noch nicht beendet, denn kurz bevor Hongs Eltern Ende 1970 geheiratet hatten, war Li Gengnan an der Grenze zu Russland stationiert und stand mit Tausenden anderen kurz vor einem Krieg mit Russland. Zur Erleichterung aller wurde der Konflikt durch Verhandlungen gelöst und auch er konnte der Tradition folgen, eine eigene Familie zu gründen.
Auch die Ein-Kind-Politik wird nicht unter den Tisch gekehrt, denn sie hat verhindert, dass Hong Geschwister bekam. Zum Glück ist das mittlerweile etwas aufgelockert worden. Die allgemein bekannte Tatsache, dass Mädchen nicht unbedingt auf dem Zeugungswunschzettel stehen, liegt in der chinesischen Kultur begründet. Im Gegensatz zu Deutschland, wo mittlerweile auch der Name der Frau als Familienname angenommen werden kann, geben in China allein die Männer den Namen weiter. Zudem werden Grundstücke und Felder durch die Gemeinde nur an sie verteilt. Traditionell haben Mädchen kein Erbrecht und sämtliches Vermögen bekommen die Söhne, obwohl das Gesetz inzwischen etwas anderes sagt. Mit all diesem Wissen bin ich meinen Schwiegereltern sehr dankbar, dass sie schon damals moderne Ansichten vertraten und mit den weit verbreiteten Praktiken zur Geschlechterselektion gebrochen hatten.
Am letzten Urlaubstag fahren wir beide nach Taicang, schauen aber vor der Rückkehr in unser Haus noch bei der lokalen Bank of Suzhou vorbei. Vielleicht lohnt es sich ja, ein Konto zu eröffnen und mein Gehalt, dass in den letzten Monaten auf dem Girokonto der ICBC Bank eingegangen war, hier als Festgeld mit gutem Zinssatz anzulegen, doch wir haben die Bürokratie der chinesischen Bank unterschätzt. Für die Kontoeröffnung muss ich mehrere Dokumente ausfüllen und handschriftlich in Chinesisch bestätigen, dass ich das Kleingedruckte zur Kenntnis genommen habe. Die Bankangestellte erklärt uns anschließend, dass Geldeinzüge von anderen chinesischen Banken mit ausländischem Namen von dieser Bank aus nicht so einfach getätigt werden können, da die Apparate nicht darauf ausgelegt seien. Besser wäre es doch, das Geld bei der anderen Bank im Gebäude nebenan abzuheben und hier in bar einzuzahlen. Ich erinnere mich daran, dass ich dies doch schon mal vor zwanzig Jahren so gemacht habe. Damals war eine Online-Überweisung nicht möglich. Hat sich die Welt seither nicht weitergedreht?
Mir ist das Ganze zu aufwendig, doch Hong erklärt mir, Bargeld von der einen Bank abzuheben und bei der anderen Bank einzuzahlen, ist hier noch gang und gäbe, um Überweisungskosten zu sparen und Bürokratie zu vermeiden. Mittlerweile ist es kurz nach drei Uhr und die Bankangestellte weist uns darauf hin, dass die anderen Banken schon geschlossen sind. An Geldautomaten gibt es eine Höchstgrenze von 20.000 RMB, was in etwa 2.750 Euro entspricht, also verwerfe ich diese Idee gleich wieder.
Jetzt bleibt mir nur noch die Online-Überweisung, doch auch diese Möglichkeit ist mir verwehrt, denn alle Online-Überweisungen in China laufen über eine Zentralstelle der Bank of China in der Hauptstadt Beijing und die sind ausgerechnet heute noch alle im Urlaub.
Hong sieht es gelassen und versteht mein Problem nicht. »Morgen ist der erste offizielle Arbeitstag nach dem CNY, da kannst du die Überweisung ausführen.«
Draußen ist es immer noch kalt. Da wir außer den harten chinesischen Kiwis, die Hongs Eltern uns mitgegeben hatten, nichts weiter zu essen zuhause haben, gehen wir zum chinesischen Grill, einem BBQ-Restaurant. In solchen Restaurants herrscht immer großer Andrang und wir müssen wie üblich eine Nummer ziehen, um einen Sitzplatz zu bekommen. Auf der Toilette treffe ich einen Chinesen, der mir erzählt, er wohne in Australien und sei extra zum chinesischen Neujahrsfest hergekommen. Manchen sind Traditionen offenbar sehr heilig.
Als ich den rohen Fisch auf die Grillplatte legen will, nimmt Hong mir das Besteck samt Fisch aus der Hand und meint, nur Frauen beherrschten diese Arbeit, Männer könnten nur essen, saufen und schlafen. Hong will mich wieder einmal provozieren, denn sie sollte es besser wissen, da in ihrem Elternhaus immer ihr Vater in der Küche steht.
Ich murmle vor mich hin: »Ein Fisch am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen, aber ein Fisch am Abend …«
Hong hat es gehört und dichtet zu Ende: »… dann schläft man gut«. Es reimt sich nicht und ergibt keinen Sinn, aber das macht Hong überhaupt nichts aus.
Ich zahle mit Bankkarte und gebe am Tisch meine Geheimzahl ein. Hong rügt mich dafür, dass die Bedienung die Geheimzahl erkennen konnte.
»Na und?«, erwidere ich.
»Vielleicht hast du schon mal davon gehört, dass Bankkarten gefälscht werden?«, kontert sie schnippisch. »Jetzt kennt die Kellnerin deine Kontodaten und die PIN. Wenn die dein Konto leerräumen, siehst du das Geld nie wieder!«
»Soll ich jetzt zur Bank gehen und die Geheimzahl ändern lassen? Sollte das mittlerweile nicht online möglich sein?«, frage ich genervt zurück. Bei meiner Bank in Deutschland gibt es diese Option im Online-Banking. Mir wird klar, dass das nicht geht, weil ich noch kein funktionierendes Online-Bankkonto habe. Bisher hat Hong alle notwendigen Überweisungen von ihrem Onlinekonto getätigt, daher habe ich mich noch nicht um ein eigenes Onlinebanking gekümmert. Der Aufwand mit der Bank ist mir zu viel und das Essen ist so lecker, dass ich die Angelegenheit einfach vergesse.
Eine Steuerquittung, in China Fapiao genannt, gibt es heute noch nicht. Erst in zwei Wochen, denn das Restaurant ist brandneu und die Lizenz der Behörden steht noch aus. Das ist zwar illegal, aber in China nimmt das niemand so genau. Glück für uns, so müssen wir nicht hungrig ins Bett gehen.
Als wir nach Hause kommen, ist die Wohnung wieder ziemlich ausgekühlt, weil Hong die Klimaanlage ausgeschaltet hat. Ich frage mich, was wohl günstiger wäre: die Wohnung jetzt wieder von 13 Grad auf 20 Grad hochzuheizen oder das Gerät einfach bei 20 Grad laufen zu lassen.
Hong sieht das pragmatisch: »Ist doch klar: Die Heizung anderthalb Stunden für umsonst laufen zu lassen, ist auf jeden Fall viel teurer! Du kannst von uns Chinesen noch viel über das Sparen lernen«. Chinesen seien echte Sparkünstler, referiert Hong weiter, sogar heißes Abwasser würde verkauft, es könne direkt bei den Fabriken wie Stahlwerken, die Wasser zur Kühlung ihrer Maschinen nutzen, bestellt werden. Das so erwärmte Wasser würde mit LKWs zu den Kunden, meist öffentliche Badeanstalten, transportiert und alle profitierten davon. Mich erstaunt, dass Kaufpreis und Transportkosten offenbar unter den Heizkosten für das Wasser liegen und sich das Ganze tatsächlich rentiert.
So viel zur Wasserqualität! Ich überlege unwillkürlich, wie oft ich in China schon in diesem Brackwasser gebadet habe. Ist es vielleicht sogar radioaktiv?
Mit einer noch absurderen Sparidee reißt mich Hong aus den Gedanken: »Wenn du richtig Geld sparen willst, dann mach die Heizung aus und zieh warme Kleidung an.«
Frauen haben doch sowieso immer das letzte Wort, in China erst recht. Wir werden uns wahrscheinlich noch oft über dieses Thema streiten, die Mentalitäten sind einfach zu verschieden. Ich möchte zwar auch sparen, aber doch nicht auf Kosten unserer Gesundheit.
In der Nacht können wir beide vor lauter Sodbrennen nicht schlafen. Entweder haben wir viel zu viel gegessen oder in dem Grillgewürz war mal wieder zu viel Glutamat. Die Wahrscheinlichkeit, dass beides zutrifft, ist sehr hoch.
Am nächsten Morgen, dem ersten Arbeitstag nach dem chinesischen Neujahrsfest, haben wir immer noch Sodbrennen. Auch das Wetter sympathisiert mit uns, denn es regnet in Strömen. Leider muss ich heute nach draußen, denn ich habe mich von meiner Frau überreden lassen, den umständlichen Weg für den Geldtransfer zu gehen. Hong holt unseren Fahrer ab, sie wechseln die Sitzplätze und wir machen uns auf den Weg. Pünktlich zur Schalteröffnung halb neun heben wir zwei große Bündel Geldscheine ab und zahlen es bei der anderen Bank ein. Die Zählmaschine scheint auch noch im Urlaub zu sein, denn sie hat sich verrechnet. Der Bankangestellte zählt nun die Scheine solange von Hand nach, bis alles stimmt. Danach folgt der obligatorische Formularkrieg. Ich staune immer wieder, wie viele Formulare man unterschreiben muss, um etwas Geld einzuzahlen, da unterscheidet sich China nicht von Deutschland. Immerhin fallen die Zinsen für Neukunden heute ein kleines bisschen höher aus als in den letzten Tagen.
Nach dem Stress in der Bank muss Hong schnell weiter in das thailändische Konsulat in Shanghai, um ein Visum für den gemeinsamen Urlaub zu beantragen. Als Deutscher darf ich visumfrei in Thailand einreisen, wenn ich bei der Einreise ein gültiges Rückreiseticket vorweisen kann. Da die Vertretung bereits halb zwölf mittags die Tore schließt, ist Eile geboten. Ich fahre ein Stückchen bis zur Firma mit und dann lasse ich Hong mit dem Fahrer allein.
Als ich gegen halb elf im Büro im zweiundzwanzigsten Stock ankomme, ist es kalt. Von meinen Kollegen erfahre ich, dass die Zentralheizung im Gebäude noch ausgeschaltet und die Kantine im fünften Stock auch geschlossen ist. Die Verwaltung will wohl nur Miete kassieren, aber die Betriebskosten sparen! Die meisten Angestellten kommen erst am nächsten Montag oder einfach nur etwas später zur Arbeit. Mein amerikanischer Chef ist auch da und wir unterhalten uns über das Budget und die weiteren Kostenreduzierungsmaßnahmen. Mittags laufen wir ins Restaurant nebenan und er bezahlt. Er hat den typischen Gang eines Seemannes und bringt mich damit immer zum Schmunzeln. Anschließend habe ich bis sechs Uhr abends ein Meeting mit meinem Mitarbeiter Dr. Zhang, um die Kalkulationstermine der Unternehmenszentrale in Deutschland zu erfüllen.
Zuhause erzähle ich Hong von meinem Mittagessen im Restaurant mit meinen Geschäftsfreunden. Als ich dort erwähnte, dass ich nur E-Mail und Skype zur Online-Kommunikation benutzen würde, haben sie mich ausgelacht. Ich sei »out«, denn heute hat doch jeder das chinesische WeChat oder WhatsApp.
Hong hat natürlich beides auf ihrem Handy. »Du bist sowieso immer zu beschäftigt, um dich darum zu kümmern. Wusstest du, dass es zum guten Ton gehört, eine WhatsApp-Nachricht innerhalb von vier Minuten zu beantworten? Bei manchen Unternehmen sind Service und Vertrieb ohne WhatsApp gar nicht mehr denkbar. Wenn du eine Firma hast, brauchst du jemanden, der sich in Vollzeit darum kümmert.«
Ich staune und nehme mir vor, mich etwas näher damit zu beschäftigen. Aber heute nicht mehr.
Meine Frau erwähnt noch, dass sie sich heute Morgen mit meinem Fahrer über den Unfall mit dem Hund unterhalten hat. Der Fahrer gab zu bedenken, dass die Versicherung unbedingt über den Schaden informiert werden müsse, da die Leasingfirma sonst nicht für den Schaden aufkommen werde. Also einigten sie sich kurzerhand darauf, am kommenden Sonntag einen kleinen Unfall für die Polizei in Szene zu setzen, damit die Reparatur während unseres Thailand-Urlaubes, der in acht Tagen beginnt, auf Kosten der Versicherung durchgeführt werden kann.
Der sechste Tag der Woche ist ein Samstag. Logisch, denkt jetzt jeder Europäer, aber in China ist das nur bedingt logisch, denn hier werden die Wochentage einfach von Montag bis Samstag durchgezählt, also Montag ist die 1, Dienstag die 2 und so weiter. Der Sonntag heißt sowohl Sonnentag als auch Himmelstag. Obwohl der heutige Tag aufgrund der staatlichen Vorgaben zum Ausgleich für den zusätzlichen Feiertag an CNY ein offizieller Arbeitstag in China ist, fehlt noch immer ein Großteil der Belegschaft. Um ein paar Arbeiten abzuschließen, verzichte ich kurzerhand auf das Mittagessen. So schaffe ich einiges und kann früher als sonst nach Hause gehen.
Hong duscht gerade im kalten Bad, als ich das Haus betrete. Der Gedanke, jetzt an ihrer Stelle zu sein, lässt mich frösteln. Offenbar ist sie wieder genauso abgehärtet wie früher. Beim Abendessen erzählt sie mir, dass sie auch nichts zu Mittag gegessen hat, weil es wichtigere Dinge zu erledigen gab. Übrigens sei auch kein Trinkwasser mehr da, wirft sie wie nebenbei ein.
Ich verstehe den Wink und laufe noch schnell in einen Supermarkt, um ein paar Flaschen zu kaufen. Danach mache ich es mir auf dem Sofa gemütlich und schaue mir den Film »Die Bourne Identität« an. Dabei wird mir sofort klar: Was der amerikanische Geheimdienst alles kann, kann der chinesische schon lange. Schließlich kann ich mich noch gut an die Zeit erinnern, als ich vor zwanzig Jahren zum ersten Mal nach China kam. Alle Autos und sämtliche Hotelzimmer waren verwanzt und jedes Telefongespräch wurde ungeniert abgehört. Unterkünfte und Fahrzeuge samt Fahrer wurden einem zugewiesen. Westlichen Ausländern stand man damals noch viel misstrauischer gegenüber als heute. Nun stellt sich mir die Frage: Arbeitet der Geheimdienst heute moderner und noch geheimer oder haben sie es aufgegeben und man wird wirklich nicht mehr beobachtet?
Mir macht die Kälte mal wieder zu schaffen, also schütte ich den Rest meines chinesischen Reisweins in einen Topf und erhitze ihn. Da dieser Wein eine gelbe Farbe hat, wird er in China auch »Gelber Wein« genannt. Reiswein gibt es in auch in Japan, dort heißt er Sake, und in Korea mit Namen Magoli, diese Weine sind jedoch fast klar und nicht gelb gefärbt.
Nachdem die Wärme des Weins meinen Ansprüchen genügt, gieße ich ihn in ein Glas und begebe mich in mein Büro im dritten Stock unseres Hauses.
Plötzlich stürzt Hong in mein Büro und schimpft wie ein Rohrspatz: »Das ganze Haus stinkt nach Gelbem Wein, hast du dich erbrochen?«
Das Weinglas vor meinen Mund haltend, schaue ich sie verwirrt an. »Nein, ich hab mir den nur heiß gemacht.«
»Säufst du etwa die ganze Flasche?«
»Beruhige dich doch, es ist ja nur ein Glas«, versuche ich sie zu beschwichtigen.
»Deine Spermien sind trotzdem besoffen, schwimmen irgendwohin, finden das Ziel aber nicht. Kinder kommen besoffen zur Welt, wenn der Vater so viel trinkt.«
Hong scheint mit ihrem Kinderwunsch oder Nichtkinderwunsch sehr wankelmütig zu sein. Was will sie denn nun wirklich? Weshalb regt sie sich so auf? Im Reiswein ist weitaus weniger Alkohol als im Schnaps.
Sie zitiert mich in ihr Büro ein Stockwerk tiefer und ich befürchte schon Schlimmstes, aber es geht um ein völlig anderes Thema. Sie hat im Internet eine Immobilie gefunden, die der lokale Gerichtshof in Taicang verkauft. Ganz in der Nähe unseres jetzigen Mietshauses. Wie in Deutschland werden Objekte, deren Eigentümer zahlungsunfähig werden, veräußert, damit die Banken nicht darauf sitzen bleiben.
Ich überschlage die Zahlen und erkläre Hong, dass diese Eigentumswohnung zu teuer sei. Der Gerichtshof will verdienen, der Gläubiger auch.
»Das ist vermutlich auch nur der Einstiegspreis zum Verhandeln«, weiß ich aus Erfahrung. Trotz des hohen Einstiegspreises finde ich das Objekt interessant und schlage eine Wohnungsbesichtigung vor, doch dann bemerken wir, dass die Kaution für die Versteigerung stolze 300.000 RMB, rund 40.500 Euro, beträgt.
Ich überfliege das Kleingedruckte. »Hier steht, man bekommt später sein Geld zurück, aber die Frage ist wann. Solange die das Geld haben, können die Behörden und Banken damit arbeiten«, gebe ich zu bedenken.
Hong reagiert aufgebracht: »Das ist chinesische Kriminalität, gedeckt und initiiert vom Staat. Lassen wir lieber Finger davon, denn es ist wie bei einem Hund, dem du ein Stück Fleisch gibst, du bekommst es nie mehr zurück.« Sie muss es ja wissen, sie hatte schließlich mal einen Hund gehabt.
Am Sonntagmorgen fängt es an, leicht zu schneien. Da Hong weiterschlafen will, jogge ich allein. Danach rufe ich meinen Fahrer an, um mit seiner Hilfe eine Polizeistation in Taicang zu finden, die die Geschichte von dem Autounfall mit dem Hund glaubt. Hong bekommt ein Formular zum Ausfüllen für die Versicherung des Autos. Zum Dank überreiche ich dem Fahrer ein Geschenk, das ich zu diesem Zweck von zuhause mitgenommen hatte. Dieses Geschenk hatte ich vor zwei Tagen von der Bank für meine Geldanlage erhalten. Alles läuft wie geschmiert.
Während des Tages räume ich mein Büro auf, sortiere Papiere in Ordner oder schreddere sie. Hong zieht mit zu mir nach oben, so dass wir nur noch ein Büro heizen müssen und Geld sparen können. Sie arbeitet an ihrem Laptop gegenüber und ermahnt mich mehrmals, jedes Papier vor dem Schreddern gründlich zu überprüfen. Nun frage ich mich, ob es ihr tatsächlich ums Geldsparen geht oder ob sie mir nur kontrollieren möchte.
Nach dem Abendessen telefoniere ich mit Daniel in Deutschland und Hong mit ihrer Mutter. Wir gehen diesmal früher als sonst ins Bett. Die Wärmflasche ist schon mit heißem Wasser gefüllt.
Am Mittwoch fährt Hong zum monatlichen DUSA-Treffen nach Suzhou, um alte Bekannte und Arbeitskollegen zu treffen und um Neuigkeiten auszutauschen. DUSA – European Business Association – wurde vor zwölf Jahren von mehreren deutschen Unternehmen gegründet, um kleineren und mittleren deutschen Unternehmen die Geschäftsanbahnung in China durch Informationsveranstaltungen, Workshops und Trainings zu erleichtern11. Hong hat über ihre Rechtsanwaltskanzlei in Suzhou, für die sie neben ihrer Tätigkeit an der Uni als freiberufliche Rechtanwältin arbeitet, eine Mitgliedskarte bekommen und hat so einige Vergünstigungen, die sie gerne ausnutzt.
Währenddessen mache ich mich mit dem Flugzeug vom Shanghaier Inland-Flughafen Hongqiao auf den Weg, um einen Lieferanten im etwa fünfhundert Kilometer entfernten Qingdao in der Shandong-Provinz zu besuchen. Der Businesstrip soll zwei Tage dauern und ich habe Hong versprochen, morgen Abend wieder zurück zu sein. Wie in China üblich werden mein Kollege, ein chinesischer Einkäufer, und ich mit einer Limousine abgeholt, um in das Werk des Lieferanten außerhalb der Stadt gebracht zu werden.
Zu meinem Leidwesen muss ich feststellen, dass die von uns beauftragte Platte wesentlich dicker ist als die der Konkurrenz. Weiterhin bemängele ich, dass das Material auf der Zeichnung nicht für Drehteile geeignet sei. Mein Kollege lenkt ein, es liege an den Standardisierungsbestrebungen der Firma. Ich bin jedoch der Meinung, dass bei dem Materialkostenanteil am Produkt der Verlust wesentlich höher sei als jedwede Einsparung durch Standardisierung. Außerdem produziere das Drehteil lange Späne und bei diesem neuen Material müsste ein Arbeiter diese Abfälle alle paar Sekunden entfernen, sonst würden sie sich um die Drehmeißel wickeln und das könnte richtig gefährlich werden. Mein Einkäufer sagt mir, deren Vorgaben kämen vom Headquarter, die chinesischen Konstrukteure hätten keine Erlaubnis irgendetwas zu ändern.
Ich verdrehe die Augen. Das alte »Copy-&-paste-Verfahren«. Aber warum beschützt der Einkäufer den Lieferanten, anstatt mir bei der Argumentation zu helfen? Mir wird klar, dass er die gute Beziehung, die er in den letzten Jahren aufgebaut hat, nicht gefährden und so ein angenehmes Arbeiten ohne Stress haben will.
Nach der Besprechung werden wir vom Lieferanten zum Abendessen eingeladen. Wir sitzen an einem runden Tisch im vorbestellten und vorgeheizten Nebenraum eines traditionellen Restaurants. Ich verlange einen warmen Gelben Wein. Der hat weniger Alkohol als Rotwein und Schnaps, macht deshalb nicht so schnell beschwipst und erhält die Denkfähigkeit länger. Seine Wärme tut in dieser kalten Jahreszeit ebenso gut. Ich gebe der Bedienung den Fotoapparat, damit sie von der ganzen Gruppe ein Bild zum Andenken knipst.
Im Hotelzimmer angekommen beginnt das Sodbrennen und dauert bis in den Morgen. Ich bin mir sicher, dass im gestrigen Essen sehr viele künstliche Geschmacksverstärker enthalten gewesen sein müssen. Die sind immer die Ursache für mein Sodbrennen.
Beim gemeinsamen Frühstück pflichtet mir mein Kollege bei: »Glutamat ist eine chinesische Tradition, verursacht bei Chinesen jedoch keine Probleme. Chinesische Mägen haben sich seit Jahrhunderten an diesen Stoff gewöhnt, dein Magen verträgt das nicht so gut.«
Draußen lassen die chinesischen Fahrer die Autos in der Kälte warm laufen, damit die Gäste und der Fahrer nicht frieren. Mir ist die dadurch entstehende Umweltverschmutzung zuwider. Kein Wunder, dass das Land solch hohe Feinstaubwerte erreicht. Jeder denkt hier nur an sich, nicht an die Umwelt. Über die Verschmutzung und den Smog wird nur geredet, keiner tut etwas dagegen.
Wir werden zu einem Unterlieferanten gebracht, bei dem ich die Daten vom Fertigungsprozess der Platte aufnehme und meine Ideen zur Kostenreduzierung diskutiere.
Am Nachmittag auf der Fahrt zum Flughafen unterhalten wir uns über die Kulturunterschiede zwischen Ost und West.
»Ich kenne da einige deutsche Unternehmen, die einfach nicht verhandeln wollen. Die kriegen keine Aufträge und machen schon seit ewigen Zeiten Verluste in China!«, regt sich mein Einkäufer auf.
Ich erwidere, dass es diesen Deutschen wohl am nötigen Know-how fehle, wie in China Geschäfte gemacht würden. Oft behaupteten sie, sie hätten Vorgaben von der deutschen Zentrale, die sie nicht verändern dürften. Das werde sich nur ändern, wenn die Firma pleite sei und von anderen übernommen würde, die dann das Management austauschten. Ich weiß auch, dass die meisten Deutschen gleich mit dem Kopf durch die Wand wollen. Die Chinesen hingegen gehen um die Wand herum, sie sind pragmatischer und flexibler. Ich mache es mittlerweile genauso und bin nicht mehr so stur wie früher.
Am Flughafen kaufe ich noch eine Kleinigkeit für meine Frau. An Bord ist es wahnsinnig eng und ich muss meine langen Beine nach außen drehen, damit ich mich hinsetzen kann. Dummerweise habe ich die Essenseinladung vom Lieferanten ausgeschlagen, damit wir den Flug nicht verpassen. Unsere Firma finanziert auf dem eineinhalbstündigen Flug kein Essen, so dass ich Hunger leiden muss. Immer diese Sparmaßnahmen. Hoffentlich wartet zuhause ein leckeres Abendessen auf mich.
Hongs Eltern sind bereits in Taicang eingetroffen, um gemeinsam mit uns den Abschluss des fünfzehntägigen Frühlingsfestes mit dem Laternenfestival gebührend zu feiern. Wu Meilan hat das Haus mit vielen hübschen Lampions verziert, um den Geistern den Weg nach Hause zu erleichtern. Auch Kerzen werden zu diesem Zweck draußen angezündet und viele Menschen tragen kleine Laternen die Straßen entlang. Kulinarisch gibt es natürlich auch etwas zu bieten. Was dem Deutschen sein Berliner Pfannkuchen in der Karnelvalszeit ist dem Chinesen sein Tāngyuán, ein Klößchen aus klebrigem Reismehl mit süßer Füllung, zum Laternenfest.
Da es gerade so schön festlich it, überreiche ich Hong fröhlich meine Geschenke zum morgigen Valentinstag, einen Regenschirm und eine Delikatesse aus Qingdao, Guotie genannt. Das sind leicht geröstete Teigtaschen mit Fleisch- oder Gemüsefüllung.
Während Li Gengnan das Abendessen vorbereitet, gönnen Hong und ich uns noch eine Joggingrunde. Dabei erzählt sie mir von früheren Zeiten.
»Frauen aus reichen Familien durften aus Sicherheitsgründen ein Leben lang das Haus nicht verlassen. Die Tradition, Frauen zu kleine Schuhe aufzuzwingen, entstand nur dadurch, dass Männer der Meinung waren, wenn Frauen nicht laufen könnten, dann blieben sie auch zuhause und seien treu. Nur am Laternenfest erlaubten die reichen Eltern ihren Töchtern mit den kleinen, zusammengebundenen Füßchen auf der Straße spazieren zu gehen. Das war der einzige Tag im Jahr, an dem sie mit Männern flirten konnten. Diese furchtbare Tradition der Qing-Dynastie wurde erst 1919 aufgehoben, wobei das Laternenfest noch immer zur Brautschau und Ehestiftung genutzt wirf. Bis heute ist es noch üblich, dass nur Frauen und Männer aus der gleichen Gesellschaftsschicht heiraten dürfen.«
In diesem Jahr fällt der Valentinstag auf einen Freitag. Aus meinem Versprechen, spätestens sieben Uhr abends von der Arbeit zurück zu sein, wurde leider nichts. Ich war schon spät dran und dann haben mir noch die vollen Straßen einen Strich durch die eh schon knappe Rechnung gemacht. Chinesen nehmen es mit der Pünktlichkeit zwar nicht so genau, aber meine eineinhalbstündige Verspätung ist selbst für Hong zu viel.
Da wir nun alle Hunger haben, gehen wir vor unserem Urlaub gemeinsam huǒguō, chinesischen Feuertopf, essen. Das Essen ist günstig. Für fünfzig Renminbi pro Person, was etwa 6,50 Euro entspricht, können wir drei Stunden lang essen und trinken, so viel wir wollen.
Wie nebenbei klärt mich Hong darüber auf, was es bei Geschenken in China unbedingt zu beachten gibt. »Es gibt drei Geschenke, die du in China unbedingt vermeiden musst! Regenschirme, Standuhren und Birnen.«
Der Regenschirm macht mich ehrlich nervös und ich frage nach dem Warum.
Hong malt mir die Schriftzeichen auf und erklärt, dass »Standuhr« leicht zu verwechseln ist mit »enden«, »Birne« sich anhört wie »scheiden lassen« und die Aussprache für das Wort »Regenschirm« genauso klingt wie das Wort »trennen«.
Oh je, dann war mein gestriges Geschenk an meine Frau nicht gerade beziehungsfördernd, aber meine chinesische Familie hat geflissentlich darüber hinweggesehen und meinen Fehlgriff offenbar nicht so tragisch genommen.
Bei »Äpfeln« ist es anders, denn eine Silbe ähnelt »Frieden«, daher schenken sich vor allem Liebespaare gerne Äpfel.
Klingt abergläubisch … oder war das jetzt ein Wink mit dem Zaunpfahl? Als Deutscher muss ich mich besser vorher informieren, bevor ich hier Geschenke verteile.
1 Quelle: http://www.chinas-recht.de/940705b.htm (16.01.2017)
2 Seite „Christentum in China“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 31. Dezember 2016, 22:37 UTC. URL: https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Christentum_in_China&oldid=161144551 (Abgerufen: 19. November 2017, 11:25 UTC); Seite „Protestantismus in China“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 20. Dezember 2014, 16:17 UTC. URL: https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Protestantismus_in_China&oldid=136956581 (Abgerufen: 19. November 2017, 11:26 UTC)
3 Seite „Mitgliederentwicklung in den Religionsgemeinschaften“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 12. Januar 2017, 21:03 UTC. URL: https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Mitgliederentwicklung_in_den_Religionsgemeinschaften&oldid=161577057 (Abgerufen: 19. November 2017, 11:27 UTC)
4 Seite „Römisch-katholische Kirche in China“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 12. Januar 2017, 15:13 UTC. URL: https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C3%B6misch-katholische_Kirche_in_China&oldid=161566866 (Abgerufen: 19. November 2017, 11:28 UTC)
5 Seite „Geschichte Chinas“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 6. Januar 2017, 18:36 UTC. URL: https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Geschichte_Chinas&oldid=161364081 (Abgerufen: 19. November 2017, 11:31 UTC); http://www.china-guide.de/auslaendische-aggressionen-und-imperialistische-aufteilung-chinas.html (09.01.2017)
6 Quelle: http://german.china.org.cn/german/de-12sx/matter.htm (06.02.2017)
7 Quelle: http://www.my-chinese.ch/fake-food-counterfeit.htm (14.4.2017)
8 Quelle: http://www.dietfurt.de/bayrisch-china/ (09.02.2017)
9 Quelle: http://www.seelenzeichen.de/kwan1.htm (14.4.2017)
10 Color in Chinese culture. (2017, September 12). In Wikipedia, The Free Encyclopedia. Retrieved 11:33, November 19, 2017, from https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Color_in_Chinese_culture&oldid=800299743; Seite „Fünf-Elemente-Lehre“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 6. März 2017, 23:52 UTC. URL: https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=F%C3%BCnf-Elemente-Lehre&oldid=163343410 (Abgerufen: 8. November 2017, 10:32 UTC)
11 Quelle: https://www.dusa-eu.cn/about-us/ (18.01.2017)