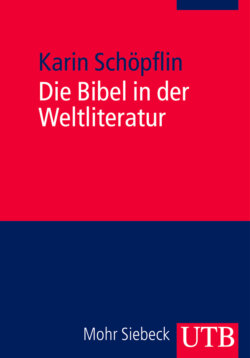Читать книгу Die Bibel in der Weltliteratur - Karin Schöpflin - Страница 7
2.1. Bearbeitung biblischen Materials: Der Prolog im Himmel
ОглавлениеDie Himmelsszenen des HiobbuchesNach dem allgemeiner gehaltenen, das dramatische Medium reflektierenden Prolog auf dem Theater führt der Prolog im Himmel in die Tragödie selbst ein. Goethe (1749–1832) greift darin deutlich auf das Buch Hiob zurück, das in den beiden Eingangskapiteln zwei Himmelsszenen (1,6–12; 2,1–6) enthält, deren zweite die erste wiederholt und zugleich weiterführend geringfügig variiert. In diesen biblischen Szenen findet ein himmlischer Thronrat statt: Es versammeln sich die Gottessöhne vor dem HERRN, unter ihnen auch der „Satan“. Gott tritt in einen Dialog mit ihm, erkundigt sich nach seinem Knecht Hiob, den er charakterisiert als „fromm und rechtschaffen, gottesfürchtig und meidet das Böse.“ Der Satan unterstellt, dass Hiob nur solange gottesfürchtig bleibt, wie er Gottes Segensgaben genießt: seinen Reichtum an Vieh, Dienerschaft und Kindern. Gott gestattet Satan daraufhin, Hiob Besitz und Familie zu nehmen unter der Bedingung, dass er Hiobs Leben nicht antastet.[6]
Erzengel loben die SchöpfungIn seinem Prolog folgt Goethe der Tradition, die die Gottessöhne als Engelwesen interpretiert: Goethe lässt die himmlischen Heerscharen und die drei Erzengel Raphael, Gabriel und Michael auftreten. Letztere kommen in der Bibel vor[7], doch entwickelte sich die Vorstellung von Engelwesen vor allem außerhalb der kanonischen |8|biblischen Schriften. Jeder Erzengel besingt Elemente des Kosmos, den Wechsel von Tag und Nacht, Meer und Land, Sturm und Gewitter (V. 243–266). Gemeinsam beten die drei Gott lobend an (V. 267–270). Die einleitenden Worte der Engel berühren sich sowohl mit der ersten Schöpfungserzählung in Genesis 1 als auch mit hymnischer Psalmensprache.
Dialog zwischen Mephistopheles und GottIm Anschluss daran entspinnt sich ein Dialog zwischen Mephistopheles und Gott, den nicht Gott wie in Hiob 1,7, sondern Mephistopheles eröffnet (V. 271). Mephistopheles entspricht der Satansgestalt, die analog zu den Engeln eine eigene, außerbiblische Entwicklung durchgemacht hat. Anders als die Engel versteht Mephistopheles sich nicht auf erhabene Lobpreisungen, seine Interessen sind weltlicherer Natur:
Von Sonn’ und Welten weiß ich nichts zu sagen,
Ich sehe nur, wie sich die Menschen plagen.
Der kleine Gott der Welt bleibt stets von gleichem Schlag,
Und ist so wunderlich als wie am ersten Tag. (279–282)[8]
Er beklagt die Lebensbedingungen der Menschen und wirft Gott vor, dass er dem Menschen die Vernunft geschenkt hat (283–292), hat also an der Schöpfung grundsätzlich nur etwas auszusetzen (296–298)[9]. Wenn er den Menschen als „kleinen Gott der Welt“ (V. 281) bezeichnet, spielt er damit an auf die Gottebenbildlichkeit des Menschen und den göttlichen Auftrag an ihn, über die übrigen Geschöpfe zu herrschen (Gen 1,26). Gott spricht Mephistopheles auf Faust, seinen „Knecht“ (V. 299, vgl. Hi 1,8) an, den Mephistopheles daraufhin charakterisiert (V. 300–307), was Gott im Hiob-Prolog selbst tut (Hi 1,8): Mephistopheles beschreibt Faust als einen unbefriedigt Zerrissenen, der nach den Sternen greift und göttliche Erkenntnis erstrebt, andererseits aber den Freuden der irdischen Welt zugetan ist. Gott setzt Hoffnung in Doktor Faust, obwohl er ihm offenkundig nicht so geradlinig dient wie Hiob:
|9|Wenn er mir jetzt auch nur verworren dient,
So wird’ ich ihn bald in die Klarheit führen.
Weiß doch der Gärtner, wenn das Bäumchen grünt,
Daß Blüt’ und Frucht die künft’gen Jahre zieren.[[10]] (308–311)
Die WetteDaraufhin wettet Mephistopheles, dass es ihm gelingen werde, „Ihn meine Straße sacht zu führen!“ (V. 314). Gott gesteht es ihm zu, jedenfalls solange Faust sein irdisches Leben führt (V. 315–316). Der HERR rechnet durchaus mit einem Ausgang zu seinen Gunsten; doch auch Mephistopheles ist zuversichtlich, dass sein Vorhaben gelingt (V. 330–331). Für den Fall eines Erfolges wünscht er sich:
Wenn ich zu meinem Zweck gelange,
Erlaubt Ihr mir Triumph aus voller Brust.
Staub soll er fressen, und mit Lust,
Wie meine Muhme, die berühmte Schlange. (332–334)
Wenn er Faust auf seine Seite gezogen und von Gott abgebracht hat, soll es jenem gehen wie der Schlange, die Gott verfluchte, dass sie Staub fressen sollte (Gen 3,14b), nachdem sie die Frau im Garten Eden zum Ungehorsam gegen Gott beredet hatte. Indem Goethe Mephistopheles hier einen Bezug zur Sündenfallgeschichte der Bibel herstellen lässt, ordnet er diese Gestalt einmal mehr den Gott widrigen Mächten zu und deutet die existentielle Tragweite der Wette an, bei der es darum geht, ob Faust den Sündenfall gewissermaßen wiederholt oder nicht. Mit der anschließenden Gottesrede füllt Goethe eine viel diskutierte Leerstelle aus:
Gottes Verhältnis zum BösenIch habe deinesgleichen nie gehaßt.
Von allen Geistern, die verneinen,
Ist mir der Schalk am wenigsten zur Last.
Des Menschen Tätigkeit kann allzuleicht erschlaffen,
Er liebt sich bald die unbedingte Ruh;
Drum geb’ ich gern ihm den Gesellen zu,
Der reizt und wirkt und muß als Teufel schaffen. (337–343)
Gott lässt das Wirken teuflischer Mächte bewusst zu, um den Menschen herauszufordern und ihn nicht in Trägheit verfallen zu lassen. Damit ist bei Goethe klar, dass die Mächte, die das Böse, das Gott Entgegen-Gesetzte („Geister, die verneinen“), verkörpern, Teil der von Gott gesetzten Weltordnung sind. Gott scheint |10|Mephistopheles sogar mit einer gewissen Wertschätzung zu betrachten, da er ihn „Schalk“ nennt und so Intelligenz, Scharfsinn und Witz[11] seines Gegenspielers hervorhebt. Dem entspricht Mephistopheles’ allein gesprochene, ironische Schlussbemerkung, in der er sich zudem explizit als „Teufel“ bezeichnet:
Von Zeit zu Zeit seh’ ich den Alten gern[[12]],
Und hüte mich, mit ihm zu brechen.
Es ist gar hübsch von einem großen Herrn,
So menschlich mit dem Teufel selbst zu sprechen. (352–353)
Goethes Umgestaltung des Hiob-PrologesGoethes Prolog im Himmel hat in älteren Verarbeitungen des Faust-Stoffes keine Entsprechung. Wie die Himmelsszenen im Hiob-Buch, die Goethe als Vorbild gedient haben, bietet der Prolog dem Publikum Einblick in die Hintergründe des Geschehens, das auf der Bühne zu sehen sein wird, und zwar buchstäblich auf höchster Ebene: Eine Wette zwischen Teufel und Gott bildet den Grund dafür, dass Mephistopheles Doktor Faust in Versuchung führt. Gute, göttliche Mächte und böse, teuflische stehen im Wettstreit um Faust, wobei Mephistopheles als göttlicher Widerpart aktiver sein wird. Im Anschluss an gängige Traditionen sind die biblischen Göttersöhne als Engel dargestellt und der Ankläger als Teufelsgestalt. Wer mit Hiob vertraut ist, könnte angesichts des Prologes im Himmel zunächst erwarten, dass Gott analog zur biblischen Vorlage den Sieg davontragen werde. Doch gibt es gerade im Vergleich zu Hiob Indizien, die diese Erwartung relativieren: Während in der Bibel Gott das Gespräch bestimmt, indem er es eröffnet und Hiob überaus positiv charakterisiert, ist bei Goethe Mephistopheles der eindeutig führende Dialogpartner: Er beginnt die Unterredung, ist weitaus beredter als Gott, übernimmt die Schilderung von Fausts Charakter und hat auch das letzte Wort. Überdies deutet die Beschreibung Fausts auf einen zwiespältigen Charakter, der durchaus anfällig für Versuchungen erscheint. Die Anspielungen auf die Sündenfallgeschichte (Gen 3), die Goethe in den nach dem Hiob-Buch gestalteten Dialog eingeflochten hat, tun ein Übriges, um das folgende Geschehen vorwegnehmend zu beleuchten. Durch die vorgeschalteten biblischen Bezüge gibt Goethe dem Faust-Drama somit eine theologische Tiefendimension, die sich nur voll erschließt, wenn man mit Hiob und Gen 3 vertraut ist.