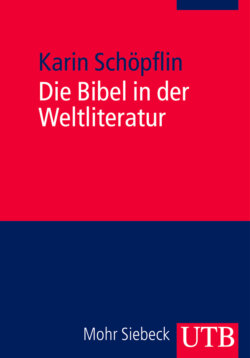Читать книгу Die Bibel in der Weltliteratur - Karin Schöpflin - Страница 8
|11|2.2. Einzelne biblische Bezüge und Anspielungen
ОглавлениеZwei knappe Ausschnitte aus der Tragödie sollen illustrieren, wie Goethe biblisches Material an Stellen einbringt, die nicht wie der Prolog im Himmel insgesamt nach biblischem Vorbild gestaltet sind.
Menschliches Erkenntnisstreben bleibt vergeblichZunächst ein Ausschnitt aus der ersten Szene, „Nacht“, die Faust einführt (V. 354ff.). Faust hat in allen vier Fakultäten studiert, den Doktorgrad erworben und Studenten unterrichtet, und doch sieht er, „daß wir nichts wissen können!“ (V. 364). Diese Verzweiflung an der Unfähigkeit des Menschen zu erkennen, „was die Welt / Im Innersten zusammenhält“ (V. 382–383), teilt Faust, der sich als „gescheiter als alle die Laffen, / Doktoren, Magister, Schreiber und Pfaffen“ (V. 366–367) ansieht, mit dem Prediger Salomo, der nach Weisheit strebte, weiser war als alle und doch erkannte, „dass […] dies ein Haschen nach Wind ist. Denn wo viel Weisheit ist, da ist viel Grämen, und wer viel lernt, der muss viel leiden.“ (Pred 1,17–18)[13]. Weil die Wissenschaften ihn nicht weitergebracht haben, will Faust es mit der Magie versuchen (V. 377ff.), mit Geisterbeschwörung, die ihm die ihm gesetzten Grenzen überwinden helfen und die Weltordnung erschließen soll. Die Versenkung in ein magisches Buch schenkt ihm die Ahnung einer Entschränkung und lässt ihn ausrufen: „Bin ich ein Gott? Mir wird so licht!“ (V. 439).
Der Mensch will sein wie GottSein zu wollen wie Gott stellt eine Versuchung für den Menschen dar, die ihn zu Fall bringt, was die Sündenfallerzählung beispielhaft zeigt (vgl. Gen 3,5). Faust erscheint ein Erdgeist (V. 481), dessen genaue Natur und Identität jedoch geheimnisvoll bleiben, der Fausts Gottebenbildlichkeit verächtlich relativiert (511–517). Nachdem Wagner ihn unterbrochen hat, greift Faust wieder allein den Gedanken der Gottebenbildlichkeit des Menschen, der aus Gen 1,26–27 stammt, erneut auf (614–622). Als Ebenbild Gottes fühlt sich Faust wie (ein) Gott und nicht mehr wie ein „Erdensohn“, wie Adam, den Gott aus Erde schuf (Gen 2,7). Er fühlt sich aufgrund der Gottebenbildlichkeit einem Cheruben überlegen, einem göttlichen Wesen, das jedoch Gott untergeordnet ist[14]. Das verächtliche Wort des beschworenen |12|Geistes hat ihn jedoch buchstäblich wieder auf den Boden zurückgeholt, so dass er konstatiert:
Den Göttern gleich’ ich nicht! Zu tief ist es gefühlt;
Dem Wurme gleich’ ich, der den Staub durchwühlt,
Den, wie er sich im Staube nährend lebt,
Des Wandrers Tritt vernichtet und begräbt. (652–655)
Er fühlt sich nun wie die niedrigste Kreatur, die im Staub lebt und unversehens umkommt. Der Staub als ihr Lebenselement und ihr leicht eintretender Tod betonen ihre Vergänglichkeit. Zugleich mag der „Wurm“ auch die Schlange assoziieren, die nach dem Sündenfall des Menschen verflucht wurde, auf dem Bauch zu kriechen und Erde zu fressen und von den Nachkommen des Menschen zertreten zu werden (Gen 3,14–15). Diese Assoziation deutet darauf hin, dass auch Faust sich wie verflucht empfindet.
Bezüge zur Anthropologie der biblischen SchöpfungserzählungenDie genannten biblischen Bezüge und Anspielungen in dieser Eingangsszene der Tragödie verweisen auf Texte, die sich mit der Erschaffung des Menschen und seinem Sündenfall befassen und die Frage nach der Stellung des Menschen innerhalb der Schöpfung und gegenüber Gott implizieren. Es besteht eine Spannung zwischen der Gottebenbildlichkeit des Menschen nach Gen 1 sowie der durch die Verbotsübertretung erlangten gottgleichen Erkenntnis des Menschen nach Gen 2–3 und seiner Kreatürlichkeit, die seine Vergänglichkeit und Begrenztheit seiner Erkenntnismöglichkeiten einschließt. Eben diese Spannung macht Faust zu schaffen, weil er sich mit dieser Grundbefindlichkeit des Menschen nicht abfinden kann. Die biblischen Anspielungen passen zudem zur Figur des Faust, der ja auch als studierter Theologe eingeführt wird.
|13|Goethe hat eben diese genannten Verweise auf biblisches Gut bewusst gewählt; sie machen insofern die Eigenart seiner Bearbeitung des Faust-Stoffes aus. Das lehrt ein Vergleich mit der Eingangsszene von Christopher Marlowes The Tragical History of Doctor Faustus (zwischen 1587 und 1593): Dort geht Faust in seinem Studierzimmer die Fakultäten durch und zitiert jeweils kurze Sätze aus Werken, die für Philosophie, Medizin und Jurisprudenz bedeutsam sind. Für die Theologie holt er zum Abschluss die Bibel des Hieronymus, d.h. die Vulgata hervor und zitiert daraus zwei neutestamentliche Stellen (Römer 6,23 und 1Joh 1,8)[15], die den Tod als der Sünde Sold und die unbestreitbare Sündhaftigkeit des Menschen konstatieren. Durch die unterschiedlichen biblischen Verweise setzen Marlowe und Goethe je eigene Akzente in der Deutung des Titelhelden.