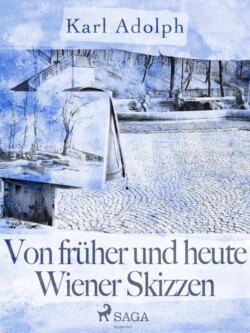Читать книгу Von früher und heute. Wiener Skizzen - Karl Adolph - Страница 7
Karlis Freude
ОглавлениеKlein Karli der Hausmeisterin und die kleine Erna der Partei vom zweiten Stock im Hintertrakt hatten Streit bekommen. Karli, den seine vier Lebensjahre entschuldigen müssen, hatte in aller Fremdheit des Begriffs männlicher Ritterlichkeit der Erna eine „geschmiert“. Erna war um ein Jahr älter, aber sie schrie trotzdem gottsjämmerlich. In den Streit der Kinder mischten sich die Mütter (es klingt nicht so wunderlich), und es entspann sich, wie stets, ein lebhaftes Für und Wider.
„Dass du dich stets mit den Kindern abgeben musst, ich hatte es dir schon so oft verboten,“ tadelte Ernas Mutter ihr weinendes Töchterchen. Das Wort war aufgegriffen worden.
„Kindern? — Wer san denn dö Kinder? Sö bringen dös so aussa, wia: a verwahrloste Bagaschi. Natürli’, Beamtenkinder kennan net alle sein. Was si’ halt heit all’s Beamter schimpft. Hint’ nix, vurn nix, aber d’ Nasen hoch, und in der Aktentaschen schleppen s’ d’ Erdäpfeln und d’ Ruab’n ham. Aber natürli’ a Aktentaschen. Da hab’ i scho’ g’fressen, wan i an’ so an’ plederten Kerl, den ’s G’wand z’ weit und der Mag’n z’ eng is, mit aner Aktentaschen siech.“
„Auf Ihre Gemeinheiten gehe ich nicht ein. So ordinär kann sich nur der Pöbel benehmen,“ konnte Ernas Mutter nur mühsam erwidern.
„Na — nobel werd’n m’r aa no’ sein. Weil Sö glaub’n, als Beamtenfrau ... Bitt’ Ihna, dö zwa Zimmer und Vurzimmer, wo S’ eh dös ane Zimmer vermiet’ hab’n, damit Ihna der Zins nix kost’t, wer’ m’r no’ jeden Tag anbringa. Und dann nehman m’r uns anständige Arbeiter von der Staatsdruckerei oder von aner Zeitung. Dö Leut’ müass’n für eahnere paar Gulden aa a Arbat niederleg’n, net wia die Herrn ‚Beamten‘ in eahnere Kanzlei’n, dö scho’ frei hab’n, wo a Arbeiter erst wieder anständig zum arbeiten anfangen muass.“
Ernas Mutter hatte nicht die Kraft, sich zu einer geschickten Erwiderung emporzuraffen.
„So eine Ordinärheit!“ vermochte sie nur zu stammeln.
„Jawohl. Mir Weana san scho’ amal net anderscht. Und du Hundsbua, miserabler, wannst di’ no’ amal abgibst mit die Kinder von solche Leut’, derlebst was.“ Damit erhielt Karli ein tüchtiges Kopf-, einige Rücken- und Steissstücke, dass er heulend in die elterliche Wohnung entfloh.
Karli hatte sich in seinen ersten kurzen Lebensjahren schon die Redeweise eines Erwachsenen angeeignet, und zwar in breitester Weise. Zum Gaudium aller Parteien, als deren Liebling er galt, trotzdem er der Hausmeisterische war.
Nachmittags erzählte er:
„Da Voda hat ’sagt, a Ruah will er ha’m daham, hat er ’sagt. D’ Muatta hat ’sagt, der Voda is a Tepp. Ja — das hat s’ ’sagt.“ Karli grinste spitzbübisch.
„Und was hat der Vatta g’sagt?“ forschte man.
„Der Voda hat ’sagt, die Muatta is a tumme Tans, sie is im Hirn an’brennt, hat er ’sagt. Ja, das hat er ’sagt.“
Niemand zweifelte an der Ehrlichkeit Karlis. Man überschüttete ihn mit Liebkosungen. Die kleine Erna durfte den ganzen Tag über nicht hinuntergehen. Sie sass am Fenster und sah traurig und neidvoll in den Hof — — —
Das war eine Zeit! Erschütternd, lähmend hatten sich unvermeidliche Ereignisse vollzogen. Schwer, unheilvoll, dräuend. Kriegserklärung um Kriegserklärung. Die Erde dröhnte buchstäblich vom Tritt der aufmarschierenden Bataillone. Der Weltkrieg war ausgebrochen. Mit der Wucht eines Sturmes, der Wälder hinwegfegt wie Kehricht, war das Grosse auf den Plan getreten. Das Überwältigende, wie ein Naturereignis sich Vollziehende.
Was hatten dagegen alle sich abspielenden kleinlichen Ereignisse der Alltäglichkeit zu bedeuten? Was alle Zänkerei, die gerade nur einen tiefen Friedenstag belebend zu unterbrechen vermag, vorausgesetzt, dass man an Zänkereien Gefallen findet.
Wie Blitzschläge fuhr es auch in die beiden Familien von Karlis und Ernas Eltern. Der eine hatte Hammer und Kelle, der andere die Feder mit der Flinte vertauscht. Merkwürdig, wie unähnlich sich sonst die Männer im Berufe sahen, die Feldgraue verwischte jeden Unterschied. Sie waren beide Krieger, sonst nichts, die für geraume Zeit aufgehört hatten, an ihre bürgerlichen Berufe zu denken.
An die Grenzen! An die Grenzen! Das Vaterland ruft! — — —
Als sich die zwei begegneten, tauschten sie einen herzlichen Händedruck. Ihre Weiber mochten bisher geschmollt haben miteinander und — nun, es ist Weibesart, einen Schatten der Verstimmung auch anderen mitzuteilen — den Männern etwas von ihrem Groll beigebracht haben. Zum Teufel mit so Dummheiten!
Ernas Vater war sehr ernst. Er verliess einen nur mühsam durch Vermieten aufrechterhaltenen Hausstand. Denn auch die beiden Mieter des einen Zimmers, ein kleiner Beamter wie er und ein Student, waren unter die Waffen gerufen worden.
„Werd’n m’r scho’ mach’n,“ tröstete der Hausbesorger; „d’ Frau und d’ Klane nehman si’ halt derweil a Kabinett, d’ Möbeln stell’n m’r am Bod’n, und wann’s unser Herrgott will, dass m’r wieder hamkumma, bleibt all’s beim alten. A Kündigung und gar a Pfändung gibt’s jetzt net, aber i man’, m’r mach’n in Hausherrn ’s Herz net schwerer, als nur sein kann. Bitt’ Ihna, bei seine fünf Häuser geht Rebbach gnua drauf. Jetzt bin i ka’ Hausmasta mehr, meine Alte muass er a g’halten, — no, mit ’n Zins san m’r ja aa aus ’n Wasser.“ — — —
Die Männer waren eingerückt. Ernas Mutter wehrte sich gegen die Verminderung ihres Hausstandes. Wer konnte dafür, dass der Ernährer weggeholt worden war und die beiden netten Mieter auch, die bisher so pünktlich ihren Zins bezahlt hatten? Und das war doch nur eine Bosheit der Hausmeisterischen, als sie anfragen liess, wann sie die Wohnung zu kündigen gedenke?
Gerade nicht! Ihr Mann war was Besseres, nicht ein gewöhnlicher Maurer, an dem man oft nicht anstreifen durfte, um sich nicht zu beschmutzen.
„Dö blöde Gans wird m’r’s bald z’ bunt mach’n,“ erklärte Karlis Mutter im Hof einer Versammlung von Weiblichkeit. „Was glaubt s’ denn eigentli’? Von was will s’ denn in Zins zahl’n? Dö paar Netsch, dö er ham’bracht hat, hab’n grad auf a Batzl Zuaspeis und Brot g’längt. In Zins hab’n dö zwa Melakn am Zimmer ’zahlt. No jetzt ... Mein Mann hat ihr’s so guat g’mant. D’r Hausherr liasst ja aa für a Vierteljahr reden, aber i bitt’ Ihna, zu was braucht so was a so a Trumm Wohnung? Weg’n dö paar Scherb’n? D’r Tandler gibt kane hundert Kronen für dös G’lump, dös, mir scheint, eh beim Ratenjuden no’ net aus’zahlt is. I fürchtert mi’ der Sünden mit dera Strachmacherei.“ ...
„Mutta, i möcht’ gern in ’n Hof obigeh’n, mit ’n Karli spiel’n,“ sagte die kleine Erna.
„Net dass d’ di’ unterstehst, Mistmensch ölendigs. Derer Hausmasterbruat kräul i allweil no’ net hint’n eini. Und wannst den Bankerten, den Karli, no’mal anschaust, hast es mit mir z’ tuan. Was glaubt dös Luader eigentli’ von unseran’? Wer is denn schon a Hausmasta? D’r gar Neam’d, der letzte Dreck.“
Das war Klein-Ernas Mutter, die nicht lange zuvor nur zu stammeln vermocht hatte: „So eine Ordinärheit ...“
„Und justament. Wann’s aa net christlich ausschaut. Dö Funsen muass die Kündigung hab’n. Unserans is aa von kan’ Bam obibeut’lt wur’n. Was bild’t si’ dö Guldenzwanz’ gkreuzer-Beamtin denn ein, wer s’ is? Weil s’ so g’schrauft hochdeutsch red’t?“
Aber eines Tages hörte man ein schrilles Schreien. Nicht „g’schrauft hochdeutsch“.
„Mein Mann, mein armer Mann! Wer gibt mir mein’ Mann wieder? Heinrich! Heinrich! Es is do’ net mögli’? Du wirst uns ja do’ net allan lass’n?“
Unten im Hofe weinte Karlis Mutter um die Wette mit den anderen Frauen. „Das arme, arme Weib! Um Gottes will’n! Karli, i bitt’ di’, schau, das d’ recht zu unsern Herrgott bet’st, dass uns net aa so was passiert. Er soll uns unsern Vattern erhalten!“
Und der kleine Karli vergnügte sich etwas später mit der kleinen Erna.
„D’Muatta hat ’sagt, mir därf’n jetzt wieder spül’n mitanand’.“ — — —