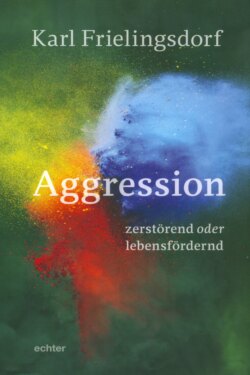Читать книгу Aggression - zerstörend oder lebensfördernd - Karl Frielingsdorf - Страница 7
ОглавлениеAggression und Beziehung – was ist das?
| 1. | Was ist Aggression? |
Das Wort Aggression stößt bei vielen Menschen zunächst auf Ablehnung und Widerwillen.
Die wachsende Gewalt im öffentlichen und privaten Leben, die Religionskriege und die Völkermorde in aller Welt verbinden die Begriffe Aggression und Aggressivität mit Gewalttätigkeit und Brutalität und lassen diese in einem schlechten Licht erscheinen.
In diesem Kapitel wollen wir zunächst auf die eigentliche Bedeutung des Wortes „Aggression“ zurückgehen. Vom lateinischen Wort „aggredi“ = „ad-gredi“ stammend, bedeutet Aggression: „herangehen“, auf jemand „zugehen“, „sich einem anderen nähern“, „in Beziehung treten“.
Wir verstehen Aggression als ein emotional initiiertes, aktives Verhalten, das gerichtet oder ungerichtet sein kann. „Als naturale Antriebskraft gehört Aggression zur Grundausstattung des Menschen. Sie bedarf zwar der Steuerung, ist aber zugleich für seine humane Entfaltung unentbehrlich“ (Korff, 232 f.). So wären die menschlichen Handlungsantriebe ohne die Aggressionen nicht zu verwirklichen. Allerdings müssen die Aggressionen auch in den emotionalen Zusammenhang des menschlichen Lebens integriert werden, weil sie sonst destruktiv wirken. Durch die rationale Überprüfung der aggressiven Antriebsimpulse auf das Ziel, z. B. die Beziehung, hin, können die Aggressionen konstruktiv und lebensfördernd eingesetzt werden. Das kann durch Regeln geschehen, nach denen Auseinandersetzungen geführt werden oder Beziehungslernen geschieht.
Von der ursprünglichen Wortbedeutung her ist nicht von vornherein klar, mit welchen Gefühlen, Motivationen und mit welchem Ziel Aggressionen als aktives „Auf-einander-Zugehen“ verbunden sind; ob es sich dabei um eine positive Begegnung oder um einen zerstörerischen Angriff handelt. Die so verstandene Aggression kann z. B. mit Gefühlen wie Ärger, Angst, Wut und auch mit Gefühlen wie Freude, Sympathie oder Liebe verbunden sein.
Ein Beispiel: Angenommen, Sie stehen in einer Schlange vor einem Bankschalter. Plötzlich erhalten Sie von hinten einen Schlag auf die rechte Schulter. Auf dieses „Herangehen“, auf diese Aggression können Sie unterschiedlich reagieren. Wenn Sie den Schlag als einen Überfall erleben, reagieren Sie wahrscheinlich mit Schrecken, Angst und Panik. Erfahren Sie den Schlag als freundschaftlichen Klaps auf die Schulter und entdecken einen guten Bekannten hinter sich, den Sie lange nicht gesehen haben, stellt sich Freude und Sympathie ein. Empfinden Sie den Schlag als eine Ungeschicklichkeit und Unachtsamkeit, erleben Sie zunächst vielleicht Ärger und dann nach der Entschuldigung des anderen Wohlwollen und Verständnis. Interpretieren Sie den Schlag auf die Schulter als Unverfrorenheit und Frechheit, werden wahrscheinlich Ärger, Wut und Empörung hochkommen. Erleben Sie den Schlag als kumpelhafte Anbiederung, werden Sie vielleicht Ablehnung, Ekel und Ärger spüren. So kann dasselbe aggressive Verhalten sehr unterschiedliche Reaktionen auslösen, je nachdem wie dieser Schlag auf die Schulter empfunden und gedeutet wird.
Über den Ursprung der Aggressionen gibt es verschiedene, oft kontroverse Theorien. Alle enthalten wichtige Aspekte, die zum Ganzen einer Aggressionstheorie beitragen können. Bevor ich aber auf diese bisher bekannten unterschiedlichen Aggressionstheorien eingehe, möchte ich auf die neuesten Ergebnisse der pränatalen und perinatalen Psychologie hinweisen, die in den letzten Jahrzehnten zu einem Paradigmenwechsel geführt haben. Sie besagen, dass das Kind von der Zeugung an und vor allem in der pränatalen Zeit ein fühlendes soziales Wesen ist, das in der frühen Lebenszeit Erfahrungen macht, die seine spätere psychosoziale Entwicklung beeinflussen und im künftigen Leben Blockaden, Vermeidungen und Re-Inszenierungen auslösen können (Hildebrandt, 2015,12). Für emotionale Erfahrungen, also auch für Aggressionen, gilt: Entscheidend für den Einfluss eines Erlebnisses auf unsere psychosoziale Entwicklung ist die Möglichkeit eines Abgleichs mit einer Art Erfahrungs-Pool. Natürlich hat ein Mensch in der pränatalen und perinatalen Phase viel weniger Vergleichsmöglichkeiten in seinem Erfahrungs-Pool als ein Erwachsener, um Irritationen oder Krisen und Aggressionen einzuordnen. Hildebrandt bringt ein Beispiel: Bei der rauchenden Schwangeren geht es keineswegs nur um Gift und Gase, es geht um die erschütternde Erfahrung, dass sich das schützende und nährende System Plazenta plötzlich in ein bedrohliches, Erstickung bringendes Organ verwandelt. Damit soll nicht gesagt sein, dass Kinder rauchender Mütter prinzipiell einen seelischen Knacks hätten. Dennoch wird die Erfahrung abgespeichert und somit lebenslang Einfluss haben, und sei es nur in Form eigener Sucht. Dabei gilt der Grundsatz: Je früher das Erleben, desto geringer ist der Vergleichs-Pool, desto tiefer der Eindruck der Spur im Lebensweg. Die moderne Hirnforschung weist darauf hin, dass ganz frühe intrauterine Erfahrungen als besonders gravierend angesehen werden, weil sie wie eine Grund-Matrize, eine Art Ur-Erfahrung das Leben beeinflussen wie die Tonart einer Sinfonie. Natürlich gibt es dort immer mal wieder strahlendes Dur, aber die Grundtonart ist möglicherweise bitteres Moll (Hildebrandt, 2015,12 ff.).
Obwohl diese Ergebnisse der Hirnforschung in den nun folgenden Aggressionstheorien kaum berücksichtigt sind, können sie uns wichtige Hinweise über den Ursprung der Aggressionen geben.
Es gibt zwei Grundtheorien über die Entstehung und Auswirkung der Aggressionen. Die psychobiologische Richtung (Lorenz, Portmann sowie Freud und die Psychoanalyse) sehen die Aggressionen als angeborene und endogene Faktoren an. Dieses psychodynamische Modell nimmt den Energiebegriff der klassischen Physik auf, der besagt, dass man keine Energie einfach verschwinden lassen kann. Sie bleibt und sucht sich einen Ort. Ist dieser Ort gefüllt und kann er keine weiteren aggressiven Energien mehr aufnehmen, dann bedarf die aggressive Triebenergie eines Ventils. Die Lösung in diesem „Dampfkesselmodell“ liegt darin, dass die aggressiven Energien frühzeitig, bevor es zum „Überdruck“ mit Explosionsgefahr kommt, hinausgelassen werden auf ein anderes „Objekt“ hin, so dass sie z. B. im Sport ausgelebt werden können (Sublimierung).
Die lerntheoretische Schule gibt den Bezug auf den endogenen Trieb auf und schaut auf die äußeren Bedingungen und die Rolle des Lernens und der Erfahrung bei der Entwicklung aggressiven Verhaltens. „In der Sicht der sozialen Lerntheorie ist der Mensch weder von inneren Kräften getrieben noch hilflos von Umwelteinflüssen bedrängt. Psychologisches Funktionieren lässt sich am besten verstehen als dauernde reziproke Interaktion zwischen Verhalten und seinen kontrollierenden Bedingungen“ (Bandura, 43 f.). Auf dem Weg der Verhaltensformung ist es möglich, mit Hilfe entsprechender Belohnungs- und Bestrafungsstrategien auf dem Hintergrund von bestimmten Verhaltensmodellen einen wünschenswerten Umgang mit Aggressionen zu erlernen.
Die Frustrations-Aggressions-Hypothese (Dollard, Miller, Sears) sieht die Aggression als eine Konsequenz von Frustration. Für sie ist Aggression eigentlich reaktiv, d. h., „sie ist eine Folge der Verhinderung unmittelbarer Trieberfüllung“. Als solche ließe sich „Aggression dann auch durch Überwindung aller Frustration schaffenden äußeren Ursachen überwinden“ (Korff, 232).
W. Doise unterscheidet vier Erklärungsebenen für das bessere Verständnis menschlichen Verhaltens, die H. W. Bierhoff auf die Aggressionstheorien anwendet:
| + | Intraindividuelle Erklärungen: Theorien, die intrapsychische Ursachen für aggressives Verhalten heranziehen, z. B. eine hohe physiologische Erregung oder Ärger. |
| + | Interpersonale Erklärungen: Aggressionen entstehen aus missverständlicher Kommunikation oder unterschiedlichen Interpretationen derselben Handlungen. |
| + | Intergruppale Ebene: Aggressionen zwischen unterschiedlichen Gruppen oder Gruppenmitglieder sind aggressiv gegeneinander, weil sie unterschiedlichen Gruppen angehören. |
| + | Ideologische Ebene: „Gesellschaftliche Ideologien legen fest, welche Handlungen erlaubt oder gar erwünscht sind und begünstigen oder verhindern damit auch die Entstehung von Aggression und Gewalt“ (Bierhoff, 4 f.). |
(Ausführliche Darstellungen zu diesem Thema findet man u. a. bei Bierhoff, 2–25 und 88–106; Klessmann 1992, 36 ff.; Berkowitz, 27 ff.; Scharfenberg, 16 ff.; Kernberg, 137 ff.). In diesen Theorien zur Entstehung von Aggressionen kommt leider der positive Aspekt von Aggression als lebensfördernde und beziehungsstiftende Antriebsenergie zu kurz. Aggression wird zu einseitig destruktiv gesehen. Für uns ist es wichtig, dass alle diese Theorien wesentliche Aspekte zum besseren Verstehen von Aggression entfalten, jedoch letztlich keine von ihnen eine ganzheitliche Aggressionstheorie darstellt.
Aggressionen sind weder rein biophysikalische noch allein sozial bedingte Phänomene. „Wir sind ihnen weder hilflos ausgeliefert noch können wir sie durch geeignete Erziehungsmaßnahmen völlig aus der Welt schaffen … Aber sie sind formbar und für verschiedene Zwecke einsetzbar. Deswegen ist es von besonderer Bedeutung, die möglichen positiven und kreativen Funktionen von Ärger und Aggression ebenso zu verstehen und darzustellen wie ihre gefährlichen und destruktiven Wirkungen“ (Klessmann 1992, 60 f.).
In diesem Zusammenhang ist es hilfreich, die Entstehung der lebensbehindernden und zerstörerischen Aggressionen näher zu betrachten (Besems 1980). Auf Schädigung oder Zerstörung ausgerichtete Aggressionen sind nicht der Ausgangspunkt, sondern die Folge eines Prozesses. Normalerweise liegen den Aggressionen in der Tiefe Verletzungen zugrunde, aus denen sie sich langsam entwickeln. Jede Verletzung bringt Schmerzen mit sich. Kann der Schmerz, aus welchen Gründen auch immer, nicht angemessen ausgedrückt werden, entsteht Ärger, die psychische Dimension der auf Schädigung ausgerichteten Aggression. Kann dieser Ärger keinen Ausdruck finden, so dringt er in die tieferen Schichten des Menschen ein und ruft u. a. körperliches Unwohlsein hervor, das gewöhnlich in Form der Wut zu Tage tritt. Wenn die in der Wut enthaltene Energie nicht in Bewegung gesetzt wird, entsteht die Aggression, die ein konkretes „Objekt“ sucht, woran sie sich ausagieren kann. Geschieht dies nicht, wird die Richtung der Aggression umgekehrt, gegen sich selbst, in die sogenannte Autoaggression.
Eine Wandlung der Aggressionen in ihre lebens- und beziehungsfördernde Dimension ist dann möglich, wenn ich die Stufen der Aggression in umgekehrter Reihenfolge noch einmal durchlaufe. Dabei muss ich darauf achten, dass ich die damit verbundene Energie und ihre Richtungsorientierung jeweils wahrnehme und auf den „richtigen“ Weg bringe.
Das bedeutet, dass ich bei der Autoaggression da ansetze, wo ich mich durch Aggressionen selbst schädige oder verletze, die eigentlich anderen gelten. Hier ist es notwendig, nach innen zu schauen und zu spüren, gegen wen sich eigentlich meine Aggressionen richten. Ist mir das klar, dann kann ich die Aggressionen nach außen richten, indem ich z. B. Steine auf ein stellvertretendes „Objekt“ werfe, darauf schlage, boxe, trommle oder es anschreie.
Danach kann ich neben dem Gefühl der Befreiung noch ein körperliches Unwohlsein spüren, das sich psychisch im Ärger ausdrückt. Ich bin erschöpft und erleichtert, spüre aber immer noch die Wut nachklingen und weiß nicht, wie ich die Energie abfließen lassen soll. Hier kann jede körperliche Bewegung helfen, z. B. laufen, körperlich arbeiten, viele Sportarten, damit ich zu einem größeren Gleichgewicht komme. Wut und verbleibender Ärger können auch in Wutbriefen, die laut gelesen werden, oder in Schimpfen und Anklagen bzw. in stellvertretenden körperlichen Auseinandersetzungen ausagiert werden.
Meist kommen danach Schmerz und Trauer hoch, oft vermischt mit Tränen, die andeuten, dass sich etwas löst. Der Blick ist frei für die Verletzung, die der Aggression zugrunde liegt, sei sie nach außen oder nach innen gerichtet. Hier kann dann der Prozess des Verstehens und der Versöhnung ansetzen, in dem die Aggressionen nicht mehr schädigend, sondern fruchtbar und lebensfördernd eingesetzt werden.
Wie bereits angedeutet, verstehen wir Aggressionen auch als einen Ausdruck von Lebensenergien, die in jedem Menschen vorhanden sind. Aggression ist eine positive Kraft, eine Antriebsenergie, die aus der inneren Lebensquelle des Menschen gespeist wird. Im Unterschied zur ungebündelten und eruptiven Wut kann die Aggression zielgerichtet und komprimiert werden (Besems, 30 ff.). Diese aggressive Lebensenergie macht den Menschen lebendig und aktiv, mit ihr gestaltet er kreativ seine Lebenswirklichkeit. Wir brauchen diese Antriebskraft immer wieder, um unsere potentiellen Möglichkeiten in Fähigkeiten und in Tun umzusetzen.
Im existentiellen Sinne bezeichnet Tillich diese aggressive Lebenskraft als „power to be“, d. h. als Trieb jedes lebendigen Wesens, sich mit zunehmender Intensität und Extensität selbst zu realisieren (Tillich, 36). Mit dieser aggressiven Lebenskraft verwirklicht der Mensch zunächst sich selbst. Sie gibt ihm die Möglichkeit, sein Leben in die Hand zu nehmen. Er entwickelt Selbstständigkeit und kann zu einer autonomen Persönlichkeit werden. Damit ist natürlich nicht eine fremdbestimmte Selbstsicherheit gemeint, die sich in Leistungen und den entsprechenden Bestätigungen durch andere beweisen muss. Die innere Lebenskraft zeigt ihre wahre Stärke in Krisensituationen und bei großen Herausforderungen. „Solche aktive Selbstbehauptung ist erfolgreich in dem Maß, wie die Subjekte in diesem Prozess der Selbstbehauptung ihre eigene Kraft spüren und die davon betroffenen „Objekte“ merken, dass sie es nicht mit einer aufgeblasenen Fassade, sondern wirklich mit dem Ausdruck einer inneren „power to be“ zu tun haben“ (Klessmann 1992, 75).
Das aggressive Potential ist ebenso notwendig, um die Welt zu erforschen und die anderen Menschen als Du zu entdecken, um dann auf dieses Du zuzugehen und Beziehungen anzuknüpfen.
In der Beziehung zu Gott ist die Aggression ein wichtiger Impuls auf unserer Suche nach einer Begegnung mit ihm, nach dem Gott, der in uns wohnt und gleichzeitig als Du im „Außen“ unseres Selbst zu finden ist.
Wir können unseren aggressiven Lebensenergien unterschiedliche Richtungen geben und sie verschieden wirken lassen. Wir können sie lebens- und beziehungsfördernd einsetzen. Wir können sie aber auch destruktiv-zerstörerisch gegen uns selbst und andere richten. Oder wir können sie einfach brachliegen und ruhen lassen. Das verursacht auf Dauer einen Energiestau, der sich dann vielleicht an unpassender Stelle Raum und Luft verschafft.
Daraus ergibt sich die Aufgabe, Wege zu finden, wie wir unser aggressives Lebenspotential lebensfördernd und beziehungsstiftend einsetzen können. In diesem Sinne schreibt C. Thompson: „Aggression ist keinesfalls notwendig destruktiv. Sie kommt aus einer angeborenen Tendenz, zu wachsen und das Leben zu meistern … Nur wenn diese Lebenskraft in ihrer Entwicklung behindert wird, verbinden sich Elemente von Ärger, Wut oder Hass mit ihr und werden schließlich zu erbarmungsloser Aggression“ (Thompson, 179).
| 2. | Einige mit der Aggression verwandte Begriffe: Ärger, Wut, Zorn, Hass, Feindschaft, Groll |
Da die mit der Aggression verwandten Begriffe wie Ärger, Wut, Zorn, Hass und Groll häufig vermischt und synonym gebraucht werden, wollen wir eine kurze Klärung und Abgrenzung der wichtigsten Begriffe vornehmen.
Ärger ist vor allem ein psychisches Unwohlsein, das sich u. a. in einer lauteren Stimme, in Fluchen, Schimpfen, Drohgebärden und heftigen Bewegungen äußern kann. Die körperliche Erregung (z. B. Erröten, Schweißausbruch, drohende Gebärden, erhöhte Pulsfrequenz) muss „einer bestimmten psychologischen und kognitiven Einschätzung und Zuordnung unterworfen werden, um als spezifisches Gefühl – und nicht nur als diffuse Erregung wahrgenommen zu werden“ (Klessmann, 24; Bierhoff 5 f.).
Neben dieser Verbindung der physiologischen Erregung mit einer psychischen Einschätzung der aktuellen Situation spielt auch das soziokulturelle Element eine Rolle: „Die Einschätzung und Zuordnung sowohl der physiologischen Erregung als auch der auslösenden Situation sind bestimmten vorgegebenen gesellschaftlichen Regeln und Normen unterworfen, also nicht völlig Ausdruck individueller Spontaneität und Freiheit“ (Klessman 1992, 25). So ist Ärger eine Mischung aus Leidenschaft und einem kontrollierbaren Ausdruck. Kann der Ärger nicht geäußert werden, wirkt die Kränkung weiter und der Ärger schlägt plötzlich in Wut um.
Wut ist zunächst ein mehr körperliches Unwohlsein, ein leidenschaftliches Gefühl, das einfach „heraus“muss. Das geschieht meist unkontrolliert, eruptiv und wenig zielgerichtet und äußert sich in lautem Türzuschlagen, im Zertrümmern von Geschirr, im Treten gegen einen Schrank u. a. m. Wut ist ein Zustand „hoher affektiver Erregung mit motorischen und vegetativen Erscheinungen, der sich als Reaktion auf eine Beeinträchtigung der Persönlichkeits- oder Vitalsphäre aus einem aggressiven Spannungsstau entwickelt“ (Tisch, 2572). Nach einem Wutausbruch tritt meist wieder eine Ruhepause ein, ohne dass allerdings das eigentliche Problem gelöst ist: mit der dahinterliegenden Verletzung und Ohnmacht (ohnmächtige Wut) heilsam umzugehen.
Zorn ähnelt in seinem spontanen Anteil der Wut (Zornausbruch), kommt aber im Gegensatz zu den Begriffen Ärger und Wut in der Alltagssprache weniger vor. In Ausdrücken wie „heiliger Zorn“ oder Zorn Gottes ist er insgesamt archaischer und dem literarischen und religiösen Bereich vorbehalten (Klessmann, 26). Im Unterschied zur oft unkontrollierten Wut vollzieht sich Zorn mehr überlegend, ist zielgerichtet und wägt bewusst mehr die Konsequenzen für sich selbst und die Umwelt ab.
Groll und daraus erwachsene Feindschaft sind keine spontanen Gefühlsäußerungen wie Wut und Zorn, sondern länger andauernde Zustände, die sich z. B. aus einem unterdrückten Ärger entwickeln können. Es ist möglich, dass sie auf Dauer alle anderen Gefühle überdecken. Wenn sie nur noch auf die Schädigung anderer Menschen ausgerichtet sind, werden sie zu Hass.
| 3. | Unterschiedliche Formen von Aggression |
Wenn wir von dem zunächst wertfreien Begriff „Aggression“ ausgehen, können wir folgende Weisen von Aggressionen unterscheiden, die in ihrer Richtung und Wirkung unterschiedlich sind: die zerstörerischen (destruktiven) Aggressionen, die unterdrückten Aggressionen sowie die lebensfördernden und beziehungsstiftenden (konstruktiven) Aggressionen. Wir verdeutlichen sie am Modell des Autofahrens.
| 3.1. | Zerstörerische (destruktive) Aggressionen |
Die zerstörerischen Aggressionen sind durch ihre schädigenden Auswirkungen gekennzeichnet. Hier wird die Energie ohne Rücksicht auf das Wohl und die Grenzen des Gegenübers „zum Ziel“ gebracht. Diese Aggressionen können ihre zerstörerische Wirkung nach außen in sinnloser Wut, in chaotischen Kraftakten, in willkürlicher Unterdrückung bis hin zum Mord ausüben. Das geschieht in Privatfehden und Völkerkriegen, in Folterungen, in Wortfechtereien, im „Fertigmachen“ von anderen Menschen ebenso wie im Mobbing am Arbeitsplatz oder in der Schule. Alexander Mitscherlich meint dazu: Mehr oder weniger sind wir alle verführbar, den Mitmenschen zu quälen. Auch die sind es, die solches weit von sich weisen. Sie wissen nur nicht, was sie tun. Diese negative Tendenz wird von den Medien Tag für Tag unterstützt, wenn nach einer internen Untersuchung fast die Hälfte aller deutschen Fernsehprogramme, genau 47,7 Prozent, sich irgendwie um destruktive Aggression und Bedrohung drehen. Darin sind enthalten 481 Mordszenen wöchentlich und 70 täglich.
Die zerstörerischen Aggressionen können sich auch in subtileren Formen äußern, z. B. in „spitzen“ Bemerkungen, in „beißender“ Ironie, in „schlagenden“ Worten, in „Kränkungen“, in „Sticheleien“, in der schamlosen Neugier des Schlüsselloch-Journalismus, in der Verachtung oder im Auslachen und Verspotten anderer Menschen.
Hiermit setzen diese Aggressionen einen zerstörerischen Teufelskreis in Gang: Sie ziehen Hass und Feindschaft, Unverständnis und Unversöhnlichkeit, Verletzungen und Kränkungen nach sich, die bei den Geschädigten wiederum destruktive Aggressionen hervorrufen können nach dem Motto: „Wie du mir, so ich dir“. Die Kräfte, die eigentlich dem Leben dienen sollten, werden „gegen“ das Leben verwandt und können sogar in letzter Konsequenz zum Nicht-Leben, d. h. zum Tode, führen.
Menschen, die ein solches destruktives Aggressionsverhalten entwickeln, haben als Kinder oft Gewalt und Drohbotschaften erfahren: „Wenn du nicht brav bist, schlag ich dich tot“; „Du darfst nur leben, wenn du dich anpasst und nicht aufmuckst“. Aus diesen Kindern wurden häufig mit Gewalt der Trotz und Eigenwille herausgeprügelt. Sie haben gelernt: „Wenn die anderen stärker sind, passe dich an und ducke dich. Wenn du selbst stärker bist, unterdrücke die andern, hau drauf und schikaniere sie. Halte sie klein und lebe auf ihre Kosten.“
Häufig setzen die Betreffenden ihre Aggressionen nicht direkt in einer Auseinandersetzung mit den Kontrahenten ein, sondern lassen sie destruktiv an Untergebenen aus. Franklin Roosevelt kommentiert das so: Wer die Hand als Erster zum Schlag erhebt, gibt zu, dass ihm die Ideen ausgegangen sind. Stellvertretende aggressive Handlungen geschehen in unterschiedlichen Beziehungsgefügen, z. B. wenn Eltern ihre zerstörerischen Aggressionen an ihren Kindern auslassen oder Lehrer an ihren Schülern. Es fehlen die konstruktiven Zwischentöne des aggressiven Verhaltens, das zum Leben führt.
Vergleichbar ist dieses zerstörerische Verhalten mit dem eines Autofahrers, der sein Auto „auf viele PS hochfrisiert“ hat und rücksichtslos mit überhöhter Geschwindigkeit durch die Stadt fährt. Er beachtet keine Ampeln, keine Fußgänger, keine Verkehrsschilder, die nach seiner Meinung nur für die anderen gelten. Er fährt ohne Rücksicht auf Verluste und lässt eine Spur der Verwüstung zurück: schrottreife Autos, verletzte Menschen, Angst und Schrecken. Wenn Ungeduld und Hilflosigkeit aufeinandertreffen, entsteht Aggression (Tom Borg).
Eine andere Weise, die zerstörerischen Aggressionen auszuleben, ist die der Autoaggression: Menschen richten ihre Energie destruktiv nach innen gegen sich selbst. Eine solche Selbstzerstörung kann bis zum Selbstmord führen, der im Volksmund auch ein „verhinderter Mord“ genannt wird. Diese Menschen haben in der Kindheit meist folgende negativen Elternbotschaften gehört: „Du bist wertlos“; „Du bist ein Nichtsnutz“; „Ach wärst du doch nie geboren“; „Du bringst mich noch ins Grab“; „Geh mir aus den Augen“ etc. Vielleicht haben sie bei Vater oder Mutter erlebt, dass das Leben sinnlos und eine unerträgliche Last ist, nicht lebenswert. Solche Menschen verachten sich und ekeln sich vor sich selbst. Auch wenn nur relativ wenige Menschen ihr Leben durch Selbstmord beenden, so gibt es verschiedene selbstzerstörerische Methoden, wie man sich langsam, aber sicher dem Tod nähern kann: durch Tot-Trinken, Tot-Essen, Tot-Hungern, Tot-Schuften, Zu-Tode-Langweilen etc. Auch psychosomatische Störungen oder neurotische Verhaltensweisen können autoaggressive Reaktionen sein.
Im religiösen Bereich wird dieses autoaggressive Verhalten z. B. in einer „negativen Askese“ oder in einer „falschen Demut“ sichtbar, wo Menschen sich „um des Himmelreiches willen“ selbst kasteien und in einem sogenannten Opferleben ihre unterdrückte Wut selbstzerstörerisch gegen sich selbst richten.
Dieses destruktive Verhalten gleicht dem Verhalten eines Autofahrers, der seinen Wagen in die Garage fährt, das Tor schließt, den Motor anmacht, in den Leerlauf schaltet und auf Vollgas stellt. Alle Energien des Wagens werden sinnlos eingesetzt. Sie bleiben im Dunkel, im Rauch und Gestank stecken, setzen nichts in Bewegung. Der Autofahrer gibt Vollgas und „vergast“ sich dabei selbst. Er zerstört sich und den Wagen.
| 3.2. | Unterdrückte Aggressionen |
Unterdrückte Aggressionen fallen auf den ersten Blick nicht besonders auf. Doch je weniger sie beachtet werden, desto mehr können sie wirksam sein. Die Menschen mit mehrheitlich unterdrückten Aggressionen machen nach außen eher einen friedlichen und vorsichtigen, freundlichen und zurückhaltenden Eindruck. Bei näherem Hinschauen zeigen sich allerdings auch die Auswirkungen der unterdrückten Aggressionen in ihrem Verhalten: Sie wirken gehemmt, ängstlich, verklemmt, verkrampft, antriebsschwach und uninteressiert. Sie machen den Eindruck von Nachgiebigkeit, sind übervorsichtig, einfallslos und entscheidungsschwach. Zur Bekämpfung und Unterdrückung der eigenen Lebensimpulse und Energien benötigen sie viel Kraft. Aggressionen gelten als unerlaubt oder verboten, nicht schicklich oder unangemessen. Deshalb müssen sie unter Kontrolle gehalten und mit allen Mitteln „be-herrscht“ werden. Dies ist auf Dauer sehr anstrengend und kraftraubend. Menschen, die ihre lebensfördernden Aggressionen unterdrücken, gleichen dem Diener im Evangelium, der sein Talent in der Erde vergräbt, weil er Angst vor seinem Herrn hat (Mt 25,14 ff.).
Lebensgeschichtlich gesehen, haben ihnen die Eltern meist verboten, ihre Aggressionen zu äußern: Aggressionen sind nicht vom Guten oder gar „Sünde“; „Aggressionen zeigt man nicht, weil sie zerstören und zum Streit führen“; „Aggressionen sind in sich schlecht und schädlich“.
Unterdrückte Aggressionen wirken sich auch körperlich aus: „Entweder man nimmt ein leises Zittern wahr, eine mühsam zurückgehaltene Wut, das nervöse Flattern, die zusammengebissenen Zähne, die hinter Überfreundlichkeit versteckte Wut, die Kälte in der Stimme …; da kocht einer vor Wut, aber der Deckel ist fest zugeschraubt. Oder man bemerkt eine merkwürdige Lahmheit, Blassheit, Unlebendigkeit, Erschöpfung, Müdigkeit, Ausgelaugtheit, Traurigkeit, Starrheit“ oder Lähmung. Damit einher geht häufig ein introvertiertes Verhalten und eine depressive Grundstimmung (Lambert, 14 ff.).
Solche Menschen sind mit einem Autofahrer zu vergleichen, der in seinem Wagen sitzt, Vollgas gibt und gleichzeitig die Fuß- und Handbremse betätigt. Die Lautstärke des Motors lässt die großen Kräfte und Gegenkräfte ahnen, die im Auto wirksam sind. Allerdings verpuffen die meisten Energien, da sie nicht in Bewegung umgesetzt werden. Das Auto und der Fahrer bleiben bei allem Energieaufwand unbeweglich. Das Ganze endet in Erschöpfung, Kraftlosigkeit und Stillstand.
| 3.3. | Lebensfördernde (konstruktive) Aggressionen |
Die lebens- und beziehungsfördernden Aggressionen wirken als kreative, aufbauende und gestaltende Kräfte, die Leben und Beziehung anstiften und letztlich auf Liebe ausgerichtet sind, die wiederum neue Energien freisetzt. Erfüllt von dieser Lebensund Liebesenergie vermögen Menschen ihre Kräfte für sich selbst und für andere einzusetzen. Sie sind entscheidungsfreudig, gehen Konflikten nicht aus dem Wege, sagen ihre Meinung und sind doch einfühlsam und anpassungsfähig. Sie besitzen ein gesundes Selbstbewusstsein und kennen ihre lebensfördernden und zerstörerischen Anteile, und sie sind in der Lage, damit umzugehen. Sie haben sich mit ihrer eigenen Lebens- und Glaubensgeschichte auseinandergesetzt und haben ihre negativen Elternbotschaften in eigene, positive Leitsätze umgeschrieben, die ihnen helfen, ihre Aggressionen lebensfördernd einzusetzen. Sie sehen ihr Leben in Beziehung und sind geprägt von einem Glauben, der über das Irdische hinausweist. Aus dem „Prinzip Hoffnung“ lebend, lehnen sie einen lähmenden Pessimismus ebenso ab wie einen blinden Optimismus.
Sie haben gelernt, in kleinen Schritten auch die Zwischentöne der lebens- und beziehungsfördernden Aggressionen zu sehen und zu leben, z. B. in persönlichen Beziehungen, in Freundschaften, in der Ehe, in der Beziehung zur Umwelt und in der Beziehung zu Gott.
Ein Mensch, der seine Aggressionen so konstruktiv einsetzt, gleicht einem Autofahrer, der ein umweltfreundliches Auto fährt, der seinen Wagen gut kennt und ihn pflegt. Er setzt die PS-Energien seines Autos ein, um Neues zu entdecken, sich frei zu bewegen, und er steuert bestimmte Ziele an. Er lädt Menschen zu gemeinsamen Reisen ein und bildet Fahrgemeinschaften. Er nutzt den Wagen, um Waren zu transportieren. Auf seinen Fahrten ist er aufmerksam und passt sein Tempo den Gegebenheiten an, wie z. B. Steigungen, Abfahrten, Kurven, Signalen, Schildern und eventuell auftauchenden Hindernissen.
So steht er weder unter „Überdruck“, den er auf das Gaspedal überträgt und dadurch wertvolle Energien vergeudet. Noch fährt er mit „Unterdruck“, den er in ein langsames Dahinschleichen umsetzt. Sein Autofahren ist angemessen und stimmig, wenn er die freigesetzten Energien situationsgerecht und verantwortlich für sich selbst, die anderen und für die Umwelt und ihre Zukunft einsetzt.
| 4. | Was ist Beziehung? |
| 4.1. | Definition |
Ganz allgemein ist Beziehung eine Verbindung, ein Verhältnis zwischen zwei Subjekten, die sich in unterschiedlichen Kommunikationsformen äußern können. Hier geht es vor allem um zwischenmenschliche Beziehungen, die konstitutiv für das Leben des Menschen als soziales Wesen sind. In unserer von Individualismus und Selbstverwirklichung geprägten Zeit wird das Wort „Beziehung“ eher statisch verstanden und lässt die vormals mitgemeinte, dynamische Dimension des „Aufeinander-Beziehens“ mehr in den Hintergrund treten.
Die humanistische Psychologie betont, dass die Entwicklung der Persönlichkeit und das Entstehen von Wertgefühlen nicht zuletzt durch die Begegnung mit anderen geschehen. Rogers z. B. nennt Echtheit, einfühlendes Verstehen und emotionale Wertschätzung als Bedingungen, damit eine Beziehung gelingt. Im Kapitel über Beziehungsstörungen werden wir sehen, wie sehr eine Beziehung von der Dynamik der aufeinander gerichteten Lebensenergien lebt und von einem ausgewogenen Verhältnis von Nähe und Distanz abhängt.
Die christliche Anthropologie betont, dass der „Mensch daraufhin angelegt ist, mit Gott und in ihm die Fülle und Vollendung des Lebens zu finden und zu teilen“. Das tiefste Wesen des Menschen ist also „relativ“ (Greshake, 34), d. h. er steht trotz aller Eigenständigkeit als freies Geschöpf letztlich nicht in sich, sondern er ist und verwirklicht sich in der Beziehung zu Gott und seinen Mitmenschen. Augustinus drückt diese Einsicht treffend aus: „Du hast uns auf Dich hin erschaffen, und unruhig ist unser Herz, bis es ruht in Dir.“
Dieses Grundverständnis von Beziehung findet sich heute in der Beziehungstheologie und Beziehungsethik wieder (Pompey 1986, 179 ff.). Der christliche Gott unterscheidet sich von den monotheistischen Vorstellungen dadurch, dass seine letzte Seins-Wirklichkeit in der trinitarischen Beziehung besteht. Es ist eine liebende Beziehung zwischen den drei „Personen“ Vater, Sohn und Geist (1 Joh 4,8), in der alles Heil und jede Erlösung in dieser Welt ihren Ursprung hat. Durch die Erschaffung der Welt und insbesondere des Menschen schafft Gott sich ein „Gegenüber“ und eröffnet somit eine weitere Beziehungsmöglichkeit. Auch den Menschen erschafft Gott als ein Beziehungswesen, das ihm und seiner Beziehungsmöglichkeit ähnlich ist, wie es im ersten Schöpfungsbericht der Bibel beschrieben wird: „Gott schuf also den Menschen als sein Abbild; als Abbild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie“ (Gen 1,27).
Der Mensch ist also auch in seiner Beziehungsfähigkeit Gott ähnlich. Doch der Mensch ist auch frei, dieses Potential anzunehmen und lebensfördernd oder -zerstörend einzusetzen. Da das Wesen dieser Beziehungswirklichkeit des Menschen in Analogie zur innertrinitarischen Beziehung Gottes die Liebe ist, setzt sie Freiheit voraus, „d. h. die Verweigerung der Beziehung, das Nein, muss potentiell immer auch möglich sein, damit das Ja ein echtes Ja ist“ (Pompey 1986, 196). Eine erzwungene Beziehung ist keine liebende Beziehung. Die liebende Beziehung Gottes und des Nächsten ist ohne freie Zustimmung nicht möglich.
Wie die Offenbarungsgeschichte berichtet, misstraute der Mensch seinem Partner Gott, konnte die Liebe zu Gott nicht durchhalten, nicht glauben, dass Gott ihm alle guten Lebensmöglichkeiten der Beziehung zu sich, zum Nächsten, zur Schöpfung bot. „Die Menschen wollten selber erkennen – im Sinne von erfahren und erleben –, was gut und böse für sie ist, und glaubten, Gott hätte ihnen etwas vorenthalten (Gen 3,1–24). Die Folgen dieser Beziehungsstörung zu Gott waren die Beziehungsstörung des Menschen zu sich, zum Nächsten und zur Schöpfung. An dieser Urtat der Menschen wie an den Folgen dieser Urtat haben alle Anteil (Un-Heils-Zusammenhang)“ (Pompey 1986, 196). In der Ablehnung der Beziehung zu Gott und zur eigenen gottähnlichen Beziehungsfähigkeit wurzelt die Sünde, die Schuld und Un-Heil mit sich bringt. Diese fundamentale Beziehungsstörung zu Gott wirkt sich bis heute aus in Feindschaft und Hass, wo Menschen ihre aggressiven Lebensenergien nicht beziehungsstiftend, sondern zerstörend einsetzen, indem sie sich bekämpfen, verletzen und töten.
Trotz dieser existentiellen Beziehungsstörung zwischen Gott und Mensch infolge des Ungehorsams (Gen 3,1 ff.), in dem der Mensch selbstherrlich über seine Lebensenergien entscheidet, blieb Gott dieser Beziehung treu. Er kommt den Menschen in seiner vergebenden Liebe immer wieder neu entgegen. Ihre Krönung findet diese Liebesbeziehung Gottes zu den Menschen und der Schöpfung in der Menschwerdung und in der Erlösung durch Jesus Christus, in dem uns Gott als Mensch konkret erfahrbar wird: „Um die Menschen in den Wurzeln der Beziehungsstörung zu heilen, nimmt er Menschennatur an, wird den Menschen gleich mit Ausnahme der Sünde, d. h. der Beziehungsstörung zu Gott (Hebr 4,15; 2 Kor 5,21; Phil 2,6 ff.). Durch die Menschwerdung – einschließlich aller Beziehungsleiden der Seele und des Leibes, z. B. von den Menschen und von Gott verlassen bis zur Zerstörung seiner Beziehung zum eigenen Leib in Folter und Tod – kommt Gott den Menschen nahe und überwindet in seiner Auferstehung und Himmelfahrt den Beziehungsbruch Mensch – Gott und macht die neue Gottesbeziehung des Menschen deutlich und wieder lebendig“ (Pompey 1981, 97).
Die Beziehung zu Gott ist also nichts Zusätzliches, Akzidentelles im Leben des Menschen. Greshake weist darauf hin, dass „die Beziehung zum Schöpfer, die freilich in Freiheit anerkannt oder verweigert (nicht aber abgeschüttelt) werden kann, den Menschen überhaupt erst zum Menschen“ (Greshake, 34) macht. Die Beziehung des Menschen zu seinem Schöpfergott, der in sich selbst in dreipersönlicher Beziehung lebt und liebt, ist eng verbunden mit der Beziehung zur übrigen Menschheit und Schöpfung. Dieser Gott, der auch seine Geschöpfe, die er nach seinem Bild geschaffen hat, in die Communio des eigenen Lebens einbeziehen will, kann nur gefunden werden, wenn der Mensch diese Communio mit anderen Menschen lebt. So wird die Beziehung zu den anderen Menschen und zur Mitwelt eine verleiblichte Ausdrucksform der Beziehung zu Gott (Greshake, 36).
Im christlichen Sinnhorizont gesprochen, gründet die Aggression als lebens- und beziehungsfördernde Kraft letztlich im Schöpferwillen Gottes, der den Menschen auf Beziehung hin geschaffen und ihn dementsprechend mit einer aggressiven Lebensenergie ausgestattet hat, die auch zum anderen strebt und Beziehung stiftet.
| 4.2. | Der Mensch als eigenständiges und relationales Wesen |
Wenn wir das Wesen des Menschen innerhalb seiner Welt betrachten, fällt zuerst seine Eigenständigkeit auf. Er ist ein freies, mit Geist begabtes Einzelwesen, das Selbstständigkeit und Selbstbestimmung besitzt, er ist Person.
Gleichzeitig ist der Mensch relational, d. h., er ist in seiner Welt auf vielfältige Weise eingebunden und steht mit anderen Menschen von der Zeugung bis zum Tod in Beziehung. Auf dem Hintergrund der abendländischen Tradition stellt sich die Frage, ob diese wechselseitigen Beziehungen für den freien Menschen konstitutiv oder nur sekundär sind. Oder sind sie gar bedrohlich, weil sie den Selbststand und die Unabhängigkeit des Einzelnen einschränken?
Das christliche Abendland hat den Menschen lange Zeit als Einzelwesen beschrieben, als Ebenbild Gottes, als in sich ruhende Persönlichkeit oder als autonomes Ich. Dass der Mensch Partner und Partnerin von anderen Menschen ist und in Gemeinschaft lebt, wurde als zweitrangiger Sachverhalt angesehen.
Auch in der Neuzeit wird der uneingeschränkte Selbststand des Menschen in den Vordergrund gestellt. Beziehungen und Bindungen schränken die Freiheit des Einzelnen ein. Selbstbestimmung wird so zu einem Kampf gegen alle Fremdbestimmungen und Abhängigkeiten, Bindungen und Beziehungen. Diese seit Descartes zu beobachtende Tendenz neuzeitlichen Denkens findet ihren deutlichen Ausdruck in einem Wort von Karl Marx: „Ein Wesen gibt sich erst als selbstständiges, sobald es auf eigenen Füßen steht, und es steht erst auf eigenen Füßen, sobald es sein Dasein sich selber verdankt. Ein Mensch, der von der Gnade eines anderen lebt, betrachtet sich als abhängiges Wesen.“ Gefragt ist also der Selbststand gegen abhängig machende Beziehungen (Greshake, 43), wobei Beziehungen grundsätzlich mit Abhängigkeit in Verbindung gebracht wurden.
Mit dem Begriff der Selbstverwirklichung haben die Psychologie und Pädagogik der letzten Jahrzehnte diese Idee der Neuzeit aufgegriffen. Als Ideal gilt, „sich von den gesellschaftlichen Konventionen und den mitmenschlichen Erwartungen, der Fremdbestimmtheit freizusagen und damit dem eigenen wahren und eigentlichen Selbst zum Durchbruch zu verhelfen. Das falsche Selbst, die angepasste Fassade, entwickelt man, weil man geliebt und akzeptiert werden möchte und sich scheut, eigene Verantwortung zu übernehmen. Zum eigentlichen Selbst findet man durch den radikalen Anspruch, sich in von der Umwelt unabhängigen Gesetzen zu definieren als einmaliges und authentisches, nur aus sich und in sich zu verstehendes Wesen“ (Willi, 1986,10).
In den letzten Jahren wird immer deutlicher, dass der Mensch diese Unabhängigkeit gar nicht besitzt und sie eigentlich auch nicht anstrebt, weil er Anerkennung und Liebe braucht. Empirische Beobachtungen bestätigen, dass der Mensch den tiefsten Zugang zu sich selbst in Beziehungen findet: „Der Mensch entwickelt sich in Beziehungen. Wir werden in Beziehungen gezeugt, geboren, gestillt, ernährt, gepflegt, unterrichtet und angelernt. Immer sind es mitmenschliche Beziehungen, welche der Entwicklung Anstoß und Form geben. Aber auch der Erwachsene entfaltet seine Persönlichkeit nicht aus sich heraus, sondern in Beziehungen …“ (Willi, 10 f.). Das In-sich-Stehen und das Auf-andere-hin-Sein bedingen sich also gegenseitig. Der Mensch wird am Du zum Ich.
In diesem Zusammenhang ist Martin Buber zu erwähnen. In der Begegnung mit der jüdisch-chassidischen Mystik erkennt Buber, dass erst die gegenseitige Wesensbeziehung zwischen zwei Menschen zur vollen Teilhabe des Seins führt. Dieses Verhältnis zum Sein sieht Buber zweifach: als Ich-Es und Ich-Du. In diesen beiden Möglichkeiten des Menschseins, der Urdistanzierung und dem In-Beziehung-Treten wird das Spezifische des Menschseins deutlich : Im Unterschied zum Tier kann der Mensch sich von der Welt abgrenzen, die Welt zum Gegenüber machen. Die „Urdistanz stiftet die menschliche Situation, die Beziehung, das Menschwerden in ihr“ (Buber, 416). Erst wenn ich das selbstständige Anderssein gelten lasse, kann der oder die andere er oder sie selbst sein und mit mir in Beziehung treten.
E. Grisebach geht noch einen Schritt weiter: Er sieht den Konflikt als konstitutiv für das Verständnis personalen Handelns. Nach ihm „zielt aller Umgang des Menschen mit Wirklichkeit grundsätzlich auf ‚Herrschaft‘, auf Vergegenständlichen, Verfügen und Unterwerfen. Während die Naturwirklichkeit diesem Zugriff stumm ausgesetzt ist, erfährt der Mensch im anderen Menschen das einzig antwortfähige Wesen in der Natur, das sich der Besitzergreifung ausdrücklich widersetzen kann …“ „In dieser grenzsetzenden Dialogizität von ‚Spruch und Widerspruch‘ entsteht für Grisebach das spezifisch humane Kräftefeld, aus dem heraus alle substanzielle Selbstwerdung des Menschen, alle reale Sozialität und eigentliche Moralität erwächst“ (Renöckl, 67 ff.). So haben alle menschlichen Beziehungen auch eine konflikthafte Dimension, wo die unterschiedlichen aggressiven Energien aufeinanderprallen können oder nicht zum Fließen kommen. Wichtig ist, dass die Spannungen wahrgenommen, ausgesprochen und konstruktiv ausgetragen werden.
| 4.3. | Aggression und Beziehung |
In welchem Verhältnis stehen Aggression und Beziehung? Das traditionelle Verständnis sagt, dass Aggressionen Beziehungen eher stören oder gar zerstören. Wenn wir jedoch die ursprüngliche Bedeutung der Aggression als „Herangehen“ und „Zugehen“ auf andere betrachten, dann ist Aggression geradezu beziehungsstiftend. Denn Beziehung entsteht, wenn zwei Menschen aufeinander zugehen, ihre Lebensenergien einer auf den anderen ausrichtet und wenn sie diese in gegenseitigem Geben und Empfangen teilen. Beziehung meint, sich aufeinander „beziehen“.
In Platons „Symposion“ erzählt Aristophanes von der Erschaffung des Menschen als Kugelwesen. In dieser Geschichte sagt er Wesentliches über das Verhältnis von Aggression und Beziehung im menschlichen Leben aus: Zuerst, so erzählt Aristophanes, „gab es drei Geschlechter von Menschen, nicht wie jetzt nur zwei, männliches und weibliches, sondern es gab noch ein drittes dazu, welches das gemeinschaftliche war von diesen beiden, dessen Name auch noch übrig ist, es selbst aber ist verschwunden. Mannweiblich nämlich war damals das eine, Gestalt und Benennung zusammengesetzt aus jenen beiden, dem männlichen und weiblichen, jetzt aber ist es nur noch ein Name … Ferner war die ganze Gestalt eines jeden Menschen rund, so dass Rücken und Brust im Kreise herumgingen. Und vier Hände hatte jeder und Schenkel ebensoviel wie Hände und zwei Angesichter und vier Ohren, auch zwei Schamteile, und alles übrige, wie es sich hieraus ein jeder weiter ausdenken kann …“ Diese Wesen waren sehr mächtig und gewaltig an Kraft und Stärke, so dass die Götter ängstlich beratschlagten, wie sie diese Giganten entmachten könnten. Zeus machte den Vorschlag, den Kugelmenschen in zwei Hälften zu teilen, denn „so werden sie schwächer sein und doch zugleich uns nützlicher, weil ihrer mehr geworden sind, und aufrecht sollen sie gehen auf zwei Beinen“ (Platon Bd. 2, 189e–190a).
Seit die ursprüngliche Kugelgestalt des Menschen in zwei Teile getrennt ist, setzen diese beiden Teile alle Energien ein, um wieder zusammenzukommen, ebenso das Männliche und Weibliche ins Mannweibliche. Dieses Streben, „durch Nahesein und Verschmelzung mit dem Geliebten aus zweien einer zu werden …, dieses Verlangen eben und Trachten nach dem Ganzen heißt Liebe“ (Platon Bd. 2, 191a–d).
Ähnliche Gedanken wie in Platons Symposion finden sich u. a. auch im Alten Testament: „Es ist nicht gut, dass der Mensch allein bleibt“ (Gen 2,18). Und darum „verlässt der Mann die Gemeinschaft mit Vater und Mutter, und er bindet sich an seine Frau und sie werden ein Fleisch“ (Gen 2,24).
Hier ist in einem Mythos begründet, was wir im täglichen Leben erfahren: Aggressionen und Beziehung gehören zusammen. Die Aggression ist die Lebensenergie, die zum anderen strebt, um mit ihm zusammen zu sein. Als inneres Streben, als Sehnsucht, als Lebenskraft sucht sie die Liebe zum anderen Menschen als Lebenserfüllung. Auf diese Weise ermöglichen Aggressionen Beziehungen in ihrer Vielfalt.
| 5. | Geistesgeschichtliche Wurzeln für das abwertende Verständnis von Aggressionen und Gefühlen |
Der kurze geistesgeschichtliche Überblick möchte zum besseren Verständnis einige Hintergründe aufzeigen, die u. a. zur heutigen Abwertung der Gefühle und insbesondere der Aggressionen geführt haben. Dabei taucht der Begriff Aggression nur selten direkt auf. Die aggressiven Antriebskräfte werden den Affekten zugeschrieben und mit den Begriffen Wut, Zorn, Ärger, Groll, Triebe, Leidenschaft oder Hass meist einseitig negativ beschrieben. Es sind gewisse durchgehende Trends in der Geringschätzung der Leiblichkeit und der Gefühle festzustellen: von Platon über die stoischen Tugend- und Lasterkataloge, die von Paulus und einigen Kirchenvätern aufgegriffen wurden, bis hin zur Aufklärung und in unsere Zeit.
| 5.1. | Das ganzheitliche biblische Menschenbild |
Das biblische Menschenbild ist ganzheitlich angelegt und geht von einer Leib-Seele-Einheit aus. Dabei spielen Gefühle und Beziehungen eine wichtige Rolle. Sowohl im Alten Testament als auch im Neuen Testament wird ein Beziehungsrahmen deutlich, „in dem der Mensch aus der Gottesbeziehung sein Selbstverständnis gewinnt und seine mitmenschlichen Beziehungen, seine Beziehungen zur Welt und zum Leben gestaltet“ (Außerleitner, 410 ff.). Das personale Gottesverhältnis wird vor allem in Beziehungsmetaphern ausgesprochen, die Vertrauen und Furcht, Intimität und Ehrfurcht, Nähe und Distanz ausdrücken. Die mitmenschlichen Beziehungen sind ebenso wie das Selbstverständnis des Menschen in der Gottesliebe verwurzelt und empfangen aus ihr die Qualität der Nächsten- und Selbstliebe. So ist das ganze Leben des Menschen im Alten Testament von einer religiösen Beziehungsdynamik geprägt, die durch die wechselnde Intensität der Gemeinschaft mit Gott bestimmt wird. Der Tod bildet die Grenze der leiblichen Existenz des Menschen.
Das Neue Testament greift die ganzheitliche Sicht des Menschen als Leib-Geist-Lebewesen auf (Mt 6,22 ff.; Lk 11,34 ff.; 12,22 f.). Durch die Gemeinschaft mit Christus, dem menschgewordenen Gott, wird der Mensch in die Dynamik der trinitarischen Liebe mit hineingenommen: Es entsteht eine neue Qualität der Schöpfung durch die Beziehung der „Gotteskindschaft“. Auch hier werden die Gottesbeziehung und die mitmenschlichen Beziehungen in den Evangelien lebensfördernd und beziehungsstiftend gesehen, besonders deutlich in den Metaphern vom Leib Christi oder vom Weinstock und von den Rebzweigen.
Diese Verbindung der gott-menschlichen Beziehungen drückt sich auch in den Grundhaltungen des Christen und in seinem mitmenschlichen und sozialen Verhalten aus. Letztlich wird diese Umwandlung durch den „heiligen“, den beziehungsstiftenden und ganzmachenden Geist initiiert, der „gerade keine Dichotomie von Welt und Gott, Materie und Geist, sondern die Verleiblichung des göttlichen Heils in der menschlichen Gesellschaft“ bewirkt (Außerleitner,412).
Allerdings zeigen sich bereits in den paulinischen Briefen erste hellenistische Einflüsse der Leibfeindlichkeit. Der Leib wird als Ort der Sünde gesehen. Gefühle aller Art, insbesondere Ärger, Hass, Wut und Zorn, werden an einigen Stellen pauschal mit einem sündigen Verhalten gleichgesetzt (Eph 4,31 f.; Kol 3,8 ff.; Gal 5,19 ff.). In diesen Texten drückt sich eine dualistische Tendenz aus, die Gefühlen wie Zorn, Ärger und Wut die Sanftmut, Liebe und Freundlichkeit als das Ideal christlicher Vollkommenheit gegenüberstellt. Über allem stand das Motto: die Kontrolle behalten, sich beherrschen. Dies war seit der Zeit des frühen Christentums ein wichtiges Ziel christlicher Lebensführung. „Die Kontrolle zu verlieren heißt, dem Leib mit seinen Begierden einen Raum zu geben, wo eigentlich der Verstand, die Seele mit ihren dem Göttlichen nahekommenden Qualitäten bestimmend sein sollten“ (Klessmann, 16).
Mit diesem Verständnis von Aggressionen geht eine einseitige Abwertung einher: Die lebensfördernden und beziehungsstiftenden Seiten der aggressiven Lebenskräfte werden kaum berücksichtigt und gleichzeitig die negativen Aspekte von Sanftmut, Freundlichkeit und Friedfertigkeit ausgeblendet, die zur Harmonisierung und Vermeidung von Auseinandersetzungen und Konflikten führen können.
Und doch konnte man nicht übersehen, dass im Alten Testament häufig vom Zorn Gottes die Rede ist und dass die Propheten sich voll von aggressiven Lebensenergien wie Zorn, Ärger und Eifer leidenschaftlich mit den Feinden Gottes auseinandersetzten. Auch Jesus zeigte ebenso wie Paulus Zorn und Ärger und reagierte aggressiv in der Auseinandersetzung mit den Pharisäern (z. B. Lk 11,37 ff.) und Schriftgelehrten. Dasselbe gilt für den Umgang Jesu mit seinen Jüngern, wenn er z. B. zu Petrus sagt: „Weg mit dir, Satan, geh mir aus den Augen“ (Mk 8,33). Ein weiteres Beispiel ist die Vertreibung der Händler aus dem Tempel (Mk 11,15 ff.). Wie ist diese Aggressivität Jesu mit dem christlichen Vollkommenheitsideal zu vereinbaren? Die Lösung lautete damals: Gegen die Feinde des Glaubens und der Gemeinde sind Ärger und Aggressionen erlaubt, nur intern, untereinander sollen sie ausgeschlossen sein (Klessmann, 17).
| 5.2. | Dualistische Tendenzen |
In der Auseinandersetzung mit seiner Endlichkeit und seinem begrenzten Leben war der Mensch schon immer versucht, die Lösung für seine Lebensprobleme in der Dichotomie von Seele und Leib zu sehen. Um von den leiblichen Belastungen (Mühsal, Krankheit, Schmerz, Tod) befreit zu werden, hielten sich viele Philosophen (u. a. Plato, Aristoteles, Plotin) an das dualistische Prinzip der Trennung von Leib und Seele: Geist und Seele zu sein und den Leib nur zu haben. Das führte zu einer Geringschätzung des Leibes bis hin zur Leibfeindlichkeit.
Das platonische Seinsschema und stoische Einflüsse haben bis in unser Jahrhundert hinein das ganzheitlich-biblische Selbstverständnis des Menschen immer wieder überlagert (Außerleitner, 413). Die prä-existente, unsterbliche Geist-Seele muss durch Läuterung aus dem Gefängnis des Leibes befreit werden, um zu ihrem „göttlichen Ursprung“ zurückzugelangen.
Das platonische Stufenschema widerspricht in wesentlichen Punkten dem biblischen Verständnis von der Selbstwerdung des Menschen: z. B. in der Abwertung der Materie und des Leiblichen gegenüber einem positiven, ganzheitlichen Schöpfungsverständnis der Bibel. Es unterscheidet sich im Leib-Seele-Dualismus von der biblischen Leib-Seele-Einheit, die das Leibliche und damit auch die aggressiven Lebensenergien und die Sexualität wertschätzt. Die absolute Transzendenz Gottes widerspricht der biblischen Offenbarung von der Menschwerdung Gottes in Jesus Christus ebenso wie die Lehre von der Göttlichkeit der Seele der biblischen Lehre von der geschaffenen Gottebenbildlichkeit. So wertet Platon in seinem Stufenschema (Reinigung – Erkenntnis – Einigung) das Leibliche, das Materielle und damit auch das Emotionale und Geschlechtliche ab. Gefühle allgemein und die leibhaften Triebe sind minderwertig.
Die hellenistisch gebildeten Kirchenväter (Origines, Gregor von Nyssa und Dionysius im griechischen Raum, Ambrosius, Augustinus und Gregor der Große im lateinischen Raum) haben sich mit dem platonischen Stufenschema auseinandergesetzt und immer wieder versucht, das platonische Gedankengut mit dem biblischen Verständnis in Einklang zu bringen. Dabei haben die Einzelnen in ihren Theorien zur Selbstwerdung des Menschen und seines Weges zu Gott unterschiedlich platonisches Gedankengut übernommen. Ihre Kritik am platonischen Denken „richtete sich vor allem gegen die Möglichkeit der direkten Gotteserkenntnis, des Tugendfortschritts aus eigener Leistung, gegen die Göttlichkeit der Seele und gegen die Möglichkeit ihrer substanzhaften Vereinigung mit Gott … Diese Kritik wurde jedoch selten ganz konsequent durchgezogen. Der Grundsatz: ‚Der Logos wurde Mensch, damit wir göttlich werden‘ (Clemens und Athanasius von Alexandrien, Origines) zeigt zu deutlich, welche Attraktion die platonistischen Motive Gotteserkenntnis, Göttlichkeit der Seele, Vereinigung mit Gott auf die Kirchenväter ausübten“ (Außerleitner, 136 f.).
Die dualistische Tendenz spiegelt sich auch in den von der Stoa übernommenen Tugend- und Lasterkatalogen wider, wo die leiblichen Triebe und die Affekte wie Wut, Zorn und Ärger als Sünde betrachtet werden.
Die Wüstenväter nehmen den Leib zwar ernst, sie verstehen ihn aber als Ort der Versuchung, als Einfallstor für die Sünde. Sie kasteien den Leib, um ihn gleichsam für die Auferstehung „vorzubereiten“. Letztlich ist das „Leibliche“ auch für sie minder-wertig.
Thomas von Aquin hat die biblische Tradition der seelisch-leiblichen Einheit des Menschen in seiner Theologie ausdrücklich aufgegriffen. Er sieht den Menschen ganzheitlich als Geschöpf Gottes in seiner Geist-Seele-Leib-Wirklichkeit (S. th. I, 76). Die erlösende Zuwendung und Liebe Gottes wendet sich dem ganzen Menschen zu, seiner Seele, seinem Geist und seinem Leib, vor allem in der Menschwerdung seines Sohnes Jesus.
Seit Thomas ist das biblisch-ganzheitliche Verständnis in der christlichen Anthropologie neu verankert, wenn es auch immer wieder durch neuplatonische, stoische und moralisierende Einflüsse in Frage gestellt wird.
Zu erwähnen ist noch die Mystik, in der eine ambivalente Einstellung zur Leiblichkeit zu beobachten ist. Das zeigt sich z. B. in der Fragestellung, ob Mystiker über alle Geschöpflichkeit hinaus mit Gott in sich in Berührung kommen oder ob Mystiker „nur“ in der geschaffenen Welt von Bildern und Wahrheiten und in der konkreten Menschwerdung Jesu Gott erfahren können. Sudbrack schreibt dazu: „Jede Mystik hat es mit Bildern zu tun. Aber sie besteht im ständigen Überschreiten der Bilder, besser gesagt: in deren Öffnung für die geistige Welt, die sich im Bild verleiblicht“ (Sudbrack, 148).
Der Mensch begegnet Gott in vermittelter Unmittelbarkeit auch in der Schöpfung und vor allem im menschgewordenen Gottessohn Jesus Christus (Sudbrack, 150). So sprechen sich Bernhard von Clairvaux, Teresa von Avila u. a. in kritischer Auseinandersetzung mit der platonischen Stufenlehre gegen ein rein geistiges Beten aus, weil dadurch das Menschliche und damit auch die Menschwerdung Gottes letztlich abgewertet werden.
Die dualistischen Denkformen der Neuzeit gehen vor allem auf Descartes und seine res cogitans und res externa und auf I. Kant mit seinen drei Säulen „Vernunft – Verstand, Verstand – Sinnlichkeit, Pflicht – Neigung“ zurück. In der Aufklärung und auf andere Weise im Pietismus hat sich ein „dualistisches Ideal“ menschlicher Lebensführung, „vernunftmäßig und beherrscht zu leben“, durchgesetzt. D. h., alle nach außen drängenden Gefühle, insbesondere die aggressiven Antriebskräfte, Ärger, Wut, Zorn und Leidenschaft, müssen unterdrückt werden, um einen möglichst hohen Grad an „Vollkommenheit“ zu erreichen und so dem Willen Gottes zu entsprechen.
Die Abwertung der Leiblichkeit und die Unterdrückung der Emotionen hat u. a. zu der sogenannten negativen Aszese geführt, die eine falsch verstandene Selbstverleugnung zur ausschließlichen Tugend erklärt und als Nachfolge des leidenden Jesus betrachtet.
Unterdessen wissen wir, wie wichtig die aggressiven Antriebskräfte, die in die Aus-ein-ander-Setzung führen, und damit auch Gefühle wie Wut, Ärger und Zorn für die Entwicklung der Ich-Stärke und der persönlichen Identität sind. Werden sie unterdrückt, wird eine gesunde Persönlichkeitsentfaltung und Selbstwerdung des Menschen eher behindert oder gar verunmöglicht. Ferner besteht die Gefahr, dass die Abwertung des Leiblichen und die Unterdrückung von Gefühlen allgemein und insbesondere von lebensfördernden Aggressionen zu einer Vermeidung von konstruktiven Auseinandersetzungen im religiösen Leben und im kirchlichen Bereich führen können.
| 5.3. | Die wiedergewonnene ganzheitliche Sicht des Menschen |
Das 2. Vatikanische Konzil orientiert sich wieder eindeutig an dem ganzheitlichen Menschenbild der Bibel und betrachtet den Menschen als „Geist in Leib“. Durch seine Leiblichkeit vereint der Mensch die „Elemente der stofflichen Welt in sich: Durch ihn erreichen diese die Höhe ihrer Bestimmung und erheben ihre Stimme zum freien Lob des Schöpfers. Das leibliche Leben darf also der Mensch nicht geringachten; er muss im Gegenteil seinen Leib als von Gott geschaffen und zur Auferstehung am Jüngsten Tage bestimmt für gut und der Ehre würdig halten“ (Rahner/Vorgrimler, 460 f.).
Leib und Leiblichkeit sind für den Christen vom Glauben her als Geschenk Gottes grundsätzlich positive Werte. Durch die „Fleisch-Werdung“ des Sohnes Gottes, der uns in allem gleich wurde, außer der Sünde, ist der Wert des Leibes noch einmal unterstrichen worden und, wie die Bibel sagt, „geheiligt als Tempel Gottes“ (1 Kor 3,16). Gefühle und auch die aggressiven Lebensenergien haben ihren Sitz im Körper. Erst der Leib ermöglicht, dass sie sich bewegen können und zum Aus-Druck kommen, „aus dem Körper heraus“ und sich so auf andere zubewegen und Beziehung stiften. Freude, Sympathie, Glück, Liebe und Leid drücken sich im Körper aus; Freude z. B. in Formen der leiblichen Freude: in Tanz, Sport, Spiel; oder Liebe in der sexuellen Intimität und Zärtlichkeit. Wie sehr können leibliche Gebärden, Mimik, Gesten und die ganze Körpersprache seelische und geistige Vorgänge im Menschen nach außen vermitteln. D. Mieth schreibt zusammenfassend: „Daher kann der Leib nicht einfach als das aufgefasst werden, was wir mit dem Tier gemeinsam haben. Ebenso wenig ist der Leib die Summe der körperlichen Funktionen des Menschen. Leiblichkeit bezeichnet die psychosomatische Einheit im Hinblick auf ihre sichtbare und sinnliche Erscheinung“ (Mieth, 642).
M. Schneider beschreibt das Menschenbild der christlichen Anthropologie wie folgt: „Ziel christlichen Lebens ist kein entleiblichter und entsinnlichter Geist (nous, intelligentia), das wäre eine (neuplatonische) Versuchung. Gewiss müssen die Sinne geläutert und von jeder egoistischen Begierlichkeit gereinigt werden, doch den geläuterten ‚Sinnen‘ kommt es zu, den menschgewordenen Gott zu erspüren: ‚Was wir gehört und mit unseren Augen gesehen … und mit unseren Händen betastet haben vom Wort des Lebens‘ (1 Joh 1,1 f.). Die innere Bedeutung der Sinne wird im Blick auf die Menschwerdung Gottes deutlich. Seit der Himmel auf die Erde herabgekommen und der Herr bleibend gegenwärtig ist, findet der Mensch Gott in allen Dingen des Lebens, also nicht jenseits, in einer geistigen Welt; das reine Herz schaut ihn schon jetzt überall“ (Schneider, 270 f.). Auch die Vollendung des Menschen in Gott wird am ganzen und unteilbaren Menschen offenbar werden, einschließlich seiner Leibgestalt. So hofft der gläubige Mensch nicht auf eine Befreiung vom Leib, sondern auf die Vollendung seiner Leiblichkeit.
In jüngster Zeit wird in der Liturgie und im Gebet die Bedeutung des Leibes neu entdeckt: in den körperlichen Gebetshaltungen, in Gestik und Mimik, in Bewegung und Tanz. Hier wird der Leib in ein ganzheitliches Beten und Meditieren bewusst mit einbezogen, gemäß dem Wort des Paulus: „Verherrlicht Gott in eurem Leib“ (1 Kor 6,20).
Im christlichen Brauchtum wird die Ehrfurcht vor dem Leib u. a. in den sakramentalen „leiblichen Berührungen“ ausgedrückt.
In der Taufe wird die Stirn des Täuflings mit Chrisam gesalbt und das Wasser des Lebens über seinen Kopf ausgegossen. Sein Mund wird als Ort des Aus-Drucks der Gefühle und der Einnahme von lebenserhaltenden Speisen und Getränken gesegnet. Ebenso das Herz, als Sitz des Lebens, der Gefühle und der Verankerung von Beziehungen.
In der Eucharistie kommen wir in der Gestalt von Brot und Wein mit Christus leibhaftig in Berührung.
In der Krankensalbung wird der Körper des Kranken an allen Sinnen mit dem Öl des Heiles gesalbt.
Im Begräbnis nach dem irdischen Tod wird der Leib in die Erde gebettet, aus der er genommen ist, in der Erwartung seiner Verklärung bei der Auferstehung von den Toten. Hier wird deutlich, dass wir von Gott als Menschen mit Leib, Geist und Seele geschaffen und erlöst sind.
Leider hat sich die ganzheitliche Sicht des Menschen als Leib-Geist-Wesen in den Jahren nach dem Vatikanischen Konzil nur langsam durchgesetzt. Nach wie vor sind Vorurteile gegenüber dem Leiblichen, den Gefühlen und Beziehungen im Allgemeinen und den Aggressionen und der Sexualität im Besonderen in christlichen und kirchlichen Kreisen zu finden (vgl. die Ergebnisse der im Oktober 2015 beendeten Bischofssynode).
| 6. | Zusammenfassung |
Die Fabel des arabischen Mystikers Sa’di vom „invaliden Fuchs“ fasst unser Thema Aggression und Beziehung gut zusammen (Mello, 64): „Unterwegs im Wald sah ein Mann einen Fuchs, der seine Beine verloren hatte. Er wunderte sich, wie das Tier wohl überleben konnte. Dann sah er einen Tiger mit einem gerissenen Wild. Der Tiger hatte sich satt gefressen und überließ dem Fuchs den Rest. Am nächsten Tag ernährte Gott den Fuchs wiederum mit Hilfe des gleichen Tigers. Der Mann war erstaunt über Gottes große Güte und sagte zu sich: ‚Auch ich werde mich in einer Ecke ausruhen und dem Herrn voll vertrauen, und er wird mich mit allem Nötigen versorgen.‘
Viele Tage brachte er so zu, aber nichts geschah, und der arme Kerl war dem Tode nahe, als er eine Stimme hörte: ‚Du da, auf dem falschen Weg, öffne die Augen vor der Wahrheit! Folge dem Beispiel des Tigers, und nimm dir nicht länger den behinderten Fuchs zum Vorbild.‘
Auf der Straße traf ich ein kleines frierendes Mädchen, zitternd in einem dünnen Kleid, ohne Hoffnung, etwas Warmes zu essen zu bekommen. Ich wurde zornig und sagte zu Gott: ‚Wie kannst du das zulassen? Warum tust du nichts dagegen?‘
Eine Zeitlang sagte Gott nichts. Aber in der Nacht antwortete er ganz plötzlich: ‚Ich habe wohl etwas dagegen getan. Ich habe dich geschaffen.‘“
Zum menschlichen Leben gehört wesentlich die Spannung zwischen Ich und Du, zwischen Geben und Empfangen, in der die aggressiven Lebensenergien, die in die Auseinandersetzung, Loslösung und Distanz führen, eine entscheidende Rolle spielen. Einerseits besteht die Aufgabe, die aggressiven Energien einzusetzen, um Ich selbst zu werden und autonom zu bleiben. Das beinhaltet auch, mich nicht in symbiotischen oder abhängigen Beziehungen zu verlieren, in denen die Ich-Identität verschwimmt und eins wird mit der Identität des anderen oder wo ich meine Identität ausschließlich über die Identität des In-Beziehung-Seins mit einem Menschen oder einer Gruppe gewinne. So wird die Selbstwerdung gerade verhindert. Ebenso gehört zu einem erfüllten menschlichen Leben, dass ich meine aggressiven Lebensenergien einsetze, um auf andere Menschen zuzugehen und mich ihnen Schritt für Schritt zu öffnen und mit ihnen zu leben. Dann können gute und heilsame Beziehungen entstehen, in denen Liebe geschenkt und empfangen werden kann.
Eine heilsame Beziehung gründet zunächst in der Beziehung zu mir selbst mit einer geordneten Selbstliebe, die Selbstzerstörung ausschließt; dann in der Beziehung zu anderen Menschen und zur Umwelt mit einer geordneten Nächstenliebe, wo auch Hass und zerstörerische Aggressionen lebensfördernd aufgearbeitet und in neue Beziehungsmöglichkeiten umgewandelt werden; das gilt auch für die Beziehung zu Gott, in der eine aggressive Auseinandersetzung den Weg zu einer tieferen Gottesbeziehung eröffnet (Frielingsdorf 1993, 45 ff.).
Eine wichtige Voraussetzung für das Gelingen von Beziehungen sind der Selbststand und die Fähigkeit, gerade auch den zerstörerischen Aggressionen standzuhalten und sie in lebensfördernde umzuwandeln. Wenn die aggressiven Schritte auf den anderen zu beziehungsfördernd sein sollen, dann sind sie einfühlsam und differenziert zu setzen. Sie erfordern viel Geduld und Vor-Sicht beim Aufeinanderzugehen, damit die anderen nicht abgeschreckt, verletzt oder überfahren werden. Gute Beziehungen wachsen langsam heran und sind als Vorstufe von Freundschaft und Liebe sehr verletzbar und empfindlich, gerade weil sie so kostbar für das menschliche Leben sind. So können Aggressionen heilsame Beziehungen stiften und im Rahmen der Selbstliebe, der Nächstenliebe und Gottesliebe zum Gelingen des Lebens wesentlich beitragen.