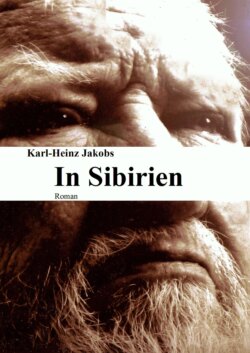Читать книгу In Sibirien - Karl-Heinz Jakobs - Страница 5
Erstes Kapitel: Die Verhaftung
ОглавлениеChitrowski Markt
Der Chitrowski Markt in Moskau liegt dort im Zentrum der Hauptstadt, wo die Jausa in die Moskwa mündet. Während sich die Moskwa in mehreren Schleifen durch das Stadtgebiet von West nach Ost windet, fließt die Jausa in großem Bogen von Nord nach Süd und prägt mit malerischen Brücken und imposanten Kais das Stadtbild der Innenstadt östlich des Kreml.
Hier im Dreieck zwischen Moskwa und Jausa bildet die Flußmündung ein Tal, in dem sich die Nebel der Niederung mit Rauch und Gestank aus Fischbratküchen, dem Dampf aus Wurstkesseln und dem Machorkaqualm aus Kaschemmen, Nachtasylen und Bordellen mischt. Das ist der Chitrowski Markt. Umgeben von Kirchen, Parks und Kathedralen, von Regierungsgebäuden, Kasernen und Universitäten, bildet er eine Insel des Elends inmitten der strahlenden Metropole mit ihren Palästen, Türmen und Triumphbögen. Alles, was schön und angenehm ist an Moskau, wird dem Pokrowskij Bulwar zugerechnet, ihm und den anderen Prachtstraßen der russischen Hauptstadt, Arbat unter ihnen, Twerskaja und Gartenring. Alles was häßlich ist an Moskau, wird dem Chitrowski Markt zugeschoben und anderen fragwürdigen Vierteln, der Sucharewskaja zum Beispiel oder der Smolenskaja.
Es war Herbst, später Herbst 1936, Herbst jenes Jahres, in dem Lena in die tragischen und unheimlichen geschichtlichen Ereignisse hineingerissen wurde, von denen hier die Rede sein soll.
Um den Chitrowski Markt hatte Lena immer einen großen Bogen geschlagen. Vor dem Elend in seiner jämmerlichsten Gestalt hatte sie Scheu.
„Aber auch du wirst dorthin kommen“, sagte Ervin, als tröste er sie, „wart’s nur ab. Irgendwann landet jeder einmal auf dem Chitrowski Markt.“
„Ist das eine Drohung oder eine Prophezeiung.“
„Weder ... noch“, sagte Ervin, „es ist nur eben Moskau. Hier ist alles anders als woanders in der Welt. Während die Rathausuhr in Berlin rechts herum läuft“, sagte er, „in Richtung auf eine ungewisse Zukunft, die Uhr in Prag am Jüdischen Rathaus links herum, in Richtung auf einen unerklärlichen Ursprung, haben die Uhren in Moskau Zeiger, deren Umdrehungsrichtungen wechseln und niemand ahnt, in welcher Zeit er sich augenblicklich befindet.“
Einmal, auf dem Weg zum Lehrinstitut für Zivilingenieure am eleganten Pokrowskij Bulwar, verirrte sich Lena tatsächlich im unüberschaubaren Gewirr der Müllhalden, der Gäßchen und Hinterhöfe des Chitrowski Marktes. Aus der düsteren Woronzowofeld-Straße kommend hatte sie, statt in den Boulevard abzubiegen, den sie als solchen nicht erkannte, den Weg in die Podkolokolnij-Gasse eingeschlagen, und plötzlich war sie vom Rauch und Dampf des Chitrowski Marktes umgeben, von Bettlern, die schamlos eiternde Wunden vorzeigten, von Huren, die Lumpen lüfteten, von Kindern, die mit krallenartigen Fingern nach ihr griffen, von Kerlen, die in zerrissenen Kitteln und steifen Hüten die fremde Verirrte musterten, als überlegten sie, wozu diese einfach und sauber gekleidete hübsche Dame wohl zu gebrauchen sei.
Benannt war der Chitrowski Markt nach Chitrow, Nikolai Petrowitsch, Generalmajor, dem in den Achtzehnhundertfünfzigern die öden Felder des Stadtbezirks Mjasnizkaja im Flußwinkel von Moskwa und Jausa westlich des Pokrowskij Bulwars gehörten. Grundstück für Grundstück hatte er an Spekulanten verkaufen müssen, an Stepanow, Bardadym und Bunin, an Rumjanzew, Jaroschenko und Kulakow, die im Auftrag der Stadt und auf deren Kosten Nachtasyle, Waisenhäuser und Suppenküchen einrichteten und gewaltige Gewinne einstrichen, wenn sie für eine Schlafstelle im Gemeinschaftssaal zwei Kopeken nahmen, für ein Einzelbett im „Dreistöcker“ fünf Kopeken und für ein Zimmer zu dritt pro Person acht Kopeken.
Hier auf dem Chitrowski Markt hatten sich schon immer die Verratenen und Verunstalteten versammelt, die Gedemütigten, Gemaßregelten und dem Galgen Entsprungenen, während hundert Meter weiter auf dem Pokrowskij Bulwar die reichsten Familien Moskaus in Prunkvillen residierten: Sawwa Morosow, der Volksfreund, ebenso wie die Kriegsgewinnler Bachruschin, Chlebnikow und Rasturgujew.
Nach der Oktoberrevolution waren die Spekulanten auf dem Chitrowski Markt enteignet und vertrieben worden, ihre Häuser hatten andere Namen erhalten. Die ehemalige Verbrecherkneipe Sibirien hieß: Partisan, das ehemalige Bordell Zwangsarbeit hieß Roter Stern und über dem niedrigen Eingang des ehemaligen Nachtasyls Schweinehaus im Hinterhaus des Gebäudekomplexes, das früher dem Waffenschieber Kulakow gehört hatte, prangte nun in roten verschnörkelten Buchstaben: Hotel Erster Mai. An Stelle der halbnackten und kahlgeschorenen riesenhaften Gestalten, die zu Zeiten des Zaren in den Häusern die Aufsicht führten und aussahen, als wären sie einem Gemälde Repins entstiegen, wurden zu Lenas Zeiten die Häuser auf dem Chitrowski Markt von riesenhaften Krüppeln in quergestreiften Matrosenhemden regiert, die einst als Blaujacken in Odessaer und Kronstädter Flotten blutige Meutereien gegen das zaristische Regime angeführt hatten.
Die Regierung hatte die Verstümmelten des Weltkrieges, die Krüppel der Revolution und des Bürgerkrieges, die Geistesgestörten und aus ihrer Lebensbahn Geworfenen in den Hohen Norden und den Fernen Osten deportiert. Dort sollten sie in weltfernen Klöstern und auf einsamen Inseln ihren Lebensabend beschließen. Den Namen Solowezki flüsterte man sich hinter vorgehaltener Hand zu, und Schauer des Grauens überlief die Tuschelnden beim Weitergeben des Wortes. Aber viele der Deportierten waren nicht in der Wildnis geblieben, sondern hatten sich auf die Beine gemacht, um in der Stadt ihrer Hoffnung zu leben, in Odessa, Brjansk und Petrograd, in Minsk, Tula und Charkow. Wer in Moskau illegal leben wollte, versteckte sich in den Kellern, Ruinen und Hinterhöfen des Chitrowski Marktes.
Lena war nicht die einzige gutgekleidete Fremde auf dem Chitrowski Markt. Zu zweit, zu dritt flanierten in Pelze oder in dicke Tuchmäntel gehüllte neugierige Damen und Herren durch die zerfallenden Gassen, fotografierten und notierten. Hier schnappte Lena ein Wort in Englisch auf, dort eins in Französisch. Die Ausländer schienen begierig zu sein, einen sozialistischen Slum zu erleben. Es gab viel zu entdecken und spöttisch zu kommentieren.
Lena war erschrocken angesichts des Gewimmels eitriger und schorfiger Jammergestalten, inmitten von Krüppeln und Gehetzten. Müllhaufen säumten die Straße. Während sich Lena mühsam der Kinder erwehrte, die sie umjohlten und versuchten, sich an ihrem Mantel festzukrallen, rief sie umstehende Männer zu Hilfe:
„Hallo, Sie da, bitte helfen Sie mir“, und als der Angesprochene sich nicht rührte, sondern sie nur ruhig betrachtete, als spreche sie nicht seine Sprache, wandte sie sich an den nächsten: „Lieber Herr, ich habe mich verirrt, wie komme ich zurück zum Pokrowskij Bulwar?“
Keine Antwort.
Vor dem ehemals Kulakowschen Haus, das früher Das Bügeleisen genannt wurde, spie ein Feuerschlucker unter dem Gejohle der Umstehenden meterlange Flammen in die Horde abgerissener Kinder, die lärmend davonstoben und wiederkamen, wenn der Artist Atem schöpfte. Über offener Flamme kochte eine dicke Kasachin Kascha in einem großen eisernen Kessel. Vor einer Tonne, die liegend auf Rädern montiert und mit der Inschrift: Kwas! versehen war, standen frierende Zerlumpte, die mit alten Konservendosen oder zerbeulten Blechbechern in der Hand warteten, vom tatarischen Verteiler bedient zu werden. Mitten auf dem Platz hatte ein Schausteller sein Pferdekarussel aufgebaut.
Daneben trieb mit schwarz angemaltem Gesicht ein Schlangenbändiger seine Possen, indem er den Kopf des Reptils küßte, während sich der kinderarmdicke Leib um seinen Körper ringelte. Auf der Suche nach einem Ausweg aus dem Durcheinander irrte Lena an einer Fischbratküche vorbei, wo Heringe in spritzendem Öl brieten und an einer Kochstelle, deren Besitzerin mit gellender Stimme ihr Produkt ausrief:
„Frische Kaldaunen! Frische Kaldaunen! Frische Kaldaunen!“
„Löcher stopfen! Löcher stopfen!“ rief aus der Tür des ehemals Rumjanzewschen Hauses ein Mann mit Holzbein und zwei Reihen Stahlzähnen, die blitzten, sobald er den Mund auftat. „Brandlöcher stopfen, Schußlöcher, Dreiangeln ... Alles stopfen wir ohne Ansehen der Person ... Ich sehe“, rief er Lena zu und musterte sie von oben bis unten, alles an ihr sah frisch und sauber aus, „Sie haben nichts zu stopfen, aber Ihr Mantel gefällt mir und auch die Stiefelchen sind sehr schön, was wollen Sie dafür haben?“
Mit schroffer Bewegung wandte sie sich von dem Schausteller ab.
„Das ist der Chef der Krebse“, erläuterte leise eine wohlklingende Männerstimme neben ihr.
Ein Mann in zerknautschtem Schlafanzug und dickem Schal um den Hals hatte sich ihr genähert:
„Krebse, das sind die Schneider“, sagte leise mit einschmeichelnder Stimme der Mann im Schlafanzug, unter dem es bei jeder Bewegung leise knisterte, „Krebse sind die bedeutendsten Künstler auf dem Chitrowski Markt. Was nachts hinten in ihren Werkstätten eingeliefert wird, verläßt Stunden später in veränderter Form vorn den Laden: Kein Mensch, der hier seinen nachts gestohlenen Pelz sucht, wird ihn eine Stunde später wiedererkennen ... Sie sind fremd hier? Darf ich Sie einführen in die Moskauer Unterwelt?“
„Nein.“
„Sie haben keine Wahl“, er wies mit der Hand in die Runde: „Wie wollen Sie hier je wieder herausfinden?“
Lena war von dem Knistern bei jeder Bewegung des Mannes im Schlafanzug irritiert.
„Wer sind Sie denn?“
„Ich bin der Dichter Satinajew“ sagte mit geschmeidiger Stimme der Mann.
„Und warum treiben Sie sich hier herum, anstatt im Haus der Literatur Lesungen zu geben?“ fragte Lena streng.
„Die Zeit ist nicht geeignet, im Haus der Literatur futuristische Lesungen zu geben“, sagte Satinajew vorsichtig.
„Ach, ein Futurist sind Sie!“ rief Lena in beleidigendem Ton, angesichts des Dichters in seinem lächerlichen Aufzug verlor sie ihre Zurückhaltung: „A-e-i-o-uuu, Otko! - U-i-a-o-eee, Okto!“ äffte sie: „ja, denken Sie wirklich, wenn Malewitsch mit Holzlöffeln in den Knopflöchern durch Moskau spaziert“, rief sie, „oder wenn Krutschenik sich mit einem Bindfaden ein Kopfkissen um den Hals hängt, könnten Sie heute mehr als faule Eier ernten? In Zürich hatten wir Hugo Ball mit ähnlichem Unfug, in Paris Tristan Tzara, in Berlin ...“
„Gnädige Frau“, sagte Satinajew lächelnd, „was regen Sie sich auf? Ich kenne die von Ihnen genannten Personen nicht. Ich bin ein Futurist aus dem Jahr 1913, und hier ist meine frei gewählte Welt.“
„Frei gewählte Welt!“ rief Lena, und an einen unsichtbaren Zeugen gewandt: „Den Chitrowski Markt nennt er seine frei gewählte Welt! Daß ich nicht lache!“
„Ich habe mich im Krieg vor dem Militärdienst gedrückt und in der Revolution habe ich durch Abwesenheit geglänzt“, sagte lächelnd der Dichter, „heute habe ich mich Ihnen als Führer durch den Chitrowski Markt angeboten. Keineswegs wollte ich Sie kränken oder, was Sie offenbar befürchtet hatten, Sie etwa mit eigenen Gedichten belästigen. Ich bin auch nicht teuer. Wenn Sie mir fünf Kopeken für meine Dienste geben, nehme ich Sie dankend an.“
„Gut“, sagte Lena, sie kramte in ihrer Aktentasche und reichte dem Dichter einen Rubelschein, „bitte nehmen Sie, das ist für Ihre Bemühungen. Und nun schaffen Sie mich weg von hier.“
Gleichmütig steckte der Dichter den Schein in die Brusttasche seines Schlafanzuges, der wiederum knisterte bei jeder Bewegung.
„Was knistert da in Ihrem Anzug?“ fragte Lena.
„Oh“, sagte Satinajew, „stört es Sie?“
„Es irritiert mich.“
„Es sollte Sie nicht irritieren“, sagte Satinajew geschmeidig, „es sind nur die Zeitungen, die ich um meinen Körpereb gunden habe. Es ist morgens manchmal schon recht kalt, wissen sie, außerdem bereite ich mich auf den Winter vor, ich trainiere sozusagen für die kalte Jahreszeit, probiere dieses, probiere jenes, um nicht zu erfrieren später, übrigens“, er beugte sich leicht vor, „die Iswestija hält viel besser die Kälte ab als die Prawda,“ er beugte sich noch weiter vor, „aber sagen Sie das, bitte, nicht weiter, ich möchte nicht schuld sein am Niedergang der Prawda.“
Eine Frau ohne Augenlider, ohne Nase und Lippen trat hinzu.
„Wer ist die“, herrschte sie Satinajew an.
„Oh“, sagte Satinajew unterwürfig, „das ist ...“, er sah hilfesuchend zu Lena hin, die mit gekrauster Stirn die Hinzugetretene musterte, und da Lena keine Anstalten machte, ihn aufzuklären, ergänzte er, als habe er ein Geheimnis zu verkünden: „Das ist eine Genossin aus dem Ministerium.“
„Von welchem Ministerium?“
„Vom Ministerium für Barmherzigkeit.“
„Das gibt es nicht.“
„Das sollte es aber geben“, sagte Satinajew.
„So?“ sagte die Frau ohne Augenlider, ohne Nase und ohne Lippen, indem sie sich an Lena wandte, „vom Ministerium sind Sie also.“
„Nein“, sagte Lena, „ich bin Dozentin an der Militärakademie.“
„Das ist ja noch schöner“, sagte die Frau ohne Augenlider, ohne Nase und ohne Lippen, „dann teilen Sie der Partei und Stalin mit, daß wir vom Chitrowski Markt fest auf dem Boden des Marxismus-Leninismus stehen ...“
Wegen ihrer Behinderung fiel es ihr schwer, Lippenlaute auszusprechen und Lena hatte Mühe, sie zu verstehen. Ihr Gesicht war von großflächigen Brandnarben verunstaltet, aus den beiden oberen Löchern schauten zwei glasige Augen:
„ ... Und wir billigen die Hinrichtung der Verräter mit Sinowjew und Kamenjew an der Spitze“, fuhr die Lippen-, Lid- und Nasenlose fort, „wir verstehen, daß wir beiseitegeschoben werden mußten, um dem Aufbau des Sozialismus nicht im Wege zu stehen. Das Proletariat soll sich nicht erschrecken bei unserem Anblick ...“
Bei einem Blick zur Seite bemerkte Lena, wie Satinajew, Hände auf dem Rücken, verlegen lächelnd vor sich hin blickte, als beobachte er einen ungewöhnlichen Vorgang im Straßenstaub.
„ ... Aber wir können mehr leisten für das Allgemeinwohl, als hier herumzulungern. Habe ich nicht nützliche Hände?“ rief die Lippen-, Lid- und Nasenlose, und hielt Lena ihre Hände entgegen, feingliedrige und stark vernarbte Finger, „und hat Anatoli nicht starke Hände?“ Sie wies auf den Mann ohne Beine, dessen Unterleib auf dem Rollwägelchen festgeschnallt war, der so Angeredete hielt Lena seine Hände entgegen. „Sagen Sie Stalin und der Partei“, fuhr die Lippen-, Lid- und Nasenlose fort, „daß wir bereitstehen. Ich würde mich nicht genieren, in einer Spezialabteilung der Automobilwerke am Produktionsband zu stehen - um das Proletariat nicht zu ängstigen mit einer Gesichtsmaske. Und Anatoli“, sagte die Lippen-, Lid- und Nasenlose, der Mann ohne Beine, dessen Unterleib auf dem Rollwägelchen festgeschnallt war, hielt Lena erneut seine Hände entgegen, „Anatoli könnte ohne weiteres in derselben Abteilung auf einem Spezialstuhl sitzen und ebenfalls seine Arbeit zum Wohle des Volkes verrichten. Man hat uns zu Ungeziefer degradiert. Aber wir sind kein Ungeziefer, sondern Verunglückte, deren Herz für die Revolution genau so stark schlägt wie das Ihrige ...“
Lena konnte den Blick in das verstümmelte Gesicht nicht länger ertragen. Vergebens sah sie sich nach Satinajew um, der nun, abgewandt, die Hände auf dem Rücken, eine interessante Bewegung am Himmel zu studieren schien. Und dem habe ich einen Rubel gegeben? fuhr es Lena durch den Sinn, einen Rubel dafür, daß er mich hier teilnahmslos stehen läßt? Na, warte, Bürschchen, dachte sie, du wirst was von mir zu hören kriegen.
„ … Das Schicksal hat uns gedemütigt“, fuhr die Lippen- Lid- und Nasenlose fort, als Lena ihren Blick wieder auf sie richtete, „aber es hat uns nicht untergekriegt. Anatoli“, der Mann ohne Beine, dessen Unterleib auf dem Rollwägelchen festgeschnallt war, zeigte Lena seine Hände, „ist kein illegaler Bombenhersteller geworden, obwohl er einer der gesuchtesten Sprengmeister der Roten Narewarmee war. Und ich bin keine Prostituierte geworden ...“ Sie machte eine kleine Pause, als wolle sie die Wirkung ihrer Worte in Lenas Gesicht ablesen, „ja“, sagte sie aggressiv, „lachen Sie nur ...“
„Ich habe nicht gelacht“, verteidigte sich Lena, die eher erschrocken als amüsiert war von den Worten der Verunstalteten.
„Ich weiß, daß Sie innerlich lachen“, sagte die Frau, „das beweist aber nur Ihre geringe Kenntnis der menschlichen Natur. Ich bin mit meinem Gesicht hier die Umschwärmteste von allen. Ich könnte Tausende verdienen bei perversen Ausländern, die sich an meinem Gesicht aufgeilen. Aber ich tus nicht. Ich bin Bolschewikin. Einem Genossen gebe ich mich freiwillig und umsonst hin, aber keinem Volksfeind und Ausbeuter, und mag er noch so reich sein und mir den Himmel auf Erden versprechen.“
Glutrot ging die Sonne unter und legte sich über die Türme und Paläste des Kreml und des Roten Platzes wie eine Gloriole, als Lena, geführt von Satinajew, den Chitrowski Markt verließ.
„Sie haben mich mit dieser Frau alleingelassen“, fuhr Lena den Dichter an, „Sie haben sich wie ein Unbeteiligter verhalten, obwohl ich Sie bezahlt habe.“
„Hier!“ sagte Satinajew, er zog den Rubelschein aus der Brusttasche seines fadenscheinigen Anzugs, „hier haben Sie Ihr Geld.“
„Unterstehen Sie sich!“
„Was soll ich mit einer solchen Summe anstellen? Jedem, dem ich den Schein auf den Tisch lege, wird vermuten, ich hätte ihn gestohlen!“
„Führen Sie sich nicht auf wie ein Kleinkind! Wer war die Frau?“
„Sofija Nikolajewna Burgina“, sagte Satinajew mürrisch, indem er den Geldschein wieder wegsteckte.
„Sie betonen den Namen so sonderbar.“
„Sie kennen ihn nicht?“
„Muß man ihn kennen?“
„Aber Sie kennen sicher den Namen des Genetikers Burgin.“
„Burgin?“, sagte Lena erschrocken, „was hat diese Frau mit Akademiker Burgin zu tun?“
„Sie war seine Frau.“
„Sie war die Frau des Akademikers Burgin?“, sagte Lena langsam wie in Trance, „sie war die Frau des Mannes, der im vergangenen Jahr wegen Sabotage erschossen wurde?“
„Ja“, sagte Satinajew, „so ist es.“
Lena wußte Bescheid. Jeder in der Sowjetunion wußte Bescheid, mochte er in Kirgisien leben oder am Tschirachtschai. Lena wußte Bescheid und erinnerte sich. Die Berichte in den letzten Jahren über Burgin in der Zeitung hatten sie erschüttert, ein Name, der wie Wawilows oder Lyssenkos 1936 in aller Munde war. Es ging, wie sie wußte, um den merkwürdigen Streit in der Biologie über die Vererbbarkeit anerzogener Eigenschaften, an dem die ganze Nation teilgenommen hatte, obwohl nur wenige etwas davon verstanden. Auf dem Höhepunkt der Auseinandersetzungen, die mit politischen Verdächtigungen und persönlichen Beleidigungen geführt wurden, hatte es den ersten Toten gegeben, Akademiemitglied Burgin.
Wie alle im Volke, die nichts von Genetik verstanden, hatte sich Lena instinktiv auf der Seite derjenigen gestellt, die von der Vererbbarkeit anerzogener Eigenschaften träumten: Wenn es möglich war, den neuen, den sozialistischen Menschen zu schaffen, indem man ihm alle negativen Eigenschaften nahm, die ihm in Jahrtausenden von tierischen Zustandsformen bei der Menschwerdung anerzogen worden waren, müßte es auch möglich sein, Reis und Hirse so zu erziehen, daß sie in unwirtlichen Gebieten zu reichen Ernten führten, ein Nahrungsmittel-Überfluß ungeheuerlichen Ausmaßes wäre die Folge ... Lena glaubte fest daran.
Aber Leute wie Burgin hatten nicht nachgelassen, das Gegenteil zu beweisen: Hungersnöte würden ausbrechen, die Menschen würden beginnen, sich selbst aufzufressen. Scheußlich, dieser Kerl mit seinen inhumanen Prophezeitungen! Und als die Hungersnot tatsächlich ausbrach, als hätte er sie herbeigeredet, hatte jedermann im Volke gewußt, wer Schuld daran war. Volksfeind Burgin! Kopf ab! hieß es auf den Leserbriefseiten in den Zeitungen.
Es war die Zeit, als jedermann im Volke sich berufen fühlte, an Angelegenheiten des Staates und der Gesellschaft teilzunehmen und seine persönliche Meinung darzulegen, ein Triumph der Demokratie, wie Lena sie verstand. Aber Lena hatte auch Respekt vor dem Mann und seinem: Hier stehe ich, ich kann nicht anders, Gott helfe mir, amen! Sie spürte, daß Satinajew sie von der Seite betrachtete, spöttisch, wie sie mit kurzem Blick feststellte.
„Und was ist der Frau mit ihrem Gesicht passiert?“ fragte sie.
„Das Haus, in dem sie wohnte, brannte kurz nach der Hinrichtung ihres Mannes ab, sie konnte nur das nackte Leben retten, und nun glaube ich“, sagte Satinajew lächelnd, „habe ich Ihnen genug Stoff zum Nachdenken gegeben ....“
Vergessen war der Auftrag, im Lehrinstitut für Zivilingenieure nach dem Rechten zu sehen. Sie war schon wieder halb auf dem Pokrowskij Bulwar, sah schon die Lichter des Hauses der Rasturgujews, das sie wie einen Leuchtturm in stürmischer See begrüßte, als sie plötzlich stehenblieb. Aus den Tiefen des Pokrowskij Bulwars erscholl ein Chorgesang, der ihr in Mark und Bein schnitt. Es war Stalins Lieblingslied:
„Wetschernij swonn“, hallte es von weit und in getragenem Tonfall durch die beginnende Nacht, die ersten blassen Sterne waren schon zu sehen, danach aber kam nicht wie üblich das Bomm ..., Bomm ..., Bomm ..., sondern ein Geknatter aus Maschinengewehren: rattattattatta ..., rattattattatta ..., rattattattatta ... Erst, nachdem auch die Wiederholung des ersten Verses mit Geknatter verklungen war und nachdem Lena sich orientiert hatte über die Richtung, aus der die Salven kamen, fiel ihr ein, daß vielleicht die Insassen der Dscherschinskij-Kaserne zwischen Dreifaltigkeitskirche und Christi-Auferstehungs-Kathedrale etwas zu feiern hatten, den Jahrestag der Revolution vielleicht, dem zu Ehren sie übten? Auch die nächsten beiden Verse des von Stalin so sehr geliebten Liedes wurden von Geknatter aus Maschinengewehren begleitet: „Kak mnogo dum“, rattattattatta ..., rattattattatta ..., rattattattatta ...„na wadschit on“, rattattattatta ...., rattattattatta ..., rattattattatta ...
Es wurde eine sternklare Nacht. Auf dem Weg nach Hause, wie immer zu Fuß, sah sie hoch oben die fernen Lichter auf den Sperlingsbergen jenseits der Moskwa. Heute erheben sich dort in Marmor und weißem Sandstein, in einem Stil, der an asiatische Tempelbauten erinnert, nur höher, nur ausladender, nur massiger, die Türme und Kastelle der Lomonossow-Universität. 1936 gehörten die Lichter zu Irrenanstalt und Fußballstadion.
Flackernd spiegelten sich die erleuchteten Mauern des Kreml in den ruhig dahinziehenden dunklen Wassern des Flusses, der dieser Kapitale ihren Namen gegeben hat. Lena liebte diese Stadt über alles. Sie liebte diese Stadt, weil sie vor neun Jahren hier Asyl gefunden hatte, nachdem sie Hals über Kopf aus dem arbeitslosen Deutschland ins Vaterland der Werktätigen geflohen war. Den Ausdruck Vaterland der Werktätigen gebrauchte sie aus vollem dankbarem Herzen. Trotzdem fühlte sie sich in letzter Zeit so eingeengt, daß es ihr fast das Herz abschnürte.
Die Moskwa mündet in die Oka ... hatte sich Lena getröstet, die Oka rauscht in die Wolga, die Wolga fällt ins Kaspische Meer, dessen südliches Ufer bis nach Persien reicht, bis nach Persien! Mit zahlreichen Kanälen ist Moskau auch mit den Weltmeeren verbunden ... Nein-nein, dachte sie dann in manchmal aufsteigender Hoffnung, man war nicht abgeschnitten von aller Welt, wenn man in Moskau lebte, nein-nein, nein-nein, nein-nein.
Freunde
1936, dem Jahr, in dem meine Erzählung beginnt, lebte Lena nun schon neun Jahre in Moskau, war im Rang einer Genossin Oberleutnant Dozentin an der Militärakademie geworden, wo sie Deutsch unterrichtete. Den guten Ruf, den sie bei den angehenden Obersten und Generalen genoß, verdankte sie ihrer Findigkeit beim Ausknobeln neuer Methoden des Unterrichts. Großen Erfolg hatte sie, wenn sie versuchte, den ihr anvertrauten Offizieren Grammatik, Orthografie und Vokabeln mit Hilfe deutscher Volks- und Kunstlieder beizubringen. Sie hatte ein Buch zu dem Thema veröffentlicht mit dem Titel: ‘Wir singen und lernen deutsch dabei’. Ihr ganzes Repertoire an Liedern hatte sie mit nach Moskau gebracht, angefangen von Im schönsten Wiesengrunde bis zum Lied von der Erde von Mahler. Wenn sie mit ihrer klaren Stimme, die mal sanft, mal schneidend klang, die Melodien vorsang, saßen die hochrangig uniformierten Männer mit den Händen auf den Schenkeln da und lauschten gebannt. Allerdings war ihr anfangs übel geworden, als die zukünftigen Truppenführer: Reicht mir in der Todesstunde ..., ein Lied aus dem Repertoire der Berliner Arbeiterbühne, im Stil eines Donkosakenchors zu singen begannen. Das korrigierte sie umgehend mit wortreichen Standpauken ... Hier in Moskau hatte sie ihr Element gefunden.
Sie war nun vierzig ... Donnerwetter, wie die Jahre vergehen, man findet kaum Zeit, sich zu besinnen, ... hatte schlohweißes Haar, war klein und zart mit einem anmutigen Gesicht, aus dem die Reife einer geprüften Persönlichkeit sprach. Wenn sie sich in ihrer maßgeschneiderten Uniform auf der Straße zeigte, drehten sich manchmal Leute nach ihr um angesichts einer so reizenden, jugendlich wirkenden Person in Militärbluse, der das Haar weiß unter der Uniformmütze hervorquoll und sich breit über die Schultern ergoß. Sie war verheiratet, doch ohne Mann.
Das Unglaubliche war geschehen: Karcsi lebte mit einer anderen Frau zusammen, ausgerechnet mit der Siebenstern, die sich 1923 schon in Wien an ihn herangemacht hatte, als er und andere Überlebende der niedergeschlagenen Ungarischen Räterepublik in Baracke 23 des ehemaligen Grinzinger Seuchenhospitals Unterschlupf gefunden hatten. Damals hatte die Siebenstern ihr, Lena, weichen müssen. Doch nun hatte sie ihm in Moskau aufgelauert und galt als seine Sekretärin:
„Dieses häßliche Geschöpf mit spitzer Nase und breitem Kinn ...“ ereiferte sie sich, wenn sie sich bei Ervin beklagte.
„Wozu beschreibst du sie mir, ich kenne sie doch.“
„Und?“
„Was und?“
„Habe ich recht?“
„Nein, natürlich nicht, aber eine Frau in deiner Situation kann nicht anders reden.“
„ ...der die klobigen Schuhe, die sie trug, von den klapperdürren, schwarz behaarten Beinen wie Abfalleimer abstanden.“
„Jaja“, sagte Ervin, „jaja.“
Von Zeit zu Zeit trafen Lena und Karcsi sich heimlich, wenn sie nicht weiterwußte und Rat brauchte, politischen Rat, versteht sich, auf dem Gebiet war er besonders beschlagen.
„Auf dem Gebiet ist er besonders verschlagen“, sagte Ervin, wenn wieder einmal, zu seinem Unmut, Karcsi ihr Thema war.
Lenas Freundschaft mit Ervin war 1923 in Baracke 23 des ehemaligen Grinzinger Seuchenhospitals durch Karcsi zustande gekommen, Károly, wie in ordentlichem Ungarisch sein Vorname lautete, Károly Rubin. Immer wieder verblüffte sie der Gegensatz zwischen den Freunden. Längst waren sie zu politischen Gegnern geworden. Aber waren sie in ihrem Innersten nicht immer noch Freunde? Befreundet als Jugendgespielen und als Offiziere der Ungarischen Räterepublik?
Die Freunde sprachen selten von ihren Erlebnissen in den Revolutionsmonaten vom 21. März bis 1. August 1919. Aus Andeutungen und Erzählungen anderer, manchmal aus Zeitungsberichten hatte sich Lena mit der Zeit ein Bild machen können von dem, was damals geschehen war, als Ervin, der Skeptiker, einundzwanzig Jahre alt, Militärkommandant von Kecskemét war und Karcsi, ebenso alt, Divisionskommissar beim Sieg der Roten Armee über die königlich rumänische Armee bei Szolnok.
Es gab ein Foto aus jener Zeit, das zwei schmächtige Jünglinge in Badehosen zeigte, die sich übermütig wie Kinder gegenseitig mit Wasser spritzten. „Das Duo Infernal am Balaton“, stand handschriftlich darunter. Wenn sie das Foto ansah, konnte sie ein Lächeln nicht verkneifen. Was muß das für eine Armee gewesen sein, die solche Kinder zu Kommandanten und Kommissaren gemacht hatte?
Nun lebten die Freunde in derselben Stadt, und hatten keinen Kontakt zueinander. Karcsi, der sich in mehreren Sprachen auszudrücken verstand, war ins Sekretariat der Kommunistischen Internationale aufgestiegen, und Ervin, ein erfolgloser Schriftsteller, bereitete sich darauf vor, Moskau zu verlassen. Fünf Jahre hatte er vergeblich versucht, seinen Roman über die Ungarische Räterepublik herauszubringen, Romain Rolland hatte ihn Stalin persönlich empfohlen, doch stets hatte es geheißen, nein! es sei ein zum Roman aufgeblasenes defaitistisches Pamphlet, das dem Leser die Unmöglichkeit einer proletarischen Revolution plastisch vor Augen führe ...
In der Sucharewskaja hatte Lena einmal bei einem Einkaufsbummel, ohne Uniform natürlich, ein hübsches Kleid aus Musselin ergattern können. Als sie Karcsi davon erzählte, sagte er abweisend:
„Das ist Diebesgut. Man kauft nicht auf der Sucharewskaja.“
Als Ervin davon hörte, schnaubte er:
„Der hat gut reden. Er kauft in Regierungsläden. Wieso erzählst du ihm solche Dinge, die er nicht versteht und nie verstehen wird.“
Auf der Smolenskaja hatte sie preiswert eine hübsche Vase erworben, deren Herkunft ebenso ungewiß war.
„Gospodin, Gospodin“, rief sie in komischer Verzweiflung: „Wenn Karcsi das wüßte!“
„Ich kann diesen Namen nicht mehr hören“, sagte Ervin, „das nächste Mal wirst du die Klappe halten, wenn Typen wie Karcsi fragen, woher du deine kleinen Nettigkeiten beziehst.“
Das Leben in Rußland war ungewiß geworden in jenem Jahr.
Vor vier Monaten war Gorki gestorben. Lena hatte die Nachricht in der Straßenbahn aufgeschnappt. Eine schluchzende Frau war eingestiegen und hatte die Fahrgäste mit ihrem Kummer irritiert.
„Weshalb weinen Sie denn?“ fragte Lena.
„Gorki ist tot.“
Der Satz ging im Wagen von Mund zu Mund.
„Woher wollen Sie das wissen?“
„Es kam vorhin im Radio durch.“
Und als sich die Fahrgäste klar darüber wurden, daß an der Wahrheit der Nachricht nicht zu zweifeln war, hielt der Straßenbahnfahrer an und legte eine Gedenkminute ein. Gorki war tot. Ein nicht zu ersetzender Verlust war eingetreten.
„Und wer kriegt nun die Stelle?“, jammerte das armselige Weib, das bei der Vollkollektivierung vor vier, fünf Jahren heimatlos geworden am Rand der Smolenskaja stand und auf reinlichem weißem Tuch mit geklöppelter Umrandung Zwiebeln und Mohrrüben aus dem Hausgarten feilbot.
„Die Stelle“, sagte Lena, „wird wohl für immer offen bleiben.“
„Gorki war der einzige, dem Stalin vertraute“, antwortete das Weib, „nun sagt niemand mehr Stalin die Wahrheit.“
„Gorki“, sagte Ervin verächtlich, „dieser Schwadroneur“, und wandte sich ab.
Die eisernen Ringe, die sich Lena ums Herz legten, wurden immer enger.
Eine Weile später hieß es: Freiheitskämpfer! Meldet euch an die spanische Front, der Schakal marschiert auf Madrid. Mit Schakal war General Franco gemeint. Auch Lena hatte sich gemeldet. Sie wollte als Krankenschwester ins Feld ziehen, aber General Malischkin, der Chef der Militärakademie, verkündete:
„Die Rote Armee beteiligt sich nicht am Freiheitskampf der Spanier. Aber wer die Armee verläßt, kann sich freiwillig melden.“
Zwölf Offiziere der Militärakademie quittierten den Dienst und gingen nach Spanien an die Front. Es hatten sich noch mehr gemeldet, angenommen wurden aber nur zwölf. Lenas Gesuch, die Armee zu verlassen, wurde abgelehnt mit der Begründung: „Und wer bringt uns dann Deutsch bei?“
Lena war unabkömmlich 1936, denn mit dem Fach, für das sie zuständig war, verfolgte die Leitung des militärischen Abschirmdienstes einen ganz besonderen Plan. Die Deutschstämmigen unter den Kommandeuren mit Oberst Kuchelbeker an der Spitze waren die fleißigsten gewesen beim Erlernen des Deutschen, und da sie es in der schlesischen Sprachfärbung lernten, sprachen manche von ihnen es, als wären sie in Schlesien geboren. Sie hatten die Theorie entwickelt, sich nach Deutschland einschleusen zu lassen, um das Dritte Reich von innen zu zerstören. Wie es zu machen sei, darüber wurde heftig gestritten. Die einen sagten, sie, die nun ein Deutsch im einheimelnd schlesischen Klang sprachen, könnten ohne sprachlich aufzufallen, von Frankreich oder England aus nach Deutschland einwandern und Sabotage-Aufgaben übernehmen. Die anderen waren der Meinung, und zu ihnen gehörte Oberst Kuchelbeker, daß ihnen eine Schlüsselrolle zufiele, wenn sie mit dem verführten deutschen Arbeiter in ihrer Sprache und ihrem Jargon sprächen.
Als sie Ervin davon erzählte, schaute er Lena kopfschüttelnd an:
„Das sind keine Kommandeure, das sind Traumtänzer. Nach zwei Sätzen wird der deutsche Arbeiter sie der Gestapo ausliefern. Die können doch nicht im Ernst meinen, der deutsche Arbeiter sei von Hitler verführt worden. Hitler hat ihm Arbeit und Brot gegeben und dafür dankt der deutsche Arbeiter ihm. Dafür zieht der deutsche Arbeiter das Braunhemd der SA an. Die SA, das ist der deutsche Arbeiter.“
Dann fand der Prozeß gegen Sinowjew, Kamenjew und einem Dutzend anderer hoher Parteifunktionäre statt, der mit Todesurteilen gegen alle endete ... Nun war niemand mehr seines Lebens sicher ... Doch Stalin ließ in aller Öffentlichkeit die neue Verfassung des Landes diskutieren, die Redefreiheit, Pressefreiheit und Versammlungsfreiheit garantierte:
„Der arbeitenden Bevölkerung und ihren Organisationen“, verkündete Stalin und das ganze Land hing mit dem Ohr an den Radioapparaten, „der arbeitenden Bevölkerung und ihren Organisationen werden Druckerpressen, Papiervorräte, öffentliche Gebäude, Straßen, Verkehrsmittel und alle anderen wesentlichen Voraussetzungen zur Ausübung ihrer bürgerlichen Rechte zur Verfügung gestellt. Das Gesetz garantiere den Bürgern der UdSSR die Unverletzlichkeit der Person. Niemand dürfe in Haft gesetzt werden, außer durch Beschluß eines ordentlichen Gerichts. Die Unverletzlichkeit der Wohnstätte jedes Bürgers sowie das Briefgeheimnis seien durch Gesetz geschützt.“
„Es ist die demokratischste Verfassung der Welt“, jubelte im fernen Los Angeles der Schriftsteller Lion Feuchtwanger, der vor Hitler an die Pazifikküste geflohen war, ein Wort, das die hiesigen Zeitungen in Millionenauflage nachdruckten. Lena las es gierig.
„Ein solches Wunderwerk wie die stalinsche Verfassung“, memorierte sie die Worte des weit entfernt lebenden Dichters, „hat es noch nie und nirgends gegeben.“
„Aber wo soll sie gelten?“ fragte Ervin spöttisch, „hier in Moskau etwa? Moskau ist eine Stadt mit sieben Leben, die Übergänge sind fließend, und ich habe in keinem ihrer irrwitzigen Leben Anzeichen vom Wirken einer neuen Verfassung gespürt.“
Lena hatte an den Fingern abgezählt, was er mit sieben Leben gemeint haben könnte und kam nicht dahinter. Weshalb sieben? Sie begriff es nicht. Was sie herausbekam, waren entweder mehr oder es waren weniger als sieben Leben. Wahrscheinlich redete er wieder einmal in seinen schwer zu durchschauenden Metaphern.
Was hielt ihn noch in Moskau? Er hatte seinen ungarischen Paß behalten und stand schon mit einem Fuß in Paris. Er konnte sich nun alles erlauben. Adieu, Ervin, adieu, mein Freund, dachte sie, wer weiß, wann wir uns wiedersehn. Es hatte schon viele Abschiede in ihren bisher vierzig Lebensjahren gegeben. Auch dieser Abschied, der nun bevorstand, ging ihr zu Herzen. Sie wußte, Ervin würde nicht bleiben in Paris. Sein Ziel war Madrid und die Internationalen Brigaden. Das durfte in Moskau aber nicht bekanntwerden. Sie gehörte zu den Wenigen, denen er sich anvertraut hatte. Aber wozu diese Geheimniskrämerei?
„Ich will nicht unter sowjetischem Befehl kämpfen. Ich traue den Politkommissaren nicht.“
„Du warst selbst Politkommissar.“
„Ich war Kampfkommandeur“, sagte Ervin und hob stolz das Kinn, „Politkommissar war Karcsi, und das war unter einem anderen Stern.“
„Es war unter dem roten Stern der ungarischen Räterepublik.“
„Eben“, sagte Ervin, „genau das wollte ich damit ausdrücken.“
Als der Prozeß gegen vier der höchsten Parteiführer mit dem Todesurteil gegen sie und dem Dutzend Mitverschwörer endete, glaubte Lena, nicht weiterzukönnen. Sie empfand sich plötzlich wie ein Mensch ohne Bindungen. Wenn so ehrenwerte Führer sich als Verräter entpuppten, wem war dann noch zu trauen? Auch Radek dann nicht, Karl Bernardowitsch, den sie als Volksredner liebte und verehrte. Keiner verstand es wie er, unpopuläre Maßnahmen der Regierung in volkstümlicher Sprache so vorzubringen, daß sie plötzlich einen vaterländischen Sinn erhielten. Mit ihm und dem bereits erschossenen Kamenjew hatte sie an der Bahre Clara Zetkins Totenwache gehalten, für sie eine Ehre ohnegleichen. Radek würde wohl einen eigenen Prozeß kriegen. Aus der Partei ausgeschlossen war er schon. Jetzt saß er in der Lubjanka, dem Staatssicherheitsgefängnis, und wartete auf den Staatsanwalt.
Natürlich in der Lubjanka. Sie selbst, Lena, käme dort nie hinein. Die Lubjanka war für die höheren Genossen bestimmt. Auf sie wartete, wenn es darauf ankäme, bestenfalls die Butyrka, das Gefängnis für Kriminelle und niedrigere Staatsverbrecher.
„Butyrka! Butyrka!“ rief Ervin entrüstet, „du siehst Gespenster. Du bist nicht wichtig genug, um in die Butyrka zu kommen. Was willst du denn da? Die Butyrka ist etwas für Verbrecher. Du gehörst in die Universitätsbibliothek und nicht in den Knast. In den Knast kommen Leute mit Einfluß und von Bedeutung. Bilde dir bloß keine Schwachheiten ein.“
In der Pokrowskij-Kathedrale, las sie in der Zeitung, war ein Mann festgenommen worden. Gläubige hatten beobachtet, wie er sich mit zwei Fingern bekreuzigte. Während die Gemeinde sich ins Gebet vertiefte, war er nach vorn geschlurft und hatte mit zwei Fingern demonstrativ das Kreuz geschlagen. Unter den Gläubigen entstand Gemurre, das sich zu lauten Beschimpfungen steigerte. Beherzte Männer schoben sich aus den Reihen des Gestühls, eilten zu dem Kerl hin, um ihn zur Rede zu stellen, der immer noch vorn stand und sich erneut mit zwei Fingern bekreuzigte.
Während der Pope die Gnade des Herrn auf den Gotteslästerer herabflehte, eilten andere ihm zu Hilfe, und umringten ihn zu seinem Schutz. Als die Miliz eintraf, hatten die Uniformierten Mühe, zu dem Altgläubigen vorzudringen. Bei der Festnahme wehrte er sich, und erst als Verstärkung eintraf, konnten er und die wenigen Gleichgesonnenen überwältigt werden. Für die Altgläubigen des zaristischen Adels, stand anderntags in der Zeitung, sei im neuen Rußland kein Platz. Lena las den Bericht mit versteinter Miene.
Die Altgläubigen, Staroobrjadtschestwo nach russischem Sprachgebrauch, das wußte man doch, gab es vor allem unter den Bauern. Bei den Adligen wurde es Ende des vergangenen Jahrhunderts lediglich Mode, sich an Wladimir den Heiligen und die Zeit der ersten Taufe der heidnischen Rus vor tausend Jahren zu erinnern. Es galt als elegant, sich mit zwei Fingern zu bekreuzigen. Die Aristokratia tat es aus Übermut, tat es, um sich demonstrativ von der Religion des Zaren abzusetzen, der Anstalten machte, die Leibeigenschaft zu mildern.
Sich mit zwei Fingern zu bekreuzigen und den Namen des Gekreuzigten wie Ïisus auszusprechen, war schon immer gefährlich gewesen und hatte vor dreihundert Jahren zu Folter und Scheiterhaufen geführt. Lena begriff nicht den Tumult um die Altritualisten. Aber andererseits, warum konnte der Kerl zum Bekreuzigen nicht drei Finger nehmen wie ordentliche Orthodoxe? Sie war hin und her gerissen wie immer.
Gerüchte über einen zerschlagenen Staatsstreich gingen um. Von schwarzen Limousinen war die Rede. Sie selbst hatte eines Nachts ein solches Fahrzeug in hohem Tempo durch die Stadt kurven sehen. Tagsüber hatten sich die geschlossenen Lieferwagen, auf deren Seitenflächen in mehreren Sprachen das Wort Brot stand, in beängstigender Weise vermehrt. Jeder in der Stadt wußte, daß in ihnen nicht Lebensmittel, sondern Gefangene transportiert wurden. Aber weshalb dann das Versteckspiel und ausgerechnet mit Brot, das knapp war im ganzen Land und nach dem sie manchmal stundenlang anstehen mußte.
Eines Tages hieß es, Oberst Kuchelbeker sei ermordet. Drei seiner engsten Freunde wurden der Tat verdächtigt und zwei Tage später standrechtlich erschossen. Unmittelbar danach hatte sich die Parteigruppe an der Militärakademie aufgelöst und der Lehrkörper wurde drastisch reduziert. Auch sie war entlassen worden, war nun nicht mehr Dozentin, sondern einfache Lehrerin. Auch der Titel Oberleutnant war ihr aberkannt worden, der ihr als Militärangehörigen zustand. Daß sie sang- und klanglos zurückgestuft worden war, kränkte sie. Sie hatte sich schon auf ein Leben im Dienst der Roten Armee eingestellt, der sie treu dienen wollte.
Oberst Kuchelbeker hatte zu ihren Schülern gehört. Sie konnte sich gut an seinen weichen Bariton erinnern, wenn er Im schönsten Wiesengrunde sang. Lena ließ sich nicht irremachen in ihrer Theorie, daß die Pläne, die an der Militärakademie geschmiedet wurden, verraten waren und daß der Tod des Obersten von Berlin gesteuert war. Es gab aber auch den Verdacht, daß er sich aus Verzweiflung über den Zustand der Roten Armee selbst die Kugel gegeben habe.
Wer an Selbstmord glaubte, behielt seine Meinung für sich und bemühte sich, darauf angesprochen, den Mord zu verurteilen und der Hinrichtung der Rädelsführer zuzustimmen. Unverzüglich hatte auch sie zugestimmt, als General Malischkin sein rechtes Auge auf sie richtete, denn in dieser Frage gab es kein Zaudern. In dieser Frage wie in vielen anderen damals gab es auch keine Freunde, gab es weder Bruder noch Schwester. Seit dem Bürgerkrieg trug General Malischkin über der Narbe links eine schwarze Augenklappe, die sich im Laufe der Zeit zu einem schmutzigen Grau verfärbt hatte.
In der Chinastadt, las sie in der Zeitung, dem Wohn- und Verwaltungsviertel im Zentrum Moskaus, das sich östlich des Kreml dem Roten Platz und der Basiliuskathedrale anschließt, wurde der vierzehnjährige Oleg Tamakow mit dem Orden Held der Arbeit ausgezeichnet, weil er dem Staatssicherheitsdienst gemeldet hatte, seine Eltern hätten die Hinrichtung der geständigen Verräter Sinowjew und Kamenjew als ein Verbrechen bezeichnet. Die Zeitungen brachten den Bericht über den Jungen auf der ersten Seite mit Foto, als Beispiel für die vorbildliche Tat eines außergewöhnlichen Menschen. Lena versuchte in den Zügen des Abgebildeten zu lesen. Es war ein ernstes Kindergesicht, hell, sympatisch und treuherzig.
Sie las den Bericht mehrmals, versuchte geduldig dahinter zu kommen, was manchmal nur angedeutet war, doch auch zwischen den Zeilen fand sie keinen Hinweis auf Meinungsfreiheit und Unverletzlichkeit der Person, wie die künftige stalinsche Verfassung es postulierte. Sie erfuhr von den Bemühungen des jugendlichen Denunzianten, als neu ernannter Straßenvertrauensmann, Ordnung in die chaotischen Beziehungen der Bürger zueinander zu bringen. Das war auch nötig, denn die Gesetzlosen in der Stadt waren schon zur Bedrohung der ordentlichen Bürger geworden. Den Eltern, die dem Urteil eines Sondergerichts zufolge schwere Strafen abbüßten, rief der Sohn im Zeitungsinterview zu: Bessert euch! Und kehrt als Geläuterte in die Gesellschaft zurück!
Lena hatte Mitleid mit den Verurteilten, die nun, wer weiß wo, dahinvegetierten. Sie hatte keine Vorstellung davon, wo das sein könnte, und das beunruhigte sie.
Ervin hatte sie hinaus in den Park gezogen. Nachdem er sich vergewissert hatte, daß niemand in der Nähe war, sagte er:
„Noch zwei Wochen, dann fahre ich.“
„Ja, du mit deinem ungarischen Paß. Und wenn sie dich an Horthy ausliefern?“
Einen Moment stutzte er. Alle Kommunisten, deren Admiral Horthy von Nagybánya, der Sieger über die Ungarische Räterepublik, habhaft wurde, waren erschossen worden. Dann lachte er:
„Das wäre fatal, in der Tat, aber das tun die nicht. Die haben ja Gottseidank keine Grenze mit Ungarn.“
„DIE“ rief sie zornig, „bist du schon so verroht, daß du deine Genossen die nennst? Oder wen meinst du, wenn du DIE sagst?
„DIE“, sagte Ervin, „das sind die Elfenreigen auf morgendlichen Wiesen, DIE, das sind Rotkäppchen und die Großmutter ohne den Wolf und die, das sind die Pfeifenrauchringe aus dem Knasterkocher des allersanftesten Vaters der Werktätigen.“
„Verdammt noch mal“, rief sie, „kannst du nicht ein einziges Mal deine trotzkistischen Sticheleien lassen?“
Das Wort trotzkistisch hatte sie, wie es allgemein üblich war damals, gewohnheitsmäßig ausgesprochen, ohne genau zu wissen, was es bedeutete. Niemand im weiten Land hatte eine genaue Vorstellung von dem Wort, das zu einem Schreckensruf geworden war. Mal wurde es genutzt, um Parteimitglieder zu Abtrünnigen zu stempeln, mal wurde es genutzt, um eine besonders niederträchtige Art von Vaterlandsverrat zu brandmarken.
Schwach hatte sie die Vorstellung, daß Trotzki die Möglichkeit bestritt, allein im industriell unentwickelten Rußland den Sozialismus einzuführen. Nach Trotzkis Meinung könne der Sozialismus nur in einem industriell hochentwickelten Land beginnen, Deutschland zum Beispiel, um sich wie ein Buschfeuer über den Erdball auszudehnen. So ungefähr hatte sie es verschwommenen Zeitungsberichten entnommen, die sie wie die Chiffren einer Geheimschrift zu entschlüsseln versuchte.
In den oft seitenlangen Beschimpfungen Trotzkis fand sie keinerlei sachliche Auskünfte über das Wesen seiner Anschauungen. Schriften von ihm, die sie in Bibliotheken suchte, waren aus den Regalen verschwunden. In Büchern, die ihn zitierten, waren die entsprechenden Absätze geschwärzt. Sie hatte die Seiten gegen Licht gehalten, um vielleicht doch etwas zu entziffern. Vergebens. Die schwarze Tinte war undurchdringlich.
Aber der Mann war ein Mitkämpfer Lenins gewesen, er hatte der Revolution als Außenminister und Kriegskommissar gedient und den Aufstand der Kronstädter Konterrevolutionäre niedergeschlagen. Und plötzlich sollte er zu einem Verräter geworden sein? Konnte man das glauben? Wie, wenn es sich um einen grotesken Irrtum handelte? Aber weshalb gewährten ihm dann die Regierungen kapitalistischer Länder bereitwillig Asyl, anstatt ihn als ihren Todfeind von Land zu Land zu hetzen?
„Ich bin kein Trotzkist“, antwortete Ervin ernst, „sondern ein Versöhnler.“
Auch bei diesem Wort verstand sie nicht, daß Menschen, die sich dazu bekannten, Volksfeinde seien und ausgerottet werden müßten. War sie nicht auch eine Versöhnlerin, wenn sie sich bemühte, in Diskussionen einen goldenen Mittelweg zu suchen, anstatt unversöhnlich in Worten aufeinander loszugehen? Und wieso gestand Ervin ihr, ein Versöhnler zu sein. Nichts zwang ihn dazu. Was bezweckte er damit? So weit also ist es mit uns gekommen, daß ich schon meinen engsten Freunden mißtraue.
„Dem Henker ist es egal,“ sagte er, „wem er den Genickschuß verpaßt, aber mir ist es nicht egal, wenn man mich mit dem falschen Titel anredet.“
„Du plapperst zu viel“, sagte sie, „Du solltest vorsichtiger sein in der Auswahl deiner Gesprächspartner. Weißt du nicht, wer ich bin?“
„Ich weiß“, sagte er, „ ich weiß. Du bist eine Gläubige, die besser in die Kirche gehen sollte als zu Parteiversammlungen; Leute wie du sind verblendet, aber sie denunzieren nicht.“
„Wenn du dich nur nicht täuschst“, sagte sie.
„Du bist ein unschuldiger Mensch, der gewarnt werden muß, und ich bitte dich, laß dich von mir warnen: verlaß dieses Land.“
„Das geht nicht“, sagte sie.
„Wieso sollte es nicht gehen? Du bist Deutsche mit deutschem Paß.“
„Soll ich vielleicht zu Hitler überlaufen?“
„Im Zug nach Deutschland könntest du in Warschau aussteigen.“
„Und dann?“
„Über die Tschechoslowakei nach Frankreich. Du könntest wie ich zu den Internationalen Brigaden gehen, als Krankenschwester, das wolltest du doch.“
„Ich kann nicht.“
„Lena.“
„Ja?“
„Komm mit mir, oder komme nach. Ich würde dir helfen. Du müßtest nur wollen. Wie lange sind wir nun schon Freunde?“
„Dreizehn Jahre?“
„Dreizehn Jahre. Ich habe nie begriffen, wieso du einen Kerl wie Karcsi heiraten konntest.“
„Es war kein anderer Bewerber da“, versuchte sie zu scherzen.
„Ich war immer da“, sagte Ervin, „aber egal. Jetzt hat Karcsi dich sitzenlassen. Komm jetzt mit mir, und wir fangen beide ein neues Leben an.“
„In den Internationalen Brigaden?“
„Wo du willst. Wir müssen nicht in den Tod gehen wollen, um uns von Stalin zu befreien. Wir können auch das Leben wählen, so frei wären wir dann.“
„Ist das nun eine Liebeserklärung oder was?“
„Es ist eine Liebeserklärung, um es mal ganz deutlich zu sagen.“
„Sie kommt aber zu spät.“
„Ich habe dich immer haben wollen.“
„Eine weißhaarige Alte.“
„Lena, du weißt, daß wir zueinander gehören, du weißt das schon lange. Ich mache mir den Vorwurf, daß ich dich nicht schon längst über Karcsi aufgeklärt habe. Deine Hochzeit mit ihm war die reinste Kolportage. So wie ihr heiratet man nicht. Mache jetzt einen Strich unter die lächerliche Vergangenheit und komm mit.“
„Ich bin Sowjetbürgerin.“
„Was?“
„Ja, ich bin Sowjetbürgerin. Endlich. Ich habe lange darauf gewartet, und jetzt hat die Partei zugestimmt.“
„Seit wann?“
„Seit einer Woche.“
„Karcsi hat dir dazu geraten“, rief er, „an allem ist Karcsi schuld.“
„Nein, ich sehe ihn kaum, ich selbst habe mir dazu geraten.“
„Mein Gott“, sagte er nach kleiner Bedenkpause, als er die Aussichtslosigkeit ihrer Situation einsah, „was hast du getan? Du bist verloren.“
„Ach“, sagte sie, „mit einem Mal? Ich denke, du hältst mich für eine Gespensterseherin.“
„Ich meinte“, sagte Ervin verlegen, „jetzt stehst du ohne Schutz da. Bisher war der deutsche Paß dein Schutz. Der wird dir jetzt fehlen.“
„Wenn du Moskau verläßt“, sagte sie leise, „wenn du im Westen bist, Ervin, bitte, bring uns nicht in Schande.“
„Wie meinst du das?“
„Erzähle nicht, wie es wirklich um uns steht in Moskau.“
Er sah sie mit großen Augen an und schüttelte den Kopf, als könne er nicht fassen, was er eben gehört hatte.
Stalins Antlitz
Vor Ausländerhotels hatte Bettlerkönig Alvare seine Drücker ausschwärmen lassen, jeder mit einem Sortiment Flöhen versehen.
„Eine kleine Gabe, Hochwohlgeboren, zehn Rubelchen nur, Durchlaucht, und ich werde den Floh, den ich in der Hand halte, nicht in Ihren Pelz setzen.“
Natürlich zahlten die Ausländer rasch und bereitwillig und beschwerten sich hinterher beim Hoteldirektor. Es wurden strengste Strafen verheißen. Doch alles blieb beim Alten, und Lena wunderte sich: Wer war Bettlerkönig Alvare? Und wer von verantwortlichen Funktionären stand auf seinen Lohnlisten? Oh, oh, oh, wenn Stalin doch nur wüßte, was geschieht in seinem Land. Aber wie es ihm mitteilen, ohne selbst von seinen Feinden zermalmt zu werden?
Wodkasäufer, beobachtete sie, die nicht genug Geld hatten für eine ganze Flasche, umlungerten die Schnapsläden, die Hand in der Knopfleiste der Jacke, wobei sie einen oder zwei Finger sehen ließen. War ein Finger zu sehen, so hieß das: Ich suche noch einen Mann zum Kauf einer Flasche, waren zwei Finger zu sehen, so hieß es: Ich suche noch zwei Mann. Hatten die Mitsäufer zueinandergefunden, verdrückten sie sich in den nächsten Hausflur und gluck-gluck-gluck - eine Daumenbreite, gluck-gluck-gluck - die zweite Daumenbreite, gluck-gluck-gluck - die dritte Daumenbreite, kurz noch den Boden ausgekratzt, Flasche in den Rinnstein: Klirr! Ja, es gab viel zu sehen und zu beobachten in Moskau damals und viel nachzudenken über das Gesehene und Erlebte.
Kudratkin stand im Alexandergarten auf einer ausgedienten Munitionskiste und hielt Vorträge. Stolz verkündete er seinen Namen: „Ich bin der Sprengkommandeur Genosse Jewgeni Wsewolodowitsch Kudratkin!“ Mit gewaltiger Stimme, die buschigen Augenbrauen zusammengezogen, legte er der schaudernden Menge dar, wie er in Tobolsk, Ischim, Tabda und Omsk Kirchen gesprengt hatte, neunundzwanzig an der Zahl. Er konnte fotografisches Material vorweisen: Die Maria Verkündigungskirche in Tobolsk zum Beispiel davor und danach. Klimperte auch mit den Orden an der Brust seiner abgetragenen Sergeanten-Uniform. Nach drei Tagen war er verschwunden. Niemand suchte nach ihm. Nur der Schauder des Grauens blieb bei Rechtgläubigen noch lange, wenn sie an Tobolsk, Ischim, Tabda und Omsk dachten, als ob Tobolsk, Ischim, Tabda und Omsk die einzigen Orte gewesen wären, in denen Kirchen gesprengt worden waren.
Versteint hatte Lena den Diskussionen in der Militärakademie gelauscht, bei denen es manchmal oberflächlich nur um Wortnuancen ging, in Wirklichkeit um Tod und Leben. Sie selbst meldete sich selten zu Wort, und wenn sie sich erhob, um zu sprechen, wurde es still im Saal. Sie gehörte zu den wenigen Dozenten und Professoren, die mäßigend in die Diskussion eingriffen, was ihr als Prinzipienlosigkeit und Duckmäusertum ausgelegt worden war. Weil sie nicht unverzüglich, ohne groß nachzudenken, lautstark und parteilich aufgetreten war, vor allem deswegen war sie entlassen worden. War nun Lehrerin am Technischen Institut Nr. 73 und Mitglied einer ganz anderen Parteigruppe.
Sie hatte gehofft, in einem nicht so exponierten Kreis außerhalb des Militärbereichs ein angenehmeres Klima zu finden, eins, das nicht so stark geprägt war vom Haß der Genossen aufeinander. Doch auch hier versteinte sie mehr und mehr, kaum, daß sie begonnen hatte zuzuhören. Wieder saß sie versteint am Tisch und mußte sich stundenlange gegenseitige Anschuldigungen anhören, von denen sie wenig verstand, da sie die Gesichter der neuen Genossen noch nicht auseinanderhalten konnte. Nur, wenn einer der neuen Genossen aufsprang und auf seinen Widersacher losging, begriff sie:
„Du Schuft! Du Verräter! Gebt mir einen Revolver, ich erschieße den Hund auf der Stelle!“
Diese Sprache kannte sie von der Militärakademie. Viele ihrer dortigen Freunde waren schon erschossen worden. Sie war heil davongekommen, unerklärlicherweise.
Manchmal, wenn sie zufällig über den Roten Platz lief, oder wenn sie absichtlich einen Umweg machte, schaute sie zu dem Fenster des Kremlpalastes hinauf, von dem es hieß, daß hinter ihm Stalin sitze und arbeite, und sie wünschte, er möge einmal zusammen mit ihr durch seine Stadt spazieren. Sie würde dann mit dem Finger auf die Stätten des Elends und des Lasters zeigen. Er würde seine Pfeife aus dem Mund nehmen und sagen:
„Das habe ich nicht gewußt, Lena, charoscho, nun hast du es mir gesagt, und nun werden wir es ändern.“
Wie die vielen andern zahllosen Ungefragten im Lande hoffte auch sie auf Stalin sehr. Wie die vielen anderen Stummen und Verstummten im Lande hätte auch sie vieles Stalin erzählen wollen. Stunden- und tagelang hätte sie wie die vielen anderen Trauernden und Hoffenden Stalin von den Zweifeln, von den Sorgen, von der Not im Lande berichten wollen, und wie viele andere im Lande war sie gewiß, daß er ein offenes Ohr für sie haben würde.
Er aber saß, die Nächte durchgrübelnd, hinter seinem gardinenlosen Fenster an seinem schlichten Schreibtisch und arbeitete. Man kannte von Bildern in Zeitungen das Zimmer mit dem spartanischen Feldbett im Hintergrund. Rastlos verdarb er sich die Augen beim Schreiben, vertieft in staatsmännischen Schriften, beim Lesen der Nachrichten aus allen Teilen seines gewaltigen Reiches, beim Tüfteln und Regieren unter der funzligen Tischbeleuchtung, die zum Glück keine Petroleumlampe war, wie in vielen anderen Wohnungen der Stadt, sondern elektrisches Licht, das auch sie, Lena, schon hatte.
Kürzlich hatte sie in der Zeitung der Eisenbahner ein humoristisches Gedicht gelesen, das ihr sehr gefiel:
Eh, wird Stalin sagen und am Barte drehn,
achtmal sechs ist neunundzwanzig,
unsre Butter wird nie ranzig,
guten Stahl gibt unser Vieh,
Korn und Milch die Industrie,
alles, was du brauchst zum Leben,
wird uns die Gewerkschaft geben,
Kascha, Kwas und Allerlei:
Dir zum Wohl! sagt die Partei.
Sie hatte herzlich über das sinnenfrohe Gedicht gelacht und gewünscht, daß auch Stalin es zu Gesicht bekäme, dessen Lachfältchen um die Augen sich vertiefen würden, hätte er Zeit, Gedichte zu lesen und nicht nur Kommuniques, Lageberichte und Staatsverträge.
Früher hatte er selbst Gedichte geschrieben, doch dazu fehlte ihm heute die Zeit, leider. Vielleicht wäre aus ihm ein großer Dichter geworden, ein neuer Shakespeare, ein neuer Puschkin und ein neuer Goethe in einer Person. Das hätte sie ihm zugetraut. So war aus ihm zum Glück der Welt der größte Staatsmann aller Zeiten geworden, bedauerlich oder nicht, so ist das Leben!
Zu ihrer Beunruhigung aber druckte wenige Tage nach der Veröffentlichung des Gedichts die Eisenbahnerzeitung Leserstimmen ab, die heftig gegen die irreführenden, lächerlichen, ja diskriminierenden Verse protestierten. Mit dem Gereime solle der neue Fünfjahresplan diffamiert werden: Da die Industrie, wie allgemein bekannt, planmäßig noch nicht alle Bedürfnisse der Bevölkerung nach Gütern des täglichen Bedarfs decke, gebe der Verfasser in bösartiger Verstellung vor, daß wohl die Landwirtschaft eingesetzt werden müße, die Bedarfslücken an industriellen Gütern zu schließen. Und umgekehrt: Da der Volkswirtschaftsplan in realistischer Voraussicht den Bedarf der Bevölkerung an Nahrungsmitteln schrittweise decke, anstatt übereilt sofort das Land mit Butter, Zucker und Melonen zu überschwemmen, Lebensmittel, die dann doch nur verderben würden, was zu Chaos und Zerstörung des bisher Erreichten führen würde, gebe der Verfasser in bösartiger Verfälschung der realen Situation vor, die Industrie werde dann vielleicht die Probleme der Landwirtschaft lösen können. Jede Zeile des Gedichtes wurde hervorgehoben und analysiert:
„Mit der zweiten Zeile stellt der Verfasser das russische Volk hin als einen Haufen des Rechnens in den Grundrechenarten unfähiger Hinterwäldler, obwohl jeder im Lande weiß, daß Rußland mit Lomonosow der Welt einen der hervorragendsten Mathematiker und Naturwissenschaftler geschenkt hat.“
Lena erstarrte, als sie erfuhr, der Verfasser sei festgenommen und werde vor Gericht gestellt. Ihr war klar, nur Volksfeinde seien imstande, den Verfasser einer harmlosen Reimerei zu verurteilen. Das müßte Stalin wissen, was Volksfeinde in seinem Land anstellten, dachte sie, das müßte unser geliebter Führer wissen, das müßte der Schöpfer der demokratischsten Verfassung der Welt lesen, die seit Wochen in den Zeitungen diskutiert wurde und bald reif sein würde, zum Gesetz erhoben zu werden. Sogar fröhliche Dichter werden neuerdings festgenommen und müssen ihre leichtgeschürzten, unschuldigen Verse vor dem Staatsanwalt verteidigen. Wenn Stalin wüßte, was geschieht in seinem Land und seinem Namen, würde er dreinschlagen. Aber er weiß es leider nicht. Und warum weiß er es nicht? Weil er von Feinden der Revolution umgeben ist:
„Dreinschlagen!“ sagte sie leise vor sich hin und ballte die Faust: „Drein-schlagen!“
Stalins Gesicht liebte sie wie kein anderes. Sie hatte es in Wirklichkeit nur flüchtig bei Vorbeimärschen auf dem Roten Platz gesehen, wenn sie, fähnchenschwingend inmitten ihrer hochgewachsenen Kommandeure der Militärakademie, sich den Hals nach Stalin verrenkte.
„Wo ist er? Wo ist er?“ rief sie in kindischer Verzückung, „ich kann ihn nicht sehen! Seht ihr ihn denn?“
Oberst Kuchelbeker hatte sie hochgehoben und der Tribüne wie eine Trophäe entgegengehalten: „Sehen Sie ihn nun?“ - „Ja!“ hatte sie gejubelt, aber da war der Block der Kommandeure und Generalstabsoffiziere bereits am Mittelteil der Tribüne über dem Mausoleum, in dem der einbalsamierte Leib Lenins ruhte, schon vorbei. Sie konnte gerade noch einen flüchtigen Blick auf den rechten Flügel der dort aufgereihten Führer und Würdenträger werfen: Grigorij Jewsejewitsch Sinowjew zum Beispiel, Vorsitzender des Petrograder Stadtsowjets, Vorsitzender der Komintern und Mitglied des Politbüros; Lew Borissowitsch Kamenjew, Vorsitzender des Moskauer Stadtsowjets, Volkskommissar für Innen- und Außenhandel und Vorsitzender des Rats für Arbeit und Verteidigung; und ganz außen sogar Radek, Karl Bernardowitsch, Redakteur und internationalistischer Agitator ... Sie war stolz, die Gesichter zu kennen, die dazugehörigen Personen mit Familien- und Vatersnamen fehlerfrei auswendig zu können und zu wissen, welche Funktionen sie im Leben des Landes wahrnahmen oder wahrgenommen hatten, Kamenjew und Radek, daran erinnerte sie sich immer wieder, kannte sie sogar von Angesicht zu Angesicht.
Aber auch nach fünfmaligem Vorbeimarschieren hatte sie Stalin nicht länger als wenige Sekunden sehen können. Zu dicht war der Wald der Leiber und Fahnen, die ihr die Sicht versperrten. Oberst Kuchelbeker hatte sie huckepack nehmen wollen, die niedliche Portion, aber General Malischkin winkte ärgerlich ab. Er liebte Vertraulichkeiten dieser Art unter Vertretern seiner Hochschule nicht.
Sie kannte Stalins Gesicht von Fotos und Gemälden. Jedes Fältchen seines Gesichtes war ihr vertraut, jedes verschmitzte Lächeln, das Pfeifchen, das er sich anzündete. Viele solcher Fotos hatte sie aus Zeitungen und Illustrierten geschnitten, sortiert und nach einem bestimmten System abgelegt, und da sie zeichnerisch begabt war, hatte sie sich eine besondere Methode ausgedacht, die bewegungslosen Bilder in Bewegung zu setzen.
Die Art, zeichnerisch eine Bewegung vorzutäuschen, kannte sie aus ihrer Kindheit im Schlesischen: Man nahm Blätter vielleicht doppelt oder dreimal so groß wie Spielkarten und von gleichfester Struktur, und zeichnete: zum Beispiel ein Pferd im Galopp. Auf dem ersten Blatt das Pferd in einer bestimmten Phase seiner Bewegung, auf dem zweiten Blatt das Pferd in einer um einen Millimeter veränderten weiteren Phase der Bewegung, auf dem dritten Blatt die wiederum um einen Millimeter veränderte dritte Phase der Bewegung und bei jedem weiteren Blatt eine weitere Phase. Wenn man dann den Stapel von vierzig, fünfzig Blatt mit der Linken festhielt und mit dem Daumen der Rechten den Stapel nach hinten bog und nun langsam Blatt für Blatt abschnippen ließ, ergaben die vorschnellenden einzelnen Bilder vor dem Auge des verblüfften Betrachters den Eindruck einer fortlaufenden Bewegung. Daumentheater wurde in ihrer schlesischen Kindheit diese Art genannt, bewegte Bilder zu schaffen. Dieselbe Methode wandte sie an, als ihr einfiel, daß es Spaß machen müsse, Stalins Gesicht in Bewegung zu zeigen.
Ausgehend von dem berühmten Foto Leonows, das Stalin beim Anzünden seiner geliebten Pfeife zeigt, hatte sie sich folgenden Bildablauf vorgestellt: Stalin, die Augen gesenkt, hält das Streichholz an sein Pfeifchen, ein Rauchwölkchen steigt auf. Stalins linke Hand hält den Kolben des Pfeifchens fest, während er, immer noch gesenktem Blickes, aufmerksam den Vorgang des Rauchbildens beobachtet. Plötzlich hebt Stalin den Blick und schaut den Betrachter direkt an. Die Lachfältchen an den Augen vertiefen sich, die Augen selbst bekommen einen leichten Schleier der Freude angesichts des Betrachters, die Lippen kräuseln sich zu einem verschmitzten Lächeln und während die Augenschlitze schmaler und schmaler werden vor freundlichem Lächeln, bilden sich in den Rauchwölkchen die Worte: Proletarier aller Länder, vereinigt euch!
Dergestalt war das Bild von Stalin, das sie in ihrem Herzen trug, und auf das sie nichts kommen ließ.
In der Moskauer Erdstadt, dem Viertel in der Metropole, die nördlich der Chinastadt und der Weißen Stadt liegt, war der Keller des Menschenfressers Worotynski entdeckt worden, eines wohlhabenden Fleischbeschauers, der die Metzgereien der Gegend zuverlässig mit frischer Wurst, eingelegtem Sauerfleisch und ausgelassenem Griebenschmalz beliefert hatte, schwarz natürlich, zu erschwinglichen Preisen. Jedesmal, wenn er von Dienstreisen in die Provinz zurückkehrte, freuten sich die Eingeweihten auf einen neuen würzigen Happen. Als der Schiebering aufflog, wurden, wie das gerichtsmedizinische Institut in mühseliger Puzzlearbeit herausfand, die sauber zerlegten Reste von sieben Getöteten gefunden, einige in der Wurstmaschine. Es war die Rede von insgesamt etwa dreißig Opfern.
Abends saß sie am Radio, den Ton leise gestellt, das Ohr an den Lautsprecher gepreßt, und hörte Meldungen von immer neuen Verhaftungen, Meldungen von immer neuen Erschießungen. Namen von Menschen kamen in den Meldungen vor, mit denen sie ein Stück des Lebens gemeinsam gegangen war. Deutlich standen ihr die Gesichter vor Augen.
Als die Welle der Verhaftungen begann, war sie mit dem einarmigen Obersten Baragamow die ganze Nacht aufgeblieben, und sie hatten sich ihre Zukunftssorgen anvertraut. Da war sie noch ohne Angst gewesen, und ihr Freund hatte sie in der Illusion gelassen, daß alles gut werden würde, wenn nur Stalin wüßte, daß hinter seinem Rücken die Rote Armee zerschlagen werden sollte.
Auf der schmalen Parkbank hatten sie sich geliebt, sie auf dem Rücken liegend, die Beine zu beiden Seiten herabbaumelnd. Sein Glied war so straff geworden und er war so tief in sie gedrungen, daß sie glaubte zu spüren, wie es pulsierte ... Hinterher genierte sie sich ihrer verhaltenen Schreie und zog die Situation ein wenig ins Lächerliche:
„Ich werde mir doch nicht etwa einen Splitter eingezogen haben.“
Er verstand nicht, was sie damit meinte, fragte aber nicht nach. In dieser Nacht brachte Baragamow ihr bei, den rot leuchtenden Mars am Sternenhimmel aufzusuchen und sagte, sie solle auf seine Bahn achten:
„Was auch passieren sollte später einmal, beim Aufsuchen des Marses wollen wir uns aneinander erinnern.“
Sie glaubte nicht, daß sie es schaffen würde, irgendeinen Planeten ohne fremde Hilfe aufzufinden, versprach ihm aber, es zu tun. Ein bißchen lächerte es sie, denn eine so romantische Vorstellung von Liebe hatte sie nicht. Immerhin war sie schon vierzig, er fünf Jahre jünger. Vor Beginn des Studiums hatte er schon ein Panzerbataillon kommandiert, bei seinem Ehrgeiz würde er bald General sein.
Drei Tage später erschien er nicht zum Unterricht und blieb spurlos verschwunden. Das Gerücht ging um, er sei verhaftet worden bei Nacht. Er sei aber noch am Leben, hieß es, er sei als Kronzeuge für größere Verbrecher ausersehen. Verzweifelt suchte sie eine halbe Nacht nach dem Planeten ihres Versprechens, und tatsächlich konnte sie ihn nicht finden.
Andere Freunde waren schon erschossen worden. An Stepan Ignatjewitsch Berjusow, erinnerte sie sich, wie sie zusammen im Sokolniki Park Fahrrad gefahren waren, sie mit kleinen Kunststückchen, freihändig zum Beispiel, er ungeschickt gegen einen Baum. Was hatten sie gelacht. Sein Name war letzte Woche im Radio durchgekommen als Beispiel für einen gewissenlosen ehemaligen Stabsoffizier, der geheime Pläne kopiert hatte, um sie ausländischen Diplomaten auszuhändigen.
Beim Namen von Dawid Dawidowitsch Wanger erinnerte sie sich stiller, nachdenklicher Spaziergänge im Schloßgarten von Lefort, ein blutjunger Major, der sich Gedanken machte über Puschkins Poem „Der neunzehnte Oktober“. Sie hatte ihn ausgelacht:
„Und Sie wollen ein Militär sein? Warum sind Sie nicht Mönch geworden?“
„Mönch hätte ich nicht werden können“, hatte er lächelnd geantwortet, „höchstens Rabbiner.“
Er gehöre einer Bande von Saboteuren an, erläuterte die metallene Stimme im Radio, die im Dienst ausländischer Firmen Geld genommen hatte beim Einkauf minderwertiger optischer Geräte für den Verteidigungsfall.
Hochzeit
Es war merkwürdig, wie oft sie mit Juden zu tun gehabt hatte, Höhepunkt 1923 ihre Hochzeit mit Karcsi in Wien, als sie mittellos in Grinzing, Baracke 23 des ehemaligen Seuchenhospitals, gelandet war. Karcsi zuliebe war sie zum jüdischen Glauben übergetreten und hatte den Vornamen Debora angenommen.
In „Baracke 23“ hatten führende Mitglieder der Ungarischen Kommunistischen Partei Unterschlupf gefunden, heimatlose Flüchtlinge nach dem Zusammenbruch der Räterepublik im Sommer zuvor: Ernö, ehemaliges Mitglied des Zentralkomites; György, ehemaliger Volkskommissar für Kultur; Ervin, ehemaliger Stadtkommandant von Kecskemét; Józsi, ehemaliger enger Mitarbeiter Béla Kuns; István, ehemaliger Frontkommandeur, Károly Rubin, genannt Karcsi, ehemaliger Divisionskommissar beim Sieg der Roten Armee über die königlich rumänischen Streitkräfte bei Szolnok.
Den Namen „Baracke 23“ hatten sie sich gegeben zu Ehren und im Andenken an die 23 führenden Politiker der Räteregierung, Ottó Korvin an der Spitze, die sich nicht hatten retten können und erschossen worden waren, als Horthy an die Macht kam. Doch auch Ernst Kulka, Puppenspieler von Beruf und in der Münchner Räterepublik Volkskommissar für Finanzen hatte vorübergehend Unterschlupf in Baracke 23 gefunden, sowie Komponist Hanns Eisler und Romancier Bernhard Kellerman mit seiner Frau, keine Ahnung warum.
Ein merkwürdiger Mann dieser Karcsi, den sie geheiratet hatte: Aus seinen immer blitzsauberen Brillengläsern hatte er sie ironisch angeblickt bei der Frage, ob sie ihn heiraten wolle, so daß sie es zuerst für einen seiner hintergründigen Scherze hielt. Natürlich wollte sie ihn heiraten, was für eine Frage. Damals waren die Wiener Seuchenbaracken in Grinzing der einzige Unterschlupf für Flüchtlinge aller Art. Baracke 23 war den Kommunisten vorbehalten. Andere Baracken wurden von Zeugen Jehovas regiert, von Monarchisten, von Zigeunern.
Wie die anderen Bewohner der Seuchenbaracken war auch Karcsi mittellos nach Wien gekommen. Sein Vater, ein wohlhabender Weinhändler, hatte sich geweigert, dem Sohn weiterhin Schecks auszustellen. Da waren sie in tuschelnder Runde auf die Idee gekommen, dem Vater mit einer Heirat Geld abzujagen. Der aber sagte Unterstützung nur zu, wenn die Hochzeit nach jüdischem Ritual stattfand. Das Geld des Vaters war dazu bestimmt, die Parteikasse aufzufüllen.
Karcsi, dieser weichherzige, zurückhaltende und ein wenig versponnene Mensch mit den Allüren eines zerstreuten Professors, ein stotternder Junge manchmal, der meisterhaft die Laute spielte, und selbst eine Sammlung Lautenlieder herausgegeben hatte, soll einer der unbeugsamsten Kommissare der Ungarischen Räterepublik gewesen sein? Sie konnte es fast nicht glauben. Ervin ja, dem glaubte man gern militärische Gewalt, der war ein Haudegen, ihn stellte man sich gern vor auf einem Pferd mit geschwungenem Säbel durch Reihen von Feinden jagend, aber Karcsi? Instinktiv schüttelte sie den Kopf bei dem Gedanken daran. Aber offenbar war es so gewesen.
Er selbst sprach nie darüber. Jedoch gab es Andeutungen von Genossen, die sie mit zunehmendem Interesse registrierte. Während er ihr Nettigkeiten sagte, offenbar, weil er dachte, daß sie zu einem Heiratsantrag gehörten, putzte er ununterbrochen die Gläser seiner Brille mit einem Hirschlederlappen, schaute prüfend durch das eine Glas, indes er es gegen das Licht hielt, schaute durch das andere.
„Karcsi, Lieber“, sagte sie, “deine Brille ist sauber, sauberer wird sie nicht.“
„Alles ist möglich“, sagte er, „alles ist möglich.“
„Bist du denn verliebt in mich, Karcsi?“ fragte sie.
„Oh, ja“, sagte er, „ich bin sehr verliebt in dich“, es schien, als habe er beim Überprüfen der Brillengläser einen Fleck übersehen, denn er hauchte gegen das Glas und rieb es anschließend blank. Es gibt sicher überzeugendere Liebeserklärungen, dachte sie ein wenig enttäuscht.
Als am Tag vor der Hochzeit das rituale Bad vorbereitet wurde, war sie sich des Ernstes der Situation noch nicht bewußt. Was soll schon sein, dachte sie, ich steige in den Zuber und fertig. Der zukünftige Schwiegervater hatte das mit Mosaiken und Ornamenten geschmückte Badehaus einer in maurischem Stil erbauten Synagoge für die rituelle Waschung ausgewählt.
Obwohl fünfhundert Liter Quellwasser ausreichend gewesen wären bei ihrer Taufe, ließ er die dreifache Menge in das Becken laufen. Die Proselytin in der Familie sollte nicht liegend eintauchen, sondern stehend. Mit großen Augen und ein wenig eingeschüchtert bewunderte sie die marmornen Stufen, die goldschimmernden Handläufe, die Pfosten und Knäufe aus gedrehtem Holz.
Esther, Karcsis Schwester, eine schmallippige Brünette mit langen Locken, die verführerisch kastanienbraun glänzten, war beauftragt, das rituelle Bad zu überwachen. Sie zog Lena in ein langes Gespräch, aus dem sich nach und nach ergab, daß sie vor allem herausbekommen wollte, wann die letzte Monatsblutung gewesen sei und wann der letzte Geschlechtsverkehr.
Ein Mann mit dem Gebetsmantel über dem Kopf saß in der Ecke und hantierte mit Scheren, Rasiermesser und Kamm, die er auf einem niedrigen, mit Blumen geschmückten Tischchen sorgfältig ausbreitete. Lena, die instinktiv eine Gefahr auf sich zukommen sah, fragte erschrocken:
„Was macht der Mann da?“
„Das ist der Friseur der Synagoge.“
„Was will der hier?“
„Du weißt es nicht?“
„Der ist doch nicht etwa meinetwegen hier?“
„Hat noch niemand mit dir darüber gesprochen?“ und als Lena den Kopf schüttelte, schlug Esther theatralisch die Hände zusammen und blickte wie hilfesuchend gen Himmel: „Immer bleibt alles an mir hängen. Andauernd muß ich die Versäumnisse meines Bruders ausbaden, der sich Revolutionär nennt, aber zu feige ist, seiner Zukünftigen zu sagen, daß sie als Verheiratete den Schejtel trägt,“ und als Lena sie begriffsstutzig anschaute, „dir werden jetzt die Haare abgeschnitten, von nun an wirst du die Perücke tragen, den wir Schejtel nennen.“
„Kommt überhaupt nicht in Frage.“
„Schau“, sagte Esther, indem sie umständlich ihr schönes Haar abnahm, „so sieht eine verheiratete Jüdin aus.“
Lena, die sofort den Badeturm verlassen wollte, konnte nur mit Mühe von Esther zurückgehalten werden, die noch andere Frauen zu Hilfe rief und schließlich den Synagogenvorsteher.
“Laßt die Frau“, sagte der fromme Mann, „laßt sie in Ruhe, sie weiß vielleicht noch nicht, daß abgeschnittene Haare wieder nachwachsen.“
Stolz stieg sie ins Bad. Es kam ihr vor, als habe sie einen Sieg erfochten, und als Esther sie mahnte, ganz unterzutauchen, tat sie es ohne Murren.
Mit Esther freundete sie sich sogar ein bißchen an.
„Ich kann diese überstürzten Hochzeiten nicht ausstehen“, sagte Esther.
„Karcsi und ich kennen uns schon lange“, entgegnete Lena.“
„Wie lange kann es gewesen sein? Zuerst war er Soldat in der österreichischen Armee ...“
„ ...verwundet kam er nach Berlin, wo ich ihn wiedersah, und eines Tages schrieb er mir: Wenn du nichts besseres vorhast, besuche mich in Wien. Da bin ich zu Fuß von Berlin nach Wien getippelt, aber kennengelernt haben wir uns 1913 im Hessischen, da war ich fünfzehn und er achtzehn, und er hat mir viel von den Vorzügen des Lautenspiels erzählt.“
„Aber du wechselst den Glauben. Ich bin der Meinung, wer den Glauben wechselt, soll sich langsam darauf vorbereiten und sich mit den Hauptschriften der Judenheit befassen.“
„Ich wechsele nicht den Glauben.“
„Wie soll ich das verstehen?“
„Ich habe keinen.“
„Sie hat keinen Glauben!“ wandte sich Esther an eine nicht vorhandene Zuschauerschaft, „das sagt sie mir glatt ins Gesicht?“ und an Lena gewandt: „Kennst du wenigstens die Bibel?“
„Ich kenne sie so gut, daß ich sie widerlegen könnte.“
„Aber welche Bibel willst du widerlegen?“ rief Esther entsetzt, und so, als käme ihr ein rettender Gedanke, „doch wahrscheinlich die Bibel der Christen? ja!“, rief sie in triumphierendem Tonfall, „die ist leicht zu widerlegen.“
Das Gespräch fand zu abendlicher Stunde im Garten statt, und György, der Talmudkundige, der durch Zufall von einem Busch verdeckt, dem Gespräch mit wachsender Erheiterung gefolgt war, gab sich zu erkennen und ergänzte spöttisch:
„Raw Kajana sagt dazu in einem nämlichen Fall: Ein Zwanzigjähriger, der die ganze Lehre durchstudiert hat, erfuhr erst mit dreißig, daß die Lehre zweierlei Bedeutung hat, und mit vierzig erfuhr er, daß sie dreierlei Bedeutung hat, und als er sechzig war, mußte er zur Kenntnis nehmen, daß sie viererlei, fünferlei und sechserlei Bedeutung hat ... Was lässt sich daraus ablesen? Jeder, der die Lehre studiert, wird sie richtig erst später verstehen oder vielleicht nie.“
„Mischen Sie sich gefälligst nicht in unser Gespräch“, rief Karcsis Schwester erbost dem ehemaligen Volkskommissar für Kultur zu, „das fehlte noch, daß ausgerechnet Sie sich in unser Gespräch mischen.“
Als Karcsis Vater erschien, das Haupt in den Gebetsmantel gehüllt, als der Sohn betreten vor ihm stand und vor Befangenheit nicht wagte, das Gesicht zu heben, kam es ihr vor, als wohne sie einer intimen Handlung bei. Die Situation war ihr peinlich. Sie wollte sich schon davorschleichen, aber aus Trotz blieb sie. Wenn ich schon Akteurin einer solchen Zeremonie bin, dachte sie, dann will ich auch im Einzelnen wissen, wie sie abläuft.
Zuerst wickelte der Mann im Gebetsmantel dem Sohn einen langen mit einer Lederkapsel bestückten Riemen um Oberarm und Unterarm, und als sich Lena schon fragte, wo er das lange Ende lassen würde, schlang er den Riemen mehrmals dem Sohn um die Hand bis hin zum Mittelfinger, der auch mehrmals umwickelt wurde.
Lena beobachtete den Vorgang mit gespannter Aufmerksamkeit. Sie wollte wissen, welche Bedeutung die Gebetskapsel habe, durch die der Gebetsriemen gezogen wurde, sie wollte wissen, wie der Gebetsriemen gewickelt wird und sie wollte wissen, wie der ehemalige kommunistische Truppenkommissar sich dabei verhielt, aber es gab niemand, der sie aufklärte.
Dann kam ein Synagogendiener, auch er mit dem Gebetsmantel über dem Kopf, und reichte dem Vater den Gebetsriemen für den Kopf. Da der Sohn größer war als der Vater, mußte der sich auf Zehenspitzen stellen, und Karcsi ging ein wenig in die Knie. Diesmal kam die Lederkapsel in die Mitte der Stirn am Haaransatz. Die beiden Riemen wurden am Hinterkopf verknotet. Abschließend legte der Vater dem Sohn mit, wie ihr schien, zärtlicher Gebärde die beiden Riemenenden über die Schultern nach vorn über die Brust.
Vor allem wunderte sie sich über Karcsi, in dessen Gesicht sich nun nicht nur Befangenheit spiegelte, sondern ein Ausdruck, den sie bei ihm noch nie entdeckt hatte und der so etwas wie Schmerz ausdrückte. Aber welcher Art der Schmerz war, konnte sie nicht erraten. Es wird wohl der Schmerz des Gotteslästerers sein, dachte sie, denn was hier vorging, hielt sie für Gotteslästerung. Sie verachtete zwar alle Religionen, aber noch nie hatte sie sich dazu verstiegen, sich lustig zu machen über Gläubige in ihrem Glauben. Es gehört wohl ein gehöriges Maß Kaltschnäuzigkeit dazu, dachte sie, sich derart zu verstellen, um in den Genuß eines Barschecks zu kommen.
Doch dann kam ihr der Gedanke, daß der ehemalige kommunistische Politkommissar im Herzen vielleicht gläubig geblieben sei. Vielleicht hatte er den Glauben an Gott nur getauscht mit dem Glauben an die proletarische Revolution, und war, angesichts der Rituale und Zeremonien, die er als Kind kennengelernt hatte, wieder zum alten Glauben zurückgekehrt, vieles an seinem Verhalten bei der Zeremonie schien darauf hinzudeuten.
Als sie hinterher Karcsi nach der Bedeutung der Kapsel fragte, lehnte er unwirsch ab:
„Danach fragt man nicht.“
„Aber du kennst sie.“
„Natürlich.“
„Steckt etwas drin in der Kapsel?“
„Ja.“
„Und was?“
„Wozu willst du das wissen?“
„Weil ich dabei bin, deinetwegen zum jüdischen Glauben überzutreten.“
Das Gespräch war ihm peinlich. Während er die Brille mit seinem Hirschlederlappen putzte, ohwohl sie sauber war, blickte er sich verstohlen um, ob jemand, der Vater vielleicht, sie beobachte.
„Du weißt, daß unsere Heirat pro forma geschieht“, sagte er, „wir haben es dir haarklein erklärt: Mein Vater unterstützt unsere Ehe nur, wenn wir rituell heiraten, aber wenn wir rituell heiraten, mußt du übertreten.“
„Und warum ist es dir peinlich darüber zu sprechen?“
„Es ist mir nicht peinlich, sondern es ist ungehörig, mit einer Nichtgläubigen darüber zu sprechen.“
„Du selbst bist aber auch ungläubig.“
„Ich muß aber so tun, als glaubte ich.“
Sie wollte auch geschnürt werden, aber ihr wurde bedeutet, daß es Frauen nicht zieme, geschnürt zu sein. Sie wollte auch den Schmuck zwischen den Augen tragen, aber ihr wurde bedeutet, daß Frauen dieses Schmucks nicht bedürften. Und als das Höre-Israel erklang, da wollte sie es auch mitsprechen, aber ihr wurde bedeutet, daß es ihr nicht zustehe. Sie wurde aber aufgefordert, den Verlobungsspruch nachzusprechen:
„Ich will mich mit dir verloben für alle Ewigkeit. Ich will mich mit dir verloben in Gerechtigkeit und Recht. Ich will mich mit dir verloben in Gnade und Barmherzigkeit. In Treu will ich mich mit dir verloben und den herrn erkennen.“
Den Spruch fand sie angemessen der Situation, obwohl sie zu seinem letzten Teil eine abweichende Meinung vertrat.
Auch bei der Hochzeit ging es feierlich zu. Das Brautkleid ganz in Weiß stand ihr gut, und Karcsi, der sie bisher immer nur in Wanderkluft gesehen hatte, machte ihr verliebte Augen, zum erstenmal, wie sie registrierte.
Sie bekam den Namen Debora. Karcsi erläuterte eilfertig:
„Das ist eine große Ehre, denn du bist nach der Richterin in Israel benannt, die vor dreitausend Jahren den Sieg über die Kanaaniter errang wodurch dem Land ein vierzigjähriger Frieden beschert wurde.“
„Das weiß ich“ sagte sie ungeduldig, „ich kenne sogar das Lied, das sie sang.“
György, der Talmudkundige, stichelte:
„Debora heißt übersetzt: Wespe, und Raw Nachman hat gesagt: daß überhebliche Frauen Wespe genannt werden sollen.“
„Bin ich denn überheblich?“
„Nein!“, sagte Karcsi und György sagte: „Sehr.“
„Menschenskind“, sagte Karcsi, „laß sie in Ruhe mit deinem Spott.
Und der Talmudkundige rezitierte:
„Ein Mensch verkaufe alles, was er hat, und heirate die Tochter eines Gelehrten. Findet er nicht die Tochter eines Gelehrten, so heirate er die Tochter eines der Großen seiner Zeit. Findet er nicht die Tochter eines Großen seiner Zeit, so heirate er die Tochter eines Synagogenvorstehers. Findet er nicht die Tochter eines Synagogenvorstehers, so heirate er die Tochter eines Almoseneinnehmers. Findet er nicht die Tochter eines Almoseneinnehmers, so heirate er die Tochter eines Kleinkinderlehrers. Er heirate aber nicht die Tochter eines Laien, weil sie Scheuel sind und ihre Frauen Geschmeiß. Über sie und ihre Töchter sagt die Schrift: Verflucht, der bei derart Tier liegt.“
„Ist das wahr?“ fragte Lena erschrocken. György sagte: „Allerdings“, und Karcsi sagte: „Das ist nicht wörtlich gemeint, sondern in übertragenem Sinn.“
„Ja, ja, ja“, spöttelte György, „wahrscheinlich ist auch die Legende von der Erschaffung der Welt in übertragenem Sinn gemeint.“
„Da hast du recht“, sagte Karcsi, „auch sie und die anderen Legenden sind in übertragenem Sinn gemeint.“
„Es scheint für einen jüdischen Revoluzzer schwierig zu sein“, sagte György, „den Aberglauben seiner Bibel mit dem naturwissenschaftlichen Weltbild zu versöhnen.“
Den ganzen Tag hatten sie pflichtgemäß gefastet. Karcsi jammerte: „Wenigstens ein Wiener Würstchen hätten sie uns genehmigen sollen.“ Lena litt nicht darunter. Praktisch eingestellt wie sie war, sah sie darin eine kleine Möglichkeit, die Figur zu verbessern.
Die vorgeschriebene Zahl von zehn religiös volljährigen Männern war auch vorhanden. Sie hätte gern alle ihre Freunde aus der kommunistischen „Baracke 23“ um sich gesehen, aber außer György hatte sich keiner von ihnen dazu aufraffen können, an der Feier teilzunehmen.
Morgengebet und Mittagsgebet waren ihnen erlassen worden. Als die Männer das Achtzehngebet sprachen, sah sie aus dem Nebenraum, in dem sich die Frauen versammelt hatten, wie sich Karcsis Lippen so bewegten, als spräche er den ganzen Text mit.
Auch als er ihr dann den Ring an den Finger steckte, sprach er ohne zu stocken die dabei üblichen hebräischen Worte.
„Du warst wohl im Talmudunterricht ein guter Schüler“, versuchte sie ihn zu necken. Er sah sie mit strafendem Blick an und sagte:
„Der beste.“
Es wurden noch verschiedene Gebete aus ihr nicht ersichtlichen Anlässen gesprochen, bis sich das Brautpaar zum ersten gemeinsamen Essen als Eheleute zurückziehen konnten. Während im Festsaal ein Lärmen und Gläserklingen anhob, saßen sie schweigend beieinander und wußten sich nichts zu sagen. Nur als ihr Ehemann sich über das Essen hermachte, mahnte sie:
„Schling nicht so, es nimmt dir niemand etwas weg.“
Es war ihr erster Satz als Verheiratete. Hinterher gingen sie zur Festgesellschaft hinüber. Zuerst wurde ihm, dann ihr Wein gereicht. Er trank sein Glas in einem Zug aus, stellte es vor sich auf den Boden und zertrat es mit kräftigem Aufstampfen. Noch auf den Scherben drehte er den Absatz mehrmals, bis auch übriggebliebene größere Stücke zermalmt waren.
Eigentlich hatte sie erwartet, daß er sagen würde: So wie dieses Glas zertrete ich die Feinde der proletarischen Revolution, aber er sagte auch hier nur das übliche:
„Vergesse ich dich, Jerusalem, so verdorre meine Rechte. Meine Zunge soll an meinem Gaumen kleben, wenn ich nicht dein gedenke, denn Jerusalem soll meine höchste Freude sein und bleiben.“
So ging die Hochzeitszeremonie zuende. Von den Kommunisten in „Baracke 23“ wurden die Neuvermählten lärmend empfangen.
Von allen wurde sie aus Spaß eine Woche lang Debora gerufen, manchmal, von György animiert, Wespe, bevor sich das vertraute Lena wieder durchsetzte. Wie hätte sie ahnen können, daß man sie ein paar Jahre später in Rußland noch anders, nämlich Magdalena Awgustowna, nennen würde.
Wenige Wochen nach der Hochzeit war Karcsi, ohne sich zu verabschieden, verschwunden. György hatte sie beiseite genommen:
„Wir haben Karcsi nach Ungarn geschickt, um wichtige Unterlagen der Partei sicherzustellen.“
Ihre Aufgabe sei es nun, seine Briefe, die postlagernd an sie, seine Ehefrau, gerichtet werden, ungeöffnet ihm, György, auszuhändigen. Und nach weiteren drei Wochen hatte György sie erneut beiseite genommen:
„Er ist zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt.“
Es hatte sie nicht überrascht. Sie hatte vorher gewußt: so verlief das Leben eines Berufsrevolutionärs. Die Partei war verarmt, sie, Lena, hatte ihr zu vorübergehendem Wohlstand verholfen. Aber hätte es nicht eine andere Möglichkeit gegeben, Karcsi in Wien eine unverfängliche Adresse zu sichern? Sie beklagte sich nicht, war aber gekränkt. Sie hatte sich auch darüber gewundert, wie bedenkenlos Revolutionäre sich einer religiösen Zeremonie bedienten, um an Geld zu kommen. Für Lena waren Religionen wirklich Opium für das Volk. Aber sie wußte auch, daß die Partei manchmal verschlungene Wege gehen muß, das wußte und akzeptierte sie. Über die Gründe ihrer Strategien und Taktiken hatte die Partei niemand Rechenschaft abzulegen.
Nach der Entlassung aus dem ungarischen Gefängnis, war Karcsi nach Moskau gekommen. Zuerst hatte sie gedacht und gehofft, er sei ihr gefolgt, denn sie lebte schon seit einem Jahr in der Hauptstadt des Vaterlandes der Werktätigen, ein Wort, das sie gewohnt war, in vollem Ernst und ohne ironischen Akzent auszusprechen. Doch Karcsi machte keine Anstalten, sie wiederzusehen. Da ging sie zu ihm.
Er fing sie im Flur ab. Längst lebte er, wie sie zu ihrer Verblüffung erfuhr, mit einer anderen Frau zusammen, aber nicht mit irgendeiner, sondern mit der Siebenstern, dem Weibstück mit spitzer Nase und breitem Kinn aus der Baracke 23 des ehemaligen Grinzinger Seuchenhospitals, die es verstand, mit großer Geste lange Zigaretten zu qualmen und mit „axiomatisch“ und „transzendental“ auf den Lippen die jungen Kerle zu betören, die als Kommandeure und Kommissare in der Ungarischen Räterepublik Pulverdampf gerochen, aber noch keine Erfahrung mit Frauen hatten und deren Mutter sie hätte sein können. Das Wort „Bigamie“ lag Lena auf der Zunge, doch die Erklärung, die Karcsi für sein Verhalten ihr gegenüber vorbrachte, verblüffte sie noch mehr:
„Zu den Pflichten eines Kommunisten gehört“, sagte er,“ alles zu vermeiden, das die Aufmerksamkeit der GPU auf einen ziehen könnte.“
„Weil ich meinen Ehemann besuche, ziehe ich die Aufmerksamkeit des Staatssicherheitsdienstes auf mich?“
„Indem du unklugerweise Kontakt zu mir aufgenommen hast, sind die Sicherheitskräfte gezwungen, der Sache nachzugehen.“
„Welcher Sache, zum Donnerwetter? Daß wir verheiratet sind und zwar miteinander, meinst du das mit der Sache nachgehen?“
„Die GPU hat wichtigere Aufgaben, als sich von ausländischen Gästen, die sich unvorschriftsmäßig verhalten, irritieren zu lassen.“
„Karcsi, Lieber, von welchen Vorschriften sprichst du? ich verstehe dich nicht. Ich kenne keine solchen Vorschriften.“ „Sie sind nicht niedergeschrieben worden, da jeder, der der Partei dient, sie kennt, beherrscht und achtet.“
„Und sie bedeuten?“
„Daß es unzulässig ist, wenn ein Kommunist die Staatssicherheitskräfte aus sentimentalen Gründen mit überflüssiger Arbeit belastet.“
Unermüdlich hatte er während der Belehrung die Brillengläser geputzt. Es war aber kein Hirschlederlappen, wie sie zu ihrer Genugtuung und Schadenfreude mit leichtem Lächeln entdeckte, sondern ein unbesäumter fußliger Flicken.
Andere Frauen, nicht so beherrscht wie sie, hätten getobt, ihm die Haare ausgerissen, die ihm immer auf jungenhafte Weise störrisch in die Stirn fielen, hätten seine Brille an der Wand zerschmettert. Sie nicht. Sie hatte darauf nichts zu erwidern gewußt. Aus Karcsis Mund sprach die Partei. Da hatten Gefühle zu schweigen. Außerdem war auch seine Brille nicht mehr das, was sie früher einmal gewesen war, wie sie mit hämischem Lächeln feststellte. Hier trug er ein klobiges schwarzes Kunststoffgestell mit runden Gläsern, die seinem Gesicht etwas Eulenartiges gaben.
Sie hatten sich auf ihre Bitten noch zweimal in neutraler Umgebung gesehen, einmal im Restaurant Internationale Solidarität und einmal auf dem Fahrgastschiff Leuchtender Oktober.
„Wir leben in einer belagerten Festung“, hatte er ihr gesagt, „da fragt und rätselt man nicht, da faßt man das Gewehr fester und kämpft weiter, so schwer es auch sein mag“, ein Wort, das sie nie vergaß.
Jeden Abend hörte sie aus dem ans Ohr gepreßten Radio neue Namen von Personen, zu denen sie voller Vertrauen und in Achtung vor ihrer historischen Leistung aufgeblickt hatte. Nun sollte auch Radek ein Verräter sein?
Lange dachte sie über Verrat nach. Das Wort beunruhigte sie. Und als sie mit Karcsi darüber sprach, antworte er:
„Wir sind von Feinden umgeben, eine Situation, in der schon der geringste Zweifel am Sieg unserer Sache Verrat darstellt. Der Feind zweifelt nicht. Der Feind hat keine Skrupel. Der Feind macht sich keine Gedanken um Recht oder Unrecht, um Humanität oder Barbarei. Der Feind hat nur eins im Sinn: uns zu vernichten. Er hat einen waffenstarrenden Ring um uns gelegt und wartet geduldig, daß wir beginnen zu zweifeln. Er hat es nicht eilig. Er weiß, je länger er geduldig wartet, desto näher kommt er seinem Ziel. Denn wir sind es, die sich Gedanken um Recht und Unrecht machen, um Humanität und Barbarei, und wir beginnen zu zweifeln, ob wir unsere Sache auch richtig im Sinne von Menschenrecht und Humanität anpacken. Nach dem Zweifel kommt der Wunsch, es besser machen zu wollen. Es besser zu machen heißt, es anders zu machen, als die Partei es beschlossen hat. Um sich auszutauschen, sucht der Zweifler Verbündete. Findet er sie nicht bei Freunden, so lauscht er den Argumenten des Feindes, und erscheinen sie ihm zuerst widersinnig, so werden sie ihm von Tag zu Tag plausibler.“
„Aber wie kann man zu allem schweigen, was die Partei befiehlt?“ fragte sie.
„Da gibt es ein klares Wort von Petöfi in seinem Gedicht, du kennst es, wir haben es gemeinsam übersetzt und in die richtige Form gebracht:
Wer ich bin, das sage ich nicht,
Wenn ich spreche, so versteht man mich nicht
Daß ich schweige, daran erkennt man mich.“
Sie wußte, das Gedicht lautete ein wenig anders, korrigierte ihn aber nicht.
„Aber einmal werden wir Rechenschaft ablegen müßen.“
„Rechenschaft ja, aber als Kommunisten, die allein imstande sind, die Tragik unserer Epoche zu verstehen und sie dialektisch und historisch in den Kontext des allgemeinen historischen Ablaufs einzuordnen. Rechenschaft ja, aber nicht aus der Verräterperspektive ...“, sie wollte einen Einwand machen, doch er gebot ihr mit einer Handbewegung zu warten, „ ...aber nicht aus der Sicht von Parteiverrätern wie Sinowjew, der schon verurteilt war, ehe das Standgericht über ihn verhängt wurde. In dem Augenblick, da seine Zweifel an der Partei größer waren als seine Treue zu ihr, konnte er nicht länger geduldet werden, egal, ob er dem Buchstaben nach schuldig geworden ist oder nicht“.
„Und wenn es dir geschähe?“ fragte sie leise, „Karcsi, Lieber, was, wenn es eines Tages hieße, auch du hättest die Partei verraten?“
Einen Moment flackerten seine Augen. Sie kannte dieses irrlichternde Flackern von den Augenblicken, in denen er über ihr lag und sich in ihr ergoß. Das waren die Sekunden ihres größten Glücks. Während sie sich liebten, nahm sie langsam seine Brille ab, legte sie liebevoll beiseite und wartete, bis seine Augen zu brechen schienen, und wenn es geschah, zog sie seine Oberschenkel mit zärtlicher Kraft an sich, um die Verlängerung des Augenblicks genießen zu können.
„Karcsi, es könnte doch sein, daß sie auch dich holen.“
Aber sie hatte wohl ihren Einfluß auf ihn überschätzt. Nach einer kurzen Sekunde der Verwirrung, hatte er sich und seine Gefühle wieder in der Gewalt. Er nahm die Brille ab und putzte sie wie in Gedanken.
„Das“, sagte er kühl, „kann durchaus geschehen.“
„Und wenn sie auch dich erschießen?“
„Dann geschieht es zu Recht. Dann habe ich etwas getan, das die Partei als falsch, verbrecherisch und schädlich ansieht. Dann habe ich fehlgehandelt. Das kann aus einem Irrtum entstanden sein. Wir alle sind unseren Irrtümern unterworfen.“
„Und die Partei?“
„Irrt nie.“
„Karcsi, Lieber“, rief sie leise, „besinne dich. Oder“, sagte sie von einem merkwürdigen Gedankengang eingenommen, „ist es vielleicht etwas ganz anderes?“
Sie betrachtete sein Gesicht, als er schwieg. Es war ruhig und gefaßt. So ruhig und gefaßt möchte ich einmal sein, dachte sie. Woher nimmt er die Kraft und die Gewißheit, daß alles richtig ist, was er sagt? Woher kommt diese innere Ruhe? Und wie würde er sich vor den Bütteln verhalten, bei denen ein leichter Tod noch das beste wäre, das sie zu bieten hätten? Sie wartete auf Antwort.
„Oder“, wiederholte sie leise, fast zärtlich, „ist es vielleicht etwas ganz anderes?“ Und als er nicht reagierte: „Ist es vielleicht das: Vergesse ich dich, Jerusalem, so verdorre meine Rechte. Meine Zunge soll an meinem Gaumen kleben, wenn ich nicht dein gedenke, denn Jerusalem soll meine höchste Freude sein und bleiben.“
Die letzten Worte hatte sie sehr leise gesagt, kaum, daß sie ihr als Hauch über die Lippen kamen.
„Ist es das, Karcsi? - Karcsi, Lieber, ist es das?“
Energisch und mit, wie ihr schien, unangemessener Entschlossenheit setzte er die Brille auf:
„Nein“, sagte er, „du hast, wie immer, wieder alles falsch verstanden. Und, wenn ich dir einen guten Rat geben darf, den besten, den ich für einen Menschen in deiner Situation habe: Laß diese unangebrachten Gedankengänge. Sie könnten dir einmal sehr weh tun.“
Ervin mit dem ungarischen Paß und beantragten Reisepapieren in der Tasche hatte verständnislos den Kopf geschüttelt zu Karcsis Philosophie und gesagt, während er ihr den Arm um die Schulter legte: „Er hat den Verstand verloren, gräme dich nicht um ihn. Aber er wird Karriere machen mit solchen Ansichten oder zumindest dem Genickschuß entkommen. Du aber mußt sofort aufhören, dir eigene Gedanken zu machen.“
Von fern beobachtete sie eifersüchtig Karcsis weiteren Werdegang: Wie er beauftragt wurde, am Moskauer Weltwirtschaftsinstitut bei Eugen Varga die Europa-Abteilung umzugestalten. Wie er an der Leninschule begann, Außenpolitik zu unterrichten. In der Zeitung, als einmal von ihm die Rede war, erschien im Foto neben ihm eine Frau mit spitzer Nase und breitem Kinn, die Siebenstern! seine Frau, wie erläuternd mitgeteilt wurde. Gottseidank, dachte Lena, nun kann alle Welt sehen, wie häßlich sie ist.
Doch da kam ein neuer Gedanke in ihr auf, und obwohl sie ihn gleich verwarf, er ließ sich nicht abschütteln. Sie krauste die Stirn, wenn sie dem neuen Gedanken Raum gab in ihrem Denken. Zuerst krauste sie die Stirn über sich selbst und ihre kleinbürgerlichen Anfechtungen, dann, je mehr ihr der Gedanke einleuchtete, über Karcsi, ihren Mann. Was? dachte sie, wenn er, sie, Lena, die Ungläubige geheiratet hätte wegen des Geldes, aber mit der Siebenstern, so häßlich sie war, zusammenleben wollte, weil sie Zweig war vom selben Stamm und Gefährtin in einem gemeinsamen Jerusalem? Sie schämte ich des Gedankens. Unsinn, sagte sie sich, das ist die typische Gedankenakrobatik einer abgewiesenen Spießerin, unwürdig einer aufgeschlossenen modernen Frau. Doch der Gedanke war nicht mehr zu tilgen.
Dann schien sich seine Karriere mit einem Mal zu verdüstern, wie sie besorgt beobachtete, denn er wurde degradiert. Sein Sturz war nicht dramatisch, sondern leicht abgefedert: er wurde zum außenpolitischen Redakteur der Deutschen Zentralzeitung ernannt. Ein Sturz aus unnahbarer Höhe in menschlichen Bereich. Wieviel Wochen blieb er dort? drei, vier, fünf? Aus den kümmerlichen Andeutungen hier und da war nicht recht schlau zu werden. Doch nach drei, vier oder fünf Wochen verschwand er, zuerst aus den Gesprächen unter Genossen, dann aus ihrem Leben, und am Ende wandte man sich ab mit dem Glas Sowjetskoje Schampanskoje in der Hand, wenn sein Name fiel.
Auch die Siebenstern war in der Wohnung, die Lena verzweifelt aufsuchte, nicht mehr zu finden. Vielleicht war sie bereits zu einem anderen Parteiauftrag abkommandiert. Aber wo war Karcsi geblieben, ihr lieber Mann? Hatte die Partei ihn nach China geschickt oder nach Mexiko? Das hoffte sie sehr. Oder hatte die Partei auch ihn aus dem Leben geschickt wie so viele, die Teil ihres Lebens gewesen waren?
Wenn sie an Karcsi dachte, diesen bescheidenen und unerbittlichen Kämpfer, der am liebsten im Anonymen arbeitete, stieg Rührung, stieg der Wunsch nach Zärtlichkeit in ihr auf.
Flucht
Eines Morgens auf dem Weg nach Lefortowo, wo sie arbeitete, hatte Lena das Gefühl, verfolgt zu werden. Im Zurückblicken entdeckte sie zwei Männer in Lederjacken, wie sie selbst sie einmal getragen hatte. Sie beschleunigte den Schritt, und als sie sah, daß auch die Verfolger schneller gingen, begann sie zu laufen. Im Laufen sprang sie auf eine im Anfahren begriffene Straßenbahn, sie auf den vorderen Perron, die Verfolger auf dem hinteren.
In der Straßenbahn standen die Fahrgäste wie immer dichtgedrängt. Mit Gewalt versuchten die Männer sich zu ihr durchzukämpfen, kamen aber mit dem Schaffner in Konflikt, der sie nach den Fahrscheinen fragte.
„Meine Frau dort vorne hat das Geld, bitte lassen Sie mich durch.“
„Laß nur, Liebster“, rief Lena ihm zu, „ich zahle schon.“
Und während Lenas Geld von Hand zu Hand zum Schaffner ging, sah sie, wie der eine sich schon bis zur Mitte des Wagens durchgearbeitet hatte, während der Zweite ihrer Verfolger in seinem Portemonnaie Fahrgeld hervorkramte. Leichtfüßig sprang sie in einer Kurve von der Bahn und machte sich davon, während die Verfolger mit den Fahrgästen und dem Schaffner kämpften.
Eine Hoffnung hatte sie noch: Twerskaja 36, Ecke Glinischtschewskaja-Gasse, das Haus der Kommunistischen Internationale in Moskau, Ervin hatte ihr abgeraten:
„Geh nicht hin. Die verpfeifen dich auf der Stelle.“
Sie hatte sich nicht abhalten lassen.
„Guten Tag, ich wollte in der deutschen Abteilung den Genossen Wilhelm Pieck sprechen.“
„Warten Sie bitte einen Augenblick.“
Der Wachhabende telefonierte mehrmals und lange.
Neugierig schaute sie sich in dem legendären Gebäude um. Marmorner Fußboden, Marmorsäulen, riesige, goldgerahmte Spiegel an den Marmorwänden. Eine offene breit angelegte Freitreppe führte ins erste Obergeschoß. Es gab in der riesigen, kühlen Eingangshalle aber keine Sitzgelegenheit, keine Blume, kein Gehölz. Alle Leute, die hin- und herliefen, die von oben kamen und auf die Straße wollten ebenso wie diejenigen, die von der Straße das Haus betraten, schienen Bewohner zu sein. Bereitwillig wiesen sie dem Wachhabenden an der Treppe ein gestempeltes Papier vor, Lena war die einzige, die zum Warten aufgefordert worden war.
Das also war das Haus, in dem die nach Moskau geflohene oder nach Moskau beorderte kommunistische Internationale lebte und arbeitete, furchteinflößend schon die Straße, auf der Milizionäre patrouillierten, furchteinflößend die Eingangshalle, furchteinflößend die Wachposten an Treppe und Lift.
Ende des vergangenen Jahrhunderts hatte Rußlands berühmtester Bäcker Filippow über dem elterlichen Brotladen das Renommiergebäude errichten lassen, in dem es für jedes Portemonnaie eine preiswerte Delikatesse gab. Filippow hatte die sibirischen Städte von Moskau aus mit frischen Kringeln und Brötchen versorgt, mit Piroggen, die mit Rosinen oder Pilzen gefüllt waren, mit Kohl, Fleisch, Spinat, Fisch, Konfitüre, Eiern oder Quark. Von ihm stammte die Erfindung, ofenfrische Ware einzufrieren, in Irkutsk, oder Omsk erneut in den Ofen zu stecken und aufzutauen.
Von ihm stammte die Erfindung des Rosinenbrötchen, denn als der Moskauer Generalgouverneur den Bäcker einsperren wollte, weil er eine Küchenschabe im Frühstücksgebäck gefunden hatte, steckte sich Filippow das verdächtige Kuchenstück in den Mund mit der Bemerkung:
„Das war keine Küchenschabe, Hochwohlgeboren, sondern eine Rosine.“
„Als ob es schon jemals in der Welt ein Rosinenbrötchen gegeben hätte“, schrie der Machthaber den pfiffigen Bäckermeister an.
„Doch, Hochwohlgeboren“, hatte Filippow geantwortert, „ab heute in Rußland.“
Lena kannte die Anekdoten, die sich über Filippow sogar im nachrevolutionären Moskau erhalten hatten. Die Filippowschen Erben waren enteignet worden, aber der Geist des alten Moskaus war nicht zu tilgen gewesen. Dies hier also hatte Filippow gebaut, zu seiner Zeit mit offenen Türen, durch die Damen in Pelzen und Kerle in Lumpen ein- und ausgingen, zu seiner Zeit mit fünfzig verschiedenen Verkaufstheken, hinter denen fünfzig verschiedene Backwaren an die hereinströmende Bevölkerung verkauft wurden, zu seiner Zeit mit lauschigen Eckchen hinter subtropischen Pflanzen ... Lena bedauerte sehr, daß den heutigen Internationalisten diese Annehmlichkeiten entzogen waren ...
„Sie wollten mich sprechen!“
Lena fuhr zusammen. Ein großer blonder Mann mit Berliner Schiebermütze auf dem Kopf und klobiger Pfeife im Mund hatte sie russisch angesprochen.
„Ich wollte zum Genossen Wilhelm Pieck.“
„Wer sind Sie denn?“
„Magdalena Awgustowna Rubina.“
„Das Magdalena Awgustowna können Sie sich schenken, Sie sind Frau Rubina, das genügt, und was wollen Sie?“
„Ich fürchte verhaftet zu werden.“
„Was haben Sie angestellt? Bankeinbrüche werden streng bestraft und zwar nicht nur hier, sondern auch in Paris und London.“
„Genosse ...“
„Sagen Sie lieber Herr zu mir, ich bin Herr Müller, Friedhelm Müller.“
„Herr Müller, ich bitte Sie dringend, nicht zu spaßen. Es geht um Tod und Leben.“
„Ich spaße nicht, für die Arbeiterklasse ist es immer um Tod und Leben gegangen, aber doch nicht für feine Damen wie Sie ... Also Sie wollen zu Wilhelm Pieck? Was wollen Sie von Ihm?“
„Ihn informieren über den Zustand der Partei an der Basis. Willkürliche Verhaftungen werden vorgenommen. Leute ohne Fehl und Tadel verschwinden spurlos. Ich selbst, die sich nichts zuschulden hat kommen lassen, bin auf der Flucht.“
„Auf der Flucht wovor?“
Lena zögerte mit der Antwort.
„Auf der Flucht vor Gespenstern, wahrscheinlich.“
„Vor den Sicherheitsorganen.“
„Vor den Sicherheitsorganen flieht man nicht, den Sicherheitsorganen stellt man sich. So wird es gemacht von Genossen meiner Partei.“
„Ich weiß nicht, ob es die GPU ist, die mich verfolgt oder die Sicherheitsorgane des Innenministeriums.“
„ ... oder Alvares Totschläger vielleicht? Was bilden Sie sich eigentlich ein? Sie kommen von der Straße hereingeschneit und wollen mit Wilhelm Pieck sprechen? In der Partei, der ich angehöre, nennt man so etwas eine faschistische Provokation!“
„Mein Parteivorsitzender Wilhelm Pieck hat in Berlin gesagt, daß jeder zu ihm kommen kann, der Sorgen hat.“
„Berlin! Was für Wörter Sie in den Mund nehmen! Ist Berlin nicht diese verkommmene deutsche Stadt, in der Arbeiter aus ihren Wohnungen gezerrt und auf offener Straße abgeknallt werden? Ist Berlin nicht dieser konfus zusammengewürfelte Haufen von Protzbauten, in denen eine wild gewordene Bourgoisie, aus der wahrscheinlich Sie stammen, mit Landsknechtsfahnen durch die Straßen taumelt und alles niedermacht, was ihr unter die Finger kommt? Also, bitte, kommen Sie mir nicht mit Berlin!
Aber Lena wollte nicht streiten, jetzt nicht. Sie versuchte den Mann zu beruhigen:
„Ist er im Hause?“
„Wer?“
„Wilhelm Pieck.“
„Er ist nicht im Hause, und wenn er es wäre, würde ich auch nein sagen.“
„Dann möchte ich einen anderen Verantwortlichen von der KPD sprechen.“
„Wen?“
„Woher soll ich wissen, wer von den deutschen Genossen hier wohnt.“
„Aber daß Wilhelm Pieck hier wohnt, das wissen Sie.“
Lena sagte nichts mehr. Sie sah lange schweigend den Mann an, der als Vertreter der deutschen Gruppe vor ihr stand, groß, blond, blaß, als käme er direkt aus dem Gefängnis, herausfordernd fest sein Schritt, mit dem er auf sie zugetreten war, Pfeife im Mund, die er nur herausnahm, wenn er zu sprechen anhob, auf dem Kopf seine schäbige graue Mütze. Er kam Lena vor wie der Prototyp des Arbeiters, der in der Partei aufgestiegen war und nun glaubte, das große Wort führen zu müssen. Eigentlich einer, zu dem sie Vertrauen hätte fassen können, dessen abweisender und beleidigender Ton aber eine unüberwindliche Schranke zwischen ihnen aufgebaut hatte: Er gehörte dem inneren Kreis der Parteiführung an, sie dagegen war die in Demutshaltung außenstehende Genossin von der Basis. Zwischen ihnen gab es kein verbindendes Band. Der Mann, der sich Friedhelm Müller nannte, wich ihrem forschenden Blick nicht aus, lächelte sogar leicht, als errate er ihre Gedanken, und als ihr Blick abschweifte, sagte er leichthin:
„Damit ist unser Gespräch wohl beendet.“
Machte auf dem Absatz kehrt. Indem er auf die Haupttreppe zuschritt und dem dortigen Posten unaufgefordert ein Papier vorwies, registrierte sie noch, daß sein Gang schleppend war, das Kreuz gebeugt, als trüge er an einer schweren Last, die er, die Hand am Geländer, Stufe für Stufe die Treppe hinauftrug, bevor er hinter dem Zwischenpodest verschwand. Den Lift, von zahlreichen Personen genutzt, verschmähte er.
Aber vielleicht, und der Gedanke kam ihr, als sie wieder auf der Twerskaja stand, und nicht wußte, was sie noch tun könnte, aber vielleicht hat der unhöfliche Kerl ihr nur eine Warnung zukommen lassen. Vielleicht hat er ihr nur sagen wollen: Gehen sie, verstecken Sie sich, wir haben uns auch schon versteckt.
Danach ertrug sie die Wohnung nicht mehr. Tagelang irrte sie durch die Stadt, aus Angst, verhaftet zu werden. Sie konnte ihre Zweifel nicht länger zähmen. Ja, wenn sie Karcsi an ihrer Seite gehabt hätte, dann wäre auch aus ihr ein stählerner Mensch ohne Zweifel geworden. Sie hätte es von Herzen gewollt. Aber es gab ihn mit einem Mal nicht mehr. Sie wußte, daß sie das Zeug dazu hatte, ein weiblicher Friedhelm Müller zu werden, sie benötigte dazu nur ein Stückchen des Fadens, an den sich die Friedhelm Müllers in der Welt orientierten, doch der wurde ihr nicht gereicht.
Auf der Flucht schlief sie frierend unter Brückenbogen, von Kartons und weggeworfenen Lumpen zugedeckt. Auf der Flucht schlürfte sie Wasser aus Pfützen. Auf der Flucht stopfte sie sich Abfall in den Mund. Auf der Flucht begann sie leise vor sich hin zu sprechen. Meist leise, manchmal aber auch laut gestikulierend sprach sie mit Toten, Vermißten und aus ihrem Leben Verschwundenen. Auf der Flucht verteidigte sie sich leidenschaftlich gegenüber dem einarmigen Obersten Baragamow, der ihr Vorwürfe machte, weil sie ihr Versprechen nicht einhielt:
„Es ist nicht so einfach, lieber Oberst, den Mars am Sternenhimmel aufzusuchen. Wir hätten uns auf die Kassiopeia oder den Großen Bären einigen sollen, die sind leicht zu finden, aber einen Planeten? Man sagt nicht ohne Grund Wandelsterne zu ihnen. Mal wandeln sie hierhin, mal dorthin, oft sind sie gar nicht zu sehen ...“
György, der Talmudkundige, den sie das letzte Mal vor fünfzehn Jahren gesehen hatte, tauchte plötzlich in ihren Gedanken vor ihr auf.
„Ja, spotten Sie nur, György Josefowitsch, aber die Wahrheit ist, daß ich nicht überheblich bin. Ich war es nie. Ich habe immer nur um meine Rechte kämpfen müssen. Sie sind in einem behüteten großbürgerlichen Haus aufgewachsen. Sie haben keine Ahnung, wie es bei uns in Schlesien im Haushalt eines glücklosen Hausierers aussah, der Vater andauernd unterwegs mit Schnürsenkeln und Bindfaden, kaum war er zu Hause, verprügelte er Mama und uns Kinder ...“
„General“, sprach sie leise auf den Chef der Militärakademie ein, „ich weiß nicht, weshalb man Sie erschossen hat, wahrscheinlich ist auch Ihr Tod nur ein tragischer Irrtum, aber das, was Sie uns beigebracht haben, ist - glaube ich - falsch. Ich habe Zeit gehabt, darüber nachzudenken, und glaube nun nicht mehr an Ihre Lehren ...“
“Karcsi, Lieber, du hast mir weh getan. Ich habe nicht vergessen, daß wir nur zum Schein geheiratet haben. Aber mußtest Du dieses häßliche Weibstück mir vorziehen? Immerhin bin ich hübscher als dieses langnasige Mausgesicht. Warum hast du mir das angetan? Ich habe dir eine gute Ehefrau sein wollen, auch wenn ich mich weigerte, diese dämliche Perücke zu tragen ...“
Gesichter, die sie lange vergessen glaubte, tauchten plötzlich in der Erinnerung vor ihr auf: Kurt, der Freund aus der Geigenstunde, gefallen im ersten Kriegjahr; Ernö aus Baracke 23 des ehemaligen Wiener Seuchenhospitals; der Synagogendiener, der Karcsis Vater den Gebetsriemen für den Kopf überreichte; Kudratkin, der auf seiner Munitionskiste stehend die Sprengung von siebenundzwanzig Kirchen in Tobolsk, Ischim, Tabda und Omsk verkündete ...
Zachert fiel ihr ein, als sie über eine schmutzige Pfütze gebeugt plötzlich in ihr Spiegelbild sah, Rudolf Zachert, aber sie hatte ihn immer burschikos nur Zachert genannt: Zachert! der in Berlin vor ihrer Abreise nach Moskau ihr Lebensgefährte gewesen war, stark in der Liebe, obwohl kein Jude stark im Glauben auch er. Als sie 1923 von Wien aus nach Berlin zurückgekehrt war, Karcsi, ihr jüdisch Angetrauter, im Horthy-Gefängnis, stand sie, Lena, eines Tages mit Zachert vor dem Shell-Haus am Landwehrkanal und er hatte nach oben gewiesen: „Dort im fünften Stockwerk genau in der abgerundeten Ecke werde ich eines Tages sitzen als Staatssekretär im sozialistischen deutschen Außenministerium und eine Protestnote gegen die US-amerikanische Besetzung Boliviens unterschreiben ...“ Wenn sie durch Berlin spazierten, nie Arm in Arm, beide gestikulierend aufeinander einredend, pflegte er die Bauwerke des deutschen Hochimperialismus, wie er sich ausdrückte, zu enteignen: Das Berliner Schloß ernannte er zur Reichsirrenanstalt Rote Fahne, den Berliner Dom zum Tanzpalast Rosa Luxemburg und den Reichstag zum Warenhaus Josef Wissarionowitsch Stalin. Sie saß frierend vor der Pfütze und hoffte, daß neben ihrem Spiegelbild auch Zacherts Gesicht auftauchen möge, aber es tauchte nicht auf, so sehr sie auch versuchte, es sich vorzustellen.
Mit August, ihrem Vater, zeterte sie in erbitterten Tiraden, indem sie ihm, der nichts zu begreifen schien, immer wieder ihre verpfuschte Kindheit vorhielt. Mit Karcsis Schwester Esther führte sie ein langes, hartes Streitgespräch über Jungfräulichkeit in der Hochzeitsnacht, über Gott, über die Welt. Immer neue Argumente führte Esther ins Feld, am Ende jedoch gelang es Lena, die spitzfindigsten Beweise ihrer Widersacherin für die Existenz Gottes mit noch spitzfindigeren Argumenten zu widerlegen ... Und als sie eines Tages unter der Jausabrücke am Pokrowskij Bulwar Satinajews Gesicht erkannte, hielt sie auch dieses im ersten Moment für eine der üblichen Erscheinungen.
„Satinajew“, sagte sie, „ich habe oft an Sie denken müssen in letzter Zeit. Ich habe mich erbärmlich Ihnen gegenüber aufgeführt.“
„Aber wieso denn, Sie haben mir einen Rubel geschenkt.“
„Damit habe ich mich bloß freikaufen wollen für meine Überheblichkeit Ihnen gegenüber.“
„Und für die wertvollen Auskünfte, die ich Ihnen geben durfte, beruhigen Sie sich.“
„Ich habe mich lustig gemacht über Sie. Das war falsch von mir, und ich bitte Sie um Verzeihung.“
„Sie brauchen sich nicht zu entschuldigen,“, sagte Satinjew, „ich sehe doch, daß Sie im Unglück sind zur Zeit und bedaure es sehr. Ich wünschte, ich könnte Ihnen helfen.“
„Sie haben mir schon einmal geholfen, indem Sie mir den Weg aus dem Chitrowski Markt zeigten“, sagte Lena, „Sie könnten mir auch jetzt helfen.“
„Aber wie?“ sagte Satinajew, „aber wie?“
Erst da merkte Lena, daß sie diesmal einen lebendigen Menschen vor sich hatte und keine Traumgestalt, wie in den letzten Tagen. Satinajew bot eine noch traurigere Erscheinung als vor einem Monat. Über seinen knisternden Schlafanzug hatte er eine alte Pferdedecke geworfen, die er mit hochgezogenen Schultern und fest an sich geklemmten Achseln am Herunterrutschen hinderte.
„Ich kann nicht in meine Wohnung zurück.“
„Weshalb nicht?“
„Weil ich fürchte, verhaftet zu werden.“
„Haben Sie Geld?“ fragte Satinajew besorgt.
„Nein, nichts mehr.“
„Könnten Sie sich Geld besorgen?“
„Unmöglich. Ich werde beobachtet und will meine Freunde nicht reinreißen.“
„Sie könnten mir den Schlüssel zu Ihrer Wohnung geben und ich hole Ihnen das, was Sie benötigen.“
„Meine Wohnung wird überwacht.“
„Ich glaube“, sagte Satinajew, „Sie sehen Gespenster. Wer sollte einer so netten und freundlichen Frau wie Ihnen nach dem Leben trachten?“
„Es gibt Anzeichen dafür“, sagte Lena, „es gibt Anzeichen.“
„Vielleicht kenne ich jemand, der Ihnen helfen könnte“, sagte Satinajew nach kleiner nachdenklicher Pause, „kommen Sie.“
Und so geschah es, daß sie sich eines Tages erneut auf dem Chitrowski Markt wiederfand, als sei der Chitrowski Markt auch für sie, wie für viele andere, die letzte Zuflucht.
„Aber ich kann nichts versprechen“, sagte Satinajew.
Besorgt, sie am Ellbogen geleitend, führte Satinajew sie an den Bettlern, Huren und Verstümmelten vorbei zum Kulakowschen Haus, vorbei an Fischbratküche, Kaschatopf und Kwastonne, vorbei an rauchenden Holzfeuern, an denen sich frierende Zerlumpte wärmten, vorbei an ausgemergelten Kindern, die vor zwei Monaten mit krallenartigen Fingern nach ihr gegriffen hatten, doch nun war Lena selbst so abgerissen und schmutzig, daß sie keine Notiz von ihr nahmen. Satinajew führte sie in den Hinterhof, vorbei am Eingang des ehemaligen Nachtasyls, das nun Hotel Erster Mai hieß, vorbei an Haufen von Unrat, in denen Ratten huschten.
Der dem ehemaligen Nachtasyl gegenüberliegende Hinterhaustrakt war unter der Last der eigenen Wände und des Daches zusammengebrochen. Nur der Keller schien bewohnt zu sein.
„Kommen Sie“, sagte Satinajew, „ich kann Ihnen nichts versprechen, aber einen Versuch sollte dieser Besuch Ihnen wert sein.“
Die Bewohner der Ruine, ein Mann und eine Frau, saßen, auf Stühlen an einem Tisch, alte, ausländische Magazine vor sich, in denen sie blätterten. Aufmerksam schauten sie den Ankommenden entgegen. Die Frau, machte den Eindruck einer Unternehmerin in einfachen Verhältnissen: Ein bißchen zu dick gepudert, dachte Lena. Der Mann mit Spitzbart, um den Hals ein kunstvoll geknotes rotes Tuch: Könnte Alleinunterhalter sein, dachte Lena. Quer durch den Raum führte ein dickes Ofenrohr, das mit Drähten an der Decke befestigt war und zu einem Kanonenofen führte, auf dem eine dicke, dampfende Teekanne stand.
„Gestatten, Hochwohlgeboren“, sagte Satinajew geschmeidig, „wenn ich Ihnen ... Lena unterbrach ihn:
„Ich bin Magdalena Awgustowna Rubina, ehemalige Dozentin für deutsche Sprache an der Militärakademie ... “
Der Mann verneigte sich sitzend:
„Angenehm.“
„Und das ist Fürst Anatolij Arkadewitsch Dolgorukow“, sagte Satinajew leise, und auf Lenas erstauntem Blick: „Sehr richtig, aus dem Stamm derer, die dem Vaterland bereits in der Vergangenheit unschätzbare Dienste erweisen durften.“
Der Fürst hielt Lena die Hand hin, die sie zögernd ergriff. Er zog die Widerstrebende ein wenig näher zu sich heran, und indem er mit beiden Händen die Ihre umschloß, als wolle er sie schützen, sagte er: „Haben sie keine Angst, hier passiert Ihnen nichts“, er wies auf die Frau am Tisch: „Meine Frau, Großfürstin Katarina Fjodorowna Urussowa.“
Die Frauen deuteten gegenseitige Verbeugungen an.
„Wobei kann ich Ihnen helfen?“ fragte der Fürst, und mit einem Blick zu Satinajew: „Er schleppt mir andauernd Hilfesuchende an, als sei ich Jesus.“
„Frau Rubina“, sagte Satinajew, „hat Grund zu der Annahme, unter Beobachtung zu stehen. Sie ist auf der Suche nach einem Unterschlupf ...“
„Bolschewikin, nicht wahr?“ sagte der Fürst lächelnd.
„Selbstverständlich“, sagte Lena.
„Und nun auf der Flucht?“
„Auch das stimmt.“
„Sie sind Deutsche?“
„Ja.“
„Sprechen sie noch andere Sprachen?“
„Französisch ein wenig und ein wenig englisch.“
„Mein Gott!“, sagte der Fürst, „was sind das für Zeiten, und wie wird das alles noch einmal enden?“
„Treten Sie doch bitte einmal näher“, sagte die Großfürstin, und winkte Lena heran. Zögernd machte Lena einige Schritte zu ihr hin. „Kommen Sie“, sagte die Großfürstin, „kommen Sie, geben Sie mir Ihre Hand, na, los, geben Sie sie mir schon.“
Die Großfürstin nahm Lenas ausgestreckte Rechte in beide Hände, drehte und wendete sie mehrmals, bevor sie sich in die Handfläche vertiefte: „Sie spielen Geige“, sagte die Großfürstin, „aber nicht sehr gut. Obwohl Sie besser spielen könnten. Nein, eine Künstlerin sind Sie nicht, aber wenn Sie sich ein wenig mehr Mühe geben würden, könnten sie eine passable Dilettantin werden. Also, meine liebe Dame, was ich auf den ersten Blick sehe, ist, daß Sie in Kürze eine lange Reise antreten werden, auf der Sie viele interessante und bedeutende Persönlichkeiten kennenlernen.“
Mein Gott, dachte Lena, sollte es tatsächlich wahr sein, daß ich mit Ervin fahre? Der Gedanke verwirrte sie. Dann muß ich mich beeilen. Nächste Woche sitzt er im Zug.
„Ich bin Sowjetbürgerin“, sagte sie, „ich kriege keinen Paß.“
„Sie werden fahren“, sagte die Großfürstin, „glauben Sie es mir, Sie werden fahren. Ihre Reise wird sehr lange dauern. Sie wird Sie in überaus attraktive Gegenden führen, Sie werden sich vorkommen wie eine Auserwählte, aber reich werden sie dabei nicht. Wenn ich mich tiefer in ihre Handlinien einfühle, so kann ich sagen, daß Sie lange leben werden und Ihr Tod wird leicht sein. Momentan sind Sie allerdings sehr arm. In Ihrem Portemonnaie befinden sich ...“
„ ... siebenundzwanzig Kopeken“, rief der Fürst ihr zu, „ein abgefahrenes Straßenbahnbillett und eine kleine Brosche mit abgebrochener Nadel“, er hielt Lenas Geldbörse in Händen und kramte in ihr, nein“, rief er, „mehr ist beim besten Willen nicht zu finden“, er zog den Reißverschluß zu und reichte Lena ihr Eigentum zurück.
„Was fällt Ihnen ein“, rief Lena und schaute in ihr Handtäschchen, „wie kommen Sie zu meinem Portemonnaie?“
„Vielleicht könnte ich doch was für Sie tun“, sagte lächelnd der Fürst, „zum Beispiel könnten Sie bei mir lernen, wie man an die Geldtaschen anderer Leute kommt.“
„Sie hat die richtigen Händchen dafür“, sagte sie Großfürstin, „Ich habe schon lange nicht so feine, gelenkige Finger gesehen.“
„Meine Frau, Katarina Fjodorowna, ist unpäßlich zur Zeit“, sagte der Fürst, „sie hat Angst, daß ihre Finger nicht mehr lange mitmachen in dem schwierigen Beruf, den wir ausüben. Deshalb sehen wir uns nach einer Partnerin um. Wir wohnen nicht hier, sondern als Bürger Arkadow und Bürgerin Fjodorow in einer ordentlichen Gegend mitten unter dem Volk. Unsere alten Titel führen wir nur hier, wo man uns kennt. Wir halten uns hier auf, weil wir auf das Wunder einer natürlichen Begabung hoffen.“
„Das könnte sie sein“, rief die Großfürstin, „mein Gott, ich glaube fast, sie ist es.“
„Sie haben“, sagte Lena, “mein Problem nicht richtig erkannt.“
„Doch, doch“, sagte der Fürst, „wir haben es erkannt. Sie fürchten, von Ihren Genossen liquidiert zu werden. Deshalb irren Sie durch die Stadt, ein gefundenes Fressen für Spitzbuben aller Art. Wir helfen Ihnen, indem wir Ihnen ein neues Aussehen geben, neue Papiere, neue Wohnung, mit einem Wort ein neues Leben. Allerdings auf Ihr bisheriges Leben müßten Sie verzichten, auf alle Ihre bisherigen Freunde, aber auch Ihre Feinde würden Sie verlieren, das sollten Sie bedenken. Die Einzelheiten müßten wir noch besprechen. Sie dürften ab sofort mit Ihrem bisherigen Umgang nirgendwo mehr zusammentreffen, nicht einmal zufällig.“
„Man wird mich suchen.“
„In einer Zeit, in der tagtäglich Menschen spurlos verschwinden? Aber Frau Rubina! Man wird Sie vermissen, man wird Sie heimlich beweinen, aber niemand wird Sie suchen. Es ist nicht die Zeit, sich unvorsichtigerweise auf die Suche nach vermißten Menschen zu begeben.“
„Sie brauchen sich nicht gleich zu entscheiden“, sagte die Großfürstin.
„Aber warten Sie nicht allzu lange“, sagte der Fürst, „kommen Sie morgen wieder. Wir erwarten Sie. Katarina Fjodorowna, geben Sie ihr fünf Rubel.“ Und zu Satinajew: „Sie kann in Objekt 27 übernachten.“
„Der Fürst“, sagte Satinajew hinterher, „war meine einzige Hoffnung.“
„Ist es ein echter?“ fragte Lena.
„Ein waschechter“, sagte Satinajew.
„Aber vielleicht“, sagte Lena, „ist er ein Spitzel, wie hätte er sonst überleben können.“
„Werden Sie morgen Ihre Chance wahrnehmen?“ fragte Satinajew.
„Ich weiß nicht“, sagte Lena, „ich glaube nein, oder was meinen Sie? Ich soll Taschendiebin werden?“
„Darauf läuft es hinaus.“
„Herr Satinajew, ich bitte Sie, ich bin doch keine Taschendiebin. Da lachen ja die Hühner.“
„Die Hühner sollten darüber nicht lachen“, sagte Satinajew, „der Fürst und die Großfürstin hatten ursprünglich auch andere Berufsziele. Sie haben Eindruck gemacht, und sollten morgen Ihre Chance wahrnehmen, mir hat der Fürst noch nie ein solches Angebot gemacht. Überschreiten Sie den Rubikon! Ein Zurück gäbe es dann allerdings nicht.“
Objekt 27 entpuppte sich als Sprengkammer unter der Gartenring-Brücke am Semljanoi Wall. Sie war mit alten Matratzen ausgestattet. Das Wasser der Jausa unter ihnen war verdreckt und stank nach Petroleum.
„So“, sagte Satinajew, „wir sind angekommen. Dies hier ist Ihre Bleibe vorläufig.“
„Und Sie?“
„Ich bin flexibel“, sagte Satinajew, „mal hier, mal dort“, er druckste ein wenig, „sagen Sie, Margareta Awgustowna, ob ich wohl heute bei Ihnen übernachten dürfte?“
„Aber ja“, sagte Lena, „hier ist Platz. Wir werden uns einrichten so gut wir können.“
„Hier kommt kaum eine Polizeistreife her. Die Gegend ist den Beamten zu dreckig. Sie können sich nicht denken, daß ausgerechnet dieses Fleckchen Sicherheit bietet.“
Sie blieben wach bis spät in der Nacht, wisperten dieses und jenes und versuchten, an den Lichtern der Stadt zu erkennen, um welche Gebäude es sich handelte. Wenn Satinajew sich im Erraten eines Bauwerks geirrt hatte und Lena die Siegerin blieb im Erraten, so war er derjenige, der imstande war, die Historie der an ihren Lichtern erkannten Gegend bis auf Peter den Ersten zurückzuverfolgen, manchmal sogar in eine noch frühere Zeit.
In der Dunkelheit bekam auch der Fluß ein anderes Gesicht. Der im Wasser treibende Abfall war nicht mehr zu erkennen, die schwärzlich gefärbte Flut glitzerte im Schein der Straßenlaternen. Die vorüberziehenden Schatten des Straßenverkehrs gaben dem Fluß etwas Gespenstisches. Zuerst war er hoch über ihnen mit hundert Pferdehufen und hundert eisenbeschlagenen Reifen dahingepoltert, mit zunehmender Stunde war er spärlicher geworden, bis er fast gänzlich verschwand,
„Satinajew.“
„Ja?“
„Die Professorenwitwe, erinnern sie sich?“
„Ja, was ist mit ihr?“
„Die Lippen-, Lid- und Nasenlose.“
„Ja, ich weiß, wen Sie meinen.“
„Ich habe sie heute nicht gesehen.“
„Sie werden sie nie mehr sehen.“
„Wieso nicht?“
„Sie ist abgeholt worden.“
„Vom Chitrowski Markt?“
„Als trotzkistische Provokateurin.“
„Als trotzkistische Provokateurin“, wiederholte Lena leise, „als trotzkistische Provokateurin ...“
„Sie hat es wirklich zu dick getrieben mit ihrem ewigen Stalin hier, Stalin da. Alle hatten Angst vor ihr und ihrem Mundwerk. Ohne sie ist das Leben bei uns leichter geworden.“
„Und Anatoli?“
„Der ohne Beine auf seinem Rollwägelchen?“
„Ja.“
„Hat sich das Leben genommen. War wohl auch besser für ihn. Nachdem die Burgina weg war, ich meine die Professorenwitwe, hatte das Leben für ihn keinen Sinn mehr ...“
„Sie hatten ein Verhältnis miteinander?“
„Ein überaus kompliziertes.“
Um Mitternacht befand sich nur noch hin und wieder ein Fahrzeug auf der Straße. Lena hörte es jedesmal von weit anrollen, während die Stille der Nacht schon über ihnen lag, sie hörte es anrollen, während sie lauschte und lauschte. Würde es nicht vorher in eine Nebenstraße abbiegen und dann verschluckt sein in der Nacht, wie schon mehrmals zuvor? Jetzt aber kam ein nächtliches Pferdegespann mit klappernden Hufen und eisernem Rollen vom nördlichen Gartenring, überquerte Jakowlowgasse, überquerte Woronzowofeld-Straße, überquerte Kriwogrusingasse ... als habe sie einen lebendigen Stadtplan in der Vogelperspektive vor sich, sah Lena in Gedanken die Kutsche näherkommen ... und polterte mit ohrbetäubendem Krach über die Brücke.
Lena hatte ihren Kopf an Satinajews Schulter gelegt, der mit starrem Blick an den Brückenpfeilern vorbei in den Himmel sah.
„Schlafen Sie denn nie?“ fragte Lena.
„Wenig“, sagte Satinajew, „und wenn, dann immer wie ein Hase mit offenen Augen, um jederzeit aufspringen und weglaufen zu können.“
„Weshalb das?“
„Wollen Sie das wirklich wissen?“
„Ja.“
„Ich bin ein Chodynskojer,“ sagte Satinajew und lachte.
„Na und?“
„Das Chodynskoje-Feld kennen Sie?“
„Ich war nicht dort, aber ich weiß, was da passiert ist.“
„Ganz Rußland ist ein Chodynskoje-Feld. Immer sind wir dabei, etwas Großes anzustellen, etwas noch nie Dagewesenes, und immer führt, was wir tun, in die Katastrophe.“
“Eine Millionen Menschen, sagt man, sind damals zu Ehren der Krönungvon Zar Nikolaus dem Zwoten nach Chodynskoje hinausgezogen.“
„Unter ihnen Papa, Mama, zwei Töchter, drei Söhne, ich der Jüngste, und außer mir sind alle umgekommen damals, zertrampelt, erschlagen, erdrosselt, zerschmettert.“
„Zehntausend Menschen, sagt man, sind damals umgekommen oder beschädigt worden für ihr späteres Leben.“
„Bei einer Katastrophe in Paris sind vielleicht neun Tote zu beklagen, bei einer Katastrophe in London fünf, höchstens sechs, und sogar in der Türkei, wenn da mal was passiert, kann man die Toten an zwei Händen abzählen. Findet in Rußland eine Katastrophe statt, geht es immer gleich in die Zehntausende ... Stellen Sie sich einen tausendmal vergrößerten Chitrowski Markt vor und dort drin eine Million Menschen dicht an dicht bei einer Volksbelustigung neben der anderen.“
„Ich weiß nur, daß seitdem Chodynskoje das Wort ist für Rußlands Schicksal.“
„Ich war damals fünf Jahre alt und saß bei meinem Vater auf der Schulter, als plötzlich mitten im Gedränge bei einer Fischbratküche Panik ausbrach.“
„Irgendjemand hatte Feuer gerufen oder etwas ähnliches, das vielleicht nur so klang, stand in der Zeitung.“
„Und im Nu war aus der Volksbelustigung Massenterror geworden, jeder kämpfte gegen jeden mit Zähnen und Krallen. Wie ich gerettet werden konnte, weiß ich nicht, aber ich habe mich nie davon erholt. Zehntausend Tote und Verwundete, stellen Sie sich das mal vor, wie im Krieg am Ende einer Schlacht. Das ist Rußland.
Zu ihrer Ausbildung als Taschendiebin kam es nicht. Am nächsten Vormittag wurde Lena von der Miliz als Landstreicherin aufgegriffen, und man hielt sie fest, bis sich herausstellte, daß sie eine Wohnung besaß.
„Sie haben eine Wohnung und treiben sich in der Kanalisation herum?“ schrie der Milizionär sie an.
Neidisch schaute er sich in ihrer Wohnung um.
„Bücher über Bücher“, sagte er, „wohnen Sie alleine hier?“
„Nein, die alte Frau Golowina, Varja Platonowa, wohnt auf der anderen Seite des Korridors, wir haben gemeinsame Küchenbenutzung ...“
„Sie sollten sich schämen“ schrie der Milizionär sie an, „wo ich wohne, leben zwei Familien in einem Raum, vier Kinder insgesamt. Und Sie? Anstatt glücklich zu sein, so wohnen zu dürfen, führen sich auf wie eine Verrückte. Meine Güte, Sie sind doch eine gebildete Frau.“
Danach hatte sie sich eingeschlossen, die Fenster zugenagelt, vor die Tür Schränke gerückt. Eva war gekommen, die Freundin von der anderen Seite der Kleinen Steinbrücke. Sie hatte geklopft, gerufen, wieder geklopft, dann aus Sorge um die Freundin den Hauswart geholt:
„Vielleicht ist ihr was geschehen?“
Der Hauswart hatte mit seinem Schlüssel die Tür geöffnet und war ironisch geworden, als er die zusammengerückten Möbel wegschieben mußte, um eintreten zu können.
„Nanu, wollen Sie umziehen?“ Und mit Blick auf die zugenagelten Fenster: „Achso, Sie erwarten einen Taifun.“
Es war klar, daß er, zu Hause angekommen, sich hinsetzen würde, um einen Bericht zu schreiben. Wahrscheinlich formulierte er in Gedanken schon die Höhepunkte seines Textes, wie zum Beispiel seine ironischen Bemerkungen über den vielleicht bevorstehenden Umzug und die Erwartung eines Unwetters. Die Genossen in der Registratur sollten mal was zum Lachen haben.
„Mein Gott, wie sehen Sie aus?“ hatte Eva gerufen, „Sie brauchen Hilfe. Wollen Sie nicht zu mir kommen? Dann könnten Sie den ganzen Tag im Bett liegen und sich von mir bemuttern lassen.“
Immer, wenn sie später an Eva dachte, fielen ihr diese warmen Worte ein. Wo sie sich befand und in welcher Situation sie stak, immer klangen diese Worte in ihr nach. Einmal im Leben eine solche Freundin besessen zu haben, dachte sie, entschädigt für vieles. Zum Angebot der Freundin hatte sie den Kopf geschüttelt:
„Danke, Eva, ich muß allein damit fertigwerden.“
Eva Abramowna Fainstein entstammte einer Intellektuellen-Familie aus Chmielnik im zaristischen Polen, die um 1910 mit ihr als Kind nach Deutschland übersiedelte. Wahrscheinlich hatte die Zarenherrschaft sie vertrieben. Nach der Revolution verließ Eva, volljährig geworden, Deutschland und zog nach Petrograd, dem ehemaligen Sankt Petersburg, das bald danach in Leningrad umbenannt werden würde. Dort heiratete sie Lazar, einen Moskauer russischen Revolutionär, der in der Schweiz Kurierdienste für Lenin erledigt hatte. Er sprach mehrere Sprachen fließend: russisch, deutsch, polnisch, englisch, französisch ... die ganze Sprachenskala der russisch-polnisch-jüdischen Intelligenz.
Lazar war in den zwanziger Jahren und Anfang der dreißiger ein wichtiger Mann in Moskau gewesen. Andauernd war er im Ausland unterwegs. Natürlich durfte er seine Frau nicht mitnehmen. Wenn sie dann in Moskau Empfänge für Ausländer gaben, hieß es immer:
„Was für eine bezaubernde Frau Sie haben, Lazar Lazarowitsch, wenn Sie das nächste Mal zu uns kommen, müssen Sie die Gemahlin unbedingt mitbringen.“
Selbstverständlich, hieß es dann, of course, naturellement, estestwennij ... Aber ebenso selbstverständlich dachte niemand im Ernst daran, daß die sowjetische Administration der Ehefrau erlauben würde, mit ihrem Gatten ins Ausland zu reisen.
Eva hat sehr unter dieser Heuchelei gelitten. Sie hat sehr darunter gelitten, daß man ihr so wenig Vertrauen entgegenbrachte und sie als Geisel betrachtete, die zu Hause bleiben mußte und damit eine zumindest schwache Garantie dafür bot, daß der Ehemann nicht im Ausland blieb.
Lena lernte sie kennen, als Eva einsam auf einer Bank im Neskutschnij-Garten saß und sich ausheulte. Kurze Zeit danach trennte sie sich von ihrem Mann. Sie zog aus der geräumigen Wohnung in der Twerskaja in eine winzige auf anderen Seite der Kleinen Steinbrücke, die sie mit einer Familie zu teilen hatte, mit der es jeden Tag Streit gab.
Damals besuchten sie sich gegenseitig fast jeden Tag. Oft sah Lena Evas geschiedenen Mann vor dem Haus lungern und an die Tür klopfen.
„Lena, bitte“, sagte Eva und schaute die Freundin mit treuherzigem Blick an, „Sie haben so viel diplomatisches Geschick. Sagen Sie doch bitte meinem ehemaligen Mann, daß er sich lächerlich macht, wenn er sich weiter so aufführt. Er hat wichtige politische Aufgaben zu erfüllen, und sollte sich besser auf sie konzentrieren.“
Eva war die schönste Frau, die Lena je kennengelernt hatte: langes, schwarzes, leicht gekräuseltes Haar, das ihr, zum Zopf gebunden, bis zu den Knien reichte - tagsüber trug sie es hochgeknotet wie einen Turban - leicht von innen nach außen schräg aufwärts gestellte Augen mit langen schwarzen Wimpern, Augenfarbe zwischen dunkelbraun und dunkelgrün changierend, brünetter Teint, volle Lippen, vorstehende Wangenknochen, Grübchen im fein modellierten Kinn ... Lena wurde nicht müde dieses ein wenig schläfrig wirkende Gesicht zu betrachten. Sehr zu Lenas Kummer kam zwischen ihnen nie das Du auf.
In Deutschland hatte Lena, allen Konventionen trotzend, keinen Hut getragen und hochgeschlossene Blusen verschmäht. Sie hätte sich am liebsten wie ein Knabe gekleidet, wäre am liebsten in Hosen gegangen, fürchtete aber, in solchem Aufzug vom Gendarmen mitgenommen zu werden. Da ihr Umgang nur aus ihresgleichen bestand, war das Sie ausgemerzt in der Unterhaltung mit anderen. Nur den Bürovorsteher der Städtischen Verwaltung, in der sie zeitweilig Arbeit gefunden hatte - mit höheren Vorgesetzten kam sie nicht im Berührung - siezte sie, und natürlich den Polizisten, den Beamten des Arbeitsamtes und den Besitzer des Ladens um die Ecke. Als sie arbeitslos ins Vaterland der Werktätigen übersiedelte, ein Wort, das sie ohne Scheu aussprach, so wie man die einfachen Dinge des Lebens Bett, Klo und Fenster nennt, hatte sie die Vorstellung, daß sie sich endlich männlich kleiden könne.
Die Überraschungen begannen schon am ersten Tag. Als sie bei ihrer Ankunft in Moskau empfangen worden war, hatte sie sich ordentlich vorgestellt in ihrem gebrochenen Russisch. „Ich heiße Magdalena Rubina.“ Die erste Frage, die ihr gestellt wurde, war nicht, wie sie gehofft hatte, nach der Kampfbereitschaft der werktätigen Massen in Deutschland, sondern:
„Namme von Vatter?“
Sie hatte die Frage nicht gleich verstanden. Was hatte ihr unwissender Vater mit der proletarischen Revolution zu tun? Sie war vorbereitet darauf, der sowjetischen Administration einen schlüssigen Bericht über die Situation in Deutschland zu geben, Spionage nannte man üblicherweise solcherart Berichte, und um Waffen zu bitten. Das war ihr von den Genossen ihrer Parteigruppe Prenzlauer Berg, Fehrbelliner Straße Ecke Weinbergsweg, aufgetragen worden. Statt dessen eine alberne Frage mit nebulösem Sinn.
Zwanzig, dreißig Genossinnen und Genossen aus Ungarn, Frankreich, der Tschechoslowakei und Italien waren auf dem Belorussischen Bahnhof dem Zug aus Westeuropa entstiegen, hatten sich scheu umgesehen, bis eine kleine, schielende Frau in unförmiger, schmieriger Lederjacke vor sie trat und sie in einen mit grünen Plüschvorhängen ausgestatteten Empfangsraum führte, wo bereits ein Tisch stand, an dem eine zweite Frau in Lederjacke saß, die Registrierkladde aufgeschlagen vor sich.
„Wie Vatter Nammen?“ wiederholte sie, als Lena mit der Antwort zögerte, denn in Gedanken beschäftigte sie sich mit der Kleidung der beiden Frauen. So eine Lederjacke wollte sie auch tragen, daß sie nicht schon in Deutschland auf den Gedanken gekommen war!
„Namme Vatter! Namme Vatter!“
„August.“
„O, Aw-gust.“
„Nein, Au-gust.“
„O, verrstäh. Aw-gust ... Und Sie verheiratet?“
„Ja.“
„Dann ich Sie grüße Towarischtscha Magdalena Awgustowna.“
Aber man gewöhnt sich an alles, sogar an den Namen des verhaßten Vaters, den sie nun täglich zu hören bekam. Als sie später nach den Gründen fragte, sagte Eva:
„Das ist Rußland. Man ehrt in der Anrede gleichzeitig den Patriarchen des Familienverbandes. Das geht bis in die Zeiten Ruriks zurück ... und ist sehr kompliziert. Am besten, Sie versuchen nicht zu verstehen, wie alles zusammenhängt, sondern passen sich den bestehenden Bedingungen an.“
Sie sollte sich anpassen? Sich anzupassen war gegen ihre Natur, aber was sollte sie tun? Noch einmal gegen Konventionen angehen? Und wohin könnte sie dann fliehen? So kam es, daß sie die Unbegreiflichkeiten in ihrem Gastland nicht zu begreifen versuchte, sondern sich mit der Ausrede zufriedengab: Das ist Rußland. So ist es eben in Rußland. Aber daß sogar zwischen Eva und ihr das Du nicht aufkam, irritierte sie sehr. Erst nach langen Diskussionen hatten sie sich geeinigt, sehr zu Evas Unmut, beim Sie zu bleiben, den Vatersnamen aber wegzulassen.
„Es fällt mir schwer“, hatte Eva gerufen, „Sie nicht mit dem Vatersnamen anzusprechen, das einfache Lena drückt nicht die Hochachtung aus, die ich für Sie empfinde.“
In der Gesellschaftsschicht, in der Eva groß geworden war, gab es keine Kompromisse in dieser Frage, Eva erläuterte es ihr geduldig:
„Die Kinder sagten zur Mutter: Mama, Sie ... , zum Vater: Papa, Sie ...“
Lena hörte es mit Staunen. Die innigsten Freunde pflegten sich mit Sie, mit Vor- und Vaternamen anzusprechen. Nur Betrunkene, Leute aus dem Gesinde, Feuerschlucker, kleine Kinder und Kanalreiniger sprach man mit Du an. Sogar Eva und Lazar, ihr Mann, siezten sich, wie Lena verblüfft beobachtete. So ist es eben in Rußland, hatte Eva es ihr erklärt.
„Auch im ...“, Lena hatte den Satz nicht zuende auszusprechen gewagt.
„Ja, natürlich, auch im Bett“, hatte Eva lachend geantwortet, „allerdings er und seine Mätresse duzen sich.“
„Hat er denn ...?“
„Natürlich hat er eine. Alle führenden Genossen haben eine“, und in Gedanken hatte Lena in ihrem naiven Gemüt für sich hinzugefügt: Das ist Rußland. So ist es eben in Rußland.
Nachdem Eva sie gebeten hatte, hinauszugehen und den geschiedenen Ehemann wegzuschicken, hatte Lena ihn untergehakt:
„Kommen Sie, Lazar Lazarowitsch, gehen wir ein Stück“, und als der Mann rief: „Was wollen Sie von mir? Gehen Sie zum Teufel“, hatte sie ihn gepackt, das zierliche Persönchen mit diplomatischen Geschick, wie Eva dachte: mit der linken Hand den linken Arm des Mannes arretiert, so wie sie es in der Parteigruppe Prenzlauer Berg, Fehrbelliner Straße Ecke Weinbergsweg, geübt hatten, mit der rechten Hand die rechte Schulter des Gegners festgehalten, und nun vorwärts:
„Verduften Sie endlich, Lazar Lazarowitsch, Ihre Frau will nichts von Ihnen wissen. Was sollten die Leute von Ihnen halten, einem so feinen und gebildeten Herrn?“
Sie hat nie erfahren, was wirklich zum Zerwürfnis der Gatten geführt hatte. Eva sprach nie davon. Nur einmal ließ sie eine Bemerkung fallen, über die Lena lange nachdachte. Stalin, sagte sie, gehe zu lasch mit den Konterrevolutionären um. Wenn sie etwas zu sagen hätte, würde sie den ganzen lazarschen Klüngel an die Wand stellen. Und das war nun für Lena ein Problem geworden.
Warten
Lena wurde verhaftet und aus ihrer Wohnung geholt an einem eisigen Januartag.
Kaum hatte Eva sich von Lena verabschiedet, klopfte Alex Gustawowitsch Bellin, der ehemalige Direktor der deutschen Schule an die Tür, auch ein guter Freund, der gekommen war, sie zu beruhigen. Nein, das war kein Leben, das sie führte. Es mußte etwas getan werden. Er hatte die städtische Nervenklinik alarmiert. Nun warteten sie gemeinsam auf die medizinische Betreuerin. Alex Gustawowitsch kannte sich aus in Parteisachen.
„Ach, was, Sie sehen Gespenster. Wovor haben Sie Angst? Was bilden Sie sich ein, wer Sie sind?“
„Moment mal!“ rief sie empört.
„Sie sind eine unbedeutende Lehrerin aus Deutschland. Sie brauchen sich nicht zu fürchten.“
„Moment, Moment ...“, versuchte Lena ihn zu unterbrechen, aber Alex Gustawowitsch ließ sie nicht ausreden:
„Sie brauchen sich nur vorzustellen, Sie lebten in Berlin und müßten Heil Hitler rufen. Ja, meine Liebe, da hieße es Angst zu haben.“
„Zum Donnerwetter“, rief sie, „nun halten Sie endlich die Klappe! Immerhin war ich die Unterweiserin von Obersten und Generalen.“
„Die alle inzwischen brummen, ich weiß.“
„Die meisten sind erschossen“, rief die trotzig, als höbe dieser Umstand die eigene Bedeutung. Sie fanden beide die Bemerkung komisch und lachten.
„Aber worum es geht, das ist Trotzki. Sie sind immun gegen Trotzki. Die Genossen von der GPU wären verrückt, ausgerechnet Sie zu verdächtigen.“
„Nun hören Sie auf mit Ihren Kränkungen. Ich weiß genug, um mitreden zu können.“
„Aha“, sagte Alex Gustawowitsch scheinbar provokativ, um sie zu necken, „das wird die GPU sicher interessieren: Sie wissen also Bescheid über Trotzki?“
„Ohne eine Trotzkistin zu sein!“
„Wovor fürchten Sie sich dann?“
„Ich habe die Tochter von Radek unterrichtet.“
„Na und? Hat sie was begriffen?“
„Nö.“
„Nasehnse.“
Sie lachten beide. Unversehens hatten sie vom Russischen ins Deutsche gewechselt.
„Ein dickes, faules Stück, ich hab sie nur ihres Vaters wegen genommen. Wahrscheinlich war das mein Fehler. Wer konnte auch ahnen ....“
„Daß Radek sich als Radek entpuppt? Wollten Sie das sagen?“
Irgendwann am Nachmittag kam Anton Pawlowitsch, der Zahnarzt.
„Magdalena Awgustowna, verzeihen Sie, ich wollte nur wissen, ob es Ihnen gut geht.“
„Ja, lieber Anton Pawlowitsch, jetzt, da ich Sie sehe, geht es mir wieder gut.“
„Das ist schön, Sie lachen ja wieder, und wenns auch bloß über mich ist.“
Ganz ohne Zweifel war Anton Pawlowitsch verliebt, nur wußte er nicht, es ihr zu sagen.
„Sie müßten mal nach Tula kommen, was meinen Sie wohl, wie dort gelacht wird. Tula ist die lustigste Stadt Russlands“
„Wie kommt das?“
„Wie kommt das? Wie kommt das? Wie kommt das Salz ins Meer? Sie stellen Fragen, die keiner beantworten kann. Wahrscheinlich sind die Tulaer so lustig, weil sie immer gegenüber Moskau ihren eigenen Kopf durchsetzen konnten.“
„Wieso sagen Sie das? Sie leben in Moskau.“
„Moskau, ja, natürlich, das ist die große Welt. Aber Tula, das ist eine völlig andere. Ganz in der Nähe ist Jasnaja Poljana.“
„Jasnaja Poljana!“ rief Lena, „warum sagen Sie das nicht gleich, dann kenne ich Tula, auf dem Weg zum Haus von Tolstoi bin ich durchgefahren.“
„Durchgefahren! Nein, sowas, fährt ohne anzuhalten durch Tula! Nun sagen doch Sie mal ein Wort, Alex Gustawowitsch, ist das nicht unerhört?“
„Doch, doch“, entgegnete der Angesprochene mit kleinem Lächeln, „Tula ist schon eine Reise wert“, und dann ein wenig abschwächend: „Aber, Anton Pawlowitsch, übertreiben Sie nicht ein bißchen?“
Jasnaja Poljana! Lena war gerührt, nach langer Zeit an Jasnaja Poljana erinnert zu werden. Alles, was es zu sehen gab in Rußland, hatte sie mit fliegendem Atem kennengelernt. Das Troizko-Sergijewskaja-Kloster in Sagorsk hatte sie aufgesucht, um Ikone von Rubljow und seinen Schülern im Original zu sehen, hatte mit einer leeren Blechdose in der Hand an der Quelle zur Kathedrale des Heiligen Geistes gestanden, um gesegnetes Wasser zu erhalten, aber nicht, weil sie an Wunder glaubte, sondern weil sie fast zusammengebrochen war in der Schwüle jenes sommerlichen Tages im tiefen Rußland.
Unter dem Gewölbe des Goldenen Tors hatte sie zurückgeschaut auf den Kreml in Wladimir, im erzbischöflichen Palast von Susdal hatte sie Lackmalereien aus Mstera bewundert, in Leningrad eine Hochzeitsgesellschaft vor dem Denkmal des Weltumseglers Admiral Krusenstern fotografiert, zur goldschimmerden Spitze des Großen Glockenturms in Kiew hinaufgeschaut, auf dem Jaroslaw-Hof in Nowgorod auf einer Holzbank vor der Kirche der weihrauchbringenden Frauen ausgeruht, in Wologda zugesehen, wie dort im Fluß Frauen ihre Wäsche auf Steinen sauberschlagen ..., aber nichts war ihr so teuer gewesen wie Jasnaja Poljana.
Wahrscheinlich hatte sie sich anstecken lassen von der fast närrisch zu nennenden Verehrung der Russen. Sie hatte junge Russinnen gesehen, die vom Anwesen Tolstois kommend mit Ahornkränzen im Haar lustige Lieder sangen. Sie hatte noch die Ulme vor dem Herrensitz kennengelernt, unter der sich die Armen des Dorfes versammelten, um Tolstoi ihre Sorgen mitzuteilen, so jedenfalls ging die Legende. Am Grab des Dichters rief die Lehrerin einem schüchternen Jungen zu: Nun leg endlich deine Blumen hin. Kameraverschlüsse klickten. Du mußt nach rechts rüber, rief ein Mann seiner kokett lächelnden Ehefrau zu, sonst kriege ich das Grab nicht mit aufs Bild. Sie hatte junge Birken im Park durchschimmern sehen ... Lena hatte Rußland und die Russen lieben wollen und nun liebte sie sie, die Worte von Anton Pawlowitsch rührten sie sehr.
„Aber ich spreche eigentlich nicht von Jasnaja Poljana“, sagte Anton Pawlowitsch, „ich spreche von Tula, der Ziehharmonikastadt, der Pfefferkuchenstadt, der Samowarstadt, der Waffenstadt, in der es eine Bajonettstraße gibt, eine Revolverstraße und eine Abzugsbügelstraße ...“
„Anton Pawlowitsch“, rief sie lachend, „nun hören Sie aber auf mit dem Geflunker.“
„Das ist klein Geflunker, das ist Tulaer Wirklichkeit. Eine Märchenstadt. Als Zar Alexander Pawlowitsch ...“
“Einer Ihrer Vorfahren?“
„Wieso?“
„Weil er denselben Vatersnamen hat wie Sie.“
„Schämen Sie sich, Magdalena Awgustowna, dieser Spaß auf meine Kosten ist unter Ihrem Niveau, aber ich fahre trotzdem fort mit meiner Geschichte: Als Zar Alexander aus England einen stählernen Floh nach Hause brachte, ein, wie er dachte, unnachahmliches Wunderwerk der Technik, schmiedeten drei Tulaer Büchsenmacher ...“
„ ...unter ihnen ein schielender Linkshänder ...“
„Unterbrechen Sie mich bitte nicht, Magdalena Awgustowna, aber Sie haben recht ... schmiedeten drei Tulaer Büchsenmacher, unter ihnen ein schielender Linkshänder, dem Floh Hufeisen und beschlugen ihn. Geruht wahrzunehmen, hoher Herr, erklärte der schielende Linkshänder dem Zaren, daß auf jedem Hufeisen der Name des Schmiedemeisters eingraviert ist, nur mein Name nicht, denn ich habe die Hufnägel geschmiedet.“
„Nun ist aber genug, Anton Pawlowitsch“, rief Lena lachend, „Nikolai Leskow hat die Geschichte vom schielenden Linkshänder geschrieben.“
„Das ist wahr, aber er hat sie nicht erfunden. Man kann den Floh im Tulaer Museum sehen.“
„Das stimmt nicht“, mischte sich Alex Gustawowitsch in das Gespräch.
„Jedenfalls konnte man ihn sehen. Banditen haben ihn entwendet. Im Tulaer Museum ist aber immer noch ein Gewehr im Kaliber 2,7 Millimeter ausgestellt, das 1867 hergestellt wurde und siebzig Gramm wiegt. Dort gibt es auch einen Revolver im noch kleineren Kaliber von 1,7 Millimeter, der nur fünfeinhalb Gramm wiegt. Die Patronen liegen unter Glas daneben. Aus dem Revolver ist sogar geschossen worden.“
„Fragt sich nur, worauf?“
„Ist das so wichtig? Wichtig ist, und deshalb erzähle ich Ihnen davon, daß es diese Handwerkerkunst heute nicht mehr gibt ... Oh nein“, korrigierte er sich, als er sah, wie Alex Gustawowitsch ihn unterbrechen wollte, „das hat nichts mit der Sowjetmacht zu tun. Die Sowjetmacht ist eine Bewahrerin der Künste und des Handwerks. Das sind die modernen Zeiten, die Schuld am Niedergang des Handwerks sind. Was heute zählt, das ist minderwertige Serienware.“
„Die aber preiswert ist.“
„Preiswert gewiß, aber niemand hat das Bedürfnis, einen von diesen schmucklosen Gebrauchsartikeln aufzubewahren. Können Sie sich vorstellen, daß Sie sich eine verbeulte Tabaksdose in die Vitrine stellen?“
„Wer stellt sich eine Tabaksdose in die Vitrine, eine verbeulte noch dazu?“
„Das ist aber früher geschehen, denn früher waren Tabaksdosen aus dickem, schwerem Metall gearbeitet und mit wertvollen Gravuren versehen.“
„Welcher Arbeiter hat sie sich leisten können.“
„Jeder, behaupte ich, denn so eine Tabaksdose war eine einmalige Anschaffung im Leben, auf die ein Arbeiter jahrelang sparte, denn auch er wollte ein solches Schmuckstück einmal besitzen.“
„Wahrscheinlich wurde sie noch vererbt.“
„Spotten Sie nur, Ihnen wird der Spott noch vergehen, wenn ich Ihnen die zinnerne Tabaksdose präsentiere, die ich von meinem Urgroßvater habe. Diese herrliche Handwerkerarbeit wurde tatsächlich vererbt. Weil sie handgearbeitet war, man kann auf dem Metall noch die Hiebe des Meisters mit dem Hammer erkennen, weil sie formschön war, gediegen und es war angenehm, sie in der Hand zu wiegen. Die eigene Schwere gab ihr den Charakter eines edlen Gegenstandes. Das klapprige Blechzeug, jedoch, das heute auf den Markt geworfen wird, lohnt nicht des Ansehens.“
„In Tula wurde das Niëllo erfunden“, warf Alex Gustovowitsch ein.
„Was ist Niëllo?“ fragte Lena.
„Um der Wahrheit die Ehre zu geben“, sagte Anton Pawlowitsch, „erfunden wurde das Niëllo in Tula nicht. Das Niëllo war schon den alten Ägyptern bekannt, die Tulaer Schmiede haben es lediglich wiederentdeckt und zur russischen Volkskunst erhoben.“
„Anton Pawlowitsch! Sie spannen mich auf die Folter. Worin besteht das Zeug?“
„Das ist ein schwarzes Metall, wie es zusammengesetzt wird, weiß ich nicht, ich weiß nur, daß die Tulaer Schmiede verstanden, meisterhaft damit umzugehen. Sie haben es verstanden, mit Niëllo die feinsten Gravuren in Schwarz auf silbernen Gegenständen zu zaubern ...“
Als der Zahnarzt gegangen war, lachte Alex Gustawowitsch:
„Einen amüsanten Verehrer haben Sie, Lena.“
„Und er hat Geld.“
„Das sollte man nicht verachten.“
Wieder lachten sie herzlich miteinander. Die Stimmung wurde immer ausgelassener. Alex Gustawowitsch brachte erneut den nötigen Ernst in ihr Gespräch. Die Sache mit den Verhaftungen solle sie, bittschön, nicht auf sich beziehen. Bei den Verhaftungen gehe es um höhere Ränge:
„Um uns Kleine kümmert sich kein Schwein“, und er erzählte, wie Fritz Platten reagiert hatte, als gegen ihn intrigiert wurde:
„Der ging zu Jaroslawski, schmiß ihm sein Parteibuch auf den Tisch und sagte: Vergleiche mal meine Parteinummer mit deiner. Ich habe Lenin nach Moskau gebracht. Ohne mich würdest Du mit deinem fetten Arsch nicht auf deinem weichen Sessel sitzen, sondern irgendwo in Sibirien Rinde von den Bäume nagen. Also sorge gefälligst dafür, daß man mich in Ruhe läßt. - Ja, Lena, in dieser Sprache sprechen die hohen Genossen miteinander. Wir Kleinen können darüber nur staunen.“
Es war gut, so miteinander reden zu können. Wer ein wirklicher Freund ist, dachte sie, merkt man erst, wenn man in einer heiklen Situation steckt. Sie hatte georgischen Tee aufgesetzt, den damals in Moskau kaum jemand kannte. Sie hatte ihn aus dem Kaukasus mitgebracht. Zum Tee gab es Schmalzstullen, selbst ausgelassen und, wie es in Schlesien üblich ist, mit kleinen Apfelstücken und viel Grieben, Alex Gustawowitsch leckte sich die Finger dabei vor Genuß.
Leider war damals im Kaukasus die Geschichte mit Gurgen passiert, dem balkarischen Freund. Nachdem er im Dorf seine Rede gehalten hatte, in der er darlegte, aus welchen Gründen er vom islamischen Glauben abgefallen war, und weshalb er für die Sowjetmacht einstehe, hatte sich nachts ein Kerl ins Zelt geschlichen und ihm die Kehle durchgeschnitten, als Lena aufwachte, lag sie in einer Blutlache. Immer noch klang ihr Gurgens schöne Stimme im Ohr: „In die Berge, in die Berge, heller Fluß Tschirachtschai ...“. Eine schöne Melodie, schöne, sehr schöne Worte, das Herz tat ihr weh, wenn sie an Gurgen dachte.
„Ja, Alex, stellen Sie sich vor“, sagte sie, als sie von Gurgen erzählte, „ich habe dort Lieder und Balladen nachgedichtet, vor allem viele dieser mündlich weitergegebenen rhapsodischen Gesänge. Die georgische Akademie der Wissenschaften hat jetzt angefangen, sie aufzuzeichnen. Vielleicht habe ich mit meiner Arbeit ein bißchen dazu beigetragen, das hoffe ich wenigstens.“
Da Alex Gustavowisch mit Essen beschäftigt war und keine abwehrende Geste machte, als sie ihr Kaukasus-Album heraussuchte, wagte sie es, ihm etwas daraus vorzutragen, sang sogar einige Verse:
„Im Garten schweigt die Nachtigall schon lang,
Schon lang ist es im Garten schwarz von Raben.
Ringsum die Nacht, mein Leben ist erloschen,
mit Schimpf bedeckt, was heilig war uns allen.“
“Was ist denn das?“ rief Alex Gustawowitsch. Er wischte sich die Finger an der Hose ab und nahm ihr das Blatt aus der Hand. „Was ist das?“
„Das sind Verse von der Verfluchung Chan Mursals“, erklärte sie, „Sie müssen wissen ...“
„Gar nichts muß ich wissen und vor allem, ich will davon nichts wissen. Zerreißen Sie das! Verbrennen Sie das! Vernichten Sie das!“ Und er fing an, das Blatt zu zerfetzen.
„Na! Kommen Sie zu sich, Sie Idiot! Das ist doch bloß ein Gedicht!“ Sie riß ihm die Reste des Papiers aus der Hand: „Jetzt muß ich alles neu abschreiben
Minutenlang beobachtete Alex Gustawowitsch mit gekrauster Stirn, wie die Frau die Papierstücke auf dem Tisch sorgfältig glättete und sie aneinanderlegte.
„Entschuldigen Sie, Magdalena Awgustowna ...“, sagte er nach einer Weile.
„Ach, hören Sie auf mit Ihrem blöden Magdalena Awgustowna, wenn Sie mich nicht Lena nennen, brauchen Sie überhaupt nicht mit mir zu reden.“
„Entschuldigen Sie, Lena, aber was Sie tun ist falsch. Verbrennen Sie diese Papiere. Ich meine es ernst, sehr, sehr ernst. Sie dichten sich um Kopf um Kragen.“ Und nach einer kleinen Pause: „Aber Sie haben eine sehr schöne Stimme.“
Gleich zu Beginn seines Besuchs hatte Alex Gustawowitsch dafür gesorgt, daß die Möbel von der Tür weggerückt wurden. Jetzt mühte er sich damit ab, sie alle wieder auf ihren alten Platz zu schieben.
„Mein Gott“, rief er, „und Sie halbe Portion haben diese Kawentzmänner von Schränken alleine von der Stelle gekriegt? Also: verstanden? Erstens: Sie dichten keine Poeme mehr über böse Chane. Zweitens: Sie verbarrikadieren sich nicht mehr. Drittens: Sie rennen nicht mehr wie eine Verrückte durch die Straßen. Viertens: Sie schließen sich auch nicht mehr ein. Nachher passiert Ihnen wirklich was und keiner kann hinein, um Ihnen zu helfen.“
Lena war inzwischen müde geworden. Verstohlen schaute sie auf die Uhr. Halb zehn. Sie gähnte ein bißchen, nicht aufdringlich, sondern als zarte Andeutung für den Gast, daß für die Gastgeberin Schlafenszeit gekommen sei.
Das war der Augenblick, da sie es riskieren konnte, die Wodkaflasche aus dem Sanitätsschränkchen zu holen. Als ehemaliges Wandervogelmädchen haßte sie Alkohol, kannte aber die Vorliebe des Freundes für scharfe Sachen, wollte schon ein Gläschen eingießen, nicht die üblichen hundert Gramm, bewahre, sondern ein niedliches Likörstamperl aus gefärbtem Glas, das sie eigens für solche Fälle auf dem Bazar in Naltschik erworben hatte. Aber Alex Gustawowitsch winkte ab: „Lieber nicht. Mein Herz.“
Das klang, als wolle er bald aufbrechen, Gottseidank. Sie war ihm dankbar, ohne ihn wäre sie endgültig in Depression gefallen, nun freute sie sich auf das Bett. Doch zu ihrem Unmut ergänzte er: „Vielleicht noch ein Täßchen Tee? Und, liebe Lena, wollen Sie mir nicht noch ein Abschiedslied singen?“
In „Baracke 23“ des ehemaligen Seuchenhospitals in Wien hatte Hanns Eisler mit ihr Das Lied von der Erde einstudiert, alle sechs Kanzone, er am Klavier. Jetzt, animiert vom Freund und auch sonst in sentimentaler Stimmung, sang sie:
„Mein Herz ist müde, meine kleine Lampe
erlosch im Knistern, es gemahnt mich an den Schlaf
Ich komm zu dir, traute Ruhestätte
Ach, gib mir Ruh! Ich hab Erquickung not!“ ...
Die Sechsundzwanzigjährige, die sie damals in Baracke 23 gewesen war, hatte es verstanden, die seltsamen Verse mit einer Spur Aufsässigkeit zu singen, und Eisler war des Lobes voll, wenn sie mit schneidender Stimme fortfuhr:
„Ich weine viel in meinen Einsamkeiten
Der Herbst in meinem Herzen währt zu lange
Sonne der Liebe, willst du nie mehr scheinen,
um meine bittern Tränen aufzutrocknen?“ ...
Leider hatte Eisler die eigene Sangesfreude nicht unterdrücken können und ihr mit fürchterlicher Krächzstimme die Laune verdorben. Das Lied von der Erde gehörte seitdem zu ihrem Standardprogramm ... Allerdings schien es Arthur Gustawowitsch nicht zu gefallen. Daher begann sie, mit der dampfenden Teetasse in der Hand:
„Guten Abend, gute Nacht ...“
Einmal mit Singen begonnen, fand sie kein Ende. Von Alex Gustavowisch, dem sie mit dem veränderten Programm aus der Seele zu sprechen schien, dirigierend begleitet folgten Gaudeamus igetur, Im schönsten Wiesengrunde und Wenn die bunten Fahnen wehen. Was solls, dachte sie, die tiefste Not war gebannt, die gröbste Arbeit war erledigt, man hatte Grund zu feiern, und als sie bei Arbeiterliedern angekommen waren, sang sogar Alex Gustawowitsch mit:
„Avanti popolo, alla riscossa, bandiera rossa, bandiera rossa ...“
„Noch ein Täßchen Tee, Alex?“
Als an die Tür gebummert wurde, sagte Alex Gustawowitsch:
„Das wird die Krankenschwester sein.“
Sie lachte: „Das wird die Krankenschwester sein, in der Tat.“ Sie schaute auf die Uhr: „Es ist nachts um zehn, sie kommt mit zehnstündiger Verspätung. Aber wissen Sie was, Alex, ich brauche sie nicht mehr. Und das habe ich Ihnen zu verdanken. Sie haben mir wieder Lebensmut gemacht. Sie mit Ihrer guten Laune sind besser als jede Krankenschwester.“
„Gehen Sie öffnen, gehen Sie“, sagte Alex Gustawowitsch ungeduldig.
Sie eilte zur Tür und riß sie auf:
„Hereinspaziert!“
Aber es war nicht die Krankenschwester. Statt ihrer standen zwei Männer in schweren Militär-Paletots, Fell innen, vor der Tür, beide mit hochgeschlagenem Kragen und in die Stirn gezogenen Pelzmützen, die Ohrenklappen heruntergelassen. In der funzligen Beleuchtung konnte sie von den Gesichtern nur erkennen, daß der eine der Männer einen Schnurrbart trug.
Es waren nicht dieselben Männer wie vergangene Woche in der Straßenbahn, das registrierte sie sofort und merkwürdigerweise empfand sie Beruhigung darüber. Es schienen Profis zu sein und nicht solche Amateure wie die beiden anderen.
„Sind Sie Rubina?“
„Ja“, sagte sie, während sie langsam in die Wohnung zurückwich. Der Schnurrbärtige ging rasch an ihr vorbei und stellte sich hinter sie, als wollte er sie an der Flucht hindern.
„Magdalena Awgustowna?“
„Ja“, sagte sie, während sie weiter in die Wohnung zurückwich mit dem Schnurrbärtigen hinter sich.
„Im Namen des Volkes, Sie sind verhaftet.“
Das war es also, dachte sie, so also sehen sie aus und so gehen sie vor und ihr schauderte. Aber sie hatte keine Angst. Die Angst war wie weggewischt. Nur die Finger zitterten. Damit die Männer von der Staatssicherheit es nicht merkten, legte sie die Hände auf den Rücken und verschränkte die Finger.
Sie schaute auf ihren Freund, der mit gesenktem Kopf in der Ecke saß. Für einen Moment war ihr, als spiele sich vor ihr eine Szene ab, an der sie sich nicht zu beteiligen brauchte.
„Gott sei Dank, daß Sie kommen“, sagte sie, und zu Alex Gustawowitsch in der Zimmerecke gewandt: „jetzt sind sie endlich gekommen, jetzt wird sich alles aufklären.“
Die beiden fremden Männer warfen sich einen verständnislosen Blick zu, als hätten sie mit einemmal erkannt, eine Irre vor sich zu haben, und als der Mann ohne Schnurrbart mit der Schulter zuckte, sagte der Schnurrbärtige:
„Kommen Sie mit“, und als sie sich nicht von der Stelle bewegte: „Los beeilen Sie sich, wir haben nicht ewig Zeit.“
Alex Gustawowitsch in der Zimmerecke erhob sich, trat mit zögerndem Schritt an die beiden Tschekisten heran und hielt ihnen ein Papier hin:
„Ich bin das langjährige Parteimitglied Alex Gustawowitsch Bellin, dies ist mein Dokument.“
Der Mann ohne Schnurrbart las flüchtig das Papier und sagte:
„Na, und?“
„Ich dachte nur, daß Sie vielleicht wissen möchten, wer ich bin.“
„Deutscher?“
„Ja. Ehemaliger Direktor der deutschen Schule in Moskau.“
„Gegen Sie liegt nichts vor, Sie können gehen.“
„Danke.“
Ohne die Freundin noch einmal anzusehen eilte er an ihr vorbei. Verwirrt lauschte sie hinaus in den Flur, wo sie ihn eiligen Schritts die Treppe hinablaufen hörte.
Sie trug ein dünnes Hauskleid und Hausschuhe.
„Ich habe Sie erwartet und bin bereit“, sagte sie, „ich möchte nur ein paar Sachen einpacken.“
„Nichts werden Sie tun“, sagte der Schnurrbärtige, „Sie kommen mit so wie Sie sind.“
„Das fehlte noch“, sagte der andere, „daß wir Ihnen erlauben, Spuren zu verwischen.“
„Ich will nur ein paar Sachen zum Wechseln mitnehmen, Wollsachen vor allem und ein Mäntelchen, wenn Sie gestatten ...“
„Bitte, Bürgerin“, sagte der Mann ohne Schnurrbart, „unser Beruf ist schon schwer genug, machen Sie ihn uns nicht noch schwerer.“
„Aber, Genossen, es ist Winter“, sagte sie mit kleinem Vorwurf in der Stimme, „Ich weiß nicht wie kalt es ist, aber es sind mindestens dreißig Grad unter Null.“
„Ich weiß nicht“, sagte der Mann ohne Schnurrbart, „wie Sie dazu kommen, uns Ihre Genossen zu nennen“, und so, als gebe er angesichts der Unvernunft der Welt seinen Widerstand auf: „Aber nun ist es auch schon egal.“
„Nun marsch“, sagte der Mann mit Schnurrbart und stieß sie zur Tür. Im letzten Moment gelang es ihr, wahllos ein paar Sachen zusammenzuraffen, egal, was es war, Hauptsache sie hatte etwas in der Hand.
Nach der Auskunft des Moskauer Wetteramtes zeigte das Thermometer am 20. Januar 1937 minus fünfunddreißig Grad Celsius.
Als sie häuslich gekleidet aus der warmen Stube auf die Straße trat, schlug der Frost sie wie mit einer Brechstange zu Boden.
Schon vor zwanzig Jahren, als Lena mir zum erstenmal die Geschichte ihrer Verhaftung erzählte, fielen mir ihre Ungereimtheiten auf. Die Erzählung der Frau kam wie aus einem Guß, und jede Zwischenbemerkung wischte sie ungeduldig vom Tisch.
Ich habe immer wieder nachgefragt. Noch nie hatte ich von solchen Geschichten gehört, ja, ich hatte es nicht für möglich gehalten, daß es solche Szenerien in Wirklichkeit gab, und manchmal, während sie sprach, war mir, als müsse ich aufstehen und weggehen, um mir nicht länger diese Wippchen anzuhören. Erst jetzt, da die Akten des russischen Staatssicherheitsdienstes für die Forschung freigegeben sind, habe ich die Möglichkeit bekommen, ihre Angaben zu überprüfen, und bin nun imstande, den wahren Kern herauszuarbeiten.
1982 ist sie gestorben. Natürlich bin ich froh, daß sie nie erfahren hat, wie sich ihre Verhaftung in Wirklichkeit abgespielt hat.
Schon vor zwanzig Jahren, als Lena mir zum erstenmal ihre Geschichte erzählte, fiel mir auf, daß sie einen Nachmittag und einen langen Abend vergebens auf die Krankenschwester gewartet hatte. Schon damals hatte ich einen Verdacht, den ich aber nicht auszudrücken verstand. Nur einmal, während sie tief seufzend Atem schöpfte, warf ich ein:
„Weshalb kam die Krankenschwester nicht?“
„Genau davon erzähle ich Ihnen die ganze Zeit, warten Sies ab.“
„Sie kam also noch.“
„Nein, sie kam nicht.“
„Hätte nicht Alex Gustawowitsch, der sich Sorgen um Ihre Gesundheit machte, nachfragen müssen, wo die Krankenschwester blieb?“
„Nein, das hätte er nicht. Er war nicht mein Vormund und ich nicht sein Mündel.“
Ich fragte mich während ihrer Erzählung, was der ehemalige Direktor der deutschen Schule nachts um zehn in der Wohnung seiner ehemaligen Kollegin zu suchen hatte, mit der ihn kein erotisches Verhältnis verband.
Ich fragte mich, weshalb er eilfertig den Genossen vom Staatsicherheitsdienst sein Parteidokument aufdrängte. Ich fragte mich, warum er ohne Gruß verschwand, nachdem er zehn Stunden lang Stimmung gemacht hatte. Ich fragte mich, warum er dafür sorgte, daß die Tür nicht verbarrikadiert war, als die Genossen des Staatsicherheitsdienstes eintrafen, warum er dafür sorgte, daß die Tür nicht abgeschlossen war.
Die Geschichte dieses Nachmittags und Abends in der winzigen Mietwohnung an der Kleinen Steinbrücke in Moskau vor sechzig Jahren stimmte, so wie Lena sie mir erzählte, hinten und vorne nicht.
Natürlich fragte ich mich, ob Alex Gustawowitsch tatsächlich die Städtische Nervenklinik um Hilfe gerufen hatte, und als ich eine kleine diesbezügliche Andeutung machte, sah Lena mich groß an und antwortete nicht.
Sie hat nie erfahren, wie sich ihre Geschichte wirklich zutrug.
In den freigegebenen Akten des sowjetischen Staatssicherheitsdienstes habe ich die Wahrheit gefunden.
Oder sie hat die Wahrheit geahnt und nur nicht gewagt, sie sich einzugestehen.