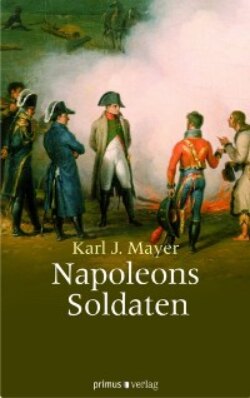Читать книгу Napoleons Soldaten - Karl J. Mayer - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Die Soldaten des Kaisers: Wehrpflicht, Disziplin, Motivation
ОглавлениеAuch wenn die Französische Revolution den Krieg nicht neu erfand: Er hatte sein Gesicht geändert, als 1792 die Revolutionskriege mit der Kanonade von Valmy begannen. Das lag weniger daran, dass die revolutionären Armeen neue Waffen einsetzten oder umwälzend neue Taktiken anwandten. Die Waffen waren weitgehend die, mit denen man schon seit hundert Jahren kämpfte. Die Taktik war wohl ein wenig anders als die des Ancien Régime, der Zeit des Aufgeklärten Absolutismus. Die Franzosen setzten jetzt mehr auf die Wucht der tief gegliederten Angriffskolonnen und auf den Kampf in aufgelöster Ordnung statt auf schmale, zerbrechliche Linien und starre, schwer zu dirigierende Reihen. Das lag aber eher an der Unfähigkeit der aus dem Boden gestampften revolutionären Bataillone, die perfekt einstudierten, maschinenhaft durchgeführten Manöver ihrer Gegner rasch nachzuahmen. So wurde taktisch die Not zur Tugend. Das wirklich Neue an den Revolutionskriegen waren die revolutionären Soldaten. Es kämpften nicht mehr Söldner des Königs, sondern Bürger einer Nation.
Andere Kriege, neue Soldaten?
Der König hatte seine Soldaten angeworben. Geworben wurden sie überall, wo sich Männer in den Soldatenstand pressen ließen. Sie kämpften in „Kabinettskriegen“ für die Interessen des Königshauses, um irgendeine Erbfolge irgendwo in Europa. Sie kämpften, weil die Disziplin sie dazu zwang und weil sie keine vernünftigere Beschäftigung fanden. Ihre Offiziere waren in der Mehrzahl Adlige, die ihre Soldaten selten zu sehen bekamen. Letztere hatten kaum Aufstiegschancen. Das Beste, was sie hoffen konnten, war, nach Jahrzehnten ohne ernsthafte Blessur oder Erkrankung ein stilles Fleckchen zu finden, wo sie mehr schlecht als recht ihren Lebensabend fristen konnten.
Die Soldaten hingegen, die nach 1789 die Revolution verteidigten, kämpften für Ideen, nicht für die Launen oder die Machtinteressen des Königs. Die Ideen lauteten: „Gleichheit, Freiheit, Brüderlichkeit.“ Und jeder Soldat war nun gleich berechtigter Bürger, nicht mehr Angehöriger eines Standes minderen Rechtes.
Die Revolutionskriege
Im Jahr 1792, drei Jahre nach Ausbruch der Französischen Revolution, griffen die Mächte Europas zu den Waffen, um die Republik niederzuwerfen. An zahlreichen Fronten brachen Kämpfe aus: am Ober- und am Niederrhein, in Italien, in Spanien, ja in Ägypten. Es waren oft erbarmungslose Gefechte, da die Republik um ihre Existenz stritt.
Aber sie behauptete sich, trotz aller militärischen Defizite und trotz Bürgerkrieg und antiroyalistischem Terror im Innern. Der Sieg der Republik versetzt noch heute Historiker in Staunen. Erfochten wurde er weniger durch den überlegenen revolutionären Geist der Bürgersoldaten oder durch neue Taktiken. Die Unfähigkeit und die Uneinigkeit der gegen Frankreich vereinigten Koalitionen retteten die Republik. Am Ende der Revolutionskriege war Frankreich unter Napoleon bereit, seine Macht bedeutend zu erweitern.
Im August 1792 wurde in Frankreich die königliche Familie gefangen gesetzt; der neu gewählte „Nationale Konvent“ erklärte das Land im September zur Republik. Dagegen setzten die absolutistischen Mächte Europas ihre Armeen in Marsch. Das französische Vaterland war in Gefahr: „La patrie en danger!“ Und es war die Pflicht jeden Bürgers, also aller Franzosen, das republikanische, revolutionäre Vaterland zu schützen. So entstand, wenn auch zunächst in eingeschränkter Form, etwas wirklich Revolutionäres: die Wehrpflicht als Kennzeichen des freien, gleichberechtigten Staatsbürgers.
Die Wehrpflicht
Erster Ausdruck dieser Bürgerpflicht, das Vaterland zu verteidigen, war das Gesetz vom 23. August 1793. Es bestimmte, dass von diesem Augenblick an jeder Franzose bereit sein müsse, in der Armee zu dienen, bis der Feind vom Boden Frankreichs vertrieben war. Junge Männer sollten kämpfen, verheiratete Männer Waffen herstellen, Frauen Zelte und Kleidung nähen, Kinder Verbandszeug vorbereiten und die Alten auf den Plätzen durch patriotische Reden den Mut der Männer anfachen und den Hass auf die Könige schüren. Die levée en masse war geboren.
Die levée en masse – zu übersetzen entweder als Aufstand der Massen oder als massenhafte Aushebung von Soldaten – ist bis heute ein Teil des Revolutions-Mythos. Denn dem Gesetz folgte bei Weitem nicht „jeder Franzose“. Manche wurden nach Hause geschickt, nachdem die geforderte Kopfzahl lokaler Bataillone erreicht war; manche fanden sich gar nicht erst zur Registrierung in den Städten ein; andere verschwanden auf dem Marsch zur Front.
Der levée en masse folgten weitere Massenaushebungen. Immer wieder forderte die Regierung in Paris junge Männer auf, sich freiwillig zu melden. Und immer wieder wurden Gesetze erlassen, die Männer zwangsweise zu den Waffen riefen. Der Menschenverschleiß an den Fronten war ungeheuer hoch. Waren die Soldaten des Königs noch ein kostbares, teures Gut, das man nach Möglichkeit schonte, waren nun – in den Worten des britischen Militärhistorikers J.F.C. Fuller – „Menschen so billig wie Dreck“1.
Jedenfalls schuf die Revolution zwei Grundvoraussetzungen für Napoleons Kriege: den Soldaten als Bürger mit Nationalstolz und gleichen Rechten und die allgemeine Wehrpflicht. Letztere wurde in dem von General Jourdan entworfenen Gesetz vom 5. September 1798 festgelegt. Waren die Aufrufe und Gesetze davor eher momentane Notmaßnahmen („bis der Feind vom Boden Frankreichs vertrieben ist“), so wurde nunmehr grundsätzlich jeder unverheiratete männliche Franzose mit Vollendung des 20. Lebensjahres militärdienstpflichtig. Die Aushebung des ersten Wehrpflichtigen-Jahrgangs allerdings war nicht sonderlich erfolgreich. Von 203 000 Wehrpflichtigen waren nur 143 000 diensttauglich, 97 000 marschierten zur Armee ab und nur 74 000 kamen in den Armeelagern an.2
Die Marseillaise
Auf ihr Kinder des Vaterlands, der Tag des Ruhms ist da. Gegen uns wurde der Tyrannei blutiges Banner erhoben. Hört Ihr auf den Feldern die grausamen Soldaten brüllen? Sie kommen bis in Eure Arme, Eure Söhne, Eure Ehefrauen zu erwürgen! Zu den Waffen Bürger, formiert Eure Bataillone. Lasst uns marschieren! Damit unreines Blut unsere Äcker tränke!“
Die Marseillaise wurde im Jahr 1792 in Straßburg als Kampflied der Rheinarmee von Claude Joseph Rouget de Lisle komponiert und getextet. Ihren Namen erhielt sie, als im Sommer 1792 ein betrunkenes Freiwilligen-Bataillon aus Marseille, das das Lied auf dem Marsch durch das Elsass gelernt hatte, es zum ersten Mal den Pariser Bürgern zu Gehör brachte. Bis auf den heutigen Tag (seit 1879) ist die Marseillaise mit ihrer mitreißenden Melodie und dem blutrünstigen Text die Nationalhymne der Republik Frankreich.
Ob ein junger Franzose sofort nach Erreichen des 20. Lebensjahres unter die Waffen treten musste, das hing von der Höhe des Kontingents ab, das der jeweilige Jahrgang zu stellen hatte. In Kriegs- und Krisenzeiten (etwa nach der Vernichtung der Armee im Jahr 1812) konnte dieses Kontingent sehr hoch sein. In relativ ruhigen Jahren sank die Zahl der Männer, die das Vaterland unter die Fahnen rief.
Setzte Napoleon etwa für einen bestimmten Jahrgang fest, dass 100 000 junge Männer Soldaten werden sollten, so wurde diese Zahl anteilsmäßig auf sämtliche Departements, Arrondissements und Kantone umgelegt. Dort wurden alle Wehrpflichtigen auf einer Liste erfasst (konskribiert). Danach wurden in den Bürgermeisterämtern so viele fortlaufend nummerierte Zettel in eine Urne geworfen, wie Männer auf der Liste standen. Jeder der Konskribierten zog einen Zettel, und je niedriger die Nummer, desto höher die Wahrscheinlichkeit, zur Armee eingezogen zu werden.
Militärärztlich gemustert wurde in den Gemeinden jeder Wehrpflichtige. War er für den Dienst untauglich (etwa wegen körperlicher Gebrechen oder weil er kleiner war als 154 Zentimeter, später 148 Zentimeter), musste er eine gewisse Geldsumme bezahlen. Dafür wurde er aus der Liste gestrichen. Auch waren bestimmte Personengruppen von vornherein von der Wehrpflicht befreit. Etwa Verheiratete, das einzige Kind oder der älteste Sohn einer Witwe.
Es gab auch – seit dem Jahr 1800 – die Möglichkeit, andere für sich dienen zu lassen. Betuchte Familien, deren Sohn beim Auswahlverfahren eine niedere Nummer gezogen hatte, konnten einen „Stellvertreter“ bezahlen, der dann in den Krieg zog. Die Möglichkeit der Stellvertretung lässt ahnen, dass die gehobenen Schichten in den Armeen Napoleons nicht gerade überrepräsentiert waren. Von einem „Volk in Waffen“ war man noch ein gutes Stück entfernt. Es dienten eher die unteren Klassen: Bauern, Tagelöhner, Handwerker. Aber auch Abenteurer, zwielichtige Charaktere, die sich ins soziale Gefüge des Dorfes oder Stadtviertels nicht einbinden ließen.
Viele Wehrpflichtige suchten verzweifelt nach einem Mann, der für sie zu den Soldaten ging. Der Soldat Adam von der 22. Demi-Brigade (Regiment) etwa schrieb im Mai 1800 aus Genf, er wünsche sich nichts sehnlicher als einen Stellvertreter. In der Schweiz bekomme man schon für 300 Francs einen solchen Mann. Er bat die Familie darum, ihm das Geld zu schicken: „Ich würde den Rest meines Lebens dafür opfern, um demjenigen zu dienen, der mich aus dieser Sklaverei befreit.“3 Aber: Wer kein Geld hatte, der musste zu den Waffen.
Die Napoleonischen Kriege I: „Die glücklichen Jahre“
Mit persönlichem Mut, Gespür für die politische Intrige und einem unersättlichen Machthunger gelang es Napoleon Bonaparte, sich nach den Wirren der Revolution an die Spitze des Staates zu setzen. Im Jahr 1804 krönte sich Napoleon zum Kaiser der Franzosen. Von nun an hatte er uneingeschränkten Zugriff auf sämtliche Ressourcen des Landes: Die Napoleonischen Kriege begannen.
Nach dem Scheitern seiner Pläne einer Invasion Großbritanniens wandte sich Napoleons Grande Armée im Herbst 1805 gegen die Kontinentalmächte Österreich und Russland. Im Oktober besiegten sich die Österreicher bei Ulm selbst. Im Dezember schlug Napoleon in seiner genialsten Schlacht die Österreicher und Russen bei Austerlitz.
Im Jahr 1806 griff auch Preußen wieder zu den Waffen. Im Oktober wurde die preußische Armee bei Jena und Auerstedt weitgehend vernichtet. Reste kämpften zusammen mit den Russen im Februar 1807 bei Eylau, einer blutigen Schlacht ohne Sieger. Im Juni desselben Jahres wurden die Russen bei Friedland geschlagen. Der Zar bat um Frieden. Napoleon beherrschte Zentraleuropa vom Atlantik bis Polen.
Dass die Soldaten sich eher aus den ärmeren Schichten rekrutierten (wobei städtische bzw. frühindustrielle Regionen relativ stärker betroffen waren als ländliche), hatte positive wie negative Auswirkungen. Für den Staat war es insgesamt günstig, wenn Männer aus „gutem Hause“ ihm in der Verwaltung, Wissenschaft oder Wirtschaft dienten. Für die Armee jedoch konnte es zu Nachteilen führen, wenn der Bildungsgrad nur durchschnittlich war. So konnte talentierten Soldaten der Weg nach oben versperrt sein, da sie nicht lesen oder schreiben konnten, die Voraussetzung für die Beförderung zum Unteroffizier oder gar Offizier.
Viele junge Franzosen entzogen sich der Wehrpflicht. War ein junger Mann zum Wehrdienst bestimmt und fand er sich nicht beim Regiment ein, dann galt er als r fractaire (Widerspenstiger). Nach ihm wurde gefahndet. Wurde er gefasst, musste er in der Regel eine Geldstrafe bezahlen und doch noch zum Dienst antreten. Auch die Familie konnte Repressalien ausgesetzt sein. Besonders wirksam war es, bei den Familien von tatsächlichen oder potenziellen Deserteuren Soldaten einzuquartieren. So war dem Sohn der Heimweg verwehrt, und auf die Eltern konnte Druck ausgeübt werden, damit sie ihn zur Rückkehr unter die Fahnen überredeten.
War der Mann bereits Soldat und machte sich dann aus dem Staub, so war er ein Deserteur. Da er zu diesem Zeitpunkt unter Militärstrafrecht stand, waren die Bestrafung und die Repressalien gegenüber Familie und Dorfgemeinschaft oft härter. Desertierte der Soldat während eines Feldzuges aus einer Fronteinheit, dann drohte gar die Todesstrafe.
Ausbildung: Rekruten im Dienste des Kaisers
Die Ausbildung der Soldaten, vor allem der Infanteristen, war nach heutigen Maßstäben sehr oberflächlich. Ihre Einführung in die Welt der Armee erhielten die Rekruten auf dem Marsch von ihrem Heimatort zur Garnison oder zum Lager. Hier wurden sie an Disziplin und Gehorsam gewöhnt, aber auch an die körperlichen Herausforderungen des Marschierens oder des Biwakierens im freien Gelände. Die neue Umgebung und die seelischen und körperlichen Belastungen waren für viele ein Schockerlebnis und führten dazu, dass nicht wenige auf dem Marsch desertierten.
Am Ende des Marsches wurden die Neuankömmlinge entweder sofort in Kampfeinheiten eingereiht oder aber in Kasernen und Depots eingekleidet und bewaffnet. Dort fand auch die eigentliche Ausbildung statt. Die Männer lernten, in Reih und Glied zu marschieren und auf Kommando die Formation zu ändern. Man brachte ihnen bei, wie sie ihre Muskete zu laden hatten oder das Bajonett handhaben mussten.
Kasernen und Ausbildungslager waren verhasst. Der Drill, das stumpfe, stundenlange Herummarschieren auf Befehl, ödete alle Soldaten an. Viele drückten sich davor. Dem eben erst zur Truppe gekommenen Regimentsmusiker Philippe-Ren Girault etwa war das tägliche Exerzieren zu viel. Er erkundigte sich bei einem Gefreiten (caporal), wie man dem Ganzen entgehen könne. Dieser gab ihm den guten Rat, Girault solle seinem Hauptmann sagen, er habe Halsschmerzen und könne den Kopf nicht drehen: „Ich wurde bis zu meiner Heilung, die allerdings auf sich warten ließ, vom Dienst befreit.“4
Jakob Röhrig gelang es hingegen nicht, sich zu drücken. Da er wie Girault nicht sofort an die Front kam, musste er monatelang exerzieren, was ihm äußerst zuwider war:
Aber das Exerzieren lernen! O, das verdammte Zeug, dachte ich, das ist ja nur da, um die Leute zu quälen. Denn mit geschultertem oder angeschlagenem Gewehr zu stehen, bis alle Fehler verbessert waren, dies hatte seine Flausen und war keine Kleinigkeit. So ging es nun von einem Tag zum anderen.5
Dabei waren lange Ausbildungszeiten in der Garnison nur in relativ ruhigen Phasen überhaupt möglich. Weder die revolutionären Armeen noch Napoleon gegen Ende seiner Herrschaft konnten es sich leisten, Soldaten für viele Monate in Lagern oder Kasernen auszubilden. Die wirkliche Ausbildung zum Soldaten erfolgte daher nicht in den Kasernen, sondern auf den Feldzügen. Und diese „Ausbildung“ dauerte lange. Es heißt, man habe zehn Tage gebraucht, um aus einem Bauern oder Handwerker einen Soldaten zu machen. Aber es habe zehn Jahre gedauert, um aus einem Soldaten einen grognard zu machen: einen kampferprobten, grummelnden, unzufriedenen, schimpfenden, mutigen Veteranen, das Rückgrat der Armee.
Das Regiment: Die Familie des Soldaten
Militärsoziologen haben als Voraussetzung einer funktionierenden, erfolgreichen militärischen Organisation die „Primärgruppe“ ausgemacht. Gemeint sind damit die Kameraden, die den Soldaten als eine Art engere Heimat stets umgaben. Die Primärgruppe war und ist dem Soldaten Familienersatz, und er setzt sich, so die These, für das Wohlergehen ihrer Angehörigen sehr viel motivierter ein als für übergeordnete politische Ziele des Staates.
In den Erinnerungen der Soldaten der Napoleonischen Epoche spielt diese Primärgruppe allerdings kaum eine Rolle. Theoretisch gehörte jeder Soldat der französischen Armee einer zehn bis zwölf Mann starken Korporalschaft an. Doch die Mitglieder dieser Gruppe bleiben in den Memoiren eher im Dunkeln. Jakob Röhrig etwa erwähnt immer wieder „Kameraden“. Doch meist nur dann, wenn sie in einer bestimmten Episode eine besondere Rolle gespielt hatten. Danach verschwinden sie wieder und Röhrig erscheint fast durchgängig als Einzelgänger. Die Gründe für das seltsam verschwommene Bild der Primärgruppe bzw. der Kameraden sind nicht eindeutig zu klären.
Der britische Militärhistoriker Paddy Griffith gibt einen Hinweis darauf, weshalb die Primärgruppen in Napoleons Armeen nicht sehr stabil waren.6 Zwar wurden Rekruten gruppenweise unter Aufsicht erfahrener Soldaten zu den Garnisonen oder an die Front geschickt. Doch dort wurden sie auf die Einheiten verteilt, die Ersatz brauchten. Das heißt, die Gruppe, die sich auf dem oft wochenlangen Marsch gebildet hatte, wurde wieder auseinandergerissen.
Dergleichen geschah immer wieder. Hatte eine Einheit Verluste erlitten, dann nahm man Soldaten aus anderen, um sie wieder auf die volle Kopfzahl zu bringen. Daher konnte es geschehen, dass ein Soldat innerhalb seines Regiments ständig von Korporalschaft zu Korporalschaft hin- und herversetzt wurde.
Die Soldaten betrachteten daher das Regiment als ihre eigentliche Heimat, ihre militärische „Familie“, und nicht die Korporalschaft, die Kompanie oder das Bataillon. Wurden Kompanien oder Bataillone auch aufgerieben, das Regiment mit seiner ruhmreichen Geschichte blieb bestehen.
Soldaten, die vorübergehend von ihrem Regiment getrennt waren, wollten nicht zu ihrer Kompanie zurück, sondern zu ihrem Regiment: „So angenehm auch meine Lage in Sevilla war, so sehnte ich mich dennoch nach einer Wiedervereinigung mit dem Regimente, das der Soldat als seine Familie anzusehen gewöhnt ist“, schreibt der hessische Leutnant Ludwig Venator.7 Das galt nicht nur für Offiziere. Auch der Infanterist Jakob Klaus war nach einem achttägigen Hospitalaufenthalt in Spanien enttäuscht, als sein 117. Linienregiment inzwischen abmarschiert war. Er kam zunächst zum 103. Regiment, schloss sich einer Abteilung des 115. an und traf schließlich wieder sein 117. Regiment: „Ich war so froh darüber, ich glaubte, ich sähe Vater und Mutter wieder.“8
Auch wenn die Kameraden in der nächsten Umgebung der Soldaten in deren Erinnerungen kaum eine Rolle spielen, so ist doch oft von Freunden und Bekannten die Rede. Die Armeen Napoleons waren groß. Doch nicht so groß, dass man nicht ständig auf vertraute Gesichter stoßen konnte. Jeder der Memoirenschreiber erwähnt irgendwann Kameraden, die ihm mit einem Schluck Schnaps das Leben retteten, die er im Hospital besuchte oder deren Tod er betrauerte. Doch handelt es sich hierbei oft um Bekannte aus der Zeit vor dem Militär; um Nachbarn, Verwandte, Männer aus der gemeinsamen Heimatstadt oder zumindest der Heimatregion. Gascogner vertrugen sich eher mit Gascognern, Pfälzer mit Pfälzern, Elsässer mit Elsässern, Polen mit Polen als mit den Zufallsbekanntschaften in der eigenen Korporalschaft.
Offiziere und Soldaten
Loyalität und Anhänglichkeit gab es nicht nur zwischen Landsleuten. Die Offiziersburschen scheinen „ihrem“ Leutnant oder Hauptmann zumeist treu ergeben gewesen zu sein. Allerdings wird solch treue Ergebenheit eher von den deutschen Rheinbundtruppen unter Napoleons Befehl berichtet. Dort waren die Offiziere oft noch Adlige, und die einfachen Soldaten kannten ihnen gegenüber nichts anderes als Unterwerfung und Ehrerbietigkeit.
Deutschland von Napoleons Gnaden: Der Rheinbund
Unter dem Ansturm der Französischen Revolution zerstob das „Heilige Römische Reich Deutscher Nation“ und mit ihm der territoriale Flickenteppich, zu dem sich Deutschland entwickelt hatte. Napoleon schuf aus vielen kleinen Herrschaften größere, mächtigere Staaten: so etwa die Königreiche Württemberg, Bayern und Westfalen, die Großherzogtümer Hessen-Darmstadt und Baden und andere. Sie schlossen sich 1806 unter dem Protektorat Frankreichs zum „Rheinbund“ zusammen.
Aus heutiger Sicht bedeutete dieser erzwungene, aber überfällige Schritt einen bedeutenden Modernisierungsschub. Doch für Napoleon waren diese Staaten zunächst nichts anderes als Ausbeutungsobjekte, die vor allem Soldaten und Geld zu seiner Verfügung zu stellen hatten.
Etwas anders sah es in der französischen Armee aus. Zwar wäre es falsch, anzunehmen, dass der Adel nach der Revolution völlig aus dem Offizierkorps verschwand. Aber er hatte seine exklusive Stellung verloren. Blaues Blut war nicht mehr die Voraussetzung dafür, Offizier werden zu können. Mehr galten nun militärisches Talent und persönlicher Mut. In der Tat gibt es zahlreiche Beispiele dafür, dass in den Armeen des Kaisers aus einfachen Soldaten Offiziere wurden. Über drei Viertel der Truppenoffiziere sollen aus dem Mannschaftsstand aufgestiegen sein. Das Verschwinden der Standesschranken zwischen Soldaten und Offizieren als Folge der Revolution führte allerdings zum Aufweichen des starren Gehorsams. Nun, da jeder Soldat, der des Lesens mächtig war, theoretisch Offizier werden konnte, fühlten sich viele auch dazu berufen. Sie hatten häufig das Gefühl, bessere Führer zu sein als die eigenen Vorgesetzten. Offiziere standen nun in der Kritik der eigenen Leute.
Insubordination und Disziplin
Der Militärhistoriker Rory Muir schreibt in seinem Buch Tactics and the Experience of Battle in the Age of Napoleon, dass es wenige Hinweise dafür gebe, dass unbeliebte Offiziere von den eigenen Leuten beschossen worden seien. Seine Vermutung, dass es solche Fälle gegeben haben muss, kann er daher nicht belegen.9 Genau so einen Fall jedoch schildert Jakob Röhrig in seinen Erinnerungen.
Es war während der Völkerschlacht von Leipzig. Die Kompanie Röhrigs stand unter starkem Beschuss feindlicher Scharfschützen mit treffsicheren Gewehren: „Die Kerls schossen so, dass mit jedem Schuss einer [seiner Kameraden] blessiert wurde.“10 Nun erhielt die Kompanie den Befehl, vorzurücken. Kurz darauf kam die Meldung, der Hauptmann sei getroffen. Röhrig eilte zu dem Verwundeten, der ihm zurief: „Je suis bless, et mžme par derri re!“ („Ich bin verwundet, und zwar von hinten!“)
Die eigenen Leute hatten also die Gelegenheit ergriffen, dem verhassten Offizier in den Rücken zu schießen. Der Hauptmann war gebürtiger Franzose, während die Masse des 150. Regiments, dem Röhrig angehörte, Deutsche waren. Der capitaine hatte seine deutschen Untergebenen häufig schlecht behandelt, ja geschlagen. Als er nun hilflos am Boden lag, sollten ihn einige Soldaten auf einer Leiter aus der Frontlinie tragen. Es fanden sich jedoch keine Freiwilligen. Röhrig musste einem Soldaten den Befehl geben, mit Hand anzulegen. Widerwillig folgte der Mann dem Befehl und verschwand mit dem schimpfenden französischen Hauptmann: „Lieber Sergentmajor [Feldwebel]! Ihnen zum Gefallen will ich es ja tun, aber diesem Saubraten nicht.“ Allerdings kam der Infanterist schon wenig später zu Röhrig zurück.
Auf meine Frage: „Wo ist der Kapitän?“ erhielt ich die Antwort: „Drüben, hinter dem Dorfe, liegt er im Chausseegraben, der Hundsbraten. Ich hoffe, er wird uns nicht mehr prügeln. Denken Sie sich“, fuhr er fort, „als wir jenseits des Dorfes waren, forderte er vom Bedienten [dem französischen Burschen des Hauptmanns] un baton. Ob ich schon nicht viel französisch verstehe, so weiß ich doch, dass baton Stock heißt. Er wollte mir also ein paar überhängen [verprügeln], weil ich nicht ordentlich Tritt mit dem anderen hielt […]. Den Bedienten fragte ich: ,Was sagte er?‘ ,O, niske, niske‘, war seine französisch-deutsche Antwort. Ich aber bedachte mich kurz und mit dem Worte: ,Ab‘ warf ich meinen Anteil Leiter in den Graben und machte schnellen Schritts kehrt.“
Das Fazit Röhrigs: „Hier also ein Beweis, dass die tyrannische Strenge der Herren Offiziere im Kriege nicht durchgeht.“ Von einem ähnlichen Fall berichtet der Gardeunteroffizier Adrien Bourgogne. Einem unbeliebten Offizier hatte eine Kanonenkugel das Bein abgerissen. Der tödlich Getroffene flehte die Männer an, ihn zu erschießen. Doch keiner der Männer wollte dem verhassten Vorgesetzten diesen letzten Dienst erweisen. Schließlich tötete eine weitere Kanonenkugel den unglücklichen Mann.
Diese Episoden sollen nicht belegen, dass Offiziere Freiwild waren. Es kam auf ihr Verhalten an. Waren sie tapfer und fürsorglich, dann riskierten die Soldaten ihr Leben für sie. Die Offiziere wurden jedoch genau beobachtet, und die einfachen Soldaten waren selbstbewusst geworden. Befehl und Gehorsam waren nach wie vor Grundlage militärischer Organisation. Aber die Männer waren nun eher dazu bereit, sich über Befehle, die sie nicht akzeptierten, hinwegzusetzen.
Nach der Schlacht von Wagram (nördlich von Wien) im Sommer 1809 etwa verbrüderten sich französische und österreichische Soldaten und die ganze französische Armee war betrunken. Nach dem Gemetzel hatten sich die Männer in den Weingärten niedergelegt. Nach Elz ar Blaze – dessen nüchterne, zynische Erinnerungen an seine Dienstzeit als Truppenoffizier zu den realistischsten Memoiren aus Napoleonischer Zeit zählen – hätten einige tausend Feinde die völlig betrunkene Armee vernichten können. Dem konnten die Offiziere nicht tatenlos zusehen. Den Männern wurde befohlen, die Österreicher, mit denen sie tranken, zu Gefangenen zu machen und deren Waffen zu zerstören. Die Antwort der Männer: „Halt. Es reicht, Herr Offizier. Sie wollen, dass wir diese guten Freunde ins Gefängnis stecken, diese tapferen Burschen, die uns zu trinken gegeben haben, diese wunderbaren Österreicher, die uns nichts Böses wollen!“11 Als der Offizier den Befehl wiederholte, wurden die Männer deutlich: „Warte mal. Wenn Du nicht augenblicklich verschwindest, dann wirst Du sehen, was wir mit Deinen Befehlen machen!“
Natürlich war Insubordination nicht die Regel. Vor allem die deutschen Kontingente Napoleons neigten selten zu Aufruhr und Meuterei. Der hessische Leutnant Friedrich Peppler erlebte auf dem Rückzug von Moskau, wie französische Soldaten „unter grässlichen Verwünschungen“ mit ihren Gewehren auf ihre Generäle anlegten.12 In den deutschen Kontingenten, so zumindest die Einschätzung Pepplers, blieben die Männer jedoch meist in der Hand ihrer Offiziere.
Das beobachtete auch ein Landsmann Pepplers, der Hauptmann Franz Röder, auf dem Marsch nach Moskau. Als seine Einheit in Regen und Kälte biwakierte, war er der Einzige, der mit den Soldaten im Freien übernachtete. Die anderen Offiziere hatten es sich in Häusern bequem gemacht. Während die Männer auf „nassem Gras“ schlafen mussten, verweigerten die Offiziere ihnen das wenige Stroh, das zu finden war. Röders Kommentar:
Es überrascht, dass die Männer es noch immer hinnehmen, von den Offizieren herumkommandiert zu werden. Das beruht nicht auf Disziplin, sondern vielmehr auf der Angst vor der Peitsche und dem Respekt, den ein Sklave seinem Herrn entgegenbringt. Französische Soldaten hätten es nicht hingenommen, wenn ihre Offiziere sie so hart behandelt hätten, nur um sie zu ärgern.13
Aber nicht alle deutschen Kontingente waren frei von Kritik an den jeweiligen Offizieren. Der bayerische Infanterist Deifl, ein Eisenschmelzer aus Neuessing bei Kelheim, wurde zusammen mit einigen Kameraden von seinem Leutnant beim Einsatz gegen Aufständische in Tirol 1809 im Stich gelassen. Nur mit Mühe gelangten die Männer zur eigenen Einheit zurück. Sie ließen in den folgenden Tagen den Leutnant wissen, was sie von ihm hielten:
Der Leutnant Braun musste aber gar vieles hören von denen Soldaten. Wenn er an unserer Kompanie vorbei kommt, dann heißt es: „Wer hat den ersten Zug versoffen [ein ganzer Zug, ca. 40 Mann, war in Gefangenschaft geraten, weil der Leutnant den Befehl zum Rückzug nicht weitergegeben hatte]? Der Leutnant Braun, Brrraun, Brrraun“, denn er hatte eine solche gereschte [barsche] Sprache, und er litt es ohne Zucken.14
Der große Motivator?
Die Soldaten des Ancien Régime brauchte man nicht eigens zu motivieren. Sie waren Söldner, es war ihr Beruf, sich der Gefahr auszusetzen. Das reichte bei Bürgersoldaten nicht mehr aus. Auch wenn hier ein großer Anteil an Revolutionsmystik mitschwingt, so waren doch viele Soldaten der Revolutionskriege dadurch motiviert, dass sie für die neuen Ideale kämpften: für Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, für die Herrschaft des Volkes gegen die Tyrannei. Jean-Roch Coignet, der es vom Schafhirten bis zum Gardehauptmann brachte, erzählt, dass während seiner Ausbildung jeden d cadi (im revolutionären Kalender anstelle des christlichen Sonntags gesetzt, allerdings nicht jeden siebten, sondern jeden zehnten Tag) die Soldaten zum Freiheitsbaum befohlen wurden. Dort schrie alles „Es lebe die Republik“, die Offiziere zogen ihre Säbel, die Kirchenglocken läuteten, und die Männer mussten „les aristocrates à la lanterne“ („hängt die Adligen an die Laternen“) singen.
Diese Indoktrination war durchaus erfolgreich. Die Briefe der einfachen Soldaten der Revolutionskriege geben häufig eine Mischung aus Stolz auf die Republik, Angst um das revolutionäre Vaterland und Hass auf die Feinde wieder. Doch nach und nach schwand der revolutionäre Elan als Motivation. Zwar blieben Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit auch das Motto der Nation, nachdem Napoleon sich im Dezember 1804 zum Kaiser der Franzosen gemacht hatte. Doch kämpften seine Soldaten nicht mehr für die Verbreitung dieser Ideale. Letztendlich kämpften sie für die Macht Frankreichs, einer Nation, die jetzt Grenzpfähle und Könige exportierte und nicht mehr Ideen. Und sie kämpften, bewusst oder unbewusst, für die Machtgelüste Napoleons. Für viele Soldaten war es l’Empereur, der sie motivierte. Das Gefühl, einer unbezwingbaren Armee unter einem militärischen Genie anzugehören, machte die Männer stolz und bereit, sich ins Feuer zu stürzen. So zumindest das gängige Klischee. Doch stimmt dieses Klischee?
Der „kleine Korporal“, so Napoleons Spitzname bei den Soldaten, war in der Tat noch Jahrzehnte nach seinem Tod das Idol vieler Soldaten, die unter ihm gedient hatten. Jakob Röhrig etwa erinnerte sich, sein Herz habe nach seiner Rückkehr aus dem Feld nicht an Frankreich gehangen, sondern am Kaiser. Und der einfache Kanonier Wesemann, ein Schafmeister aus Söhlde in Westfalen, wurde regelrecht böse, wenn nach Napoleons Niederlage Spottlieder auf den Kaiser gesungen wurden.
Napoleon war ein Meister darin, die Männer zu motivieren. Für viele Soldaten gab es nichts Ehrenhafteres, als den Kaiser zu sehen, von ihm erkannt, gelobt zu werden. Napoleon nutzte dies weidlich aus. Am Abend einer Schlacht ließ er Soldaten zu sich kommen, die besonders tapfer gewesen waren. Oft erhielten sie Geldgeschenke, das Kreuz der Ehrenlegion oder die Aussicht auf Beförderung. Er sprach sie mit ihrem Namen an, den er sich vom jeweiligen Regimentschef hatte nennen lassen. Und er kniff sie – besonderes Zeichen großer Huld – anerkennend ins Ohr.
Dem späteren Gardehauptmann Jean-Roch Coignet wurde eine solche Ehrung vom noch jungen, feurigen Napoleon nach der Schlacht von Montebello (im Jahr 1800 in Norditalien) zuteil. Coignet hatte in seinem ersten Gefecht eine Kanone erobert, seinem Hauptmann das Leben gerettet und noch drei Österreicher getötet. Auf Wunsch des Generals Berthier, des unentbehrlichen Chefs des Stabes Napoleons, wurde Coignet dem Korsen vorgestellt, zu diesem Zeitpunkt noch Erster Konsul.
Der Konsul trat auf mich zu und kniff mich ins Ohr. Ich dachte, er wolle mich ausschimpfen, aber ganz im Gegenteil, er war sehr freundlich; und während er mich noch immer am Ohr festhielt, sagte er: „Wie lange dienst Du schon?“ „Dies ist meine erste Schlacht.“ „Ah, tatsächlich, das ist ein guter Anfang. Berthier, merke ihn vor für eine Ehren-Waffe [unter der Republik verliehene Auszeichnung für besondere Tapferkeit]. Du bist zu jung, um in meiner Garde zu dienen; dafür muss man vier Feldzüge mitgemacht haben. Berthier, notiere diesen Mann […]. Du kannst jetzt gehen“, sagte er zu mir, „aber eines Tages wirst Du in meiner Garde sein.“15
Solche Geschichten sprachen sich herum. Und so glaubten die Soldaten oft wirklich, dass den Kaiser ihr Wohlergehen, ihr persönliches Schicksal interessierte. Doch abgesehen von einigen Männern seiner Alten Garde oder hohen Offizieren, die ihn seit Beginn seiner Militärkarriere begleitet hatten, war dies meist nicht der Fall. Napoleon mag gute Eigenschaften gehabt haben. Mitgefühl und Menschlichkeit gehörten nicht dazu. Sie wären ihm, der seine Ziele nur dadurch erreichen konnte, dass er Menschen opferte, auch kaum nützlich gewesen.
So waren seine großen Gesten letztlich oft hohl und berechnend. Etwa die l gion d’honneur, die Ehrenlegion, deren Mitgliedschaft – sichtbar am croix, dem auf der Brust getragenen Orden in Kreuzform – manche Soldaten mehr begehrten als Geld oder Beförderung. Napoleon selbst bezeichnete den Orden als hochet, als Firlefanz. Mit solchem „Firlefanz“ baute der Kaiser einen Kult um seine Person, dessen Zauber nicht wenige erlagen.
Nicht jeder Soldat ließ sich jedoch von Orden, Adlern und Frankreichs Ruhm blenden. Jakob Röhrig schildert in seinen Erinnerungen die Verleihung des Adlers an sein 150. Linienregiment im Frühjahr 1813, nach der Schlacht von Möckern (bei Magdeburg). Was in den Erinnerungen anderer Soldaten und ihnen folgend in der Napoleon verherrlichenden Literatur oft als heilige Handlung erscheint, entpuppt sich hier fast als Schmierenkomödie:
Auf diesem Felde kam der Kaiser zu uns, ließ das Regiment in einen Zirkel um sich schwenken und hielt eine lange Rede. Nach ihr enthüllte er eine reich mit Gold gestickte [sic!] Fahne, die mit dem kaiserlichen Wappen und unserer Regimentsnummer 150 und obendrauf mit einem übergoldeten Adler versehen war, und überreichte sie mit den kaiserlichen Händen unserem Obersten. In seiner Rede sagte er unter anderem, wie wir uns jederzeit in Gefahr um diese Fahne versammeln sollten und sie nicht eher verlassen dürften, bis sie von unserem Blut getränkt sei. Was er weiter sagte, ist mir entfallen, auch habe ich nicht alles verstanden. Als er geendet, erhob er die Rechte, was er auch uns zu tun befahl. Dabei sollten wir ausrufen: „Je le jure“, zu deutsch: „Ich schwöre es!“ Da rief nun einer: „Gib uns Brot!“, der andere: „Gib uns Schuhe!“, weil in diesen Artikeln Mangel war. Ich aber rief: „Je le jure!“16
Die Soldaten des Jahres 1813 waren andere als die der Feldzüge in Italien, Ägypten oder der Jahre 1805/1806. Vor allem die deutschen Untertanen der grande nation hatten genug von der Jagd nach Ruhm. Das 150. Regiment (das dem Kaiser nicht richtig hatte zuhören wollen) trat im August 1813 mit 78 Offizieren und 2727 Soldaten den Feldzug in Schlesien an. Es hatte am 1. November 1813 eine Kopfstärke von 22 Offizieren und 254 Mann.17 Die Mehrzahl der 2500 Männer, die nicht mehr bei der Truppe waren, dürfte dabei nicht die Fahne mit ihrem Blut getränkt haben, sondern schlicht übergelaufen sein.
Die Adler
Im Jahr 1804 beendete Napoleon ein wildes Durcheinander an Regimentsfahnen und Standarten. Ein Standardmodell wurde eingeführt: die Trikolore blau-weiß-rot mit 81 Zentimeter Kantenlänge. Den Abschluss des Schaftes bildete ein 20 Zentimeter hoher Adler mit ausgebreiteten Flügeln. Die Männer nannten ihn respektlos „Kuckuck“. Die Standarte trug die Inschrift: „Der Kaiser der Franzosen an das … Regiment“, später ergänzt durch die Schlachten, an denen das Regiment teilgenommen hatte. Neuaufgestellte Einheiten mussten sich ihren Adler durch Tapferkeit auf dem Schlachtfeld erkämpfen.
Der Adler war nicht mehr nur sichtbarer Sammelpunkt in der Schlacht, sondern nationales Symbol. Die Soldaten sollten ihn bis zum Letzten verteidigen. Nichts war demütigender für ein Regiment, als den Adler an den Feind zu verlieren.
Dass vieles, was der Napoleon-Mythos an Bildern transportiert, nachträglicher Verklärung entstammt und nicht der Realität jener Jahre, unterstreichen selbst französische Augenzeugen und Historiker. Elz ar Blaze etwa bestätigt zwar, dass die Anwesenheit Napoleons die Moral der Männer verdoppelt habe. Er galt als guter General, dessen Dispositionen für die Schlacht den eigenen Armeen stets einen beruhigenden Vorteil gegeben hätten. Andererseits hätten die Soldaten – so Blaze, der als Absolvent der Kriegsschule seine Umgebung kritisch beobachtete – nicht für den Kaiser gekämpft, sondern für Frankreich. Sie hätten ebenso für Louis XVIII. gekämpft, der nach Napoleons Sturz den Königsthron bestieg, so lange es gegen die Russen, die Preußen und die Österreicher gegangen wäre. Das vive l’empereur, „Es lebe der Kaiser“, habe er, Blaze, auf den Schlachtfeldern nur selten gehört. Und wenn, dann sei es befohlen worden. Die Soldaten hätten von Heimkehr und Frieden geträumt, nicht von Schlachten, Feldzügen und Biwaks.
Dass Blazes nüchterne Erinnerungen eines Offiziers der Großen Armee der Wirklichkeit nahe kamen, bestätigt der französische Historiker Pierre Charri. In seinem Buch Lettres de Guerres, 1792–1815 hat er über 400 Briefe französischer Soldaten jener Jahre auszugsweise veröffentlicht. Sein Fazit: Der Kaiser spielte in den Briefen so gut wie keine Rolle. Und wenn, dann nur als weit entfernte Autorität. Die Frage, ob die Männer für den Kaiser sterben wollten, verneint Charri.
Wenn der Kaiser dennoch zum Idol vieler Soldaten wurde, so geschah dies oft aus der zeitlichen Distanz zum Erlebten heraus, im verklärten Rückblick. Von den Millionen von Soldaten haben nur wenige ihre Erinnerungen niedergeschrieben. Und wenn, so nicht selten aus dem Gefühl des Stolzes heraus, Teil einer scheinbar unbezwinglichen Militärmacht gewesen zu sein, an deren Spitze Napoleon einst gestanden hatte. Die Bedrückungen des Alltags, die sich in den Briefen der Kriegszeit eher spiegeln als in den Memoiren, waren nach Jahren und Jahrzehnten weitgehend vergessen. So wurde Napoleon erst nach dem Krieg zum Abgott der Soldaten, die oftmals ihr ziviles Leben als wenig prickelnd empfanden, verglichen mit ihrer Dienstzeit in der Grande Armée.