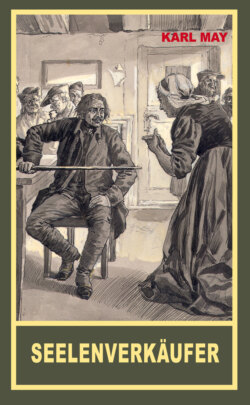Читать книгу Seelenverkäufer - Karl May - Страница 6
Im Schloss zu Dessau
Оглавление‚Der alte Knasterbart‘, wie der Feldmarschall des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation und Preußens, Leopold von Anhalt-Dessau, gern von seinen Soldaten genannt wurde, saß in seinem Arbeitszimmer. Die kleinen Fältchen an den äußeren Augenwinkeln waren zusammengezogen und die tiefen Furchen der Stirn senkten sich nieder fast bis auf die Nasenwurzel – ein Zeichen, dass er sich mit unangenehmen Gedanken beschäftigte.
Früher war es seine treue Lebensgefährtin, die einstige Apothekerstochter Anna Luise Föse gewesen, die mit mildem Zuspruch so manche Wolke verscheucht, so manche Sorge mit ihm geteilt hatte, aber die lag nun im Grab, die alte, liebe, gute Anneliese1, und er musste nun allen Ärger, alle Kränkung allein tragen und das wollte ihm doch gar nicht in den harten Trotzkopf, der die lange Reihe von Jahren bis auf den heutigen Tag kein anderes Gesetz gekannt hatte als seinen eigenen Willen.
Ärgerlich schob er den Stuhl zurück, riss einige Knöpfe des Uniformrocks auf und maß mit langen, raschen Schritten das Zimmer.
„Das ist doch, um bei lebendigem Leib aus der Haut zu fahren!“, murmelte er. „Da hat der König am dreißigsten September2 bei Sorr die Österreicher mit seinen achtzehntausend gegen volle vierzigtausend aufs Haupt geschlagen, ihnen zweiundzwanzig Kanonen, zwölf Fahnen und zweitausend Gefangene abgenommen und glaubt nun, dass sie sich auf eine solche Schlappe heuer nicht wieder hinauswagen werden. Die Armee kantoniert bei Schweidnitz und General du Moulin soll sie mit seinem Kordon an der Grenze schützen. Der König ist nach Berlin gegangen und spielt Flöte, seine Soldaten liegen in ihren Baracken und rauchen Tabak und keiner merkt, dass man unterdessen da hinter dem Gebirge einen Trank zusammenbraut, der ganz verteufelt nach Schwefel und Salpeter schmecken wird.“
Dem alten Kriegshelden schien es wohl zu tun, sich immer weiter in seinen Grimm hineinzureden.
„Ja, ja, mich macht die österreichische Therese nicht dumm, und der Kaunitz, na, der taugt so wenig, dass ich ihn für zehntausend Taler nicht in eine Kompanie stecken möchte. Der Kerl ist ja die reine Flaumfeder und zieht zehn Röcke, zwanzig Oberröcke und dreißig Pelze an, wenn er sich in den Hundstagen einmal an die Luft fahren lässt, und so einem Ofenhocker sollte der Dessauer nicht in die Karten gucken können? Prost Mahlzeit! Aber was hilft’s denn, he? Einen Brief nach dem andern schick’ ich nach Berlin, warne, mahne, bitte, drohe, kurz und gut, ziehe alle möglichen Saiten auf – und was ist die Folge? Man antwortet mir nicht einmal, lacht mich vielleicht gar noch dazu aus. Da muss doch gleich ein hundsmiserables Graupelwetter dreinschlagen, mich auch noch auszulachen! Wenn ich nur ein einziges Wort davon höre, so nehm’ ich meine zwölftausend Buntröcke, marschiere auf Berlin und lass’ das ganze armselige Nest Spießruten laufen, vom König an bis herunter zum letzten Schusterjungen!“
Jetzt befand sich der Sprecher in voller Wut. Bei den letzten Worten war er stehen geblieben und hatte drohend den Arm erhoben. Er dachte gar nicht daran, dass er sich in der schönsten Revolution gegen seinen Feldobersten befinde, und als habe jemand einen Einspruch gegen seine Rede erhoben, fuhr er plötzlich auf den Absätzen herum und rief:
„Was, das tät ich nicht? Warum denn nicht, he? Wer will mir’s denn verwehren, mir, dem Sieger in den Niederlanden, am Rhein, in Bayern, in Italien, in Schweden und so weiter? Aber was ich getan hab’, das hat man vergessen, und wenn ich warne, da lacht man und – bläst Flöte dazu. I, da spielt meinetwegen Rumpelbass oder Brummeisen, aber auslachen lass’ ich mich nicht und Antwort will ich haben, wenn ich schreibe! Aber ich weiß wohl, der Fritz ist mir nicht gut, weil ich bei seinem Alten, der Herrgott hab’ ihn selig samt seinem Tabakskollegium, einen Stein im Brett hatte. Ja, der kannte seine Leute, und wenn er auch manchmal ein wenig unbequem werden konnte, so – – Na, was will Er denn, Er Schockschwerenöter?“, unterbrach er sich, als in diesem Augenblick ein Diener unter der Tür erschien.
„Oberleutnant von Polenz. Meldung aus Halle!“
„Herrrrein!“
In der nächsten Sekunde stand der Genannte gerade und steif wie ein Ladestock vor dem Fürsten, diesem mit der Rechten ein versiegeltes Schreiben hinreichend. Leopold trat damit ans Fenster, erbrach den Umschlag und begann, den Inhalt zu buchstabieren. Er war nie ein Freund und Bewunderer der edlen Schreibkunst gewesen und Meldungen lesen oder gar selbst die Feder führen, gehörte für ihn zu den größten Strapazen des Erdenlebens. Die Zeilen konnten nichts Gutes enthalten, denn seine Miene verfinsterte sich immer mehr, und als er fertig war, ballte er das Schreiben ärgerlich zusammen und trat mit Unheil verkündender Miene auf den Offizier zu.
„Weiß Er, was in dem Wisch steht?“
„Zu Befehl, Exzellenz!“
„Weiß Er auch, was draus wird, wenn das so fortgeht?“
„Zu Befehl, nein, Exzellenz!“
„So! Oberleutnant will Er sein und weiß das nicht, was sich ein jeder Tambour denken kann? Wenn das Desertieren und Ausreißen so fortgeht, steht Er zuletzt ganz allein im Standquartier und sperrt das Maul auf oder kann sich auch so nach und nach verduften wie die andern. Da schlag doch gleich das Wetter in die Disziplin! Kein Tag vergeht, wo ich nicht vom Durchbrennen höre, und allemal sind’s die besten Kerls, die sich davonmachen, während die Taugenichtse kleben bleiben. Heut wieder der Korporal Nauheimer, der bravste Unteroffizier in der ganzen Armee. Auf den hätte ich Häuser gebaut! Warum hat sich der beiseite gemacht, he? Das muss doch einen Grund haben, denn ohne Grund desertiert kein Nauheimer!“
„Halten zu Gnaden, Exzellenz, ich weiß es nicht; der Korporal Nauheimer hat sich einen Urlaub von drei Tagen genommen und ist nicht wieder eingetroffen.“
„So! Und da zetert Ihr gleich über Desertion? Es kann doch dem Mann sonst was zugestoßen sein. Werde die Sache untersuchen! – Aber was ist denn nun das andre, he? Da wagen sich die sächsischen Werber herüber über die Grenze und schnappen uns nicht nur die besten Bauernburschen, sondern auch die eignen Soldaten weg! Nun hört mir aber alles auf! Zwölftausend Preußen stehn da, ziehen die Nachtmützen über die Ohren und lassen sich die feindlichen Werber gradzu zwischen den Beinen hindurchkriechen – will Ihm denn da Sein bisschen Verstand nicht stillstehn, he? Na, ich werde die guten Herren beim Schopf nehmen, dass es ihnen grün und gelb vor den Augen funkeln soll! Wie weit ist Er denn mit Seiner Liebsten?“
„Exzellenz, immer noch auf demselben Fleck.“
„Kann mir’s denken! Tabak rauchen, Karten spielen, mit dem Säbel rasseln, den Verstand vertrinken, einem braven Bürgermädchen den Kopf verdrehen, Schulden machen, Schlägereien anzetteln, das könnt ihr alle; aber wenn es endlich einmal ernstlich einem gescheiten und anständigen Frauenzimmer gilt, da klebt ihr in der Buttermilch und wisst kein Geschick dran zu machen!“
„Exzellenz, halten zu Gnaden, das Fräulein von Naubitz hat die Marotte, nur mit einem Offizier anzuknüpfen, der eine Kompanie hat, und da...“
„Papperlapapp! Meine Anneliese hat auch nicht nach der Kompanie gefragt! Wenn man so ein Mädchen nur zu packen weiß, dann fällt sie einem ganz von selbst um den Hals; ich weiß das genau. Aber da scheint es Ihm am Besten, nämlich an der Anstelligkeit zu fehlen. Die Naubitz ist meine Pate; Sein Vater schreibt mir und bittet mich um Förderung, und ihm zuliebe, der ein alter Kriegskamerad von mir ist, tu ich auch alles Mögliche, um die Sache zu Stande zu bringen, aber wenn Er selbst den Brei immer wieder anbrennen lässt, so mag Er zusehn, wenn ein anderer kommt und sie Ihm vor der Nase wegschnappt.“
„Verzeihen, Exzellenz, das glaube ich nicht befürchten zu müssen!“
„Nicht? Da weiß ich mehr als Er. Das Teufelsmädel ist schön, reich und klug, und ich glaube, sie hat bei ihrem letzten Besuch in Berlin einen gefunden, der es geschickter anzudrehen weiß als Er. Er ist ein Rittmeister bei den Zietenhusaren und die sind in allen Dingen gewohnt, frisch dreinzuschlagen. Da ihre Eltern tot sind, so hat der Mann kurz und bündig mich um das Jawort gebeten, und wahrhaftig, er hätte es mit Freuden bekommen, wenn mir nicht noch zur rechten Zeit Sein Vater eingefallen wäre.“
„Gestatten, Exzellenz, die Frage nach dem Namen des Rittmeisters?“
„Meinetwegen; es ist der Herr von Platen, derselbe, von dem man sich so manches lustige Reiterstückchen erzählt. Der König scheint ihn sehr zu bevorzugen. Er kann sehn, wie Er ihn aus dem Sattel bringt!“
„Werde es versuchen und sage Exzellenz meinen schuldigen Dank für die gnädige Auskunft.“
„Schon gut! Das Mädel ist grad noch hier im Schloss, geht aber schon in einigen Stunden auf ihr Gut nach Beyersdorf. Er ist noch im letzten Augenblick gekommen; geh Er zu ihr und mach Er Seine Sache besser als bisher!“
Während des letzten Teils der Unterredung hatte sich der Unmut des Fürsten etwas gelegt und einer freundlicheren Stimmung Platz gemacht, ein Umstand, aus dem sich schließen ließ, dass der Vater des vor ihm stehenden Offiziers bei ihm in gutem Andenken stehen müsse. Am Schluss der Endermahnung gab er mit der Hand das Entlassungszeichen und wandte sich zurück.
Mit militärischem Gruß trat Polenz ab und schritt so schnell durch das Vorzimmer und über den Flur, dass er fast mit einer jungen Dame zusammengerannt wäre, die sich eben anschickte, die Treppe hinabzusteigen. Erschreckt fuhr er zurück, verbeugte sich errötend und stammelte:
„Entschuldigung, Fräulein von Naubitz, ich befinde ich so sehr in Eile...“
„Dass ich den Herrn Oberleutnant keinen Augenblick aufhalten, sondern ihm gern den Vortritt lassen werde“, fiel sie ihm mit stolzer Haltung und mit einem feinen, überlegenen Lächeln in die Rede, indem sie mit einer abweisenden Handbewegung zurücktrat.
„Oh, meine Gnädige – so groß ist meine Eile denn doch nicht –, dass ich nicht einige Worte...“
„Danke, danke! Der Dienst geht vor und Ihr befindet Euch im Dienst. Bitte voranzutreten!“
„Ich werde gehorchen; aber zuvor bitte ich, mir zu sagen, warum Ihr gegen meine Person eine so große Abneignung hegt!“
„Ich muss bemerken, Herr von Polenz, dass hier nicht der geeignete Ort ist, von Zu- oder Abneigung zu sprechen.“
„Dann ersuche ich ganz ergebenst um die Erlaubnis, einige kurze Minuten beim Fräulein eintreten zu dürfen!“
„Ich steh’ eben im Begriff, der Einladung einer Freundin Folge zu leisten. Es ist ein Abschiedsbesuch, der sich unmöglich aufschieben lässt.“
Polenz wollte gerade eine Entgegnung aussprechen, als sich unten eine tiefe, wohlklingende Stimme vernehmen ließ: „Hör Er, guter Freund, ist im Lauf des Vormittags nicht ein Zwiebelhändler hier gewesen?“
Die Sonderbarkeit der Frage ebenso wie der Wohllaut der sonoren Stimme, aus der trotz der in den Worten liegenden Erkundigung doch etwas Befehlendes klang, erregte die Aufmerksamkeit der Obenstehenden so, dass sie ihre eigenen Angelegenheiten vergaßen.
„Ein Zwiebelhändler? O ja“, tönte unter einem leisen Lachen die Antwort. „Er will wohl mit ihm sprechen?“
„Ja.“
„Dann ist Er wohl der Fremde, der bei Mutter Röse mit ihm gegessen hat?“
„Ja.“
„Gut, so geh Er diese Treppe hinauf. Hinter der Tür, die Ihm links entgegensteht, wird man Ihm Bescheid sagen.“
Das war die Tür des fürstlichen Vorzimmers; es handelte sich also vielleicht um eines jener spaßhaften Vorkommnisse, die zuweilen einzutreten pflegten, wenn der Fürst die Stadt oder deren Umgegend einmal verkleidet durchstrichen hatte. Die beiden an der Treppe sahen infolgedessen dem Erscheinen des Fragers mit einer gewissen Neugier entgegen.
Jetzt kam er langsam und gemächlich die Stufen heraufgestiegen. Es war ein noch junger Mann, der vielleicht dreißig Jahre zählen mochte. Von nicht zu hoher Gestalt, war er breitschultrig gebaut, von kräftigen Formen und gewandten Bewegungen. Wie er so mit über den Rücken gelegten Armen den Fuß von Stufe zu Stufe setzte, war es fast, als sei er hier zu Haus oder finde ganz und gar nichts Besonderes in einem Besuch bei dem strengen Souverän des Deutschen Reiches.
Oben angekommen, erhob er mit einem raschen und offenen Aufschlag den bis jetzt zu Boden gerichteten Blick. Als er die Dame erkannte, leuchtete es überrascht aus dem großen, dunklen Auge, aber so schnell, so kurz, dass Polenz es gar nicht bemerkte, und dann klang es in gleichgültig fragendem Ton unter dem sorgfältig gepflegten Bärtchen hervor:
„Wo ist die Tür, die einem hier links entgegensteht?“
Fräulein von Naubitz war bei seinem Anblick bis tief in den Nacken hinab errötet und schien durch die seltsame Frage ganz außer Fassung gebracht zu werden. Desto mehr aber bewahrte der Oberleutnant seine Würde.
„Kerl“, rief er, „ist Er denn wirklich so heidenmäßig dumm, dass Er nicht weiß, was links und was eine Tür ist?“
„Freilich! Ich hielt Sein großes Maul für das Loch, durch das ich kriechen soll. Er reißt es ja sperrangelweit auf.“
Damit drehte sich der Fremde nach links und trat in das Vorzimmer. Polenz hob schon den Fuß, ihm nachzueilen, um ihn für die Beleidigung zu züchtigen, aber die Gegenwart der Angebeteten veranlasste ihn, seinen Zorn zu beherrschen.
„Freches Subjekt!“, brummte er. „Solches Volk darf man aber gar nicht beachten! – Also das gnädige Fräulein steht im Begriff, auszugehen? Und doch lässt mich der Dienst keine spätere Stunde erwarten.“
„Nun, so teilt mir schnell mit, was Ihr von mir wollt!“
„Was ich will, fragt Ihr? Nichts weiter als eine endgültige Entscheidung. Ihr kennt mich und meine Verhältnisse und wisst auch, dass ich nicht ohne Vorsprache bin.“
„So wisst Ihr desto weniger, dass die Vorsprache der Liebe nur schadet. Diese lässt sich nicht kommandieren, sie handelt nach eigenem Ermessen und ist nur für den Preis zu haben, den sie selbst bestimmt.“
„So nennt mir diesen Preis!“, bat der Offizier, indem sein Blick sich mit verlangender Glut an die Sprecherin heftete.
Mit träumerisch glücklichem Ausdruck suchte ihr Auge die Tür, hinter der vor wenigen Sekunden der Fremde verschwunden war, und leise klang es von ihren Lippen.
„Ich kann nur einem Mann gehören, der neben Körper- und Geisteskraft auch einen Sinn für die feineren Gefühle des Herzens besitzt. Das gemeine, alltägliche Leben muss mit den Strahlen der Romantik übersponnen werden, wenn die Liebe heimisch werden soll, und ich kann mir nichts Entzückenderes denken, als wenn zum Beispiel ein stolzer Ritter die Zeichen seines Standes von sich legt, um im unscheinbaren Kleid nach dem Besitz der Geliebten zu ringen.“
In süßer Vergessenheit haftete ihr Auge noch immer an der Tür, als könne sie durch diese das Wesen erblicken, von dem ihre Worte redeten; dann aber richtete sie sich stolz empor, grüßte den Oberleutnant mit einem kurzen Nicken des weißgepuderten Lockenköpfchens und rauschte die Stufen hinab.
„Die Zeichen seines Standes von sich legt – also inkognito – in unscheinbarem Kleid – stolzer Ritter – Besitz der Geliebten ringen“, murmelte Polenz. „Hm, hab’ noch gar nicht gewusst, dass sie an solchen alten Burg- und Rittergeschichten Wohlgefallen findet. Mir soll’s recht sein – da bin ich mit dabei. Nach Beyersdorf geht sie? Gut, ich komme auch nach Beyersdorf – aber natürlich inkognito. Da gibt’s dann vielleicht Eduard und Kunigunde und nachher zur Abwechslung Kunigunde und Eduard.“
Unter diesen Gedanken stieg auch er jetzt mit nachdenklicher Miene nach unten.