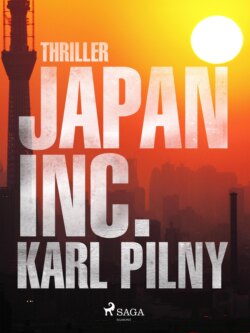Читать книгу Japan Inc. - Karl Pilny - Страница 6
1. Tag
ОглавлениеShanghai, 1. Mai 2012. 17:00 Uhr
Am ersten Nachmittag im Mai herrschte am Bund, der berühmten Uferpromenade der südchinesischen Metropole, wie üblich ein reges Treiben. Vermutlich war das Treiben sogar noch reger als üblich. Aus den imposanten Bank- und Geschäftsgebäuden am breiten Boulevard strömten Menschen um Menschen und fluteten in hektischem Gewimmel die Gehsteige und Seitenwege hinab. Nebenan auf der zehnspurigen Fahrbahn brummte der Verkehr. Autos hupten, Motoren heulten, Fahrer fluchten oder ergaben sich seufzend in die unabänderliche Tatsache, dass im unerbittlich anrollenden Verkehrsaufkommen der Rushhour ohnehin nur Stop and Go möglich war – wie sehr man auch hupen und fluchen mochte.
Vor den monumentalen Kulissen der Prachtbauten im Kolonialstil wirkten die wogenden, schnatternden und brummenden Massen, die namenlos die Straßen und Plätze bevölkerten, wie wimmelnde Ameisen. Wie Ungeziefer. Irgendein übermenschliches Wesen einer höheren Existenzform könnte auf die Idee kommen, dass man über dieses lästige, wertlose Ungeziefer nur das entsprechende Gift zu sprühen bräuchte, um es ein für allemal loszuwerden. Dann würde plötzlich gespenstische Ruhe einkehren in den Straßen und Häusern dieser eben noch vor Leben strotzenden Stadt …
Es war ein sonniger Tag. Auf der eigentlichen Promenade, direkt am Wasser des träg dahinfließenden Huangpu mit Blick auf die futuristisch aufragende Skyline des neuen Stadtviertels Pudong am anderen Ufer gegenüber, waren neben spazierenden Touristen und eilenden Geschäftsleuten wie immer auch zahlreiche Jogger unterwegs. Unter ihnen besonders viele »Langnasen« – Geschäftsleute aus Europa und Amerika, die seit der Öffnung Chinas zu Zehntausenden in die fernöstliche Boomtown geströmt waren und in ihrer raren freien Zeit versuchten, sich fit zu halten.
Der durchtrainierte, etwa vierzigjährige Läufer, der mit elastischen Sätzen den Bund entlangschnellte, hatte für die kurzatmigen abendländischen Freizeittraber nur ein verächtliches Lächeln übrig. Er hätte als Japaner durchgehen können, auch wenn er für einen Japaner wohl etwas überdurchschnittlich groß gewachsenen war. Immerhin war er im japanischen Osaka geboren und aufgewachsen, doch sein Name – Kim Park – verwies auf seine wahre Herkunft: Kims Eltern stammten aus dem nördlichen Korea und gehörten zu jenen etwa zweieinhalb Millionen Koreanern, die während der japanischen Besatzungszeit auf Nippons Inseln verschleppt und zur Zwangsarbeit verdammt worden waren. Etwa 700000 von ihnen – darunter auch Kims Großeltern – waren nach der Kapitulation des Kaiserreichs im August 1945 in Japan geblieben, wo ihnen der erhoffte gesellschaftliche Aufstieg indes meist versagt blieb. Kim Park war, nach vielen Umwegen, einer der wenigen Japan-Koreaner, die es geschafft hatten. Doch dafür hatte er einen hohen Preis gezahlt.
Während die meisten der europäischen Langnasen und »Butterstinker«, an denen der Koreaner wie selbstverständlich vorbeizog, in der abgasgeschwängerten Luft der Industriemetropole schon bald nach Sauerstoff japsten, wirkte Kim wie ein ausgeruhter Athlet, der sich aufwärmte. Dass er gerade erst ein hartes, sechzigminütiges Taekwondo-Training absolviert hatte, war ihm beim besten Willen nicht anzumerken. Bis zum Kerry Center an der Nanjing Xi Lu, wo er, nur einige Stockwerke über seiner kleinen Filmproduktionsfirma, in der 30. Etage in einem Penthouse residierte, hatte er noch etwa vier Kilometer vor sich. Ein Klacks.
Kim erhöhte die Schrittfrequenz, als er auf die Nanjing Lu einbog, die turbulente Hauptgeschäftsstraße und pulsierende Lebensader der Stadt. Doch er hatte keinen Blick für die bunten Leuchtreklamen, die aggressiven Straßenhändler und die Scharen von Shoppern, Schaufensterbummlern und Touristen, die Chinas bedeutendste Einkaufsmeile bevölkerten. Er schielte auf den Pulsmesser an seinem schlanken Handgelenk und tat das, was ihm beim Laufen immer schon am leichtesten gefallen war: nachdenken.
Den ganzen Tag schon drehten sich seine Gedanken nur um zwei Dinge. Das eine war eine aufregende Frau, die ihn für heute Abend eingeladen hatte. Das andere war ein aufregendes Drehbuch, dessen Exposé und Anfangsszenen ihm – wie er meinte – zugespielt worden waren. Der Arbeitstitel dieses Werks lautete Yellow Submarine, aber der Inhalt hatte nichts mit dem gleichnamigen Film jener vier Pilzköpfe aus dem fernen Liverpool zu tun. Als Autor firmierte ein gewisser Julian Peek. Kim Park hatte gründlich recherchiert und war zu dem Ergebnis gekommen, dass es sich bei diesem Namen um ein Pseudonym handeln musste. Kein Einziger der ihm bekannten Filmagenten hatte jemals von einem Drehbuchautor namens Julian Peek gehört – und Kim, der seit fast zehn Jahren in diesem Geschäft unterwegs war, kannte viele Agenten. Selbst die ihm bis dato unbekannte, gutaussehende Agentin mit der sinnlichen Stimme, die einige Tage zuvor unangemeldet in sein Büro geplatzt war, hatte ihm außer dem Filmstoff nur eine gefälschte Visitenkarte hinterlassen.
Kim Parks filmische Produktion ruhte im Wesentlichen auf zwei Säulen: Zum einen produzierte er in Zusammenarbeit mit mehreren großen amerikanischen und britischen Werbeholdings Commercials für den ostasiatischen Raum. Das war sein Brot-und-Butter-Geschäft, mit dem er ganz gut über die Runden kam. Zum anderen hatte er an einer Sendereihe filmisch aufbereiteter Interviews mit asiatischen Berühmtheiten gebastelt: vom thailändischen Punkmusiker mit Drogenproblemen über den provokanten koreanischen Installationskünstler bis hin zum chinesischen Anwalt, der sich für die Rechte der Wanderarbeiter einsetzt. Ihre minimalistische Machart war das Markenzeichen dieser Porträts, die sich unter den seriösen Redakteuren der großen TV-Anstalten mittlerweile eine treue Fangemeinde erworben hatten. Als Interviewer konnte er unbequem werden, wobei er aber stets fair zu bleiben versuchte und eine asiatische Zurückhaltung übte. CNN Asia hatte sich schließlich dazu durchgerungen, dem Newcomer einen Exklusivvertrag anzubieten. Seit anderthalb Jahren hieß es daher einmal im Monat An Appointment with Kim Park.
Er hatte Erfolg. Er war ein bekanntes Gesicht im Fernsehen geworden und die ostasiatische Prominenz riss sich förmlich um seine Interviews. Nur zu gerne hätte er auch diesen nebulösen Drehbuchautor Julian Peek zu einem Treffen vor der Kamera eingeladen. Doch wer seinen wahren Namen nicht nennt, zeigt meist erst recht nicht sein wahres Gesicht.
Kim Parks Unternehmen hatte mit der Produktion von Spielfilmen bisher nichts zu tun gehabt. Und Japan spielte in seinen Arbeiten nur insofern eine Rolle, als zu seinen Auftraggebern im Werbebereich etliche japanische Firmen gehörten. Von einer ersten, erfolglos gebliebenen dokumentarischen Fingerübung einmal abgesehen, hatte er noch nie in Japan gedreht. Daher wunderte er sich, dass man mit diesem unerhört brisanten Projekt ausgerechnet an ihn herangetreten war. Yellow Submarine war ein Film, für den man einen Autor in Japan mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit öffentlich gelyncht hätte. Die Story, die auf bisher unveröffentlichten Fakten zu beruhen schien, erzählte von den Verwicklungen hoher Militärs in grausame Menschenversuche, deren Spätfolgen bis in die jüngste Vergangenheit hineinreichten und die zweifellos auch noch die Gegenwart bewegten. Ein Thema, das Kim Park sofort packte und nicht mehr losließ. Besonders reizvoll fand er auch die erzähltechnische Umsetzung der Filmidee: Nach einer atmosphärisch dichten Einleitungssequenz wurde der Plot konsequent aus der Sicht eines jungen Rechtsanwalts in Tokio aufgefächert, der – angestellt bei einer großen, internationalen Sozietät – eher aus Zufall mit der Führung eines komplizierten Schadenersatzprozesses gegen einen mächtigen japanischen Großkonzern beauftragt wird, dabei zunächst grandios scheitert und erst mit Hilfe seiner couragierten japanischen Freundin weitere Beweise herbeischaffen kann, die nun eine Wiederaufnahme des Verfahrens in greifbare Nähe rücken. Doch dann muss der junge Anwalt erkennen, dass er erneut gegen Windmühlenflügel ankämpft, während eine dunkle Vergangenheit ihre langen Schatten immer bedrohlicher über die Gegenwart wirft.
Als er eine knappe halbe Stunde später sein mit funktionalem Schick eingerichtetes Penthouse auf dem Dach des Kerry Centers betrat, führte Kims erster Weg zum Kühlschrank. Er nahm eine Flasche Perrier heraus, goss den Inhalt in ein großes Glas und warf zwei Magnesiumtabletten hinterher. Er nutzte die Zeit, in der sich die Tabletten sprudelnd auflösten, um in sein Arbeitszimmer zu gehen, wo er die oberste Schublade eines roten Lackschränkchens öffnete, in dem er seine persönlichsten Schätze verwahrte: einige militärische Rangabzeichen und Verdienstmedaillen, seine verbeulte »Hundemarke« aus Aluminium sowie einen Schlüsselanhänger aus Sterlingsilber. Sein Vater hatte darauf zwei gekreuzte Anker prägen lassen, als Sohn Kim sein erstes Kommando als U-Boot-Kapitän erhielt. Wie lange war das schon her? Es waren tolle Zeiten gewesen, damals, bei der südkoreanischen Marine. Zum ersten Mal in seinem Leben hatte er zur Elite gehören dürfen – und nicht zum Abschaum wie in seiner Jugend in Japan. Aber der Preis war grausam hoch. Davon kündete eine große Narbe, die von seinem rechten Schlüsselbein schräg bis hinunter zur siebten Rippe auf seiner linken Körperhälfte führte. Er hatte noch nie über seine Verwundung gesprochen. Auch nicht über die Monate danach; diese dunkelsten Momente seines Lebens in den unmenschlichen Gefängnissen eines der schlimmsten Regimes dieser Welt.
Ganz oben in der Schublade lag die dünne Klarsichtmappe, die das – leider unvollständige – Exposé sowie die ersten Drehbuchszenen zu Yellow Submarine enthielt. Kim zog die Mappe vorsichtig, beinahe ehrfürchtig, heraus und ging, mit einem kleinen Umweg über die Küche, wo er nach seinem Mineraldrink griff, in sein weiträumiges Wohnbüro hinüber. Dort setzte er sich an den Schreibtisch, trank einen Schluck und vertiefte sich erneut in die Lektüre.
»Yellow Submarine«
Drehbuch – Rohfassung
von Julian Peek
Marinebasis kure – Aussen / Tag
Über der langgezogenen Bucht der Marinebasis von Kure, nicht weit von Hiroshima, erhebt sich die Sonne majestätisch aus dem milchigen Grau des Morgens und lässt Himmel und Meer miteinander verschmelzen. Im silbrigen Glitzern der flachen Wellen schiebt sich ein langer Schatten langsam aufs offene Meer hinaus. Das Rauschen des Kielwassers mischt sich mit den heiseren Schreien der Möwen, die das auslaufende Unterseeboot begleiten. Hoch oben an der Abbruchkante der Steilküste beobachtet eine junge Frau, wie das U-Boot Kurs auf die offene See nimmt und zum Tauchgang ansetzt. Der Bug senkt sich, die Flagge am Turm beginnt heftig zu schlagen. Das dunkel schimmernde Haar der Frau steht in reizvollem Kontrast zum hellen Glanz der Gold- und Silberfäden, mit denen ihr festlicher Kimono durchwirkt ist. Auf ihren kalkweiß geschminkten Wangen sind Tränenspuren zu sehen. Während im Hintergrund das Boot unter der Wasseroberfläche verschwindet, hebt sie plötzlich ihre rechte Hand vors Gesicht. Stahl blitzt auf. Mit einer entschlossenen Bewegung zieht sie sich die scharfe Klinge quer über den Hals. Aus der durchschnittenen Kehle spritzt ein hellroter Blutstrahl. Dann fällt sie lautlos über den Rand der Klippe in die Tiefe, hinunter in die brodelnde Gischt, und bleibt seltsam verrenkt auf einem von den Wogen umspülten Felsen liegen. In ihre starren Pupillen eingebrannt: die stolz wehende »Rising Sun« – die alte Kriegsflagge der Kaiserlichen Marine Japans.
Schnitt.
Kim Park atmete tief durch, legte das Manuskript auf den Schreibtisch und trat hinaus auf seine großzügig bemessene Dachterrasse. Aus 130 Metern Höhe ließ er seinen Blick über das abendliche Shanghai schweifen. Über diese herrliche, geheimnisvolle, wuchernde »Perle des Ostens«. Da unten schwirrten mehr als 18 Millionen rastlose Menschen umher, die in zahllosen Hochhausbauten wie die Termiten immer höher hinauswollten. Auch Kim hielt eine bis an den Horizont ungetrübte Sicht für lebensnotwendig, ja überlebensnotwendig. Überleben, ohne verrückt zu werden, war schon immer sein Spezialgebiet gewesen. Mit gutem Grund. Was sollte man auch anderes erwarten von jemandem, der seine besten Jahre eingesperrt verbracht hatte: freiwillig und voller Begeisterung (von jenen unfreiwilligen dunklen Monaten einmal abgesehen). Mit drei Dutzend anderen jungen Männern zusammengepfercht auf engstem Raum in einer knapp siebzig Meter langen Röhre aus Stahl. And we lived beneath the waves in our yellow submarine …
Wer da draußen wusste eigentlich von seiner militärischen Vergangenheit? War dieser Julian Peek etwa ein Marinekamerad von damals, womöglich auch ein Japan-Koreaner? Auf jeden Fall besaß der Mann eine Menge Mumm. Und er kannte sich verdammt gut mit den japanischen Gepflogenheiten aus – und mit einer japanischen Vergangenheit, von der man noch heute nicht gern sprach. Kim musste endlich einen Weg finden, um an ihn heranzukommen. Verflixt, wer sind Sie, Mister Peek?
Kim Park begab sich wieder nach drinnen, nahm die Klarsichtmappe und legte sie an ihren Platz in der Schublade zurück. Heute Abend würde seine Frage jedenfalls nicht mehr beantwortet werden. Heute Abend war die Party bei Cathy – das andere Thema, um das sich seine Gedanken den ganzen Tag schon bewegten. Cathy Wong, diese umwerfende Chinesin aus Los Angeles und Shanghaier Korrespondentin des amerikanischen Vanity Fair-Magazins, hatte dem im Umgang mit anderen immer nüchtern und beherrscht wirkenden Kim gründlich den ansonsten so kühlen Kopf verdreht. In seinen Augen war sie die vollkommene Frau, die mittlerweile allerdings einen gravierenden Fehler hatte: Sie war nicht mit ihm zusammen, sondern mit einem Butterstinker. Jeremy Gouldens – pah! Ein abgehalfterter Winkeladvokat mit dubioser Vergangenheit, der sich erfolglos in der Welt herumgetrieben hatte, bis er vor etwa einem Jahr in die kosmopolitischen Zirkel Shanghais hineingeplatzt war und die vielversprechenden ersten zarten Bindungen zwischen Kim und Cathy brutal gekappt hatte. Was sie nur an diesem hässlichen, latent versoffenen Riesenbaby fand? Gouldens war mindestens zwanzig Jahre älter als Cathy. Viel zu alt für sie. Kim warf einen raschen Blick auf seine Panerai. Es wurde langsam Zeit, zu duschen und sich anzuziehen.
Vor den Fenstern begannen die Lichter der Großstadt zu glitzern. Cathy würde schon noch begreifen, dass sie einen besseren Mann verdient hatte. Er durfte jetzt nicht lockerlassen. Er würde ihr Herz erobern. Irgendwann. Bald.
Shanghai, 1. Mai 2012. 18:15 Uhr
Während Kim Park unter die kühle Brause stieg, saß besagter Butterstinker gerade schwitzend in einem offenen schwarzen Porsche 911 und fluchte. Wenige Hundert Meter vor der Einfahrt in den Renmin-Tunnel, der den Fluss Huangpu unterquert und so das traditionelle Geschäftszentrum Puxi mit der Pudong New Area im Osten der Stadt verbindet, ging nichts mehr. Fünfzig Meter in fünf Minuten. Warum hatte er nicht auf Cathy gehört? Warum hatte er den Wagen nicht in der Tiefgarage des Jin Mao Towers stehen lassen und vernünftigerweise die U-Bahn genommen? Warum würde er einmal mehr zu spät kommen? Ausgerechnet heute Abend, wo er eigentlich den perfekten Gastgeber hatte mimen wollen. Seine Hektik, die brütende Hitze und der erstickende Dunst der Autoabgase begannen sich als leise pochender Kopfschmerz hinter seinen Schädelknochen bemerkbar zu machen. Per Knopfdruck schloss er das Verdeck und hoffte auf die Leistungsfähigkeit der Klimaautomatik.
»Jetzt entspann dich ein bisschen«, sagte sein Beifahrer, Richard Koo, Senior Partner und Grand Seigneur des Shanghaier Büros der internationalen Anwaltssozietät Lexman & Lexman. Und so etwas wie ein guter Freund. Ihn konnte offenbar gar nichts aus der Ruhe bringen. Jeremy hatte ihn noch nie wirklich aufgebracht erlebt. Weder früher, als sie gemeinsam in Japan für Lexman & Lexman Prozesse geführt hatten, noch jetzt, wo sie das Schicksal – und Richards soziale Kompetenz – in Shanghai wieder in einem Büro zusammengebracht hatten.
Jeremy hatte Richard viel zu verdanken. Als sie einander im Frühjahr 2010 nach zehn Jahren ohne Kontakt auf dem Chek Lap Kok Airport in Hongkong zufällig wieder über den Weg gelaufen waren, hatte Jeremy ausgesehen wie ein abgebrannter Hippie und sich auch so gefühlt. Mit seinem Anwaltsleben hatte er abgeschlossen und vegetierte auf hohem Niveau ziellos in den Tag hinein. Richards Menschenkenntnis und seinem geschulten Blick für den wertvollen Kern im Wesen eines Mannes war es zu danken, dass Jeremy wieder Tritt gefasst hatte und nun hier in Shanghai in einem nagelneuen Porsche-Cabrio saß. Dessen knapp 300 Stundenkilometer Höchstgeschwindigkeit ihm im Moment allerdings von begrenztem Nutzen waren.
Fünfzig Meter in fünf Minuten. Macht 0,6 Stundenkilometer. Wenn das so weiterging, konnten die Champagnerkorken ohne ihn knallen. Während Jeremy nervöser wurde, las Richard Koo auf dem Beifahrersitz seelenruhig im Shanghai Daily das Kinoprogramm. »Oh, heute Abend kommt Nanking Nanking«, sagte er zu Jeremy, »dieser aufsehenerregende preisgekrönte Kriegsfilm von Lu Chuan über das Nanking-Massaker von 1937/38. Den hast du mir doch mal empfohlen, oder?«
»Ja, aber nicht für heute Abend. Ist außerdem ziemlich starker Tobak. Als ich mit Cathy drin war, mussten wir nach der Hälfte rausgehen. Sie hat es nicht mehr ausgehalten. Ein ›Gemetzel für die Seele‹, wie mal ein Kritiker geschrieben hat.«
»War wohl auch keine besonders clevere Idee, deine zarte Holde zu so einem Schlachtfest einzuladen«, konstatierte Richard scharfsinnig.
»Yep«, antwortete Jeremy knapp, der sich nicht an den verpatzten Kinoabend erinnern wollte. Aber Richard konnte bisweilen unerbittlich sein. »Ist das nicht der Film, wo Chinesen mit Stacheldraht verschnürt, mit Benzin überschüttet und angezündet werden, damit die japanischen Soldaten besseres Licht haben, um in die Luft geschleuderte Babys mit Bajonetten aufzufangen?«
»Komm, hör auf, Richard!« Jeremys Stimme klang gequält. »Wenn man einen Film über Kriegsverbrechen dreht, muss man die Verbrechen eben auch zeigen. Und besonders zartbesaitet ist Cathy ansonsten gar nicht. Erst als wir später in der Century Bar oben im World Financial Center saßen, hat sie mir erzählt, dass auch Verwandte von ihr bei den Massakern umgekommen sind. Davon wusste ich ja nichts. Und dann konnte sie plötzlich nicht mehr weiterreden. Sie war total blockiert. Dass diese schreckliche Nanking-Geschichte und die übrigen japanischen Kriegsverbrechen auch in meinem früheren Leben eine wichtige Rolle gespielt haben, weiß sie bis heute nicht.« Nach einer kleinen Pause fügte er leise und wie zu sich selbst hinzu: »Aber vor der Hochzeit muss ich da wohl endlich reinen Tisch machen.«
Doch Richard Koo hatte scharfe Ohren. »Was höre ich da?«, rief er aufrichtig überrascht, »du willst Cathy heiraten?«
Jeremy versuchte vergeblich, die Frage zu überhören.
»Du willst also im zarten Alter von 49 Jahren wirklich ernsthaft noch eine Heirat ins Auge fassen? Ihr lebt doch ohnehin schon zusammen wie ein altes Ehepaar!«
»Seit über sechs Monaten«, bestätigte Jeremy, der in diesem Moment eine Lücke entdeckte und mit aufheulendem Motor die Spur wechselte. Die halsbrecherische Aktion hatte sie 20 Meter nach vorne gebracht.
»Aber für ein Glas Milch kauft man nicht gleich die ganze Kuh.« Richard Koo zog die Augenbrauen hoch.
Jeremy musterte ihn mit gespielter Empörung. »Dein Vergleich hinkt, Richard. Zugegeben: Manchmal schwanke ich noch ein wenig. Aber eigentlich bin ich fest entschlossen. Jedenfalls gab es noch nie eine Frau, die mich dermaßen fasziniert hat.«
»Im Bett wahrscheinlich.« Es klang nicht ordinär.
»Nein, auch sonst.« Jeremy zupfte nachdenklich an seinem rechten Ohrläppchen. »Man hält es nicht ein halbes Jahr lang mit einer Frau aus, die einen nur im Bett fasziniert.«
»Darf ich daraus schließen, dass du es umgekehrt ohne diese Faszination im Bett wohl nicht mit ihr aushalten würdest?«
»Hm.« Jeremy zuckte die Schultern. »Na ja, sie kann mitunter schon ganz schön anstrengend sein.«
»Du meinst – sie ist eine Frau.«
Jeremy lächelte. Das war Richard. Immer schön nüchtern-lakonisch und down to earth. Die scheinbar verzwicktesten Probleme konnte er schnell auf die einfachsten Grundfakten zurückführen. Kein Wunder, dass Cathy mit ihm so ihre Probleme hatte, sich mal »nicht richtig ernst genommen«, mal »mental unterfordert« fühlte. Frauen sind eben stolz auf ihre Kompliziertheiten.
»Na ja, meinen Segen hast du«, brummte Richard gönnerhaft. »Ich habe es schließlich auch nicht bereut, dass ich auf meine alten Tage noch Mimi geheiratet habe. Unterm Strich jedenfalls. Und mit der ist es auch nicht immer ganz einfach.« Er machte eine versonnene Pause. »Dann fühlst du dich jetzt also endlich geheilt?«
Jeremy warf seinem Freund einen prüfenden Blick zu. Sollte sich ihr Geplauder jetzt zu einem tiefschürfenden Männergespräch entwickeln? Lieber nicht. Nicht heute. »Wie meinst du das?«
»Wir beide wissen doch, dass es dich damals in Japan schon einmal richtig erwischt hat. Der Satz, dass dich noch nie eine Frau so fasziniert hat, kommt mir ziemlich bekannt vor. Und trotzdem ging die Sache damals katastrophal in die Binsen. Und als du dann mit leeren Händen dastandest, hast du alles hingeworfen, und ich habe einen guten Freund und Kollegen verloren. Und die Welt beinahe einen guten Anwalt. Wie hieß sie nochmal, deine schmucke Japanerin? Aikiko?«
»Yukiko«, verbesserte Jeremy zögernd, »und du weißt, dass ich nicht gerne darüber rede. Du bist so ziemlich der Einzige, der von der ganzen Geschichte weiß. Ja – damals ist irgendwas in mir zerbrochen. Aber das ist lange vorbei.«
»Und du hast nie wieder von ihr gehört?«
»Nope. Kein Lebenszeichen. Seit 13 Jahren – nichts.«
Was mochte wohl aus ihr geworden sein? Sie war damals ungefähr so alt wie jetzt Cathy.
»Anyway …«, seufzte Richard Koo.
»Eben. Das Leben geht weiter. Vielleicht bin ich jetzt wirklich ›geheilt‹, wie du das nennst. Cathy hat mich geheilt. Vielleicht bin ich endlich an dem Punkt, wo ich mit meiner Traumfrau eine Familie gründen möchte. Warum auch nicht? Soll ich warten, bis ich so alt und klapprig bin wie du? Am besten, ich frag sie gleich mal, wie viele Kinder sie von mir will.« Damit griff er zum Mobiltelefon, um Cathy anzurufen und das unerquickliche Thema zu beenden.
Besonders erquicklich gestaltete sich das nun anschließende Gespräch mit der Traumfrau – in dem es weniger um Kinder als um unzuverlässige Männer ging – allerdings auch nicht. Jeremy kam ohnehin kaum zum Zug. Richard konnte jedes Wort hören, das aus ihr heraussprudelte. Herrje, war die Kleine sauer. Warum hast du nicht die U-Bahn genommen, du unverbesserlicher Trampel? Jeremys Züge nahmen einen zunehmend leidenden Ausdruck an.
Dennoch war Richard beruhigt. Sein Freund schien sich auf dem richtigen Weg zu befinden.
Damals, als er dem Aussteiger Jeremy Gouldens in Honkong wiederbegegnet war, hätte er ihn um ein Haar nicht wiedererkannt. Wie ein gestrandeter Seefahrer hatte er ausgesehen. Langhaarig, unrasiert und braungebrannt, in verwaschenen Bermudashorts, einem gestreiften T-Shirt und mit vietnamesischen Flip-Flops an den Füßen. Allerdings besaß er zu Richards Erleichterung noch immer seine Kreditkarten, seine Bankkonten in der Schweiz und seine elterliche Wohnung im Londoner Nobelviertel Chelsea. Jeremy hätte sein vergleichsweise bescheidenes Luxusleben wahrscheinlich noch bis an sein Lebensende untätig fortführen können, ohne sein beträchtliches ererbtes Vermögen restlos zu verjubeln.
Jeremy und Richard hatten zwei Stunden in der Frequent Traveller Lounge des Flughafens von Honkong verbracht und über alte und neue Zeiten geredet. Wie ein moderner »Fliegender Holländer« war Jeremy jahrelang in seiner geliebten Jacht »Hebridean Spirit« über die Weltmeere gesegelt. Doch die Begeisterung, mit der er davon berichtete, war Richard gleich etwas aufgesetzt vorgekommen. Schnell hatte er begriffen, wie sehr die furchtbare berufliche und persönliche Niederlage, die Jeremy als Rechtsanwalt in Japan erlitten hatte, noch immer an ihm nagte. Davor konnte man nicht einfach wegsegeln. Der Mann brauchte Hilfe; etwas, woran er sich festhalten konnte. Beim letzten Aufruf seiner Maschine nach Shanghai war Richard entschlossen aufgestanden und hatte dem Herumtreiber eine Gardinenpredigt gehalten: »So kannst du nicht weiterleben, alter Junge. Willst du vor die Hunde gehen? Weil du nicht abschütteln kannst, was einmal gewesen ist? Weil du es vielleicht gar nicht abschütteln willst? Glaubst du denn, an mir ist die Sache spurlos vorübergegangen? Aber ich habe den Arsch zusammengekniffen und weitergemacht. Über das Trauma deines Scheiterns kannst du nur wegkommen, wenn du dich nicht permanent im alten Leid suhlst, sondern nach vorne blickst und dich mit neuen Herausforderungen konfrontierst.« Dann hatte er Jeremy seine Visitenkarte in die Hand gedrückt. »Du kannst jederzeit wieder in die Firma zurück. Darauf gebe ich dir mein Wort. Komm nach Shanghai und fang wieder an. Nicht als Partner, sondern zunächst als angestellter Anwalt. Du brauchst nur anzurufen. Und überleg nicht wieder zehn Jahre!«
Jeremy überlegte zehn Monate, dann rang er sich zum Anruf durch. Als er in Shanghai eintraf, trug er, sehr zu Richards Erleichterung, einen maßgeschneiderten Anzug aus der Londoner Savile Row und statt Flip-Flops handgemachte Schuhe von John Lobb. Ohne großes Tamtam führte Richard den neuen alten Kollegen in sein Büro im 35. Stockwerk des Jin Mao Towers und überhäufte ihn mit Arbeit. »Am besten, du legst gleich los. Es gibt eine Menge zu tun.« Wenige Wochen später hatte Jeremy dann Cathy getroffen. Seither hatte er seinen Entschluss, ins geregelte Leben zurückzukehren, nicht wieder bereut. Höchstens manchmal ein bisschen.
Wie jetzt gerade.
Mit nervtötender Langsamkeit verschwand die endlose Autoschlange vor ihnen nach und nach in einem schwarzen Loch. Die Einfahrt zum Tunnel erinnerte Jeremy an das klaffende Maul eines Drachen, der sich gierig selbst verschlingt. Gleich würden auch sie verschlungen werden.
Shanghai, 1. Mai 2012. 18:45 Uhr
Im Innenhof der betagten Kolonialvilla in der Französischen Konzession, jenem noblen Villenviertel, das der tobenden Bauwut bislang einigermaßen unbeschadet zu trotzen vermocht hat, hing die modrige Luft schwer und drückend über dem Teichbecken mit den Lotusblumen. Jeremys Anruf hatte die dicke Luft nicht vertreiben können. Im Gegenteil. Cathy Wong war wütend. Sehr wütend sogar. Punkt sechs hatte er zu Hause sein wollen. Warum musste er immer unpünktlich sein? Das durfte er sich vor Gericht doch auch nicht erlauben. Warum hatte er nicht auf sie gehört und die Metro genommen? Er hatte doch versprochen, noch etwas beim Vorbereiten zu helfen. Jetzt ließ er sie hier alleine rotieren, und die ersten Gäste konnten jeden Augenblick eintreffen. Typisch!
Seit einem halben Jahr bewohnten sie nun gemeinsam dieses Kleinod. Cathy hatte nie begriffen, wie es Jeremy geschafft hatte, für sie so ein Haus zu finden. Sogar zu einem annehmbaren Mietpreis – und das im angesagtesten Wohnviertel der Stadt, einen Steinwurf entfernt von der Einkaufsstraße Changle Lu. In einem Viertel, wo sich alles, was Rang und dicke Geldbeutel hat, gegenseitig überbietet, um eines der begehrten alten Häuser zu ergattern: neureiche Yuppies, internationale Galeristen, weltweit operierende Unternehmen der Systemgastronomie und nicht zuletzt die Strippenzieher aus der Welt der organisierten Kriminalität – die »chinesischen Mafia« der Triaden war bekanntermaßen stark in den hiesigen Immobilienmarkt involviert. »Ich kenne zufälligerweise den Besitzer«, hatte Jeremy wortkarg gemurmelt, als Cathy einmal nachzubohren versuchte, »und der schuldet mir was …« Cathy selbst hatte Gao Feng, ihren großzügigen Vermieter, noch nicht kennengelernt. Aber seinem Namen war sie schon des Öfteren begegnet, leider in zumeist wenig vertrauenserweckenden Zusammenhängen. »Er ist viel auf Reisen«, so Jeremys knappe Auskunft, »und außerdem scheut Gao die Öffentlichkeit.« Mehr sagte er nicht.
Vielbeschäftigt und öffentlichkeitsscheu. Das passte in dieses Viertel. Die Französische Konzession hatte schon immer als ideales Terrain für zwielichtige Figuren gegolten. Als sie vor zwei Jahren wieder nach Shanghai gekommen war, zurück in die chinesische Heimat ihrer Eltern, hatte sie ein kleines Appartement in der 14. Etage eines Wohnblocks weit außerhalb mit Kakerlaken teilen müssen und dafür eine fast ebenso hohe Miete gezahlt. Cathy hatte sich mit Jeremys dünnen Ausflüchten abspeisen lassen und sich vorgenommen, keine weiteren Fragen zu stellen.
Mit dem »Besser-keine-Fragen-Stellen« hatte sie bereits hinreichend Erfahrungen gesammelt. Cathy Wong war amerikanische Staatsbürgerin; die Wongs hatten sich im Jahre 1938, nach einer dramatischen Flucht aus dem von den Japanern besetzten Nanking, schließlich in Los Angeles niedergelassen. Nicht allen Mitgliedern der weitverzweigten Familie war es gelungen, den Kriegsgräueln zu entkommen. Solange sich Cathy zurückerinnern konnte, war das Thema Nanking innerhalb der Familie tabu gewesen. Über die Massaker an der Zivilbevölkerung, die Massenvergewaltigungen und sonstigen Grausamkeiten wurde konsequent geschwiegen. So hielten es die Wongs seit 75 Jahren. Was Cathy über den Japanisch-Chinesischen Krieg wusste, hatte sie sich in der Universitätsbibliothek und im Internet angelesen. Aber über dieses Wissen konnte sie sich mit ihrer Familie nicht austauschen. Sie hatte niemals Fragen stellen dürfen. So hatte sie auch ihre gesamte Jugend hindurch klaglos akzeptiert, dass ihr Vater ihr strengstens verboten hatte, japanische Produkte zu kaufen. Nicht einmal einen harmlosen Walkman hatte er ihr gegönnt.
Cathy war zweisprachig und behütet aufgewachsen. In Kalifornien hatte sie sich immer wohlgefühlt. Ihr Vater, der bereits seit Mitte der fünfziger Jahre die amerikanische Staatsbürgerschaft besaß, betrieb eine kleine Take-away-Kette im Großraum Los Angeles, die aus dem Chinarestaurant seiner Eltern hervorgegangen war. Er war das mit Abstand erfolgreichste Mitglied des Wong-Clans und vergaß nie, sich um die anderen Familienmitglieder zu kümmern. Für Cathys »kleinen Cousin« Chen zum Beispiel, einen hochintelligenten, aber psychisch labilen Jungen, dessen Vater viel zu früh verstorben war, hatte er gesorgt wie für einen eigenen Sohn. Er hatte ihm die komplette Ausbildung bezahlt und finanzierte ihm jetzt sogar noch ein Zweitstudium an der renommierten Fudan University, hier in Shanghai. Chen studierte Chinesische Geschichte, denn Restaurantchefs, so meinte Cathys Vater, wenn einmal die Rede auf ihren verschrobenen Cousin kam, hätten die Wongs bereits genug in ihren Reihen. Auch wenn sie Chen, der in einem Studentenwohnheim der Universität hauste, für einen kommunikationsgestörten Nerd hielt, mit dem sie herzlich wenig anfangen konnte, hatte es sich nicht vermeiden lassen, ihn zu ihrer Party einzuladen. Familienbande sind eben Familienbande.
Während Chen letztlich mehr ein Sorgenkind war, konnte sich Cathys bisheriger Lebenslauf wahrlich sehen lassen. Makellose Schulzeugnisse hatten ihr zunächst ein Stipendium an der New Yorker School of Journalism ermöglicht, wo sie als eine der Besten ihres Jahrgangs abgeschlossen hatte. Danach war sie zum ersten Mal wieder in die alte Heimat ihrer Eltern zurückgekehrt, um in Shanghai Chinesische Literatur zu studieren – ebenfalls an der Fudan-Universität. Obwohl sie nebenher noch einen eigenen Internetblog unterhielt und als freie Rechercheurin für westliche Medien arbeitete, absolvierte sie ihr Studium zwei Semester unter der Regelstudienzeit. Nach ihrer Rückkehr in die Staaten hatte Cathy ein Angebot der Los Angeles Times vorgefunden und sich voller Enthusiasmus ins Reporterleben gestürzt. Mit ihrem umfangreichen Hintergrundwissen, ihrer freundlich-bestimmten Hartnäckigkeit und ihrem blendenden Aussehen hatte sie einige aufsehenerregende Storys ausgraben können. Als sich ihr dann vor zwei Jahren die Chance geboten hatte, für das namhafte Vanity Fair-Magazin in dessen neu eröffnetes Büro in Shanghai zu wechseln, hatte sie keine Sekunde gezögert. Plötzlich war sie Korrespondentin und die Nummer 5 im Büro. Mit gerade einmal 30 Jahren! Ihr Vater hatte sie zu diesem gewagten Schritt ermutigt. Cathy war auch der Meinung, ihren Eltern etwas zurückzahlen zu müssen. Sie wollte ihnen nicht so auf der Tasche liegen wie ihr feiner Herr Cousin, der ihrer Meinung nach völlig nutzlos mit dem mühsam Ersparten ihres Vaters gepäppelt wurde.
Die alte englische Standuhr in der Diele schlug sieben. Wo blieben die Gäste? Wann würde Jeremy endlich kommen? Sie versuchte ihn noch einmal anzurufen, erreichte ihn aber nicht. Wahrscheinlich befand er sich noch immer tief unter dem schlammigen Grund des Huangpu.
Als sie gerade entschieden hatte, lieber noch ein paar Bier- und Weisweinflaschen mehr kaltzustellen, läutete es an der Tür. Für einen Moment hoffte Cathy, dass schuldbewusst grinsend ihre Langnase vor ihr stehen würde. Doch das breite Grinsen, in das sie nach dem Öffnen der Haustür starrte, entsprang nicht kantig britischen, sondern runden chinesischen Zügen. »Chen!«, rief Cathy, »schön, dass du da bist. Du bist der Erste. Wolltest du nicht erst später kommen?«
Chen, der ein legeres weißes Hemd über einer dunkelblauen Drillichhose trug, verzog säuerlich den Mund. »Ich konnte es eben kaum erwarten, dich wiederzusehen«, antwortete er knapp. »Und natürlich Jeremy«, schob er in einem etwas gelangweilt wirkenden Tonfall hinterher wie ein Schüler, der vor dem Lehrer sein Sprüchlein aufsagen muss.
Cathy wusste natürlich, dass ihr kleiner Cousin – der im Übrigen nur zwei Jahre jünger war als sie – Jeremy nicht ausstehen konnte und anlässlich seiner sporadischen Telefonate nach Los Angeles jede Gelegenheit nutzte, um bei seinem Ziehvater gegen Cathys Lebensgefährten zu stänkern. Dabei kannte er Jeremy nicht einmal richtig. Aber Chen mochte keine Ausländer. Die Gweilos hatten sein Volk in den Opiumkriegen gedemütigt; sie hatten den Pekinger Sommerpalast zerstört und den Boxeraufstand blutig niedergeschlagen, sie hatten wiederholt auf Kosten Chinas mit den Japanern paktiert – er könnte die Liste noch endlos fortsetzen. Dass Chen in China im Grunde selbst eine Art Ausländer war, hatte wahrscheinlich eher noch dazu beigetragen, seinen Patriotismus zu steigern. Seine Eltern waren Ende der siebziger Jahre, in der Zeit der Modernisierung nach Maos Tod, aus Kalifornien nach Shanghai zurückgekehrt, hatten hier aber nie wieder so recht Fuß fassen können, und der bald darauf geborene Chen hatte sich in seiner Kindheit und Jugend immer ein wenig wie ein Fremdkörper behandelt gefühlt.
»Wo steckt sie denn eigentlich, deine imperialistische Langnase?«
»Jeremy? Im Stau«, seufzte Cathy. »Mein guter Chen«, setzte sie hinzu, während sie ihn am Arm zur Bar im Innenhof führte, »vielleicht kannst du mir heute Abend ja einen klitzekleinen Gefallen tun …« Chen sah seine Cousine misstrauisch an »… und dich mit deinen politischen Ansichten etwas zurückhalten – ausnahmsweise mal keine deiner dogmatischen Chinareden halten und auch deine despektierlichen Äußerungen über Angehörige anderer Völker unterlassen? Wir haben heute Abend ein – na ja – internationales Publikum hier.« Statt zu antworten, zog er mit provozierender Langsamkeit eine Flasche Tsingtao-Bier aus einem Berg von Scherbeneis. Das Bier aus der größten Brauerei Chinas, ursprünglich als »Germania-Brauerei« von deutschen Siedlern in Quingdao gegründet, stellte in seinen Augen eine der wenigen positiven Hinterlassenschaften der Kolonialzeit dar.
»Ja?«, fragte Cathy geduldig, »versprochen?« Sie hätte ihn ohrfeigen können.
»Es ist schließlich deine Party, Cathy«, antwortete Chen unerträglich lässig und trank.
»Ich glaube an dich, mein Lieblingscousin!« Cathy konnte die spätpubertäre Überheblichkeit dieses Grünschnabels nicht ausstehen. Sie war erleichtert, als es in diesem Moment erneut an der Haustür läutete.
Chen sah ihr verächtlich nach. Immerhin trug seine rehäugige Cousine heute keinen Designerfummel, sondern ein knöchellanges klassisches Qipao aus karmesinroter Seide. Aber warum stöckelte sie darunter in so geschmacklosen High Heels herum? Traditionelle Lotusfüßchen, dachte Chen, ja – die wären perfekt gewesen. Schließlich konnten Frauen, die sich freiwillig in diese hochhackigen Pumps zwängten, auch nicht besser laufen als die lotusfüßigen chinesischen Frauen früher, denen die Fußknochen von Kindesbeinen an abgebunden und dauerhaft verkrüppelt worden waren. Aber seine Cousine war ja so modern, so aufgeklärt, so entsetzlich verwestlicht. Anders als Chen fehlte ihr der Sinn für die große chinesische Idee, die eines nahen Tages die Welt erobern würde. Er nahm noch einen kräftigen Schluck, dann öffnete er rasch eine zweite 0,33-Liter-Flasche. Heute hatte er Durst.
Cathy war zum zweiten Mal zum Eingang geeilt. Voll freudiger Erwartung – doch weder standen neue Gäste noch Jeremy vor der Haustür. Sondern ein junger Kurierfahrer von UPS, der fragte: »Wohnt hier ein Mr. Jeremy Gouldens? Eine Expresssendung.«
Mit Verblüffung nahm Cathy die Sendung entgegen und quittierte den Empfang. Sie schloss die Eingangstür und wiegte nachdenklich das Paket in ihren Händen. Es war in geschmackvolles grün-weißes Geschenkpapier eingeschlagen, nicht besonders schwer und in Japan aufgegeben. In Kyoto. Hatte Jeremy nicht dort gelebt, bevor er nach Tokio ging? Kyoto-shi, Kamitakano 13–7, Sakyo-ku. Dabei schien es sich um die Adresse zu handeln. »Y. Murata«: Das war der Absender. Auf Englisch hatte jemand, wohl dieser Murata, hinzugefügt: »Unbedingt persönlich zu übergeben.« Vielleicht hätte man das noch auf Chinesisch ergänzen sollen, damit es auch der Kurierfahrer mitbekommt, dachte Cathy. Sollte da etwas vor ihr verheimlicht werden?
Vielleicht handelte es sich auch bloß um irgendeinen Anwalt. Oder es war jemand von der juristischen Fakultät. Sie erinnerte sich, dass Jeremy einmal erwähnt hatte, eine Zeit lang an der Universität von Kyoto gearbeitet zu haben. Im Grunde ging sie das alles auch nichts an. Er kannte viele Leute, sie kannte viele Leute. Ihr wurde schmerzhaft deutlich, wie wenig sie über sein früheres Leben wusste – über die Zeit, bevor sie sich kennengelernt hatten. Die Zeit, als noch nicht sie sein Leben gefüllt hatte. Na gut, sie band ihm ja auch nicht lang und breit auf die Nase, mit wem sie geflirtet hatte, bevor es zwischen ihnen beiden gefunkt hatte. Schon gar nicht heute Abend.
Das hübsche Geschenkpapier irritierte sie aber doch. Immerhin duftete es nicht nach Frauenparfüm. Aber warum wohl sollte es nur ihm persönlich übergeben werden? Und nicht seiner Lebensgefährtin? Auf einmal schlug sie sich mit der flachen Hand an die Stirn. Wie konnte sie nur so begriffsstutzig sein! Wer hatte denn um Mitternacht Geburtstag? Sie! Cathy musste unwillkürlich lächeln.
Vorsichtig legte sie sein Geschenk deutlich sichtbar auf den Frisiertisch der Garderobe. Dort konnte er es nicht übersehen.
Kyoto, 24. Mai 1997. Kurz vor Mitternacht
Sakura! Die letzten zarten Kirschblüten lösten sich von ihren Zweigen und schwebten im leichten Wind taumelnd zu Boden. Der weiße Rausch war fast so schnell wieder verflogen, wie er gekommen war. Alles Leben ist vergänglich. Jeremy Gouldens lief mit offenem Hemdkragen vor dem U-Bahnhof Kokusaikaikan auf und ab und wartete auf die letzte Bahn. Sein Haar war zerzaust, sein Gesicht leicht gerötet, das zerknitterte Sakko trug er über der Schulter. Er hatte ein wenig zu viel getrunken. Sakura, Sakura! Schon oft hatte Jeremy dieses beliebte japanische Volkslied in einer Karaokebar mitgesungen. Sake und Singen war ein gut verträgliches Medikament gegen die Einsamkeit, die ihn jetzt häufiger überfiel, zwölf Flugstunden entfernt vom heimatlichen London. Es half zuverlässig, den Druck abzubauen, der auf ihm lastete, seitdem er eine einjährige Dozentur für Zivilprozessrecht an der ehrwürdigen ehemaligen Kaiserlichen Universität von Kyoto angetreten hatte. Er war nun schon seit acht Monaten in diesem fremden Land und wurde täglich mit strengen Regeln konfrontiert. Wie hieß es hier so schön? Herausstehende Nägel werden eingeschlagen. Der junge Rechtsdozent hatte angefangen zu begreifen, warum die so erfolgreich expandierende Japan Inc., das undurchsichtig verschlungene »Unternehmen Japan«, eine der höchsten Selbstmordraten auf dem Globus aufwies.
Sakura, Sakura! Gesinge und Sake schienen ihm immer noch besser, als sich nach einem harten Arbeitstag den verlockenden Angeboten des Mizu Shobai hinzugeben, des »Wasserhandels«, wie man hier die eher frivolen Seiten des nächtlichen Amüsierbetriebs nannte. Besser auch, als sich an einem der zahlreichen öffentlichen Sexautomaten mit gebrauchten Schulmädchenhöschen oder Sadomaso-Mangas zu versorgen. So etwas gehörte sich nicht für einen jungen britischen Juradozenten in Japan. Schon gar nicht, wenn man so ein ehrwürdiges japanisches Haus bewohnen durfte wie er. Das Haus gehörte einem Sake-Brauer aus Kobe. Es lag etwas außerhalb im Nordosten Kyotos in den Bergen, in der Nähe des alten kaiserlichen Sommerpalastes Shugakuin, und hatte einen klassischen japanischen Garten, in dem ein Dutzend seltener Bambusarten wuchsen.
Trotz des schönen Hauses fiel es Jeremy immer noch schwer, in diesem fremden, rätselhaften Land heimisch zu werden, dessen gleichermaßen feudale wie konforme Gesellschaft vom Unterschied zwischen uchi und soto – innen und außen – bestimmt wurde. Sowie von der Tatsache, dass sich die Bewohner Nippons für Abkömmlinge der Sonnenkönigin Amaterasu hielten. Und sich damit grundlegend von allen anderen »Rassen« zu unterscheiden glaubten. In jeder größeren Buchhandlung gab es ein paar Regalmeter mit Nihonjinron-Literatur; pseudowissenschaftlichen Werken, in denen »bewiesen« wird, dass die japanische Haut anders ist, ebenso das japanische Blut, die japanischen Haare und natürlich das japanische Gehirn. Seit prähistorischen Zeiten bewahre die japanische Rasse eine einzigartige, mystische Essenz, die sie allen anderen Rassen überlegen mache. In den dreißiger und vierziger Jahren hatte – ähnlich wie auf der anderen Seite des eurasischen Doppelkontinents der Wahn der »Arier« – die propagierte Einzigartigkeit der Eroberer furchtbare Konsequenzen für die Bewohner der von Japan besetzten Staaten Asiens gezeitigt; seit den achtziger Jahren diente sie nun vor allem als wirtschaftspolitisches Instrument: Wegen des anderen japanischen Schnees durften zum Beispiel keine westlichen Skier importiert werden. Die rigorose Durchsetzung solcher Handelshemmnisse hatte zu Spannungen mit den westlichen Industrienationen geführt.
Nein, dachte Jeremy, der in der milden Nachtluft langsam wieder nüchtern wurde: Dies ist längst ein Wirtschaftskrieg, der mit härtesten Bandagen geführt wird. Sogar das Rockefeller Center in New York gehörte inzwischen Mitsubishi! Und er, der Idealist und selbsternannte Weltverbesserer, wollte vermitteln. Er wollte übersetzen und Brücken bauen, er wollte helfen und für gegenseitiges Verständnis werben. Dafür war er nach Japan gekommen. Es durfte kein uchi und kein soto mehr geben. Für ihn existierte nur ein uchi. Begriff denn niemand, dass die gesamte Menschheit vor riesigen Problemen stand? Überbevölkerung, Umweltverschmutzung, Krieg und Terror, die zunehmende Verarmung der Dritten Welt. Jeder Mensch war gleich, hatte die gleichen Rechte und Pflichten. Aber offenbar gab es zu viele Japaner, die das anders sahen.
Und im November würde er nun also nach Tokio gehen. Spätestens seit heute Abend gab es kein Zurück mehr. Er hatte das exzellente Angebot der Tokioter Dependance der internationalen Anwaltssozietät Lexman & Lexman angenommen. Die Aussichten waren auch allzu verführerisch, nicht nur was das Gehalt betraf. Wenn man dort Wort hielt, würde er gleich an einem sehr komplizierten größeren Fall mitarbeiten können. Und das nicht einmal erst ab November. Man hatte ihn gefragt, ob er schon jetzt, selbstverständlich gegen Bezahlung, stundenweise vor Ort in Kyoto einige Recherchearbeiten übernehmen könne, vorrangig in der Universitätsbibliothek und an verschiedenen Archiven und Seminaren. Seine eher dürftig bezahlte Dozententätigkeit ließ ihm bei allem Druck doch einen gewissen Rahmen an Freizeit, und so sagte er sofort zu.
Heute Abend hatte er sich mit dem für ihn zuständigen Prozessanwalt, Mr. Koo, getroffen, der gerade in Kyoto unterwegs war – anscheinend in gewissen Angelegenheiten, die ebenjenen Prozess betrafen. Jeremy hatte zu dem besonnen und sympathisch wirkenden Mitvierziger spontan Vertrauen gefasst, und die Aussichten, die Mr. Koo ihm bei Bier und Sake in der Karaokebar eröffnet hatte, elektrisierten ihn. Soviel Jeremy seinen Andeutungen hatte entnehmen können, ging es da um gewaltige Schweinereien eines international operierenden Pharmakonzerns, die dies bisher stets zu vertuschen gewusst hatte. Aber Mr. Koo war zuversichtlich, diesmal gewinnen zu können. Wenn er, Jeremy, ihm dabei half! Genau dafür war er ja Anwalt geworden: um für die Gerechtigkeit und das Gute zu kämpfen. Und plötzlich war er mittendrin im Heldenkampf. Wieder schwirrte ihm der Kopf.
Sakura, Sakura, Kirschblüten unter dem Frühlingshimmel.
So weit das Auge reicht.
Shanghai, 1. Mai 2012. 20:30 Uhr
Wenn die Korrespondentin eines bedeutenden Magazins zu einem festlichen Abendessen Gäste nach Hause einlädt, ist das immer auch mit Arbeit verbunden. Mit Stress und Versagensängsten. So viel konnte schiefgehen. Doch wenn sie sich jetzt in ihrem von Fackeln erhellten Innenhof umschaute, konnte sie durchaus zufrieden sein. Cathy besaß seit jeher ein Faible für bunte Mischungen. Sie hatte ihren etwas gewagten, scharf gewürzten Gästecocktail offensichtlich doch perfekt gemixt, und es war ein überraschend harmonisches Ganzes entstanden. Abgesehen davon, dass die Olive noch fehlte: Jeremy, der noch immer im Stau stand. Aber es ging auch ohne ihn. Die Gäste standen in Paaren oder kleinen Gruppen herum, Gläser in der Hand, übten sich im Smalltalk und schienen sich zu amüsieren. Einzig Chen, der etwas abseits auf einem Bistrostuhl saß, getrocknete Krebsschwänze und gedämpfte Shanghai Crabs in sich hineinschaufelte und nebenher in einem Stapel alter Vanity Fair-Hefte blätterte, wirkte wie üblich etwas isoliert. Aber wie er so dasaß und sich an seiner Tsingtao-Flasche festhielt, machte auch er einen recht zufriedenen Eindruck. Und es war ihm hoch anzurechnen, dass er heute in der Tat wild entschlossen schien, sich manierlich aufzuführen und allen potenziellen Fettnäpfchen aus dem Weg zu gehen.
Für Punkt 21 Uhr war das Abendessen angesetzt, das ein eigens für den Anlass engagierter Koch sowie zwei hübsche weibliche Bedienungen im großzügigen Speisezimmer der alten Villa anrichten würden. Vorweg ließ sie klassische chinesische Horsd’œuvres reichen. Dazu gab es Bier, Wein, Scotch, diverse Longdrinks und – als Besonderheit – auch Sake. Cathy hatte die Aufnahme des japanischen Nationalgetränks in ihr Getränkesortiment für eine clevere Idee gehalten, da sie, Jeremy zuliebe, auch ein japanisches Pärchen eingeladen hatte: Yoshi und Kumiko Satori. Kumiko war eine alberne Gans, die ständig kicherte und aus irgendeinem unerfindlichen Grund in einer unmöglichen Schulmädchenuniform gekommen war. Cathy ging ihr möglichst aus dem Weg. Jeremy, wäre er denn da gewesen, hätte sich ohnehin nur für ihren Ehemann Yoshi interessiert, der seit kurzem die Shanghaier Dependance der Waguni K.K. leitete. Obwohl wenig bekannt, sei das doch eine sehr wichtige Firma, hatte Jeremy ihr eingeschärft. Eine Sogo Shosha, wie man die berühmten japanischen Handelshäuser nennt, die von Chemikalien und Textilien bis hin zum Kernkraftwerk oder Flugzeugträger so gut wie alles besorgen können. Mit seinen 45 Jahren war Yoshi, ein schmallippiger dünner Mann, aus japanischer Sicht noch relativ jung. Natürlich war es für Jeremy ein großartiger Glücksfall, dass dieses einflussreiche Unternehmen gerade an ihm so interessiert war. Trotzdem ärgerte es sie plötzlich, diese wildfremden Leute auf ihrer Party zu haben. Soweit Cathy es beurteilen konnte, war auch noch keiner der Eingeladenen mit den Satoris warmgeworden. Toll, dass Jeremy so pünktlich war: wie immer, wenn sie ihn brauchte!
Die meisten anderen Gäste, Kollegen aus Zeitungs- und Fernsehredaktionen, kannten sich bereits. Da war etwa ihre beste Freundin Coco, die für die amerikanische Vogue die Laufstege Asiens abklapperte und es heute wie immer genoss, mit ihrer Konversationskunst und ihrem Aussehen eine andächtige Schar vornehmlich männlicher Zuhörer um sich zu sammeln. Oder Mei-Ling, eine etwa 50 Jahre alte, hagere Chinesin mit wasserstoffblonden Strähnen, die sich zur Feier des Tages in einen hautengen, schwarz glänzenden Latexoverall hineingequetscht hatte. Mei-Ling drehte seit zwei Jahrzehnten Independent-Filme. Ihr jüngstes Werk, Land der Töchter, war recht erfolgreich auf einigen internationalen Festivals gelaufen. Sie stand im Ruf, lesbisch zu sein, was für ihre Arbeit an diesem Film über das funktionierende Matriarchat des chinesischen Bergvolks der Mosuo in der Provinz Yunnan sicherlich von Vorteil gewesen war.
Mimi Koo stand im krassen Gegensatz zu Mei-Ling. Die hinreißend schöne Malaiin war mit Jeremys Vorgesetztem Richard verheiratet. Wann immer Cathy von taktlosen Bekannten auf den recht großen Altersunterschied zwischen ihr und Jeremy angesprochen wurde, verwies sie auf Mimi und Richard, zwischen denen die Kluft noch etliche Jahre breiter war, deren Ehe aber dennoch harmonisch zu funktionieren schien. Mimi stammte aus einem schwerreichen Elternhaus, und das sah man. Es hieß, allein ihre Armbanduhr, eine Sonderanfertigung des Hauses Bulgari, habe eine Million Dollar gekostet: das bescheidene Hochzeitsgeschenk ihres Vaters, eines malaiischen Reeders, der angeblich über beste Beziehungen zu den Piraten verfügte, die die Straße von Malakka mit ihren Schnellbooten unsicher machten. Seine Tochter stand heute als zweites Attraktionszentrum mit in der Gruppe um Coco, schien sich ein wenig zu langweilen und war wohl verärgert, dass ihr Mann noch nicht gekommen war. Der saß noch im Auto mit Jeremy.
Neben ihr stand der koreanische Werbefilmproduzent, wie immer sein Glas Perrier in der wohlgeformten, genauso schlanken wie kräftigen Hand. Aha, der scheint sich wohl auch von Coco bezirzen zu lassen. Na ja, vielleicht ist er ja was für sie. Coco steht auf animalische, athletische Typen. Als er sah, wie Cathy zur Gruppe hinüberblickte, löste er sich von Mimi und Coco und kam zu ihr herüber. »Na, wo bleibt denn dein Sugar Daddy so lange?«, fragte er mit der Miene eines Unschuldslamms.
Sie funkelte ihn an. »Du bist heute wieder sehr witzig, Kim«, meinte sie schnippisch. »Alte Männer sind eben nicht mehr so schnell, da muss man Geduld haben. Das hat auch seine Vorteile.« Wie sie es hasste, auf den Altersabstand zwischen ihr und Jeremy angesprochen zu werden! Gerade von Kim, der schließlich auch nicht mehr der Jüngste war, auch wenn er sich, zugegeben, sehr gut gehalten hatte. »Weißt du, ich habe Jeremy für heute ein wenig Ausgang gegeben, weil er die letzten Wochen so brav abgewaschen hat«, ergänzte sie scherzend, um im gleichen Atemzug Ming-Lei zu sich heranzuziehen und sie dem Produzenten vorzustellen. »Kennt ihr euch? Ihr arbeitet zwar auf verschiedenen Seiten, doch in derselben Branche. Vielleicht kannst du sie ja mal interviewen, Kim.« Und schon unterhielt sich die chinesische Vogelscheuche mit der koreanischen Testosteronbombe. So einfach ging das. Manchmal jedenfalls.
Die Standuhr in der Diele schlug neunmal. Genau jetzt hätte das Essen serviert werden sollen. Sie hatte dem Koch und seinen Mädels signalisiert, noch eine Viertelstunde zu warten. Jeremy fehlte noch immer. Vielleicht sollte sie ihn doch noch einmal anrufen. Als sie sich ihren Weg in den Flur gebahnt hatte, wo es ruhiger war, stieß sie auf Yoshi Satori, der vor dem Frisiertisch stand und musternd Jeremys grün-weißes Paket in den Händen hielt. Als er sie kommen sah, streckte er es ihr entgegen und meinte lachend. »Wusste ich es doch, dass es heute noch einen besonderen Anlass zu feiern gibt. Darf man schon gratulieren?« Er bemerkte, dass Cathy die Sache eher peinlich war, und schob rasch hinterher: »Aber eigentlich suche ich ja nur einen Ort, wo ich mir vorm Essen mal die Hände waschen kann.«
»Die Tür, vor der Sie jetzt stehen, ist jedenfalls der Ausgang«, informierte ihn Cathy mit einem Lächeln. »Die Toiletten sind auf der anderen Seite gegenüber.«
Satori bedankte sich und drückte ihr mit einer gezierten Verbeugung das Päckchen in die Hände, als handele es sich um sein Geschenk. Sie stand einen Moment nachdenklich, nahm dann die ominöse Sendung und schloss sie im Sekretär in der Diele ein. War doch keine so gute Idee gewesen, das Päckchen hier offen hinzulegen und so gleichsam alle Gäste schon beim Hereinkommen mit der Nase darauf zu stoßen, dass heute Nacht ihr Geburtstag war und sie keine Geschenke mitgebracht hatten. Etwas taktlos, Cathy! Jeremy ging noch immer nicht ans Telefon. Es würde doch wohl nichts passiert sein?
Von draußen im Hof hörte sie das schrille Geschnatter Kumikos und eine sich überschlagende hohe, ungehaltene Jungmännerstimme – Chen. Bitte nicht.
Bis Cathy im Innenhof angelangt war, hatte sich die Situation offenbar wieder etwas beruhigt. Kumiko und Chen standen sich schweigend an der Bar gegenüber und taxierten einander mit funkelnden Blicken. Chen war also, allen Versprechungen zum Trotz, doch ausfallend geworden. Während er die Japanerin finster anstarrte, schenkte er sich mit seiner bekannten demonstrativen Langsamkeit ein Weißweinglas voll Sake ein, schnupperte daran, täuschte ein kurzes Nippen vor, verzog angewidert das Gesicht – und leerte den gesamten Inhalt in den Ausguss. »Das Zeug ist ja widerlich, schmeckt wie Benzin. Warum schüttet ihr das nicht lieber gleich in eure Autos, wo euch doch eh längst der Sprit ausgeht?«
»Chen!«, rief Cathy dazwischen. Als er seine Cousine sah, stemmte er entrüstet die Arme in die Hüften. »Cathy, Cathy, wieso tischst du uns dieses entsetzliche Gesöff auf? Willst du uns alle vergiften? Japanischer Reiswein! Warum nicht der gute Shao Xing aus China? Das muss ich jetzt aber gleich kräftig mit Bier runterspülen.« Er griff sich eine weitere Pulle aus dem dahinschmelzenden Scherbeneis.
»Vielleicht solltest du stattdessen lieber nach Hause gehen. Ich zahl dir das Taxi.« Sie hätte ihn doch besser im Auge behalten sollen. Während er scheinbar friedlich herumsaß, hatte er vielmehr die Zeit genutzt, sich unverschämt rasch einen Affen anzutrinken. Und dann wurde er unleidlich, das wusste Cathy. Da entwickelte er ein geradezu dämonisches Vergnügen daran, andere zu provozieren und bevorzugt alle Nichtchinesen mit seinen chauvinistischen Thesen vor den Kopf zu stoßen. Frau Satori wirkte allerdings auch nicht mehr ganz nüchtern. Sie schien sich mehr über Chen zu amüsieren, als wirklich beleidigt zu sein. »Du bist aber lustig, Kleiner!«, kicherte sie. »Gehst du schon zur Schule?«
Hinter Cathy erschien plötzlich Yoshi Satori und griff seine Frau etwas unsanft am Arm, was sie sofort verstummen ließ. »Immerhin darf er schon Bier trinken und damit unsere verdienstreiche Getränkeindustrie unterstützen, auch wenn er keinen Sake mag«, sagte Yoshi Satori und verbeugte sich knapp vor Chen, der die höfliche Geste mit einem angedeuteten Kratzfuß persiflierte. Satori runzelte die Stirn. »Mit wem haben wir das zweifelhafte Vergnügen?«
»Chen Wong. Ich bin Cathy Wongs Cousin. Cathys chinesischer Cousin!«
»Na, dann zum Wohl«, sagte Satori und deutete auf Chens schon wieder halb geleerte Flasche. »Chinesisches Bier«, betonte Chen. »Chinesische Getränkeindustrie.«
»Natürlich«, erwiderte Satori, der kein Interesse daran hatte, die Situation eskalieren zu lassen. Trotzdem verspürte er eine brennende Neugierde, diesen chinesischen Feuerkopf ein wenig auszutesten. Und so fuhr er fort: »Aber dir ist doch wohl sicher nicht entgangen, mein Junge, dass die Tsingtao-Brauerei seit 2009 zu einem Drittel dem japanischen Brauereikonzern Asahi gehört? Du siehst, Japans Globalisierung macht auch vor deiner Plörre nicht halt.«
»Und bald wird sie uns ganz gehören. Ganz China wird uns bald wieder gehören!«, rief Kumiko triumphierend dazwischen. »Wir sind die Weltmacht!«
»Shanghai wird euch niemals mehr gehören«, rief erregt Chen, dem es offensichtlich zu schaffen machte, was er soeben über seinen Lieblingstrunk gehört hatte. Satori sah ihn mitleidig an. »Ja, ich weiß, du bist stolz auf deine tolle Stadt. Wo ihr 2010 eure ach so tolle Weltausstellung hattet. Mit über 70 Millionen Besuchern aus aller Welt, sieh an. Und dem schönen Motto Better City, Better Life.«
»Ihr Japaner musstet vor Neid erblassen«, unterbrach ihn Chen höhnend. »Ihr habt eure große Zeit eben längst hinter euch. Eure Weltausstellung 1970 in Osaka, okay da wart ihr vielleicht noch wer, auch wenn das längst vergessen ist … Aber eure Expo in Tsukuba City, nur fünfzehn Jahre später, mal ehrlich: Hat die überhaupt stattgefunden? Da hat euer Niedergang doch schon begonnen. Und jetzt liegt ihr völlig am Boden.«
»Blas dich nicht so auf, du kleiner hundefressender Chinake!« Kumiko Satoris Schulmädchenlächeln war plötzlich verschwunden. »Was haben denn eure Olympischen Spiele 2008 in Peking bewirkt? Ach so: Ihr habt in eurer Hauptstadt nun endlich eine U-Bahn …« Sie lachte kreischend auf.
»Better City, Better Life«, griff Satori, nach einem mahnenden Seitenblick auf seine Frau, den angefangenen Gedanken wieder auf. »Kunststück, solange diese bessere Stadt auch von den besseren Menschen gebaut wird. Euer tolles Shanghai World Financial Center, auf das ihr so stolz seid, mussten bekanntlich wir bauen, weil ihr es allein garantiert nie hinbekommen hättet, eines der größten Gebäude der Welt hochzuziehen.«
»Wenn ihr es gebaut hättet, wäre es umgefallen!«, gackerte die Gans.
»Wenn ihr es bei euch gebaut hättet, wäre es auch umgefallen. Ihr baut ja nur woanders, weil ihr es zu Hause nicht hinkriegt. Weil bei euch sowieso alles gleich umfällt oder in die Luft fliegt. Weil bei euch alles kaputt und verseucht ist. Das ganze Land ist marode, das ganze Land! Nippons Größe, pah! Aus und vorbei! Soll es beim nächsten Erdbeben doch gleich ganz im Meer versinken. Als Rache für all eure Schandtaten! Und wir blühen gerade erst auf.«
Cathy zog Chen heftig am Arm, wild entschlossen, die sich anbahnende Katastrophe im letzten Moment zu verhindern.
Plötzlich ertönte schallend ein chinesischer Gong und ließ alle zusammenzucken. Über sein brummendes Nachklingen und durch das erschrockene Schweigen ringsum tönte eine laute Männerstimme, die betont fröhlich einen Guten Abend wünschte und verkündete, dass die Tafel bereitet sei. Cathy breitete mit gespielter Glückseligkeit ihre Arme aus. Mit seinen stämmigen 1,85 Metern, dem bereits lichter werdenden graumelierten Haar und seinen eher herben, kantigen Zügen stand plötzlich Jeremy im Eingang zum Innenhof, schenkte den Anwesenden das breite Lächeln eines Olympiasiegers, klatschte in die Hände und rief: »Kinder, was steht ihr herum. Vite, vite – à table!«
Im selben Moment wurden die Schiebetüren zum Speisezimmer geöffnet. Niemand hatte Jeremys und Richards Erscheinen bemerkt. Cathy wusste, was sie ihren Gästen schuldig war. Eine Szene vor aller Augen würde sie ihnen jetzt bestimmt nicht liefern. Sie flog mit ausgebreiteten Armen auf Jeremy zu, der ihre Umarmung mit einem frechen Funkeln seiner graublauen Augen erwartete.
»Du Schuft«, flüsterte sie ihm ins Ohr, »darüber reden wir noch. Aber ich bin heilfroh, dass du gekommen bist.«
»Ich vermute: viel zu spät, dafür genau im richtigen Augenblick«, raunte er leise zurück. »Mir scheint, Chen ist gerade dabei, zur Höchstform aufzulaufen. Entschuldige bitte, Liebling. Lass uns Platz nehmen, sonst wird das Essen kalt.«
»Ich verzeih dir«, lächelte Cathy und dachte an das Päckchen, das sie weggeschlossen hatte. »Hauptsache, du bist da. Jetzt soll der Abend nochmal neu anfangen und alles andere vergessen sein!« Von der Sendung würde sie ihm trotzdem erst nach dem Essen erzählen. Er konnte ruhig noch ein bisschen schmoren.
Tuschelnd begab sich die Gesellschaft Richtung Speisezimmer. Kumiko und Chen warfen sich noch ein paar bitterböse Blicke zu, doch schien nun allerseits der Hunger die Wut zu überwiegen. Cathy hoffte inständig, dass ihr endlich kompletter Gästecocktail dank der anstehenden Gaumenfreuden zur alten Harmonie zurückfinden würde. Mit all den exquisiten Leckereien, die jetzt aufgetragen wurden, schien sich auch wirklich eine allgemeine Gelöstheit breitzumachen. Chen saß am anderen Ende der Tafel, weit weg von den Satoris, hatte seine halbvolle Bierflasche an der Bar stehen lassen und schaufelte die traditionell chinesischen Speisen mit sichtlicher Begeisterung in sich hinein. Dass sich die Satoris direkt gegenüber von Jeremy und Cathy niedergelassen und damit Coco ihren Platz weggeschnappt hatten, passte Cathy weniger, aber sie wusste natürlich, wie wichtig Jeremy der potenzielle neue Mandant war. Und sie machte sich keine Illusionen darüber, dass sicher die meisten der heutigen Gäste eben auch gekommen waren, weil sie Partys wie die ihre als ideale Gelegenheit zum »Networking« betrachteten.
Sie war froh, dass die hysterische Gans an Yoshis Seite wieder ruhig, geradezu kleinlaut geworden war und sie sich kaum mit ihr zu unterhalten brauchte. Yoshi wiederum erschien ihr als zunehmend angenehmer Konversationspartner, der im Unterschied zu seiner Frau durchaus Manieren hatte. Zwischen dem ersten und dem zweiten Gang (erst gebackener Karpfen, dann dreierlei Ente mit Soße aus schwarzen Bohnen) entwickelte sich zwischen den beiden ein zwangloses Gespräch. Er fragte sie nach ihrer Arbeit und ob sie denn auch über die große ostasiatische New Energy Conference im World Financial Center berichte, die am Freitag eröffnet werden sollte.
»Wissen Sie, ich mache ja mehr die Society-Themen und weniger Politik oder Wirtschaft.«
»Klatsch«, warf Jeremy, der mit halbem Ohr mithörte, erläuternd ein.
Sie ignorierte das. »Allerdings bin ich am Freitag wahrscheinlich trotzdem im Center. Da gibt es einen großen Empfang der Moto Corporation zu Ehren ihres Präsidenten Minato Moto. Eine Mordsgeschichte, mit viel internationaler Prominenz. Das ist mehr mein Metier. Vielleicht haben Sie davon gehört?«
»Aber natürlich«, antwortete Satori schmunzelnd. »Ist ja ein hochverdienter Landsmann von mir. Fürwahr ein exklusiver Zirkel, zu dem Sie da geladen sind.«
»Genau das sagt meine Freundin Coco Kingston auch. Sie wissen ja gar nicht, wie neidisch die ist, weil sie keine Einladung bekommen hat. Aber Coco ist eben Modejournalistin, und bei dem Empfang gibt es wahrscheinlich wieder nur alte Männer in langweiligen Anzügen. Also, ich bin da ja überhaupt nicht scharf drauf. Ich könnte gerne verzichten.«
»Oh, sagen Sie das nicht. Ich an Ihrer Stelle würde mir so ein unvergessliches Ereignis auf keinen Fall entgehen lassen. Glauben Sie mir: Da erleben Sie was! Aber eine Bitte.« Satori beugte sich vor und raunte ihr, während er mit gespielter Leidensmiene zum unteren Ende der Tafel hinabsah, verschwörerisch ins Ohr: »Nehmen Sie Ihren werten Herrn Cousin nicht mit.« Cathy verschluckte sich fast an ihrer Ente vor Lachen. »Da können Sie mal ganz unbesorgt sein.«
»Und bei Ihnen läuft das Geschäft, Mr. Gouldens?«, wandte sich Satori nun Jeremy zu.
»Ich kann mich nicht beklagen, danke.«
»Haben Sie schon über meinen Vorschlag nachgedacht?«
Wie auf Kommando verfiel Jeremy nun in einen Redefluss, der kein Ende mehr nahm. Cathy hörte nicht weiter hin, seine vielen Geschäftsangelegenheiten interessierten heute nicht. »Na schmeckt’s?«, wandte sie sich lieber an Coco, die zwei Sitze neben Satori noch einen Platz gefunden hatte.
»Ganz großes Kino – aber ich muss leider auf meine Linie achten. Was habt ihr da eben vom Moto-Empfang getuschelt?«
Cathy seufzte. Dass Coco ihre Ohren immer überall haben musste. Jetzt war sie wieder bei ihrem Lieblingsthema. Sie begannen ein langes Gespräch über die Praxis der Presse-Einladungen bei exklusiven Empfängen, den internationalen Jetset, schlechtgekleidete Männer aus Wirtschaft und Politik, über japanische Baulöwen und Modepäpste.
Beim Dessert fiel Cathy das Päckchen wieder ein, und sie konnte es sich nun doch nicht verkneifen, erste Andeutungen zu machen.
»Na – du scheinst mir etwas unruhig zu wirken«, sagte sie schelmisch zu Jeremy.
»Wieso? Ich amüsiere mich prächtig.«
»Hast du nicht heute noch etwas erwartet? Eine Sendung?«
»Ich weiß nicht, wovon du sprichst.«
»Jetzt tu nicht so. Ich seh doch, dass du wie auf Kohlen sitzt. Aber keine Angst: Sie ist noch rechtzeitig gekommen, es ist alles in Ordnung.« Jeremy schob sich noch einen Löffel Vanilleparfait in den Mund. »Natürlich ist alles in Ordnung, mein Schatz«, lächelte er unsicher. »Außer vielleicht, dass du in Rätseln sprichst.«
Jetzt war es aber genug. Sie stand auf, trippelte zum Sekretär in der Diele und kam beladen zum Esstisch zurück. »Vielen Dank, Liebling – im Voraus«, hauchte sie und legte das grün-weiße Päckchen neben seinen Platzteller.
Nichts war in Ordnung.
Er war plötzlich kalkweiß. »Was ist denn das?«, krächzte er. »Das glaube ich nicht!« Alle Gespräche verstummten. Neugierige Blicke richteten sich zum Kopf der Tafel. »Das kann doch nicht sein! Ich glaub’s einfach nicht«, stammelte der Gastgeber des heutigen Abends. Die Gastgeberin beugte ihm besorgt ihren Kopf zu. »Was kann nicht sein, Schatz?« Jeremy starrte Cathy durchdringend an. Sein Blick war so leer, dass sie erschauerte. Die Anwesenden, die nun begriffen hatten, dass etwas Unvorgesehenes vorgefallen war, das sie im Grunde nichts anging, beeilten sich, wieder so zu tun, als sei nichts geschehen.
»Ein köstliches Essen, Cathy!«, posaunte Richard Koo etwas überlaut, »war lange nicht mehr so satt. Heut Abend pfeif ich auf meinen Cholesterinspiegel!« Cathy zwang sich zu einem beherrschten Gastgeberlächeln. »Greift zu, Leute! Es darf nichts übrig bleiben.«
»Bin gleich wieder da«, warf Jeremy, um Verständnis bittend, in die Runde. Er verließ langsam den Raum, sorgfältig darauf bedacht, dass niemand das Zittern seiner schweißnassen Hände sehen konnte, die die Sendung umklammert hielten und das grün-weiße Papier knistern ließen. Sobald er die Tür zur Diele erreicht hatte, begann er zu rennen. Die Treppe hinauf und in sein Arbeitszimmer, wo er das vermeintliche Geburtstagspäckchen rasch in der untersten Schublade seines Sekretärs verschwinden ließ, als gälte es, einen giftigen Skorpion zu fangen. Er versuchte sich zu beruhigen, doch sein Puls raste. Jeremy kannte den Absender.
Y. Murata. »Y«, nicht »A«. Nicht Aikiko.
Yukiko.
Kyoto, Juni 1997
Jeremy Gouldens war Yukiko Murata am frühen Abend des 21. Juni 1997 das erste Mal begegnet.
Seine Nebentätigkeit für Lexman & Lexman hatte der junge Rechtsdozent absprachegemäß am 1. Juni begonnen. Jeremys Aufgabe war es zunächst einfach nur, einige Details zur Geschichte des Kuroi-Juchi-Konzerns zu recherchieren. Hierzu hatte man ihm eine Liste übersandt, die er Punkt für Punkt abzuarbeiten hatte. Was genau Gegenstand des Prozesses war, wusste er nicht. Damit und mit allen vertraulichen Einzelheiten sollte er erst nach seiner Anstellung in Tokio detaillierter bekanntgemacht werden. So kam es ihm bei seiner Recherchetätigkeit ein wenig so vor, als würde er plan- und ziellos im Dunklen stochern. Dennoch fand er seine Arbeit bald mächtig aufregend. Nach und nach taten sich ihm bislang unbekannte Abgründe der Geschichte auf, die ihn zunehmend fesselten und beunruhigten.
Mit den japanischen Quellen tat er sich allerdings noch sehr schwer. Trotz Intensivkurs und täglichem Kontakt mit der schwierigen Sprache machte er erst allmählich Fortschritte. Gott sei Dank gab es auch einiges an englischsprachigem Material: Bücher, Zeitungsartikel, Aufzeichnungen. Oft war es allerdings äußerst beschwerlich, an die angeforderten Unterlagen heranzukommen. Gerade offizielle Stellen verweigerten ihm häufig den Zugang – mit vielfach fadenscheinigen bis hanebüchenen Begründungen.
Bevorzugt vertiefte er sich in die wenigen verfügbaren englischsprachigen Artikel und Bücher über die japanische Geschichte der dreißiger und vierziger Jahre, auch wenn ihr Inhalt ihm manchmal schier den Magen umdrehte. Die schlimmen Verbrechen der Krauts im Zweiten Weltkrieg waren ihm natürlich bekannt; wieso er dagegen von den gleichzeitigen japanischen Gräueltaten an Millionen bisher noch nie gehört hatte, war ihm unbegreiflich. Genauso wenig begriff er aber auch, was die Massaker 1937 in Nanking und geheime Experimente in der Mandschurei mit einem Prozess des Jahres 1997 zu tun haben sollten.
Zu seinen Aufgaben gehörte auch die Abarbeitung einer Liste von Namen ehemaliger Mitarbeiter von Kuroi-Juchi und sonstiger Personen, die in irgendeiner Weise mit dem Unternehmen und seiner Entstehung in Verbindung gestanden hatten. Er musste herausfinden, ob diese Personen noch leben, wer ihre Nachkommen waren, ob eventuell irgendwo ein Nachlass existierte et cetera. Nur selten war ihm ein Erfolgserlebnis vergönnt. Die meisten dieser Menschen waren entweder tot oder nicht aufzufinden. Und all die verwirrenden japanischen Namen machten ihn ganz konfus. Als er bei seinen Nachforschungen nach dem Namen »Akira Murata« auf eine Spur stieß und schließlich erfuhr, dass dieser Mann als rüstiger Endachtziger hier in Kyoto lebte, war das für ihn ein kleiner Sieg.
Kurzentschlossen begab er sich an die angegebene Adresse: ein betagtes Holzhaus unweit des Flusses Kamo. Das war zwar in seinem Aufgabenprofil nicht vorgesehen, aber er war begierig danach, seine hohe Motivation unter Beweis zu stellen, und wollte möglichst schnell mit überraschenden Ergebnissen trumpfen. Erst später wurde ihm klar, dass er damit beruflich eine riesige Dummheit begangen hatte. Privat hatte er in den Glückstopf gegriffen.
Nein, Herr Murata sei nicht da. Sie sehe hier nur manchmal nach dem Haus, solange er nach seiner Hüftoperation auf Kur sei. Was er denn von ihm wolle.
Jeremy hörte nicht recht zu. Er durfte sie nicht so anstarren. Nie hatte er eine schönere Japanerin gesehen. Natürlich nicht: Nie hatte er einen schöneren Menschen gesehen. Diese leuchtenden Augen brachten ihn um. »Sind Sie seine Enkeltochter?«
Sie lächelte ihn an und schüttelte sanft den Kopf. »Ich wüsste nicht, was Sie das angehen sollte. Aber, wo wir schon beim Fragen sind: Kenne ich Sie nicht von der juristischen Fakultät?«
Jeremy schüttelte den Kopf. Dann nickte er. Er war verwirrt. Völlig unmöglich, dass sie etwa eine seiner Studentinnen sein konnte. Diesen Anblick vergisst man nicht. Es stellte sich heraus, dass sie in der Tat ihr Juraexamen bereits hinter sich hatte, gerade ein Praktikum in einer kleinen Kanzlei in Kyoto absolvierte und nebenher an der Universität für ein Promotionsprojekt im Bereich Wirtschaftsrecht forschte. Ob er dort nicht manchmal in der Bibliothek zu tun habe? Da sei er ihr wohl schon einmal über den Weg gelaufen. Sie habe ein gutes Gedächtnis für Gesichter. Besonders für manche.
Als er ihr daraufhin ein Treffen vorschlug, zögerte sie. »Mal sehen«, sagte sie. Dann machte sie ihm die Tür vor der Nase zu.
Aber Jeremy blieb hartnäckig. Schließlich ging es hier nicht darum, eine Japanerin anzubaggern, sondern er recherchierte für seinen Fall … In den Akten zu Akira Murata stieß er auf den Hinweis, dass Murata mit fast sechzig noch einmal Vater geworden war. Eine Yukiko Murata fand sich im Promovierendenverzeichnis. Auch Adresse und Telefonnummer. Als er sie anrief, klang ihre Stimme erleichtert, als hätte sie schon gewartet und freue sich, dass er sie endlich gefunden hatte. Verstehe einer diese Japaner! Sie verabredeten sich für Samstag in der Universitätscafeteria. Am ersten Nachmittag blieb es noch bei American Cheesu-keki und Kohi. Und ein Grüntee für die Dame. Bald trafen sie sich regelmäßig.
Yukiko war vier Jahre jünger als er. Sie hatte zunächst einige Semester an der privaten Ritsumeikan-Universität Pharmazie studiert und war dann an die prestigeträchtigere ehemalige Kaiserliche Universität gewechselt, wo sie ein Jurastudium begann. Vor einem Jahr hatte sie ihr Examen mit Auszeichnung bestanden. Sie war so wissbegierig und fröhlich. Geschwister habe sie nicht, sagte sie. Ihre Mutter sei vor einigen Jahren gestorben, und sie verbringe viel Zeit damit, ihren störrischen und schwierigen Vater zu pflegen.
Als Jeremy in seinem Überschwang Richard Koo in Tokio anrief, von seinem Ausflug zum Murata-Haus und der dortigen Begegnung erzählte, erlebte er den väterlichen Anwalt zum ersten Mal leicht ungehalten. Freundlich, aber in einem Ton, der keinen Widerspruch duldete, riet er Jeremy, sich streng an die vereinbarten Aufgaben zu halten und seinen Kompetenzbereich nicht zu überschreiten. Einen privaten Umgang mit der Murata-Tochter könne er ihm natürlich nicht verbieten, aber er möge das Berufliche da um Gottes willen außen vor lassen. Gegenüber allen Menschen, einschließlich Yukiko, verordnete er ihm eisernes Stillschweigen.
Auf der anderen Seite war man da noch viel weniger tolerant. Irgendwann konnte Yukiko ihre gemeinsamen Ausflüge nicht mehr geheim halten. Ihre Freunde, Verwandten und vor allem ihr Vater fragten schockiert, ob die Gerüchte denn stimmten – ob sie tatsächlich mit einem behaarten Butterstinker liiert sei.
Einen Monat nach jenem ersten »Kaffee, Tee und Käsekuchen«-Rendezvous und drei Wochen nach ihrem ersten Kuss unter dem großen Ginkgobaum im Botanischen Garten hatte sich Jeremy aus einer Laune heraus ein Motorrad gekauft, eine 500er Enduro von Yamaha, mit der sie nun die zahlreichen Tempelanlagen und heiligen Schreine um Kyoto abgrasten. Besonders beeindruckt hatte sie der herrliche alte Moostempel der Rinzai-shu im Stadtbezirk Nishikyo, wo Amitabha, dem Buddha der umfassenden Liebe, gehuldigt wurde. Sie badeten nackt im Biwasee und in den heißen Quellen, den Onsen, von Beppu, und verbrachten zwei unvergessliche Wochenenden im alten Fischerdörfchen Takahama am Japanischen Meer; in einer kleinen, alten Pension, wo sie die einzigen Gäste waren.
Für Yukiko war es nicht einfach, wie ein Klammeräffchen auf der hohen Rückbank des Motorrads zu sitzen und sich Jeremy völlig auszuliefern, wenn er todesmutig tief in die Kurven der schmalen Küstenstraßen hineintauchte. Vor sich fühlte sie seinen breiten Rücken, neben ihr war ein Abhang und hinter ihr lag ihr altes Leben. Als sie auf dem Rückweg von Matsumoto einmal aus einer Kurve herausgeschossen kamen, stand plötzlich die untergehende Sonne als riesiger glutroter Ball vor ihnen. Statt zu bremsen, gab Jeremy noch einmal kräftig Gas. Da war es, als würden sie abheben und wie Ikarus mitten in die Sonne hineinfliegen, um in einer gewaltigen Explosion mit ihr eins zu werden. Zu verschmelzen mit ihr, mit einander, mit allem. Jetzt waren sie wirklich Sonnenkinder.
Oh Göttin Amaterasu hilf!
Shanghai, 1. Mai 2012. 23:36 Uhr
»Was meinst du, Jeremy?«
Als er nach einer gefühlten Ewigkeit zum Esstisch zurückgekehrt war, hatte er sich krampfhaft bemüht, souverän zu wirken. Aber er konnte seine wild durcheinanderrasenden Gedanken noch immer nicht stoppen. Auf einmal war alles wieder aufgebrochen. Jeremy kam sich vor wie ein Schwein. Vielleicht war er auch eins. Eigentlich hatte er vorgehabt, gerade morgen, an Cathys Geburtstag, um ihre Hand anzuhalten. Warum nur hatte diese Sendung nicht zwei Tage später kommen können?
Weil er sich dann weiter vor der Wahrheit hätte drücken können. Weil er dann weiter vor der Vergangenheit davongelaufen wäre. Weil Cathy vor diesem gewaltigen Schritt, der sie für immer zusammen- oder auseinanderbringen konnte, das Recht hatte, die Wahrheit zu erfahren. Die ganze Wahrheit. Insofern war es gut, wie es gekommen war. Aber es schmerzte. Und er hatte Angst, das Päckchen zu öffnen, als handele es sich dabei um eine neue Büchse der Pandora, aus der sogleich alles Böse der Welt quellen und über ihn herfallen würde. Große Angst.
»Was meinst du, Jeremy?«
»Bitte?« Jeremy sah Cathys Cousin irritiert an.
»Sag mal, träumst du? Ob es deiner Meinung nach stimmt, dass japanische Soldaten sich 1937 und 38 lebende Chinesen als Marschverpflegung mitgenommen haben?« Vor Aufregung und Alkohol glühte Chens runder, fast kahlrasierter Schädel; so rot wie der Sonnenball, mit dem Jeremy und Yukiko einst hatten verschmelzen wollen. Jeremy merkte, dass er orientierungslos durch ein Gespräch schlingerte, dem er nicht gefolgt war.
Die ersten Gäste waren bereits gegangen. Gegen elf hatte sich Coco verabschiedet. Sie bedauere es sehr, nicht bis Mitternacht bleiben zu können, aber sie müsse am nächsten Morgen zeitig zu einem Fotoshooting nach Singapur fliegen. Auch Mei-Ling hatte sich mit Hinweis auf einen bevorstehenden langen Drehtag empfohlen und Cathy schon einmal mütterlich alles Gute gewünscht. Obwohl sich die Nachricht von Cathys bevorstehendem Geburtstag schließlich doch noch vielfach herumgesprochen hatte, erwies es sich nun als Nachteil, den eigentlichen Partyanlass im Vorfeld verschwiegen zu haben. Der mitternächtliche Kreis zum gemeinsamen Anstoßen würde jedenfalls sehr überschaubar sein. Als der harte Kern geblieben waren noch das Ehepaar Koo, Kim Park, zum Leidwesen aller auch Chen – der Cathys Taxiangebot mehrfach ausgeschlagen hatte – sowie, sehr zu Jeremys Erstaunen, die Satoris.
»Komm, sag schon: Was meinst du, Jeremy? Haben sie sie aufgefressen? Und gib ruhig zu, dass dich all die unmenschlichen Schandtaten der Japaner am chinesischen Volk einen Dreck interessieren. Eure Imperialistengeschichtsschreibung interessiert sich ja bekanntlich auch einen Dreck dafür.«
»Redet ihr schon wieder von Nanking?« Jeremy begann langsam wieder in einer Gegenwart Fuß zu fassen, in der eine hässliche Vergangenheit offensichtlich noch unerbittlich lebendig war. »Also, in Daniel Barenblatts Buch A Plague upon Humanity über das geheime japanische Biowaffenprogramm im Zweiten Weltkrieg wird das Thema Kannibalismus in der Tat angeschnitten.« Ein etwas unglückliches Verb, dachte Jeremy, doch es schien keinem aufzufallen. Verflucht auch, warum musste Chen gerade jetzt mit diesem Thema ankommen. Er griff unterm Tisch nach Cathys rechter Hand und drückte sie zärtlich. Sie zeigte keine Reaktion, doch Jeremy ließ nicht los.
»Also, ich finde …« Cathy ergriff tapfer das Wort, während sie ihre Hand unauffällig aus Jeremys Griff befreite. »Muss man denn immer in der Vergangenheit herumwühlen? Haben wir aus der Geschichte nichts gelernt? Können wir es in Zukunft nicht einfach besser machen? Und optimistisch nach vorne schauen?«
»Endlich hast du’s erfasst«, rief Chen und deutete mit dem ausgestreckten Zeigefinger auf Yoshi Satori. »Die haben aus der Geschichte nichts gelernt. Solange so ein rechtsradikales Politschwein wie der mit den höchsten japanischen Literaturpreisen dekorierte Schmierfink Shintaro Ishihara in einem Playboy-Interview behaupten kann, die Nanking-Massaker, bei denen über 300000 Chinesen abgeschlachtet wurden, seien bloß eine chinese fabrication und hätten niemals stattgefunden, hat sich nichts geändert!« Er nahm einen bekräftigenden Schluck aus der Flasche Mei Jiu-Pflaumenwein, die er irgendwo in der Hausbar aufgestöbert hatte.
Yoshi Satori hatte ein steinernes Pokerface aufgesetzt, an dem Chens Anklagen einfach abzuprallen schienen. Kumiko wirkte noch betrunkener als zuvor und schien gar nicht mehr recht zuzuhören. Zufrieden registrierte Jeremy, dass die, wie er gehört hatte, so elitäre und mächtige Waguni K.K. offensichtlich stärkstes Interesse an einer Mandatsbeziehung mit Lexman & Lexman besaß. Sonst hätte Satori Chens Provokationen sicher längst ein Ende gesetzt, indem er unter einem höflichen Vorwand aufgestanden wäre, um mitsamt seiner entsetzlichen Ehefrau das so ungastliche Haus zu verlassen. Richard Koos Körpersprache signalisierte, dass Jeremys Vorgesetzter dies genauso interpretierte. Dennoch wurde es höchste Zeit, Chens agitatorischem Treiben Einhalt zu gebieten. Selbst wenn, wie Jeremy plötzlich aufging, sehr viel klare Wahrheit in Chens trunkenen Schmähreden steckte, konnte kein Gastgeber es tolerieren, wenn seine Gäste derart rüde beschimpft wurden. Wenn er ein Mann war, musste er handeln. Warum zögerte er noch?
»Chen: Es reicht jetzt!«, sagte in diesem Moment in scharfem Ton Kim Park. Er hatte bis dahin kaum den Mund aufgemacht. »Entweder setzt du dich jetzt hin und reißt dich zusammen … Oder ich schmeiß dich eigenhändig raus.«
Cathy warf ihm einen dankbaren, fast zärtlichen Blick zu. Solch eine entschlossene Geste hatte sie sich seit zwei Stunden von ihrer geliebten Langnase gewünscht. Cathys kleiner Cousin aber war in voller Fahrt und so leicht nicht zu bremsen. »Gerade du, Kim, hältst es auch noch für nötig, sie zu verteidigen«, murmelte er finster. »Gerade du! Hast du etwa vergessen, was sie deinem koreanischen Volk angetan haben?«
»Das ist kaum zu glauben, du bist ein Kimchi?«, prustete die aus ihrem Dämmerzustand hochschreckende Kumiko Satori. Plötzlich sprach sie Japanisch. »Kimchi-Kohl stinkt, weil man ihn monatelang unter Verschluss hält. Dann ist er besonders scharf!«, schob sie mit maliziösem Lächeln hinterher und leckte sich die Lippen. »Und du bist ein Kimchi?«
Ein knackendes Geräusch ließ die Knöchel an Kims rechter Hand weiß hervortreten. Die Narbe an seinem sehnigen Hals pochte. Seit seiner Verletzung hatte er ein besonderes Verhältnis zum milchsauer vergorenen koreanischen Nationalgericht.
»Jeder, der regelmäßig seine Sendung schaut, weiß, dass unser Kim ein Japan-Koreaner ist«, meldete sich Richard dazwischen und kehrte zur englischen Sprache zurück, die es jedem ermöglichte, mitzureden.
»Ein Kimchi!«, kicherte Kumiko Satori, »ich weiß doch schon lange, dass du ein so scharfer Kimchi bist!«
»Nachdem wir das nun geklärt haben, schlage ich vor, endgültig zum gemütlichen Teil des Abends überzugehen. Gleich gibt’s was zu feiern«, meldete sich Jeremy etwas matt zu Wort. Ihm fiel die Gastgeberrolle zunehmend schwer. »Der Champagner ist im Kühlschrank«, pflichtete Cathy ihm bei. »Soll ich die Gläser holen?«
»Fein! Champagner für mich und meinen scharfen Stinke-Kimchi!«, trällerte Kumiko fröhlich.
Kim Park hatte den Respekt, den man ihm als vermeintlichem Japaner entgegenbrachte, oft zu seinem Vorteil auszunutzen gewusst. Aber er hatte weder die Spottreime seiner japanischen Klassenkameraden vergessen noch die Repressalien, die er später auf der Nihon-Universität in Tokio ertragen musste. Und er war ein Wanderer zwischen zwei Kulturen geblieben. Korea war ein Land, auf das er ebenso stolz sein wollte. Oh ja, er konnte sich noch gut daran erinnern, wie er von Mitschülern mit Kendo-Holzschwertern halb totgeschlagen worden war. Nur weil er einen Klassenkameraden mit chinesischen Wurzeln verteidigt hatte, der den Geschichtslehrer naiv gefragt hatte: »Stimmt es, dass früher mehr als die Hälfte der japanischen Adeligen koreanischer Abstammung waren?« Die Ohrfeige hatte den kleinen Kerl vom Stuhl gefegt. Doch bevor der Lehrer nochmal zuschlagen konnte, war Kim aufgestanden und hatte gerufen: »Natürlich stimmt das. Sogar der Tenno soll von uns abstammen!« Diese unglaubliche Kombination von Gottes- und Majestätsbeleidigung hatte zu einem heillosen Tumult geführt.
Kim, dem der von Chen und den Satoris angeschlagene undifferenziert gehässige Ton zunehmend gegen den Strich ging, war versucht, darauf hinzuweisen, dass die systematische Geschichtsfälschung an den Schulen in Verbindung mit lebenslangem Brainwashing in Japan leider eine ziemlich unwissende und eigendünklerische Gesellschaft hervorgebracht habe. Aber ihm war bewusst, dass für eine sachlichere Diskussion über Bildung, Erziehung und Geschichtsbewusstsein der Abend schon zu spät und die Stimmung zu angespannt war. Und so sagte er in versöhnlichem Ton: »Wir Japaner sind an so scharfe Gerichte gar nicht gewöhnt, nicht wahr, Kumiko?«
»Wir Japaner? Ware ware«, äffte sie lallend seinen Tonfall nach.
Der im Umgang mit anderen gemeinhin nüchtern und beherrscht wirkende Kim erhob sich, griff nach einem herumstehenden Becher Sake und leerte ihn langsam über Kumikos Kopf. Ging heute Abend ja gut weg, der Sake. Die Japanerin erstarrte, um dann in ein hysterisches Wiehern auszubrechen. Yoshi Satori machte Anstalten aufzuspringen, doch Kim legte ihm warnend die linke Hand auf die Schulter. Ein Tonnengewicht. Satori verstand die Warnung sofort. Dieser Koreaner war niemand, mit dem man scherzte. Genauso wenig wie Satori selbst.
Kim, wachsbleich vor Zorn, verbeugte sich tief zu Cathy hin, drehte sich wortlos um und verließ die Party.
Allgemeines Schweigen. Jeremy blickte auf seine Armbanduhr und sagte schließlich mit gespielter Leichtigkeit: »Na, wenigstens wirst du diesen Geburtstag nie vergessen, Darling. Es ist kurz vor zwölf. Lass uns zum letzten Programmpunkt des Abends kommen und den Herrschaften den Champagner servieren.«
Jeremy ging in die Küche. Cathy folgte ihm, wie in Trance.
»Fühlst du dich jetzt besser?«, fragte Chen mit schwerem Zungenschlag, nahm noch einen Schluck chinesischen Pflaumenwein und starrte die begossene Kumiko verächtlich an. »Schade, dass es kein Benzin ist, dann würde ich dich jetzt anzünden, damit wir besseres Licht haben. Na ja, bei euch Japsen taugt Alkohol ohnehin nur zur äußerlichen Anwendung.« Zu Richard Koo gewandt, fügte er hinzu: »Diese wandelnde Schnapsleiche ist ein trauriges Beispiel dafür, dass der gemeine Japaner eben keinen Alkohol verträgt. Liegt an ihren minderwertigen Genen. Das ganze Volk ist genetisch defekt.«
»Ruhe jetzt«, befahl Richard Koo und stieß Chen, der sich schwerfällig erheben wollte, sanft, aber bestimmt auf seinen Stuhl zurück. Yoshi Satori wurde von niemandem zurückgehalten. Er stand auf und riss seine Frau grob vom Stuhl. »Was lallst du da, Kleiner?«, wandte er sich mit kaltem Lächeln an Chen. »Man braucht dich ja nur anzusehen und hat den lebendigen Beweis, dass auch der Chinese mit diesem Enzym nicht gerade gesegnet ist. Wohl so ziemlich die einzige Gemeinsamkeit zwischen unseren Völkern. Im Übrigen werden wir schon noch sehen, wer hier die überlegenen Gene hat. Deine Gene und Enzyme möchte ich jedenfalls nicht haben, armseliger Chen.«
Doch der hatte nun beschlossen, den aufgeblasenen Japaner wie Luft zu behandeln. »Auch Korea war den Japanern schon immer haushoch überlegen. Nicht nur genetisch – auch kulturell«, meinte er beiläufig zu Richard. »Wahrscheinlich haben die Japaner deshalb diesen Minderwertigkeitskomplex, der sie sogar versuchen ließ, die koreanische Kultur komplett auszurotten. Wissen Sie, wie die berühmte japanische Arita-Keramiktradition entstanden ist? Das Imari-Porzellan?«
»Halt endlich dein chinesisches Drecksmaul!«, schrie Kumiko Satori. Ihr Mann stieß ihr energisch den Ellenbogen in die Seite, ohne zu berücksichtigen, wie schwer sie auch so schon mit ihren alkoholbedingten Koordinationsschwierigkeiten zu kämpfen hatte. »Halt deinen Mund, Bengel!«, sagte Yoshi irritiert. »Du wirst deine Beleidigungen Japans noch bereuen. Denk daran, wenn du mir mal wieder über den Weg läufst.«
Mit einem dumpfen Schlag plumpste Kumiko zu Boden, um auf Cathys kostbarem dunkelroten Seidenteppich liegenzubleiben.
Cathys Cousin grinste. Er hatte es endlich geschafft, diesen blasierten Wicht aus der Reserve zu locken. Aber er wollte mehr. Dass Yoshi Satori sein Gesicht verlor. Wie schon sein Land das Gesicht verloren hatte. »Sie wissen also nicht, wie die Arita-Keramik entstand? Dann erfahren Sie es jetzt: Die Japaner haben die berühmtesten koreanischen Keramikmeister einfach auf ihre Bambusinseln verschleppt!« Triumphierend blickte Chen in die Runde. »Tausende von koreanischen Künstlern! Weil sie selbst zu blöd waren!«
»Das halte ich nicht mehr aus«, seufzte Mimi Koo und verließ den Raum. Chen schlug sich vor Vergnügen auf die Oberschenkel.
Yoshi Satori stützte sich mit den Armen auf dem Esstisch ab und musterte ihn scharf. »Bevor ich dir deinen dicken Hals umdrehe, möchte ich dir noch eine Frage stellen, kleiner Chen«, sagte er kalt. »Wem haben denn die südkoreanischen Kimchi-Fresser ihren ganzen Aufstieg zu verdanken? Wem die Infrastruktur, die Bildung, die modernen Unternehmen? Nur den Wohltaten der japanischen Besatzung, die zum Segen Koreas und aller asiatischen Völker erfolgte! Wer hat denn bis 1945 die Völker Ostasiens von der Kolonialherrschaft befreit? Wir, die Japaner!«
»Ach so«, meldete sich nun Richard Koo zu Wort, der sich an dieser müßigen Diskussion eigentlich nicht hatte beteiligen wollen. Doch zu so später Stunde und in einer so verrückten, aufgeheizten Atmosphäre wie heute konnte sein ausgeprägtes Gerechtigkeitsgefühl schon einmal über seine charakteristische Besonnenheit triumphieren. »Großzügige Wohltäter an den anderen Völkern seid ihr also! Zum Segen Koreas wurden demnach nach dem großen Erdbeben 1923 in Tokio koreanische Mitbürger zu Tausenden als vermeintliche Brunnenvergifter erschlagen. Und im Zweiten Weltkrieg wart ihr so gütig, den Koreanern selbstlos den Vortritt zu lassen, als sie die Hälfte aller ›freiwilligen‹ Kamikazepiloten stellen durften. Und weil ihr so großzügig seid, mussten eure koreanischen Mitbürger auch nur jahrzehntelang darum kämpfen, bis den 35000 umgekommenen koreanischen Zwangsarbeitern in Hiroshima eine Gedenktafel gewidmet werden konnte. Von den Zehntausenden koreanischen Zwangsprostituierten, den ›Trostfrauen‹, die noch heute auf eine japanische Entschuldigung warten, ganz zu schweigen.« Richard Koo stand kurz vor der Pensionierung und durfte es wagen, aufrichtig seine Meinung zu sagen, selbst wenn er dadurch womöglich die Aussicht auf eine lukrative Mandatsbeziehung verspielte. Im Moment pfiff er auf diese suspekte Waguni K.K. Verbrecherbande! »Mit Verlaub, Herr Satori – da sollte Ihr Kultusministerium die Schulbücher nochmals umschreiben …«
Was sollte Yoshi Satori darauf antworten? Er wusste, dass Richard Koo die historische Wahrheit auf seiner Seite hatte. Aber was kümmerte ihn die Vergangenheit. Für Satori zählte die Zukunft. Der japanische Geschäftsmann deutete knapp eine Verbeugung an. Dann versuchte er, Kumiko auf die Beine zu stellen, was grandios misslang. Richard wollte helfen, aber eine abwehrende Handbewegung des Japaners hieß ihn sitzen bleiben.
Komplizenhaft beugte sich Chen zu dem Anwalt hinüber, der unverhofft für ihn in die Bresche gesprungen war. »Das, mein Freund, ist noch harmlos im Vergleich zu dem, was diese Horde von Bauern und Piraten unserem Volk angetan hat. Dabei kam alles, was Japan heute auszeichnet, letztlich von uns über die koreanische Landbrücke auf die Inseln …« Chen rieb sich zufrieden die Hände.
»Seid ihr noch immer nicht am Ende mit eurem Dritten Japanisch-Chinesischen Krieg? Lasst einen Moment die Waffen schweigen!«, rief Jeremy, hörbar um Heiterkeit bemüht. Er balancierte ein Tablett mit sieben Champagnerkelchen und vermied es galant, über die weibliche Schnapsleiche auf dem Seidenteppich zu stolpern. Hinter ihm führte Mimi Koo eine frustrierte Cathy am Arm. Ein fürwahr unvergesslicher Geburtstag.
»Mitternacht!«, sagte Jeremy feierlich und küsste Cathy, die es reglos über sich ergehen ließ, schmatzend auf die Wange. »Kommt, Freunde, lasst uns mit einem 1980er Dom Pérignon rosé auf das Geburtsjahr der wundervollsten Frau der Welt anstoßen und Frieden zwischen den Völkern schließen.« Hatte er eben Geburtsjahr gesagt? Man verrät nicht das Alter von Frauen über dreißig. Unter normalen Umständen ein Fauxpas, den ihm Cathy nicht ungestraft durchgehen ließ; heute würde das angesichts all der übrigen Desaster aber wohl unter »ferner liefen« rangieren. Er begann mit dem Verteilen der Gläser.
Kumiko Satori musste den Champagner gewittert haben. Leise grunzend rappelte sie sich vom Teppich auf, schubste ihren Mann von sich, zog sich am Stuhl hoch und kam gefährlich schwankend zum Stehen. Ihr Make-up war verschmiert. »Happy Birthday, Misses Wong«, nuschelte sie mit schwerer Zunge, riss Jeremy den Kelch aus der Hand und stürzte den edlen Champagner in einem Zug hinunter. Feinperlig, extraktreich, langer Abgang, 96 Parker-Punkte. 329 Dollar.
Dann zeigte sie mit ausgestrecktem Zeigefinger auf den Gastgeber und begann mit eigentümlich hohler, sich schrill überschlagender Stimme ein Lied zu singen, das sich in ihrer Version wie eine japanische Totenklage anhörte. In the town where I was born, lived a man, who sailed to sea. And he told us of his life …
Jeremy zuckte zusammen. In ihrem Suff bekam Kumiko den Rest der Strophe nicht mehr zusammen und sprang direkt in den Refrain: We all live in a Yellow Submarine, Yellow Submarine, Yellow Submarine … Dazu führte sie eine Art grotesken Tanz auf.
Ein scharfes Wort von Yoshi brachte Kumiko abrupt zum Schweigen. Niemand schien zu bemerken, dass sich Jeremy verzweifelt um Fassung bemühte. Cathy mochte zu Recht über eine rundum verpatzte Party jammern, die sie niemals vergessen würde. Aber was sollte erst er sagen? Für ihn war es heute Abend schon zum zweiten Mal, als würde er unversehens mit ferngesteuerten Elektroschocks gefoltert. Was hat das zu bedeuten, fragte er sich, warum ausgerechnet dieser Song?!
»Hast du ihnen etwa erzählt, was für ein großer Beatles-Fan du bist, Jeremy?«, fragte leicht verwirrt Cathy, in die wieder etwas Leben gekommen war, und versuchte zu lächeln. Vielleicht wollte sie auch nur irgendetwas sagen, um die peinliche Situation zu überbrücken. Jeremy schüttelte abweisend den Kopf. Cathy, die wusste, wie sehr es ihn ärgerte, wenn sie sich über seinen »altmodischen« Musikgeschmack mokierte, interpretierte sein verfinstertes Gesicht als Warnung, jetzt bitte nicht wieder mit dieser leidigen Musikdiskussion anzufangen, und konnte sich eben deshalb nicht verkneifen, noch ein wenig weiterzureden und weiterzusticheln. »Aber heute legst du das Weiße Album bitte nicht auf, ja? Das vertreibt mir noch die letzten Gäste. Ein Stimmungskiller, sage ich euch! Revolution, Revolution …«
Die Satoris jedenfalls hatten auch ohne Weißes Album schon genug. »Entschuldigen Sie bitte, dass wir jetzt gehen müssen«, sagte Yoshi Satori, der sichtlich um Haltung rang. »Ich bin sicher, dafür haben Sie alle Verständnis.«
Jeremy saß ein dicker Kloß im Hals. Er sah, wie Satori seine Frau unterhakte und aus dem Raum schleifte. Kumikos Schulmädchenzöpfe hatten sich aufgelöst. Sekunden später hörte man die Eingangstür ins Schloss fallen. Dann herrschte Stille.
Mimi Koo ergriff als Erste das Wort. »Was war das eben?«
»Ich weiß es nicht«, sagte Cathy.
»Ein Menetekel«, flüsterte Jeremy düster.
»Anyway …«, tröstete Richard.
»Ein Sieg!«, lachte Chen, der als Einziger sitzen geblieben war. Er prostete seiner Cousine zu. »Alles Gute, Cathy!«
»Mit dem Sieg wäre ich mir an deiner Stelle nicht so sicher«, konterte Cathy und schritt auf ihn zu. Sie blieb vor Chen stehen, der sie fragend anblickte – um im nächsten Moment eine Ohrfeige zu kassieren, die er sein Leben lang nicht mehr vergessen würde.
Ein Teilerfolg.
Shanghai, 2. Mai 2012. 00:37 Uhr
Yoshi Satori und Kumiko standen schweigend nebeneinander am Straßenrand der Chongle Lu und warteten. Lauwarmer Regen hatte eingesetzt. Satori starrte stumm zu Boden. Er würdigte die Frau neben ihm keines Blickes. Ihr Make-up lief ihr als braunrote Soße die Wangen herunter und verschmierte ihre weiße Bluse. Die Nachtluft hatte sie wieder etwas nüchterner gemacht, und man konnte sehen, dass es heftig in ihr arbeitete. Die Straßen waren fast leer, nur ein paar Taxis waren unterwegs. Aus der Ferne dröhnte dumpf und schwerfällig ein Linienbus heran. Schließlich trat die Frau vor den Mann und verbeugte sich. »Verzeihen Sie mir«, sagte sie leise, honto ni shitsurei shimashita. Yoshi sah sie mit leerem Blick an. »In deiner Haut möchte ich jetzt nicht stecken.« Da richtete sie sich jäh auf, drehte sich um, trat auf die Changle Lu hinaus und lief zwei Schritte. Dann sprang sie. Der Bus erwischte sie frontal, überrollte sie mit den Vorderrädern und schleifte sie noch etwa 30 Meter über den Asphalt, bis er endlich stehen blieb.
Satori, der mit starrer Miene dem Bus nachgeblickt hatte, bemerkte erst jetzt das rote Mazda-MX-5-Cabrio, das mit quietschenden Bremsen neben ihm zum Halten kam. Er riss die Beifahrertür auf und sprang hinein. »Du hast dich etwas verspätet«, sagte Yoshi mit belegter Stimme.
Aus dem CD-Spieler drang leise westliche Rockmusik. Der Fahrer hatte chinesische Züge. Sein gepflegtes Äußeres, seine ebenmäßigen Gesichtszüge und besonders seine dunkel leuchtenden, mandelförmigen Augen verliehen ihm eine geheimnisvolle Attraktivität, die durch den latent grausamen Zug um seine Mundwinkel und den bisweilen etwas stechenden Blick seiner schönen Augen womöglich noch gesteigert wurde. »Und du hast dich mächtig in die Nesseln gesetzt«, gab der Fahrer in einem akzentfreien Japanisch zurück. »Um ein Haar wärst du aufgeflogen.« Er gab Gas und fuhr am Bus vorbei, vor dem jetzt einige schreiende Passanten und ein bleicher Fahrer standen. »Mann, was ist denn das wieder für eine Sauerei …«
»Ja, John, ich weiß. Kumiko … Es ist einiges schiefgelaufen.« Yoshi Satori öffnete sein Hemd und riss sich das winzige, fleischfarbene Mikrofon von der Haut. »Wer hat denn eigentlich diese Frau angeschleppt? Ein Totalausfall. Und dein Chen ist womöglich eine noch größere Pfeife.« Der andere sah ihn verächtlich an. »War es nicht deine glänzende Idee, lieber mit der guten Frau Gemahlin zu kommen? Du weißt, dass ich Bedenken hatte, ob sie wirklich für den Job geeignet ist, aber der werte Herr Satori weiß ja immer alles besser. Wohl bekomm’s. Totalausfall, tja …« Ein gespieltes Bedauern lag in seiner Stimme. »Hast ein bisschen geschubst, was?«
»Nein John, war nicht mehr nötig.«
»Egal. Und wegen Chen mach dir mal keine Sorgen. Der ist sowieso bloß ein kleiner Statist – Kanonenfutter.«
»Ein wichtigtuerischer, wirrer Hitzkopf, bei dem sofort alle Sicherungen durchbrennen.«
Der Mann, den Satori »John« nannte, zuckte die Schultern. Was kümmerte ihn Chen. »Du weißt, dass ich Tokio informieren muss«, setzte er mit kalter Stimme hinzu. »Ich hatte dich gewarnt.« Satori nickte matt. »Du fliegst noch heute nach Japan. Vorher schreibst du mir einen ausführlichen Bericht. Wir haben nicht alles auf der Aufnahme.« Satori nickte wieder. Er nahm ein zerknautschtes Päckchen Zigaretten aus der Tasche seines Anzugs, zündete sich eine Filterlose an und betrachtete mit einem etwas beklommen wirkenden Stirnrunzeln die Finger seiner linken Hand. Der gutaussehende Chinese grinste wie ein Haifisch vorm Zubeißen. »Vielleicht kann ich in der Zentrale ein gutes Wort für dich einlegen.«
Yoshi Satori antwortete nicht.
Shanghai, 2. Mai 2012. 00:42 Uhr
Kein Kuss. Keine Umarmung, keine dramatische Versöhnungsszene mit Tränen, Geständnissen, Versprechen, die schließlich im Bett besiegelt würden. Nicht heute, bitte nicht. Ein klärendes Wort vielleicht, ja, auch wenn ihr im Moment nicht besonders nach Reden war. Den Anfang würde ohnehin er machen müssen. Aber Jeremy, der aus unerfindlichen Gründen mitten im südchinesischen Mai und bei weit geöffnetem Fenster im Kamin ein Feuer entfacht hatte, saß seit einer halben Ewigkeit schweigend mit einem dreistöckigen Single Malt in der Hand da und stierte in die Glut. Cathy war immer noch ratlos. Wie konnte ein unscheinbares Päckchen aus Japan ihn nur dermaßen aus der Bahn werfen?
Plötzlich ließ sie ein Geräusch zusammenzucken. Kam es von der Straße durchs Fenster oder hatte eben ihr Herz kurz ausgesetzt?
Fast im selben Moment zersplitterte der kleine Tempelwächter aus grüner Jade, der auf einem der zierlichen Beistelltische aus kostbarem Huanghali-Holz neben Jeremys Sessel stand. Ein Schatten flog durch den Raum, streifte den elektrifizierten Kronleuchter über dem Esstisch und verschwand, so schnell, wie er gekommen war, draußen in der regnerischen Nacht. »Bloß eine Fledermaus«, sagte Jeremy dumpf und drehte ihr langsam sein Gesicht zu. Derselbe leere Blick wie vorhin, als sie ihm das Päckchen neben den Platzteller gelegt hatte.
»Jeremy …?«, hob Cathy an. »Ja?« Eine Stimme wie aus dem Grab. »Ach nichts«, winkte sie ab. »Ich geh ins Bett.« Fern heulte ein Blaulicht durch die Nacht. »Mach nur, Schatz.«
»Du solltest auch …«
Jeremy schüttelte den Kopf. »Ich komm gleich nach«, versprach er und wandte sich wieder dem Kaminfeuer zu. »Schlaf gut.«
»Alles Gute zum Geburtstag, liebe Cathy«, murmelte sie zu sich selbst, stand auf, starrte einen schweren Atemzug lang durchs Fenster in die Regennacht hinaus, dann schloss sie es sorgfältig und machte sich auf den Weg ins Badezimmer.
»Alles Gute«, hörte sie Jeremy sagen. »Ich hab dich lieb, Cathy.«
Sie verkniff sich die Antwort, die er von ihr erwartete. Erwartete er sie wirklich? Im Moment schien er ihr nur unendlich weit weg.
Shanghai, 2. Mai 2012. 01:10 Uhr
Chen saß im Schneidersitz inmitten der meterhoch aufgetürmten Papierstapel seines Zimmers in einem Studentenwohnheim der Fudan-Universität im Süden der Stadt, nippte an der Flasche Pflaumenwein, die er mitgehen lassen hatte, als er nach jener demütigenden Ohrfeige aus dem Haus geschlichen war, und ließ die Ereignisse des Abends noch einmal Revue passieren. Was für eine elende Party! Was für widerliche Leute! Das oberflächliche Geschwätz, die aufgetakelten Weiber in ihren hochhackigen Schuhen – sogar die Aufmachung seiner Cousine hatte ihn, trotz traditionellem Qipao, an eine Hure erinnert. Und als Krönung dieser stinkarrogante japanische Rassist mit seinem unflätigen Flittchen. Je mehr Details ihm einfielen, desto mehr kochte Chen vor Wut.
Sein Blick wanderte über das reichhaltige Material zur jüngeren chinesischen Geschichte sowie zum politisch-wirtschaftlichen Zeitgeschehen, das er in den vergangenen Semestern zusammengetragen hatte, und blieb zuletzt an dem vergilbten Foto des letzten chinesischen Kaisers, Pu Yi, hängen, das er gerahmt an die Wand gehängt hatte. Pu Yi war zwar nur eine Marionette gewesen, aber immerhin ein Kaiser. Nein, kicherte Chen lautlos in sich hinein, ich bin nicht verrückt: Ich lebe bloß in der falschen Zeit.
Ohne Frage hatte er sich heute Abend danebenbenommen und für einen Skandal gesorgt. Doch keine Provokation hieß Stillstand. So hatte es der große John Huang ihm und den anderen Getreuen der »Neuen Bewegung der Nationalen Kraft« erklärt, die seit ihrem letzten konspirativen Treffen allerdings, so hatte es der Führer per Dekret verkündet, »Neue Bewegung des Vierten Mai« hieß – was ihre geschichtliche Verantwortung besser unterstreiche. Für ein starkes China gelte es, genau wie damals 1919, Opfer zu bringen.
Und die zu bringen war er, Chen, bereit. Warum hatte er vorhin die beiden imperialistischen Japse aus dem Haus gejagt, während der feige Anwalt und all die anderen weggeschaut hatten? Ganz einfach: weil er, Chen, die Verantwortung übernommen hatte. Weil er sich nichts mehr bieten lassen würde. Weil er die permanenten japanischen Provokationen satthatte, die China noch immer stillschweigend erduldete. Wo war etwa der ganz große Aufschrei der Entrüstung geblieben, als der japanische Toyota-Konzern seinen Geländewagen Prado in Werbebildern ausgerechnet vor der Kulisse der steinernen Löwen auf der Marco-Polo-Brücke vor den Toren von Peking präsentierte – wo im Sommer 1937 ein simuliertes Attentat japanischer Kollaborateure den Vorwand für den japanischen Einmarsch in China geliefert hatte. Vorwand für einen geplanten Völkermord, dem am Ende 20 Millionen Chinesen zum Opfer fallen sollten. 20 Millionen!
Der vierte Mai. Übermorgen war es so weit. Seit Monaten fieberte Chen diesem Datum entgegen. Kaum jemand erinnerte sich noch, dass an diesem Datum vor genau 93 Jahren eine studentische Protestbewegung ins Rollen gekommen war, die bald große Teile der chinesischen Jugend erfasste und eine Radikalisierung in Gang brachte, die letztlich zum Bürgerkrieg und zur Gründung der Volksrepublik führte. Der historische Tag hatte der Bewegung sogar ihren Namen gegeben: »Die Bewegung des 4. Mai«. Anlass der spontanen Kundgebungen war die Nichtberücksichtigung Chinas bei der Versailler Friedenskonferenz gewesen. Genauer gesagt, die unverschämten Gebietsansprüche der Japaner, die sich das wertvolle deutsche Pachtgebiet um Tsingtao in der Küstenprovinz Shandong unter den Nagel reißen wollten. Was ihnen, dank willfähriger Unterstützung durch die europäischen Imperialistenmächte Großbritannien und Frankreich, auch gelang. Und jetzt wollten Konzerne wie Toyota und der Brauriese Asahi sowie japanische Nationalisten wie dieser Satori China erneut in die Knie zwingen. Nur die Bewegung würde eine Wiederholung solcher Schmach verhindern können. Der allmächtigen Kommunistischen Partei trauten sie dies schon lange nicht mehr zu.
Chen bewunderte John Huang. Nicht nur weil der Führer der Bewegung so smart und klug war. Ein Mann von Welt und Stil. Sondern auch weil er ihm eindrucksvoll vorlebte, dass man mit Visionen nicht nur den Verstand erobern konnte, sondern auch die Herzen. Besonders auch die Herzen von Frauen, die Chen bislang leider weitestgehend verschlossen geblieben waren. Doch er hatte keine Lust, sich bis ans Lebensende ins Millionenheer der sogenannten »kahlen Äste« zu reihen – jener Unglücklichen, die aufgrund des gravierenden Männerüberschusses in China zum ewigen Junggesellendasein verdammt sind. Um ein solches Schicksal zu vermeiden, war er sogar bereit zu kämpfen.
Chen bekam richtig Schluckauf vor Aufregung. Nur noch bis übermorgen. Dann würde hier in Shanghai vor den Augen der ganzen Welt ein unübersehbares Zeichen gesetzt werden, das alles verändern musste. Ähnlich wie damals vor 93 Jahren. Und Chen würde ganz vorne mit dabei sein. Bei ihrem letzten konspirativen Treffen heute Nachmittag im Hu Xin Ting, dem berühmtesten Teehaus der Stadt, hatte John Huang persönlich ihm die Hand gereicht, Chen aus seinen schönen Augen eindringlich angesehen und ihn, neben fünf anderen, mit feierlichen Worten ins neue Aktionskomitee der Bewegung aufgenommen. In jeder Sechsergruppe gab es nun zwei dem Gruppenkommandanten direkt nachgeordnete Aktionisten, denen die drei einfachen Mitglieder ohne operative Befugnis unterstellt waren. Bald würde ihn alle Welt für seine mutige Tat bewundern – und er sich vor Frauen nicht mehr retten können. Ihn schwindelte bei diesen Aussichten.
Richtig übel war ihm auf einmal.
Vom Magen her verspürte er ein dumpfes Wallen, das langsam den Brustkorb hinaufzog und ihm die Kehle zuschnürte. Dieser schreckliche Pflaumenwein! Er sprang auf und hoffte inständig, es noch rechtzeitig zur Toilette zu schaffen. Zu dumm, dass ihm die Japaner auch noch sein Lieblingsbier weggeschnappt hatten. Das sollten sie büßen.
Shanghai, 2. Mai 2012. 02:06 Uhr
Jeremy Gouldens trank mit Vorliebe die Whiskys der Inneren-Hebriden-Inseln Skye und Islay. Vom schweren Ardbeg über den komplexen Bowmore bis zum torfigen Laphroaig, dem pfeffrigen Talisker und dem raren Port Ellen. Am allerliebsten aber hatte er Lagavulin mit seiner fulminanten Rauchigkeit und dem zarten Beigeschmack von Seetang und Honig. Und mit einer Flasche 16-jährigem Lagavulin hatte er sich heute Nacht hinter den Schreibtisch seines Arbeitszimmers zurückgezogen. Cathy, im Schlafzimmer nebenan, schlummerte bereits seit einer Stunde. Doch er konnte nicht schlafen. Der Blues war wieder da, und er hatte beschlossen, sein Leiden mit edlem Single Malt zu verstärken und zugleich etwas zu versüßen.
Fragen über Fragen. Unangenehme Fragen, denen er sich jetzt nicht stellen wollte. Im Moment wünschte er sich nur aus allem raus. Einfach alles hinschmeißen und verschwinden. Er hatte das schließlich schon einmal gemacht. Vielleicht war es doch ein Fehler gewesen, dass er damals auf Richard Koo gehört hatte und in den Moloch Shanghai eingetaucht war. Wo er jetzt wieder Vollgas im Hamsterrad gab. Warum war er nicht einfach auf seiner Jacht »Hebridian Spirit« mit ihrer wohlgefüllten Bordbar geblieben und hatte entschleunigt weitergelebt, in der Südsee, auf den Spuren Jack Londons, den er schon als Junge bewundert hatte?
Natürlich wäre er nicht so erfolgreich geworden wie Jack. Vermutlich hätten seine eigenen Versuche als Autor auch weiterhin keine Verleger oder Produzenten gefunden. Wenn schon: Was das Geld betraf, war er ohnehin ein Sohn der Sonne. Knapp die Hälfte der üppigen Honorare, die er während seiner anderthalb Jahre bei Lexman & Lexman in Japan verdient hatte, war konsequent in Fonds und Anleihen geflossen. Für lukrative Geldanlagen hatte er schon immer ein Händchen besessen. Dazu gesellten sich die jährlichen Mieteinnahmen für seine elterliche Wohnung im Londoner Nobelviertel Chelsea. Von seinem sonstigen Familienerbe, das er nur selten anzurühren brauchte, ganz zu schweigen.
Statt sich also mit einem Longdrink in der Hand an Bord seiner Jacht zu sonnen und Abenteuerromane und philosophische Bücher zu lesen, keulte er nun, ohne eigentliche finanzielle Notwendigkeit, durchschnittlich 75 Stunden pro Woche als Anwalt und führte in der knapp bemessenen Freizeit ein Leben auf der Überholspur. Immerhin an der Seite der wundervollsten Frau der Welt, die ihn faszinierte wie keine zuvor. Oder sollte es ehrlicherweise heißen: wie nur eine zuvor? Und gerade jetzt, wo er in wenigen Stunden um die Hand der einen anhalten wollte, meldete sich die andere zurück. Und stürzte ihn in neue Zweifel. War seine Entscheidung die richtige? Warum denn wollte er Cathy heiraten? Um vor sich wegzulaufen und sich dadurch nur in neue Abhängigkeiten zu stürzen? Das würde ihm wohl ein Psychologe unterstellen. Oder weil er umgekehrt nun angekommen war, seinen Platz gefunden hatte und endlich sesshaft werden, eine Familie gründen wollte – mit dem Hintern, mit dem Herzen, mit dem Verstand? Das war Jeremys »offizielle« Begründung, von der er in seinen optimistischen Stunden auch felsenfest überzeugt war. Doch alles zerrann, wenn der Blues kam.
Welche Antwort war die richtige? Jeremy betrachtete nachdenklich sein Spiegelbild im dunklen Glas. »Komm schon«, sagte er, »entscheide dich!« Sein verzerrtes Gegenüber lächelte verlegen und schwieg. Hatte er Cathy überhaupt verdient? Er schämte sich. Wusste er doch, dass er sie beinahe täglich enttäuschte, ihren hohen, aber für eine Frau ihres Formats nur zu angemessenen Erwartungen nur selten gerecht wurde. War es, nüchtern betrachtet, nicht völlig illusorisch zu glauben, jemandem wie ihm – einem unzuverlässigen, 49-jährigen Anwalt mit Haarausfall und eher gewöhnungsbedürftigem Äußeren –, sei auf Dauer eine Zukunft an der Seite dieser Frau vergönnt? Wenn er sich nicht schleunigst änderte, konnte er diese Zukunft jedenfalls abhaken. »Verdammt«, flüsterte er, »was willst du wirklich, Jeremy Gouldens?«
Sein whiskygeschwängerter Blues war mittlerweile tiefschwarz geworden.
Jeremy lauschte in die nächtliche Stille des Hauses. Er füllte sein Glas noch einmal vier Finger breit. Der Whisky beruhigte ihn und gab ihm Mut. Den würde er brauchen, um das grün-weiße Päckchen zu öffnen, das jetzt vor ihm auf dem Schreibtisch lag. Er hatte sich vorgenommen, Cathy gegenüber reinen Tisch zu machen. Gleich heute, an ihrem Geburtstag. Noch vor seinem Antrag. Wenn er ihr die geheimen Kammern seiner Seele öffnete, würde er ihr damit letztlich ein persönlicheres Geburtstagsgeschenk machen, als es der teure Zwölfkaräter war, den er bisher sorgfältig vor ihr versteckt gehalten hatte. Davon war er überzeugt. Nicht überzeugt war er davon, dass sie das genauso sehen würde. War es nicht eher stark zu bezweifeln? Er wusste, dass er viel aufs Spiel setzte, aber seine Entscheidung war gefallen. Wenn sie ihn heiraten wollte, dann musste sie ihn ganz heiraten, samt seinem Vorleben. Er musste zu sich stehen, auch vor ihr, mit der Heimlichtuerei Schluss machen und der Vergangenheit unerschrocken ins Gesicht blicken. Doch dazu musste er auch das Päckchen öffnen.
Entschlossen riss Jeremy das Geschenkpapier auf. Darunter verbarg sich ein gelber Umschlag. Er enthielt zwei DVDs sowie einige Ausdrucke und Papiere. Da war noch ein handgeschriebener Brief, kunstvoll zusammengefaltet wie ein Origami, in Form eines Kranichs. Jeremy faltete ihn auseinander und fand nur einen einzigen Satz:
Lieber Jeremy, wenn Du diese Zeilen liest, habe ich endlich meinen Frieden gefunden. Yukiko
Die Mauer um seine Erinnerungen stürzte endgültig ein und Jeremy war, als müsste er sterben.
Kyoto, 3. November 1997. Früher Nachmittag
Der glückliche Sommer ihrer Liebe war einem kühlen, windigen Herbst gewichen. Und längst war nicht mehr alles so heiter und unbeschwert wie am Anfang. Der Druck auf Yukiko wuchs und gleichzeitig rückte der Zeitpunkt ihres Abschieds unerbittlich näher. Oh Göttin Amaterasu hilf!
Besonders Vater Akira begann, seiner Tochter zunehmend das Leben zur Hölle zu machen. Er hasste alle Ausländer, die Angelsachsen fast noch mehr als die Chinesen, und wollte seiner Tochter den Umgang mit Jeremy um jeden Preis verbieten. Für welche Spannungen zwischen Tochter und Vater er gesorgt hatte, konnte Jeremy allerdings nur aus gelegentlichen Andeutungen und Stimmungsäußerungen Yukikos erschließen, die in Bezug auf ihre Familie sehr schweigsam war. Er fragte nicht weiter nach. Jeremys Neugier nach dem Vater hatte schlagartig nachgelassen, sobald er der Tochter nähergekommen war. Außerdem war er fest entschlossen, sich strikt an seine Abmachung mit Richard Koo zu halten, die ihm vorschrieb, Berufliches und Privates peinlich zu trennen.
Nur einmal sollte er den Alten selbst zu Gesicht bekommen: als er im Überschwang des Frischverliebten eines Samstagabends trotz aller Warnungen zum alten Holzhaus am Kamo-Fluss hinausgefahren war, wo Yukiko oft die Wochenenden verbrachte. Er hatte sie einfach nur sehen und mit zwei Eintrittskarten fürs No-Theater überraschen wollen. Trotz seiner nahezu 90 Jahre war Akira Murata eine imposante Gestalt. Kräftig, sehnig, von einer geradezu jugendlichen Rüstigkeit. Als der dämonisch vitale Greis drohend auf den fremden Eindringling in sein Leben zugeschritten kam, hatte Yukiko ihn so beschwörend angefleht, bitte zu gehen, dass Jeremy verwirrt gehorchte. Bei ihrem nächsten Treffen bat sie ihn, solange ihr Vater lebte, das Haus am Kamo nie wieder zu betreten. Dabei versuchte sie vergeblich, den Striemen an ihrer rechten Schulter mit einem Tuch zu verdecken. Jeremy war entsetzt. Hier taten sich Abgründe auf, die er nicht für möglich gehalten hatte.
Sie müsse weg von dort, weg aus Kyoto, warum sie denn nicht mitkomme nach Tokio, auch dort gab es Kanzleien, wo junge Juristinnen arbeiten konnten, vielleicht konnte er sie sogar bei Lexman & Lexman unterbringen, und sie würden immer zusammen sein. Aber Yukiko schüttelte jedes Mal nur den Kopf, wenn er wieder davon anfing. Sie müsse hierbleiben und ihren Vater pflegen. Das sei sie ihm schuldig. Es gebe eben Dinge, die er nicht verstehe.
Und dann kam der 3. November, ein Sonntag. Der Tag des Abschieds. Am nächsten Morgen würde Jeremy seine Anwaltstätigkeit für Lexman & Lexman in Tokio aufnehmen. Sie hatten sich für den frühen Nachmittag auf ihren Lieblingsspaziergang verabredet – durch den Botanischen Garten im Bezirk Sakyo-ku im Nordosten der Stadt. Am Abend würde Jeremy dann den Shinkansen nach Tokio besteigen. Der Hochgeschwindigkeitszug legte die 480 Kilometer in wenig mehr als zwei Stunden zurück.
Es war ein kalter, sonniger Tag. Sie gingen am Teich mit den Schwänen vorbei und setzten sich auf die Bank vor dem mächtigen alten Ginkgobaum, dessen herbstliche Blätter nun goldgelb verfärbt waren und zu fallen begonnen hatten. Hier hatten sie sich vor vier Monaten zum ersten Mal geküsst. Wie lange war das jetzt schon her!
Sie saßen einige Zeit schweigend und hielten sich die klammen Hände. »Wir wollen diesen Ort nie vergessen«, sagte Yukiko schließlich.
»Wir hatten zu Hause auch einen Ginkgobaum«, erinnerte sich Jeremy. »Das heißt, draußen auf dem Landgut meiner Großeltern in Surrey.« Nachdenklich hob Jeremy ein besonders großes Ginkgoblatt vom Boden auf, betrachtete es, lächelte, als in ihm eine Erinnerung aufstieg, und begann unvermittelt zu rezitieren.
Dieses Baums Blatt, der von Osten
Meinem Garten anvertraut,
Gibt geheimen Sinn zu kosten,
Wie’s den Wissenden erbaut.
Ist es ein lebendig Wesen,
Das sich in sich selbst getrennt?
Sind es zwei, die sich erlesen,
Daß man sie als eines kennt?
Solche Fragen zu erwidern,
Fand ich wohl den rechten Sinn:
Fühlst du nicht an meinen Liedern,
Daß ich eins und doppelt bin?
Yukiko hatte ihn verwundert angesehen. »Uh, das klingt aber roh und hart«, befand sie jetzt. »Was ist denn das für eine aggressive Sprache? Russisch?«
»Nein, Deutsch.« – »Und was bedeutet es?«
»Keine Ahnung.« Jeremy lächelte. »Ich hab es als Kind von meiner Großmutter gelernt.«
»Deine Großmutter war Deutsche?«
»Ja, sie ist in den dreißiger Jahren nach England emigriert. Das sind Verse von einem Dichter namens Goethe. Vielleicht hast du den Namen schon mal gehört.«
»Hör mal, ich bin Japanerin und zur Schule gegangen! Ich habe Goethes gesammelte Gedichte auf Japanisch im Regal stehn. Und so klingt das im Original? Und du weißt nicht, worum es geht?«
»Doch, natürlich schon. Soviel ich weiß, geht es um ein Ginkgoblatt. Wie dieses hier.« Er hielt ihr das aufgehobene Blatt entgegen. »Schau, es ist in der Mitte durch einen Einschnitt in zwei Hälften geteilt, ist aber trotzdem ein Blatt. Und für Goethe ist es mit zwei Menschen, die sich lieben, genauso. Sie sind zwei, aber doch irgendwie eins. Dafür dient ihm das Ginkgoblatt als Symbol. Na ja, so eine Art nostalgisches Gedicht über die Liebe, weißt du.«
»Danke, das kann ich gerade gebrauchen.«
Dann nahm sie von Jeremy das große gelbe Blatt, durchtrennte es vorsichtig in der Mitte und reichte ihm die eine Hälfte. »Das bin ich«, sagte sie. »Heb es gut auf.« Die andere Hälfte schlug sie vorsichtig in ihr Taschentuch ein und legte sie sich an die Brust. »Und das bist du. Wir sind getrennt und doch eins. Versprichst du, dass du mich genauso in Ehren halten und mir treu bleiben wirst wie ich dir?«
Jeremy schluckte und nickte.
Shanghai, 2. Mai 2012. 02:40 Uhr
Jeremy saß noch immer reglos. Sein Blick so leer wie sein Whiskyglas. Vor ihm lag ausgebreitet der Inhalt der Sendung: DVDs, Papiere, der gelbe Umschlag, der auseinandergefaltete Origami-Kranich. Er versuchte zum wiederholten Male, eines der Blätter zu lesen, doch sein Blick verschwamm und kapitulierte vor den japanischen Kanji-Schriftzeichen. Oben auf der Rückseite des letzten Blattes fiel ihm ein handschriftlich auf Englisch nachgetragener Zusatz ins Auge. Mit einiger Mühe erkannte er die feine, gestochene Handschrift Yukikos und setzte die Worte zusammen: »Bei allen Fragen wende Dich zuerst an meinen Bruder Joe.« Daneben eine lange japanische Telefonnummer.
Wieso hatte sie auf einmal einen Bruder?
Er schob alles Material zusammen, um es in den Umschlag zurückzustecken. Für heute Nacht war es definitiv genug. Sein Maß war voll. Würde er noch zwei Minuten länger hier sitzen, das spürte er, würde er nun doch noch in ungehemmtes Heulen ausbrechen. Das musste nicht sein. Als er mit einer fahrigen Bewegung nach dem gelben Umschlag griff, musste er ihn wohl ein wenig geschüttelt haben. Da fiel noch etwas heraus. Etwas Leichtes, Kleines, Zerbrechliches.
Die Hälfte eines trockenen, gelben Ginkgoblattes, das man vor langer Zeit in der Mitte durchtrennt hatte.