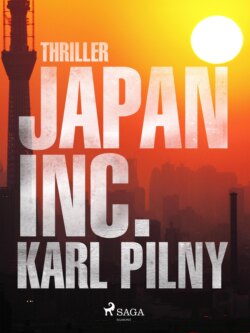Читать книгу Japan Inc. - Karl Pilny - Страница 7
2. Tag
ОглавлениеShanghai, 2. Mai 2012. 08:15 Uhr
Kim Park trabte in ruhigem Dauerlauftempo den Bund hinunter. Seine übliche Morgenrunde, bevor er, meist gegen neun, mit der Arbeit des Tages begann. Heute hatte er keinen Blick für all die anderen Jogger, an denen er gemächlich vorbeizog. Er dachte an gestern, die verunglückte Party und die unerträglichen Provokationen dieser merkwürdigen Japaner, die ihm von Anfang an höchst suspekt vorgekommen waren. Wie konnte Cathy nur solche Leute einladen? Alles die Schuld dieses dubiosen Butterstinkers!
Als er gerade in Begriff stand, in die Nanjing Lu einzubiegen, klingelte sein Mobiltelefon. Das ärgerte ihn. Normalerweise ging er beim Joggen nicht ran, um nicht aus dem Rhythmus zu kommen. Aber vielleicht war es ja Cathy, die sich für gestern Abend und die unmöglichen Gäste entschuldigen wollte.
Es meldete sich eine äußerst sympathisch klingende Frauenstimme. Aber es war nicht die von Cathy. Natürlich, die lag zu so früher Stunde sicher noch neben ihrer schnarchenden Langnase im Bett. Dennoch erkannte er die Anruferin sofort. Rau, tief und voller Sex-Appeal – das war die Stimme der jungen chinesischen Filmagentin mit der gefälschten Visitenkarte, die ihm vor einigen Tagen die ersten Seiten jenes ominösen Drehbuchs dagelassen hatte.
Er möge heute Vormittag um 10:30, bitte pünktlich, in der Shine Art Space Gallery in der Moganshan Lu sein, der Galeristenmeile von Shanghai. Dort sei auf seinen Namen eine Eintrittskarte für die Vernissage des chinesischen Pop-Art-Künstlers Feng Zhengjie hinterlegt. Wenn er den Rest des Drehbuchs von Yellow Submarine lesen wolle, solle er unbedingt kommen. Allein.
Kim fand so viel Heimlichtuerei ein wenig übertrieben, und das sagte er auch. »Hören Sie, ich bin durchaus an diesem Drehbuch interessiert, wirklich. Aber wenn Sie nicht nur irgendwelche Versteckspielchen spielen, sondern Nägel mit Köpfen machen wollen, dann kommen Sie bitte zu mir ins Büro, und wir besprechen das Ganze. Und vor allem: Sagen Sie mir erst einmal Ihren wahren Namen.«
Kurzes Schweigen am anderen Ende. »Es ist nicht ungefährlich«, hörte er wieder die raue, erotische Stimme der Agentin. »Und wir dürfen keine Fehler mehr machen. Wenn Sie mich treffen wollen, dann passen Sie auf, dass Ihnen niemand folgt. Wir wissen, wie gut Sie das können.« Dann war die Verbindung unterbrochen.
Während er weitertrabte, dachte Kim Park darüber nach, wer zum Teufel wissen konnte, dass er tatsächlich bestens darauf trainiert war, etwaige Verfolger abzuschütteln. Und wieso eigentlich wir?
Shanghai, 2. Mai 2012. 09:25 Uhr
Cathy hatte an ihrem Geburtstag, für den Jeremy und sie sich beide freigenommen hatten, eigentlich in Ruhe ausschlafen wollen. Doch ab etwa sieben hatte sie sich nur noch unruhig auf der Matratze hin und her gewälzt und konnte kein Auge mehr zutun. Als die Standuhr von unten neun schlug, hatte sie endlich beschlossen aufzustehen. Neben ihr lag Jeremy, noch in den Kleidern von gestern, und roch aus dem halbgeöffneten Mund wie ein altes Whiskyfass. Er sah schlecht aus. Mit roten Augen, fast als hätte er geheult. Das gefiel ihr nicht. Seufzend kroch sie aus dem Bett. Sie fühlte sich wie gerädert. Auch wenn von draußen eine strahlende Sonne hereinschien – der Geburtstag fing nicht gut an.
Sie ließ ihn schnarchen, ging angesäuert nach unten, bereitete sich ihren speziellen Morgentee und begab sich mitsamt ihrer Tasse wieder hinauf ins Bad, um zu duschen. Sie war gerade dabei, ihr Gesicht zu pflegen, als Jeremy seinen Kopf zur Badezimmertür hereinstreckte, um ihr nuschelnd »Alles Gute zum Geburtstag« zu wünschen. Bevor sie antworten konnte, hatte er sein unrasiertes Gesicht schon wieder aus dem Türspalt verschwinden lassen, in der Hand Zahnbürste und Mundwasser, die er sich rasch aus dem Regal gegriffen hatte. Sie hörte, wie er, unverständliche gutturale Laute ausstoßend, hinunter in die Küche stapfte, wohl über der Spüle seine Zähne putzte und ausgiebig gurgelte. Später begann die elektrische Saftpresse zu röhren und der Duft frisch aufgegossenen Kaffees zog verführerisch die Treppe hinauf.
Wahrscheinlich traute er sich nicht hoch und wollte sie locken. Gut, dann tat sie ihm eben den Gefallen. Sie stieg die Stufen hinunter und nahm das Glas frisch gepresster Orangensaft, das er ihr verlegen lächelnd an der Tür entgegenstreckte. »Ich habe mir erlaubt, für elf einen Tisch zum Brunch im Westin-Hotel zu reservieren«, sagte er schnell. »Ein kleines Champagnerfrühstück. Wenn dir nicht danach ist, kein Problem. Wir können es uns auch hier gemütlich machen, Liebling.«
Liebling?
»Tut mir leid wegen gestern Abend, da lief einiges – etwas unglücklich.«
Konnte man so sagen.
»Chen nehme ich auf meine Kappe«, hörte sie sich murmeln.
»Meinetwegen, aber lass mich trotzdem versuchen, es wiedergutzumachen. Ich will dir auch alles erklären. – Was hältst du vom ›M on the Bund‹, heute Abend?«
Die angesagteste Adresse der Stadt. Internationale Spitzengastronomie. »Hört sich ganz gut an«, versetzte sie spitz, »wie hast du es geschafft, dort einen Tisch zu bekommen?« Er zuckte die Schultern. »Das lass ruhig meine Sache sein. Jetzt erst mal ausgiebig im Westin-Hotel frühstücken und danach machen wir einen Ausflug rüber nach Chungxing. Ein wenig Bewegung an frischer Luft wird uns guttun. Und wir haben ausgiebig Zeit, uns zu unterhalten.«
»Wenn du meinst.«
»Ich hab dir heut auch was Wichtiges zu sagen.«
»Ich bin gespannt.«
Jeremy, der ihre letzten sechs Wörter als uneingeschränkte Zustimmung zu seinem Tagesprogramm interpretierte, drückte ihr erleichtert einen dicken Schmatz auf die Wange, sprang polternd die Treppe empor, riss sich die Kleider vom Leib und hüpfte mannhaft unter die Dusche, wo er juchzend unter dem kalten Wasserstrahl zu zappeln begann.
Cathy blieb stehen und nippte gedankenvoll an ihrem Saftglas.
Ich hab dir heut auch was Wichtiges zu sagen.
Hatte sie das I Ging-Orakel, das sie sich am gestrigen Nachmittag gelegt hatte, doch richtig interpretiert? Hong, das 32. Hexagramm: Die Dauer. Beharrliche Dauer im Hafen der Ehe – das war es, was sie sich von Jeremy seit langem wünschte. Und auch erwartete.
Hong: Die Dauer. Oben ›Dschen‹, das Erregende, der Donner; unten ›Sun‹, das Sanfte, der Wind. Das Urteil: Gelingen. Kein Makel. Fördernd ist Beharrlichkeit. Fördernd ist, zu haben, wohin man gehe.
Wohin ging sie? Gespannt hatte sie weitergelesen: Donner und Wind: das Bild der Dauer. Ein seltsames Bild für den Hafen der Ehe, dachte sie – wenn auch für viele Paare womöglich ein realistisches. Trotzdem war sie entschlossen gewesen, den Orakelspruch als gutes Omen für eine bald bevorstehende Eheschließung – und die Einkehr von Dauer in ihr Leben – zu nehmen. So weit der Stand von gestern. War sie heute noch genauso entschlossen? Sie war sich nicht sicher.
Während Jeremy duschte, nahm sie sich noch einmal ihre amerikanische Ausgabe des I Ging vor und blätterte im Kommentarteil. Seinem Charakter Dauer geben durch Beharrlichkeit, das ist für eine Frau von Heil, für einen Mann von Unheil. Eine Frau soll ihr ganzes Leben einem Manne folgen, der Mann aber soll sich an das halten, was jeweils seine Pflicht ist; wenn er sich dauernd nach der Frau richten wollte, so wäre das für ihn ein Fehler.
Sie schlug das Buch so energisch zu, dass es staubte. Was kümmerten sie über 2000 Jahre alte Orakeltexte! Sie wusste schon, was gut für sie war. Und für Jeremy sowieso. Sie würde sich schon holen, was sie wollte.
Shanghai, 2. Mai 2012. 10:45 Uhr
Der Raum war rechteckig und wurde ausschließlich von diversen Lichtinstallationen erleuchtet. Nichts dämpfte die ohrenbetäubende Technomusik, die ihm schon beim Hereinkommen schmerzhaft ins Ohr gejagt war. Er hatte einige Zeit gebraucht, um sich an das diffuse Licht zu gewöhnen und sich umblicken zu können: Frauen mit knallroten Lippen, glänzend porzellanener Haut, wallendem pechschwarzem Haar und seltsam leeren weißen Augen, die fast pupillenlos waren. Da war nichts Lebendiges, keine Wärme, Tiefe und Persönlichkeit in diesen Gesichtern, nur blanke Oberfläche und starrende Kälte. Ein einziges Mal war er wie gebannt für einen Moment stehen geblieben: Das eisige Gesicht, das ihm blicklos aus der Leinwand entgegensah, erinnerte ihn auf unheimliche Weise an Cathy.
Nein – auch wenn Kim Park schon den einen oder anderen prominenten Künstler, der gerade nicht unter Hausarrest stand oder im Gefängnis saß, in seiner Sendung zu Gast gehabt hatte –, mit moderner chinesischer Kunst konnte er im Grunde nichts anfangen. So war es auch kein Wunder, dass er fast auf eine Installation aus ineinander verschlungenen Neonröhren getreten wäre, die sich in alle Richtungen über den betonierten Fußboden des Ausstellungsraums schlängelten. »Vorsicht, Mann!«, schrie ihm eine zierliche, grell geschminkte Chinesin ins Ohr, die ein neonfarbenes Lackkostüm trug, passend zu den gelb-rosa leuchtenden Regenwürmern auf Eroberungszug, die Kim beinahe unter seinen englischen Loafers zertreten hätte. Eine für den großen Feng Zhengjie eher untypische Arbeit: Die leuchtenden Würmer quollen aus einem komplexen Arrangement aus schwarzen und roten Fiberglasskulpturen an der Rückwand des Raumes, die zusammen die Umrisse eines menschlichen Schädels nachzeichneten – eine Allegorie auf den Kreislauf von Leben und Tod, in der einige Kritiker auch verborgene politische Implikationen zu erkennen glaubten.
In den Wänden entdeckte Kim mehrere mit kleinen Halogenleuchten versehene Durchbrüche, hinter denen sich schmale Gänge auftaten, durch die man vermutlich zu weiteren Ausstellungsräumen gelangen konnte. Es wimmelte von Frauen, doch die geheimnisvolle Agentin konnte er nirgendwo finden. Alle sahen sie gleich aus. Kaum eine war über 30. Sie trugen Miniröcke, zumeist mit kniehohen Stiefeln, und hatten ungezähmte, kreischend bunte Frisuren. Kim erschienen sie kaum lebendiger als die grellen Porträts an den Wänden. Er biss sich auf die Unterlippe. Er hasste es, wenn ihm andere einschärften, pünktlich zu sein – das war er immer –, und dann selbst zu spät kamen. Sollte er wieder gehen?
In diesem Moment tippte ihn jemand von hinten an die Schulter. Kim fuhr herum. Ja, das war sie, auch wenn sie ihre Haarfarbe inzwischen geändert hatte und eine knallrot eingefasste Sonnenbrille trug, die ihr halbes Gesicht verdeckte. Kim nickte ihr zu. Wortlos bedeutete sie ihm, ihr zu folgen. Die Agentin führte ihn durch einen der Durchbrüche in ein Séparée, das am Ende eines schneckenförmigen Gangs lag. Der kreisrunde Raum maß höchstens drei Meter im Durchmesser. Eine Installation aus elektrischen Insektenfallen an der Decke verbreitete ein bläuliches, schummriges Licht. Eine runde Ledercouch zog sich um den Raum herum. »Nehmen Sie bitte Platz, Kim«, sagte die Agentin, entledigte sich ihrer Sonnenbrille und blickte ihn aus ihren großen, warmen Augen an, die ihn schon bei ihrer ersten Begegnung so beeindruckt hatten. »Entschuldigen Sie bitte die Umstände, aber …« Da war sie wieder, die tiefe, sinnliche Stimme.
Kim setzte sich. Die Agentin nahm ihm gegenüber Platz und stellte ihre große Einkaufstasche – einen teuren Prada Shopper – neben sich auf die Couch. Ihre Knie berührten sich leicht. Die dicken Betonwände dämpften die Bässe der nervtötenden Technomusik auf ein erträgliches Minimum.
»Sie haben wahrscheinlich einige Fragen, Kim?«
»Ich hätte viele Fragen.«
»Dann fragen Sie.«
»Wer sind Sie wirklich? Name, Adresse, Telefonnummer?«
»Nennen Sie mich Lan Liang. Das kann vorerst genügen. Wir müssen noch immer etwas vorsichtig sein.« Kim warf ihr einen misstrauischen Blick zu, begnügte sich aber vorerst mit der Antwort. Schließlich hatte er noch wichtigere Fragen. Also weiter. »Wer ist wir? Warum gerade ich? Wer ist dieser ominöse Julian Peek?«
»Die zweite dieser Fragen möchte ich zuerst beantworten, wenn Sie nichts dagegen haben: Warum Sie? Nun, weil wir zu der Überzeugung gelangt sind, dass Sie der geeignete Produzent für diesen Film wären – genau der richtige Mann.«
»Wie kommen Sie auf so was? Ich produziere Werbefilme, keine Kinothriller.«
»Sie sind ein smarter Typ, Kim. Sie genießen in der Branche einen guten Ruf. Und Sie kennen sich hervorragend mit U-Booten aus. Nicht nur theoretisch oder nur als Liebhaber … Außerdem haben Sie schon einmal bewiesen, dass Sie den Mut haben, auch unbequeme Themen anzupacken.«
»Was meinen Sie?« Kim musste sich anstrengen, sich seine Überraschung nicht anmerken zu lassen. Offenbar hatte man ihn nach allen Regeln der Kunst ausspioniert. Was ihn beunruhigte – andererseits fühlte er sich dadurch auch wieder fast geehrt.
»Wer hat denn damals in Japan den Film Itai Itai produziert, Kim?«
»Woher wissen Sie davon?«
»Woher wir das wissen, tut nichts zur Sache.«
Kim schüttelte den Kopf. Diesen dreißigminütigen Dokumentarfilm über die berüchtigte Itai-Itai-Krankheit, der in der Präfektur Toyama auf der Hauptinsel Honshu zahlreiche Menschen, darunter viele Kinder, auf grausame Weise zum Opfer gefallen waren, hatte er vor über acht Jahren in Eigenregie geschrieben, gedreht, geschnitten und produziert. Direkt im Anschluss an sein Studium an der Tokioter Nihon-Universität, als er nach seiner Freilassung wieder nach Japan gegangen war und sein zweites Leben begann. Itai Itai heißt nichts anderes als »Aua, aua«: Die durch eine schleichende Cadmiumvergiftung hervorgerufene Krankheit verursacht beim Betroffenen bestialische Schmerzen, Nierenschäden und eine Verformung des Skeletts. Skrupellose Bergbauunternehmen hatten das hochgiftige Schwermetall jahrelang in einen Fluss eingeleitet, aus dem Tausende von Familien ihr Trinkwasser bezogen. Wie so oft waren die juristischen Schritte und Ermittlungen weitestgehend im Sande verlaufen – und natürlich konnte Kims dokumentarischer Erstling in Japan bis heute nicht gezeigt werden.
»Und ich dachte, mir wäre es wohl oder übel gelungen, als Skandalfilmer genauso unbekannt zu bleiben wie dieser Julian Peek«, lächelte Kim Park. »Itai Itai war in der Tat mein erster Film, aber er passt längst nicht mehr in mein Portfolio. Sie wissen vielleicht, dass ein nicht unbeträchtlicher Teil meiner Kunden aus Japan stammt.«
»Wir werden auch nicht mehr über Itai Itai reden. Einverstanden?« Kim nickte. »Allerdings: Wenn Sie für uns Yellow Submarine produzieren, können Sie Ihre japanischen Kunden garantiert ebenfalls vergessen. Natürlich würden Sie dann aber auch in einer ganz anderen Liga spielen. Dann blicken Sie mehr Richtung Hollywood als Richtung Tokio, Mr. Park.«
Hollywood? Klang wie ein billiger Köder. Man wollte ihn offenbar auf den Leim locken. Und noch immer waren zwei seiner Fragen unbeantwortet. »Wer ist wir?«, wiederholte er.
Mit einer lässigen Bewegung zog sie aus ihrer Luxuseinkaufstasche eine rote Mappe und legte sie zwischen Kim und sich auf die Couch. Die Mappe war wesentlich dicker als der Schnellhefter, der seit einigen Tagen in der obersten Schublade seines Lackschränkchens lag.
»Mein Auftraggeber hat großes Interesse daran, dass dieser Film öffentlich gezeigt wird«, sagte sie, ohne direkt auf seine Frage einzugehen. »Der Film wäre, wie soll ich es erklären, ein Teil seines Lebenswerks. Sie mögen die Japaner doch auch nicht, Kim. Oder?«
»Dazu möchte ich mich hier nicht äußern«, entgegnete er hart.
»Ich verstehe. Als Japan-Koreaner haben Sie eine andere Bindung zum Reich der aufgehenden Sonne.«
»Was wissen Sie schon darüber.«
»Oh, Kim, so ziemlich alles. Ich vertrete eine mächtige Organisation. Das ist auch gut so, denn unsere Gegner sind ebenfalls sehr mächtig.« Kim Park sprang auf. »Ich glaube, mir reicht es jetzt. Ich bin Filmproduzent und kein Geheimagent auf einer neuen Mission Impossible. Suchen Sie sich Ihren James Bond woanders.«
»Setzen Sie sich, Kim. Bitte.« Er gehorchte.
»Sie werden meinen Auftraggeber sicher bald kennenlernen. Ein ehrenwerter und sehr großzügiger, vielbeschäftigter Mann, der nicht gern an die Öffentlichkeit tritt.«
»Ist er aus der Filmbranche?«
»Nein«, lächelte Lan Liang, »ich möchte es so ausdrücken: Er dreht ein großes Rad.«
»Julian Peek?«, schoss Kim ins Blaue. Diese Frage war schließlich auch noch offen. Sie blinkerte ihn etwas mitleidig, doch umso herzerwärmender an. »Ach, kommen Sie, Kim. Wir hätten eigentlich gedacht, dass Sie eins und eins längst zusammenzählen können. Na ja, lesen Sie erst einmal weiter … Oder wollen Sie wirklich aussteigen? Haben Sie Angst? Damals auf der ›Chung-Loo‹ waren Sie doch auch nicht so feige.«
Kim zuckte zusammen. Was wussten die über jene schrecklichen Ereignisse, die ihn körperlich und seelisch versehrt hatten? Sie hielt ihm mit ihrem verführerischen Lächeln die rote Mappe hin wie die Dompteuse einem dressierten Sibirischen Tiger ein Stück rohes Fleisch. »Bei uns kämpfen Sie auf der richtigen Seite, Kim«, fügte sie ernst hinzu. Er nahm die Mappe.
»Das Drehbuch wird allerdings bald noch einiger gründlicher Überarbeitungen bedürfen, Kim. Nach den Ereignissen. Als unser Autor vor ein paar Jahren die Erstfassung schrieb, kam er der Wahrheit schon ziemlich nahe, doch musste er sich zum Teil noch in recht wilden Spekulationen ergehen. Aber jetzt tauchen neue Informationen auf – äußerst kompromittierende Informationen. Äußerst beängstigende Informationen. Der Film wird am Ende die Geschichte eines Verbrechens erzählen, das noch immer nicht aufgearbeitet, ja noch immer nicht beendet ist. Ein Verbrechen, dessen Folgen die Menschheit noch heute fürchten muss – ja, die sie vernichten könnten.«
»Ach?« Ging es nicht auch eine Stufe kleiner? Es war Zeit, da ein wenig die Luft rauszulassen. »Wissen Sie, bisher dachte ich, es geht um eine ganz banale Liebesgeschichte …« Lan Liang durchbohrte ihn mit ihrem Blick. »Kommen Sie, Kim, hier ist kein Ort für Scherze. Die endgültige Fassung von Yellow Submarine wird die Dinge beim Namen nennen. Und es werden Namen fallen, die in der heutigen Gesellschaft eine bedeutende Rolle spielen. Glauben Sie mir, Kim, es gibt in Japan – und wohl selbst in den USA – Personen, die absolut kein Interesse daran haben, dass dieser Film produziert wird. Und die alles tun werden, um seine Produktion zu verhindern. Alles.«
»Kunst ist Provokation. Filmkunst auch«, erwiderte Kim Park. »Und sie ist frei. Sie muss frei sein.«
»In diesem Fall«, antwortete die Frau, die sich Lan Liang nannte, »könnte es für den Provokateur allerdings ungemütlich werden. Damit müssen Sie rechnen, wenn Sie annehmen. Und von frei zu vogelfrei ist es oft nur ein kleiner Schritt.« Sie blickte Kim fast bekümmert an. Doch dann erschien wieder ihr unwiderstehliches Lächeln.
»Aber lesen Sie erst einmal das Manuskript. Und dann entscheiden Sie sich. Wenn Sie nach der Lektüre noch immer der Meinung sind, es handele sich bloß um eine sentimentale Liebesgeschichte zwischen einer Japanerin und einem Butterstinker, dann werden wir uns eben nach einem anderen Produzenten umsehen. Okay?« Kim Park nickte. Dabei umklammerte er das Drehbuch wie einen kostbaren Schatz.
»Rufen Sie mich an, Kim? Sie haben ja jetzt die Nummer in Ihrem Cellphone.«
»Es wird mir ein Vergnügen sein«, antwortete Kim und ließ seinen Blick auf ihr ruhen.
Kyoto, 20. November 1998. Nachmittag
Seitdem er sein Bilderbuchleben als Dozent für Zivilprozessrecht an der Kaiserlichen Universität von Kyoto aufgegeben und seine Karriere bei Lexman & Lexman in Tokio angetreten hatte, sahen sie sich von Monat zu Monat seltener. Anfangs hatten sie es, dem Shinkansen sei Dank, geschafft, sich mindestens jedes Wochenende zu treffen. Manchmal gar zwei- oder dreimal die Woche. Aber zunehmend holten Jeremy die unvorhergesehen hohen Belastungen – und die Misserfolge – seiner Arbeit ein. Als das Frühjahr kam und wieder die Kirschen blühten, hatte er nicht einmal mehr Zeit, die Liebe seines Lebens zu vermissen, geschweige denn um in lauschigen Bars Sakura! Sakura!-Gesänge anzustimmen. Die langen Telefonate, die sie in den ersten Wochen und Monaten beinahe jede Nacht miteinander geführt hatten, hatte Jeremy inzwischen stark eingeschränkt. Yukiko war zu rücksichtsvoll, von sich aus anzurufen. Sie hätte ihn sowieso praktisch nur in der Kanzlei erreichen können, am Schreibtisch, wo er mittlerweile 250 Monatsstunden und mehr mit der Schadensersatzklage gegen den japanischen Pharmariesen Kuroi-Juchi K.K. beschäftigt war.
Anfangs, so hatte ihm Richard Koo erzählt, hatte alles nach einem eher unkomplizierten Fall ausgesehen, obwohl es immerhin um die stolze Summe von 100 Millionen Dollar ging, die Kuroi Inc., die US-Tochter der Kuroi-Juchi K.K., an insgesamt 244 Geschädigte auszahlen sollte. Diese Summe hatte Richard gemeinsam mit seinen amerikanischen Kollegen von Lexman & Lexman in Los Angeles vor dem County Court of California erstritten. Der Prozess vor dem US-Gericht hatte nur acht Monate gedauert – die Faktenlage war eindeutig. Die Kläger konnten lückenlos beweisen, dass die Kuroi Inc. mit dem Grippeimpfstoff »Virovital« bewusst ein fehlerhaftes Medikament mit gefährlichen und zum Teil sogar tödlichen Nebenwirkungen auf den Markt gebracht hatte. Nach den ersten Todesfällen war der Verdacht schnell auf Virovital gefallen, doch die Kuroi Inc. hatte keine Veranlassung gesehen, das Medikament vom Markt zu nehmen und die Verbraucher zu schützen. Im Gegenteil: Informationen waren unterschlagen oder manipuliert worden; Unterlagen zu potenziell belastenden klinischen Testergebnissen waren plötzlich spurlos verschwunden oder offenkundig vernichtet. Allerdings hatte das skrupellose Pharmaunternehmen dann doch nicht sorgfältig genug gearbeitet, um die akribischen und hartnäckigen Anwälte von Lexman & Lexman sowie die von der Kanzlei eigens für diesen Fall engagierten Privatdetektive hinters Licht zu führen, und so waren den Klägern schließlich Teile eines geheim gehaltenen Dossiers in die Hände gefallen, das die Schuld von Kuroi zweifelsfrei bewies. Doch als es dann um die Vollstreckung des Titels ging, war die Kuroi Inc. auf wundersame Weise über Nacht insolvent geworden, und die Geschädigten gingen leer aus.
Doch Lexman & Lexman gaben sich noch nicht geschlagen. Nach diesem ersten Rückschlag – das war Anfang 1997 – hatte das Executive Committee der Großkanzlei entschieden, das Team um Richard Koo aufgrund »seiner guten Beziehungen zum japanischen Establishment« beurteilen zu lassen, ob und wie man jetzt gegen die japanische Muttergesellschaft vorgehen könne. Damals hatte man begonnen, sich auch eingehender über die japanische Kuroi K.K. und ihre Geschichte zu informieren und nach möglicherweise belastendem Material zu forschen. Zu diesem Zweck hatte Richard Koo Ende Mai Jeremy mit ins Boot geholt. Nach und nach – und schneller als ursprünglich beabsichtigt – hatte Koo ihn mit den verzwickten Einzelheiten der Angelegenheit vertraut gemacht, so dass Jeremy, als er im November nach Tokio kam, sofort in medias res gehen konnte. Der ohnehin überlastete Koo gab ihm gern einen Teil seiner Kompetenzen nach dem anderen ab, bis das Kuroi-Verfahren letztendlich zu seinem Prozess geworden war.
Um nun gegen die japanische Muttergesellschaft vorzugehen, gab es im Wesentlichen zwei Möglichkeiten: Jeremy und Koo konnten versuchen, den Titel gegen die insolvente Tochter auf den Mutterkonzern umschreiben und die 100 Millionen Dollar in Japan vollstrecken zu lassen. Die wesentlich aufwendigere Variante hieß, einen neuen Prozess gegen die Kuroi K.K. in Japan anzustrengen. Dafür hätten nicht nur alle Beweise neu aufbereitet werden, sondern der Kläger hätte auch nachweisen müssen, dass die amerikanische Tochtergesellschaft auf Weisung, zumindest aber mit Billigung der Muttergesellschaft gegen die Arzneimittelgesetze verstoßen hatte.
Jeremy hatte für die erste Variante plädiert. Japan hatte erst kurz zuvor ein Produkthaftungsgesetz nach westlichem Vorbild eingeführt. Ausgerechnet Richard Koo und sein Team waren vom MITI, dem allmächtigen Ministerium für Internationalen Handel und Industrie, zu einer Expertengruppe hinzugezogen worden, die sich mit einer Analyse des Gesetzestextes und verschiedenen Änderungsanträgen befasste. Ein Richter am Obersten Gerichtshof hatte sich in dieser Sache mit dem hoch angesehenen Professor Takeda von der Universität Kyoto heftig zerstritten. Im Gegensatz zum Professor hatte der Richter die analoge Anwendung des neuen Gesetzes verfochten und auf den Boeing-Fall hingewiesen: Durch den Absturz eines amerikanischen Jumbos waren am 12. August 1985 in der Nähe von Osaka 520 der 524 Passagiere ums Leben gekommen. Ein vom Hersteller fehlerhaft repariertes Druckschott im Heck hatte zu der Katastrophe geführt. Daraufhin war Boeing in Japan verklagt und zur Zahlung von Schadenersatz verurteilt worden. Der fällige Titel war in den USA direkt vollstreckt worden. Der Richter hatte hinzugefügt: »Natürlich gibt es noch keinen Präzedenzfall, aber wenn ein ähnlicher Fall in Japan anhängig gemacht würde, müsste man einem ausländischen Kläger schon aus Billigkeit die gleichen Rechte zugestehen.«
Dergestalt ermutigt hatten Jeremy und Koo Klage eingereicht und waren nach der erwarteten Niederlage in der ersten Instanz durch eine Sprungrevision beim Obersten Gerichtshof gelandet. Das Schicksal hatte es sogar gewollt, dass sie in der Verhandlung ausgerechnet auf jenen Richter trafen, den sie bereits aus der Expertengruppe kannten. Dann war Jeremy aus allen Wolken gefallen: Mangels Präzedenzfällen wurde der Klageantrag abgelehnt und es wurden keine weiteren Rechtsmittel zugelassen. Dabei hatte derselbe Mann wenige Monate zuvor noch die komplett gegenteilige Haltung vertreten.
Das war Ende August 98 gewesen, und seitdem hatten Yukiko und Jeremy praktisch nur noch über seinen Fall gesprochen, wenn sie sich trafen. Seine Beförderung zum Partner bei Lexman & Lexman stand auf dem Spiel. Er musste diese Sache erfolgreich zum Abschluss bringen. Blieb also nur noch der Versuch, den zweiten, aufwendigeren Weg zu gehen und einen neuen Prozess anzustrengen. Doch dazu bedurfte es vor allem auch neuer Beweise
Yukiko, die, selbst Juristin, noch immer zwischen Promotion und Praktikum rotierte, wusste, dass dies der Preis war, den sie beide für den Erfolg zahlen mussten. So versuchte sie sich einzureden, dass es sich lediglich um eine Prüfung handelte, die ihnen vielleicht von ihrer Schutzgöttin Amaterasu auferlegt worden war und die ihre gegenseitige Zuneigung in Zukunft nur verstärken würde.
Als sie ihn an diesem Freitagnachmittag vom Bahnhof abholte, hatte Jeremy furchtbar ausgesehen. Sein Gesicht war grau und eingefallen. Drei Wochen waren seit ihrem letzten Treffen vergangen. »Ich glaube, ein wenig frische Luft wird dir guttun«, sagte Yukiko. »Du siehst schlecht aus, Liebster.«
Yukiko entschied, mit Jeremy durch die Palastgärten des Kyoto Gosho zu wandeln. Vierzig Minuten später standen sie vor dem verschlossenen Haupttor an der Südseite des kaiserlichen Palasts, das zu beiden Seiten von heiligen Bäumen gesäumt wird: links eine Kirsche, rechts ein Tachibana-Baum. Während sie durch die ganzjährig geöffneten Parkanlagen schlenderten, hatten sie kaum ein Wort miteinander gewechselt. Es war nun klar, dass er den letzten Shinkansen zurück nach Tokio nehmen wollte – obwohl doch eigentlich das Wochenende noch vor ihnen lag. Yukiko hatte schon bei seiner Ankunft bemerkt, dass er ohne Gepäck angereist war.
Kurz darauf standen sie nebeneinander auf einer schmalen Steinbrücke und blickten hinab auf die spiegelnde Oberfläche des kunstvoll angelegten kaiserlichen Gartenteichs. Jeremy zog eine zerknitterte Schachtel Mild Seven aus der Manteltasche und zündete sich eine Zigarette an. »Wenigstens rauchst du eine japanische Marke«, scherzte Yukiko tapfer, die Geruch und Geschmack von Tabakrauch nicht ertragen konnte. »Wann hast du damit angefangen?«
Jeremy zuckte die Schultern und nahm einen tiefen Zug. »Ich weiß nicht«, antwortete er, unvermittelt ins Japanische wechselnd. »Die Tage und Nächte verschwimmen. Es ist alles die eine gleiche, endlose Tretmühle. Eine Sisyphusarbeit. Es kommt mir vor wie ein ewiges Anrennen im Hamsterrad.«
In diesem Moment bemerkte Yukiko, wie große Fortschritte Jeremys Japanisch gemacht hatte. Untereinander hatten sie bisher fast immer nur Englisch gesprochen. Komisch, dachte sie, eigentlich sollte uns sein gutes Japanisch enger zusammenbringen. Tatsächlich fühlte sie sich ihm fremd, wenn er Japanisch sprach. Hatten Sie sich inzwischen wirklich so aus den Augen verloren? »Kommst du voran?«, versuchte sie, das stockende Gespräch zu beleben.
»Nein. Aber …« Jeremy räusperte sich. Sie sollte nicht glauben, dass sein Prozess ihm wichtiger war als ihre Beziehung. Schließlich wollte er das selber nicht glauben. Nicht glauben, dass er im Begriff stand, einen Schritt zu tun, den er doch eigentlich nicht mehr hatte tun wollen, seit ihm diese Augen das erste Mal entgegengestrahlt hatten. Nicht glauben, dass er beschlossen hatte, seine alte Abmachung mit Richard Koo aufzukündigen. Nicht glauben, dass er ausschließlich deshalb nach Kyoto gekommen war. »Yukiko, ich brauch deine Hilfe«, platzte es dennoch aus ihm heraus.
»Wie kann ich dir helfen, Liebster?« Sie rückte näher an ihn heran und legte ihre Hand auf seinen Arm.
»Hast du schon mal etwas von einer Einheit 731 gehört?«
»Einheit 731? Was soll das sein? Ist das denn wichtig?«
»Ob das wichtig ist?« Jeremy lachte leise auf. »Dutzende Kinder müssen ohne Eltern aufwachsen, nur weil ein solcher Schweinekonzern wie Kuroi-Juchi ein lebensgefährliches Medikament viel zu spät vom Markt genommen hat. Aus Profitgier? Oder etwa aus Scham, weil man in eurer japanischen ›Kultur der Schande‹ alles verlieren darf, nur nicht sein Gesicht?«
»Jeremy«, sagte Yukiko sanft, »bitte beruhige dich. Ich frage dich doch nur, was diese militärische Einheit – oder was auch immer das ist – mit deinem Kuroi-Prozess zu tun hat. Bevor du dich weiter verrennst, erzähl mir erst einmal, was es auf sich hat mit dieser ominösen Einheit 731. Wenn ich dir helfen soll, muss ich das wissen.«
»Natürlich, entschuldige. Eigentlich wollte ich dich da nicht mit hineinziehen.« Kaum ausgesprochen, schämte sich Jeremy schon für seinen Satz. So könnte auch ein Ertrinkender sprechen, der gerade von Strudeln in die Tiefe gezogen wird und einer zufällig am Ufer Stehenden verzweifelt seine Hand entgegenstreckt. Entschuldige, eigentlich wollte ich dich da nicht mit hineinziehen. Aber ich gehe das Risiko ein, dass du jetzt mit mir zusammen ersäufst.
»Jetzt tu nicht so geheimnisvoll«, lächelte sie.
Jeremy zuckte wieder die Schultern, trat seine Kippe aus und zündete eine neue an. Yukiko sagte nichts. Nach ein paar Zügen wandte er sich ihr zu, nun ruhiger: »Okay, also ich bin da auf eine sonderbare Sache gestoßen. Seit langem habe ich alles zur Unternehmensgeschichte von Kuroi zusammengetragen, was ich finden konnte. Ich – das heißt, ursprünglich war es Richard Koo – hatte die Idee, dass die Lösung unseres Problems vielleicht in der Vergangenheit von Kuroi liegen könnte. Hast du schon mal von einem Doktor Tadashi Ishii gehört?« Yukiko schüttelte den Kopf.
»Tadashi Ishii war ein Verwandter von Shiro Ishii, dem Leiter der Einheit 731 – einer geheimen japanischen Militäreinrichtung zur Biowaffenforschung in den Jahren des Zweiten Weltkriegs. Wie er war er Arzt. Direkt nach dem Krieg hat Tadashi dann zusammen mit drei Kompagnons Kuroi gegründet; von 1946 bis zu seinem Tod war er Vorstand des Unternehmens. Seine beiden Söhne haben dort heute noch wichtige Posten inne. Jetzt kommt’s: Tadashi Ishii hatte am Chinafeldzug teilgenommen, offiziell als Spezialist für Infektionskrankheiten innerhalb der ›Abteilung für Seuchenprävention und Wasserreinigung‹, so einer der gängigen Tarnnamen für Einheit 731 und ihre Dependancen. Von 1937 bis 1945 war er in Nanking und anderen chinesischen Städten und hat angeblich geforscht. Jedenfalls hat er ausgerechnet in jener schrecklichen Zeit bahnbrechende Erkenntnisse über die künstliche Verbreitung von Bacillus anthracis gewinnen können.«
»Dem Milzbranderreger?«
»Genau. Darüber hinaus hat er auch bei der Schmerzbekämpfung verblüffende Erfolge erzielt, etwa durch die Verabreichung von Strychnin. Und er hat mit Grippeviren geforscht. Offenbar gelang es ihm und seinem engsten Mitarbeiter, besonders aggressive Erregerstämme zu isolieren, die zur massenhaften Züchtung im Rahmen des sogenannten »Seuchenpräventions»-Programms vorgesehen waren – wer einmal Orwell gelesen hat, weiß, wie er solche Bezeichnungen zu lesen hat. Parallel arbeitete Ishii zugleich an besonderen Impfstoffen gegen diese Supermikroben. Es bestand nämlich damals wie heute das große Problem, dass man Viren und Bakterien, anders als etwa Hunden, nicht einfach vorschreiben kann, wen sie attackieren sollen und wen nicht. Und so geschah es in den Laboren und auf den Schlachtfeldern immer wieder, dass sie sich sozusagen gegen ihre ›Halter‹ wandten. Auch hier mit verheerenden Folgen. Daher brauchte man Medikamente und Impfstoffe. Für jedes Gift ein Gegengift. Tadashi Ishii verkündete in einem wissenschaftlichen Aufsatz, in Sachen Impfstoff unmittelbar vor einem bahnbrechenden Durchbruch zu stehen, doch dazu müssten zunächst weitere Experimente durchgeführt werden.«
»Weitere Experimente? Welcher Art?«, fragte Yukiko, von einer düsteren Vorahnung beschlichen. »Experimente mit Tieren?«
»Mit mandschurischen Affen, hieß es. Die seien am menschenähnlichsten.«
»Gibt es in der Mandschurei denn Affen? Da ist es doch viel zu kalt!«
»Nicht dass ich wüsste, Yukiko.« Beide schwiegen einen Moment. Jeremy fuhr fort: »Das dürfte Ishii und Co. auch ziemlich egal gewesen sein. Nach allem, was wir von den Gräueltaten der Japaner in China wissen, hatten sie jedenfalls keine Scheu …«
»Du spielst auf die Massaker in Nanking an, Jeremy«, unterbrach ihn Yukiko ernst, »und du weißt, dass du dir mit der Erwähnung dieser Stadt in Japan keine Freunde erwirbst.«
»In dieser Stadt erwirbst du dir mit der Erwähnung von Japan noch weniger Freunde, Yukiko. Wie auch immer: Ich glaube, dass eines dieser uralten Mittel aus Kriegszeiten in neuer Form auf den Markt gebracht wurde: als Virovital.« Jeremy wirkte grimmig und entschlossen, als er dies sagte.
»Aber was ist nun mit dieser Einheit 731?«, hakte Yukiko nach. »Und was hat sie konkret mit deinem Fall zu tun?«
»Das eben möchte ich herausfinden. Die anderen drei Gründungsmitglieder von Kuroi sollen ebenfalls dieser Einheit angehört haben. Außerdem haben sie nach dem Krieg alle gemeinsam im Sugamo-Gefängnis gesessen, zusammen mit jenen sieben ›Klasse-A‹-Kriegsverbrechern, die 1948 hingerichtet wurden. Aber kurz bevor auch ihnen der Prozess gemacht werden sollte, hat man diese japanische Viererbande unter dubiosen Umständen freigelassen. Und die US-Militärverwaltung unter General McArthur ist nicht eingeschritten.« Jeremy knetete sich mit finsterer Miene das Kinn. »Auf jeden Fall scheint die Einheit 731 in der Vorgeschichte der Kuroi-Sache eine zentrale Rolle zu spielen. Aber gerade hierzu gibt es so gut wie nichts in den Archiven. Zumindest rückt da niemand was raus.«
Jeremy fixierte seine Freundin mit ernstem Blick und fuhr fort: »Man erzählt sich die schlimmsten Dinge über diese Einheit, Yukiko. Menschenversuche. Experimente mit Medikamenten und Biowaffen. Biowaffen als Medikamente. Medikamente als Biowaffen. Der Arzt vom Lebensretter zum Todesengel pervertiert. Frauen, Kinder, Säuglinge, dahingemetzelt wie die Labormäuse. Ich habe an Literatur darüber gelesen, was ich auftreiben konnte; aber es gibt nicht allzu viel, und nur sehr wenig auf Japanisch. Und es gab überhaupt nur einen einzigen Prozess gegen Mitglieder dieser Einheit. In Chabarowsk, in der Sowjetunion, 1949, kurz nach dem Krieg. Aber er wurde offensichtlich von der sowjetischen Propaganda instrumentalisiert und, wie zu erwarten, haben Japaner und Amerikaner die ganze unvorstellbare Geschichte immer als russisches Gräuelmärchen abgetan. Ist ja schließlich für den gesunden Menschenverstand auch viel zu haarsträubend, um es zu glauben. So wie es in Deutschland noch heute Leute gibt, die behaupten, der Holocaust sei eine Erfindung der Amis. Aber dort werden diese Leute bestraft. Diese Einheit 731 war genauso real wie der Holocaust, Yukiko. Ich muss die letzten Zeitzeugen finden.«
»Wenn es diese widerwärtigen Untiere, von denen du da erzählst, je gegeben hat und wenn sie ihre gerechte Strafe nie gefunden haben und einige der Massenmörder vielleicht sogar heute noch leben und frei herumlaufen – was ich alles bezweifele –, dann werden sie die Mördergrube ihres Herzens sicher nicht gerade vor dir öffnen, Jeremy.« Sie sah ihn kopfschüttelnd an. »Außerdem – wie soll denn gerade ich dir bei deiner Suche helfen können, lieber Jeremy?«
»Yukiko …« Schon wieder musterte er sie mit diesem ernsten, fast bekümmerten Blick. »Es gibt ernstzunehmende Hinweise darauf, dass auch dein Vater ein Mitglied der Einheit 731 war.«
Dass es genau das war, was sie zusammengeführt hatte, sagte er ihr nicht. Sie litt so schon genug.
Shanghai, 2. Mai 2012. 17:25 Uhr
Noch immer saß Kim Park, in die Lektüre der roten Mappe vertieft, auf seiner Dachterrasse. Lan Liang hatte wahrlich nicht zu viel versprochen. Yellow Submarine war wirklich der couragierte Versuch einer Aufarbeitung der japanischen Vergangenheit, der den Finger auf offene Wunden legte. Der Mann hinter dem Pseudonym Julian Peek hatte sich mit der japanischen Mentalität ebenso intensiv wie kritisch auseinandergesetzt. Schnell schon zeichnete sich ab, dass die in den ersten Szenen entfaltete Beziehung zwischen dem jungen britischen Anwalt und der Tochter eines rechtsnationalen, kaisertreuen Militärattachés mit undurchsichtiger Vergangenheit zum Scheitern verurteilt war: Der alte Mann konnte es nicht zulassen, dass ausgerechnet seine Tochter diesem hergelaufenen Gaijin dabei half, nach wie vor ungesühnte japanische Kriegsverbrechen aufzudecken und damit an die Interessen jener mächtigen Instanzen zu rühren, die noch immer Wohl und Wehe im Land bestimmten.
Recht realistisch wurde dargestellt, wie der Fremde sowohl an sich selbst als auch an den Verhältnissen, den starren Sitten im Land, scheitern musste. Als sich die Hauptfigur, Rechtsanwalt Adrian Bell, eines Tages mit dem rätselhaften Verschwinden seiner angebeteten Hana-ko konfrontiert sieht und befürchten muss, dass er mit jeder weiteren Suche nach der Geliebten nur ihr Leben gefährdet, kapituliert er schließlich schweren Herzens und dreht dem Reich der aufgehenden Sonne den Rücken zu. Ende erster Teil.
Was für ein Feigling, hatte sich Kim gedacht, als er bei seiner Lektüre an dieser Stelle angelangt war. Aber so sind sie, die Butterstinker. Sobald es brenzlig wird, ziehen sie den Schwanz ein. Er hatte sich ein neues Glas Perrier eingegossen, die trockenen Lippen benetzt und gierig weitergelesen. Die nun anschließende Szenenfolge war überschrieben mit »Einschub: Historische Rückblende, Mandschuko, Frühjahr 1945«. Kim, der zu neugierig darauf war, wie die Geschichte um Adrian Bell und Hana-ko weiterging, hatte die entsprechenden Seiten kurzentschlossen überblättert. Dafür war später noch Zeit.
Die zweite Hälfte des Drehbuchs, in der Adrian Bell lange Jahre später wieder nach Japan zurückkehrt wie der gealterte Robert Mitchum in Sydney Pollacks Hollywoodstreifen Yakuza, gefiel Kim nicht mehr ganz so gut. Das war nun sicher der Teil, der – wie Lan Liang angekündigt hatte – in der nächsten Zeit noch einmal gründlich überarbeitet werden sollte. Auf den völlig unerwarteten Hilferuf seiner lange verschollenen Hana-ko hin begibt sich Adrian Bell zurück nach Tokio – oder wird vielmehr dorthin gelockt, denn das Ganze stellt sich später als eine sorgfältig eingefädelte Falle heraus. Hana-kos Vater ist tot, doch Bells übrige Widersacher von damals haben nun hohe Posten in den japanischen Wirtschafts- und Regierungskreisen inne, von denen aus sie ihre kriminellen Machenschaften steuern. Es kommt zu einer ergreifenden Wiederbegegnung mit Hana-ko, die aber bald darauf nach einem spektakulären Anschlag von einem verbrecherischen Syndikat entführt wird, das auf diese Weise den Anwalt zu erpressen versucht. Fest entschlossen, nicht noch einmal zu versagen, wächst der in die Enge getriebene Adrian Bell nun über sich hinaus und beginnt einen grausamen Rachezug, bei dem auf beiden Seiten die Köpfe fliegen wie in Ridley Scotts Actionthriller Black Rain – bis hin zum finalen Showdown in einem geheimen atomgetriebenen japanischen U-Boot.
Immerhin ein effektvolles Ende, befand Kim anerkennend. Allerdings merkte man hier dann doch, dass sich der Autor zwar gut mit U-Booten auskannte, sicherlich jedoch nie selbst eins gesteuert hatte. Aber für diese Dinge hatten sich Lan Liang und ihr Auftraggeber inzwischen ja, wie sie selbst sagte, »genau den richtigen Mann« an Land gezogen. Als Produzent und möglichst auch Regisseur würde er, Kim, schon für packende Realistik sorgen.
Unterm Strich also ein spannendes, brisantes, im Großen und Ganzen gelungenes Drehbuch. Mit einem gewaltigen Potenzial. Unbedingt. Und der tiefere, eigentliche Grund, warum Kim die zweite Hälfte nicht mehr ganz so überzeugt hatte, war, wie er sich nun eingestand, wohl mehr persönlicher Natur. Hatte er doch, wie es Lan Liang von ihm erwartete, irgendwann während der Lektüre »eins und eins zusammengezählt«. »Butterstinker« hatte sie gesagt – hatten sie ihn so sorgfältig ausspioniert, dass sie sogar wussten, dass ihm zu diesem klassischen Schimpfwort für einen Gaijin als Erstes immer eine ganz bestimmte langnasige Visage einfiel? Immerhin: Auch wenn ihm niemand bis in die Gedanken schauen konnte, so war Lan Liang doch offensichtlich darüber im Bilde, dass auch Kim einen englischen Anwalt kannte, der ein paar Jahre in Japan gearbeitet und dann einen dubiosen Karriereknick erlebt hatte, bevor er sich schließlich hier in Shanghai breitmachte – und aus seiner Abneigung gegen den hatte Kim nie einen Hehl gemacht. Jeremy Gouldens. Der Butterstinker! Für Kim Park bestand kein Zweifel mehr, dass er der Mann war, der sich hinter Julian Peek und seinem fiktiven Wiedergänger Adrian Bell verbarg. Kims Instinkt hatte ihn also nicht betrogen: Cathys Lebensgefährte war in Wahrheit ein gebrochener Mann, der mit seiner Vergangenheit nicht klarkam, etwas verbarg, »eine Leiche im Keller hatte« – und dann hatte er sich seine Lebenslüge mit einem Drehbuch von der Seele geschrieben, in dem er sein Scheitern schönfärbte und seine Wunschträume wahrmachte: Gouldens, der Loser, nun als Superheld Adrian Bell, der in Rambo-Manier alte Rechnungen begleicht und alles wiedergutmacht.
Kim stand auf, verließ seine Dachterrasse und legte die neue Mappe über die alte in die oberste Schublade seines Lackschränkchens. Gut, er hatte sich entschieden. Er wollte diesen Auftrag annehmen. Aber er würde Bedingungen stellen. Er wollte beim Umschreiben des Drehbuchs ein Wörtchen mitzureden haben. Darauf würde er bestehen. Von nun an war dies auch sein Film.
Schon hatte er nach seinem Mobiltelefon gegriffen, um Lan Liangs Nummer herauszusuchen, da fiel ihm Cathy ein. Seit Tagen und Wochen schon schob sie sich ständig wieder ungewollt zwischen seine Gedanken. Er musste sich eingestehen, dass sie förmlich zu seiner Obsession geworden war. Das war nicht gut. Erst gestern hatte er deutlich beobachtet, dass die Beziehung zwischen ihr und ihrem Butterstinker keineswegs so fest und belastbar war, wie es nach außen hin aussehen mochte. Er wusste auch, dass sie noch immer etwas für ihn, Kim, empfand, wie schnippisch sie auch tun mochte; dass seine Chance noch nicht endgültig vertan war. Er wusste aber auch, dass es für einen Mann von Unheil war, sich statt nach seiner Pflicht nach einer Frau zu richten. Das machte ihn abhängig und angreifbar. Es war das erste Mal in seinem Leben, dass er eine Situation nicht im Griff hatte. Das durfte nicht sein. Und wenn es stimmte, was Lan Liang sagte, und er sich mit der Entscheidung zur Produktion von Yellow Submarine möglicherweise in Lebensgefahr brachte, dann konnte er sich erst recht keinen Kontrollverlust erlauben. Dann musste alles wieder so werden wie früher, als alles an seiner Person hing; an seiner antrainierten Fähigkeit, im Bruchteil einer Sekunde weitreichende Entscheidungen zu treffen, über deren Folgen man besser nicht nachdachte. Entscheidungen über Leben und Tod. Über manchmal sehr viel Leben. Und sehr viel Tod.
Also, was hieß das? Sollte er Cathy jetzt meiden? Oder sie ihrem Sugar Daddy endlich ausspannen? Gerade jetzt, wo er, Kim, in Gefahr war? Aber wenn er sich durch diese Produktion gefährdete, dann hatte sich der Drehbuchautor womöglich längst schon gefährdet – ob er es wusste oder nicht. Und dann hatte er seine Lebensgefährtin wohl oder übel mit gefährdet. Kim dachte an die beiden Japaner von gestern, mit den offensichtlich irgendetwas nicht gestimmt hatte. Auf seinen Instinkt konnte er sich immer verlassen.
Wie auch immer er persönlich zu ihr stand: Er musste Cathy vor diesem Mann warnen. Sie über die Vergangenheit dieses Mannes aufklären. Gouldens selbst würde das nicht tun, dazu war er zu schwach. Wie er diese Memme doch verachtete – auch wenn der Knabe, zugegeben, ein guter Drehbuchautor war. Kim schnaubte verächtlich durch die Nase. Was hätte er noch vor ein paar Stunden dafür gegeben, mit Julian Peek Kontakt aufnehmen zu können. Jetzt, wo er ihn plötzlich schon kannte, war er gar nicht mehr so scharf darauf. Er würde den Anruf bei Lan Liang erst einmal zurückstellen. Cathy war wichtiger.
Shanghai, 2. Mai 2012. 17:43 Uhr
Das Schnellboot jagte mit einer Geschwindigkeit von 45 Knoten durch den weitläufigen Mündungstrichter des Jangtsekiang zur Stadt zurück. Jeremy starrte angestrengt auf die vorbeifliegende Küstenlinie der Insel Changxing. Cathy spielte lustlos an ihrem Cellular herum und langweilte sich. »Wonach hältst du eigentlich die ganze Zeit Ausschau?«, fragte sie.
»Sorry, ich war gerade ganz woanders«, murmelte er.
»Das sehe ich. Wo warst du denn diesmal?« Cathy sah ihn spöttisch an. So richtig da war er den ganzen Tag nicht gewesen. Eigentlich war er schon ›ganz woanders‹, seit sie ihm gestern das grün-weiße Päckchen neben den Platzteller gelegt hatte.
Das war also ihr 32. Geburtstag. Sie hatten den bisherigen Tag leidlich und mit Anstand herumgebracht – immerhin ohne neue Katastrophen, aber auch ohne Höhepunkte. Nach einem ausgiebigen englischen Frühstück im Westin-Hotel – Jeremy hatte auf Champagner bestanden und die Flasche Louis Roederer Cristal schließlich fast alleine geleert, während sie an ihrem Glas nur genippt hatte – waren sie mit dem Taxi durch den Jangtse-Tunnel hinüber auf die Insel Changxing und dann über die zehn Kilometer lange Hängebrücke weiter zur Hauptinsel Chongming gefahren, wo sie im weitläufigen Nationalpark einen ausgiebigen Spaziergang gemacht hatten. Jetzt waren sie auf dem Rückweg nach Pudong, auf dem Weg zum Abendessen – für 18:30 hatte Jeremy einen Tisch im Nobelrestaurant »M on the Bund« reserviert.
Wo warst du denn diesmal?
Jeremy sah unverändert auf die Flusslandschaft hinaus. »Wusstest du, dass Changxing zum größten Schiffsbauzentrum Chinas ausgebaut werden soll? Acht Kilometer am Südufer sind für Werften reserviert. Die über 140 Jahre alte Jiangnan-Werft ist schon vor Ort, ebenso wie die Shanghai Zhenhua Port Machinery und die Shanghai Edward Shipbuilding. Aber der absolute Clou ist der neue Tiefseehafen Yangshan unten vor den Shengsi-Inseln, der, wenn er 2020 voll ausgebaut ist, alle Rekorde brechen wird. Schon jetzt hat Shanghai Singapur als größter Containerhäfen der Welt abgelöst. Und auch Hongkong wird sich in Zukunft warm anziehen müssen.«
»Ich hätte mich heute auch wärmer anziehen müssen«, sagte Cathy düster. Den ganzen Tag ging das schon so. Entweder schwieg er oder er redete in einem fort über Sachen wie Werften, Häfen, Investmentfonds, Aktienkurse. Wenn er dann merkte, wie sehr er sie langweilte, brachte er das Gespräch krampfhaft auf Themen, von denen er glaubte, dass sie sie interessierten: ihre Lieblingsbücher, Lieblingsfilme, Lieblingssüßspeisen. Sogar nach Kim hatte er sich erkundigt; sie mit einem schelmischen Augenzwinkern recht herablassend gefragt, ob sein »koreanischer Nebenbuhler« ihn denn immer noch als »Butterstinker« tituliere, sobald er ihm den Rücken gekehrt habe. Als ob es heute nicht wichtigere Dinge gäbe. Da hätte er gleich über das Wetter reden können, das wiederum großartig war. Die Luftfeuchtigkeit hatte sich auf ein erträgliches Maß reguliert. Und die Sonne strahlte.
»Ist dir etwa kalt, Liebste? Lass dich wärmen!« Er versuchte, sie an sich heranzuziehen, aber als er fühlte, wie sie sich sperrte, lockerte er die Umarmung.
Typisch, er gibt immer gleich auf, bemüht sich nicht mal, dachte sie. Und verliert sich in hilflosen Belanglosigkeiten. Als ob es heute nicht wichtigere Dinge gäbe. Ich hab dir heut auch was Wichtiges zu sagen. Natürlich spürte sie, dass ihn etwas bedrückte, wie ein Tonnengewicht auf seiner Seele lastete. Aber wenn er die angekündigten Enthüllungen den ganzen Tag vor sich herschob, verdarb er ihr nur den Geburtstag und machte nichts besser. War es nur der Heiratsantrag, der ihm so viel Mühe machte? Nein, sicherlich war da noch etwas anderes, das mit der Sendung von gestern zu tun hatte. Das aber auch mit dem Heiratsantrag zu tun hatte. Irgendwie.
Ich hab dir heut auch was Wichtiges zu sagen.
Dass er vorhatte, ihr einen Antrag zu machen, daran zweifelte sie nicht. Wofür hätte er sonst diesen teuren Ring mit den zwei Delfinen gekauft und ihn sorgfältig zwischen seinen Rasiersachen versteckt, wo sie ihn, wie er sicher glaubte, niemals entdecken würde? Und heute hatte er ihn herausgenommen. Aber vorher musste er anscheinend noch eine Beichte ablegen, das befahl ihm seine schlechtes Gewissen. Eine Beichte, die ihm sehr schwerfiel. Etwas Schlimmes. Ein Seitensprung? Das hätte er vor ihr nicht verbergen können. Dass er HIV-positiv war, vielleicht? Quatsch, für eine solche Beichte war der Zeitpunkt definitiv überschritten. Oder dass er schon einmal verheiratet war, damals in Japan? Jetzt aber sei er für sie frei, keine Sorge, Cathy, weil er nämlich seine erste Frau im Affekt eigenhändig erwürgt hatte. Sie müsse sich aber dennoch wohl noch ein paar Jährchen gedulden: In der Sendung von gestern war nämlich eine Vorladung vor ein japanisches Gericht. Sie musste innerlich lächeln: Nein, nein, ihr Jeremy könnte nie einen Menschen umbringen. Der war kein Typ wie Kim. Aber ihre Phantasie hielt Dutzende ähnlich unerquickliche Anlässe für ein schlimmes Geständnis bereit, die sie sich besser vorstellen konnte. Ach, du hast eben schon immer eine lebhafte Phantasie gehabt, Cathy Wong. Doch ihr heimliches Schmunzeln erstarrte ihr auf den Lippen: Sie merkte, dass sie sich vor seinen Enthüllungen fürchtete. Vor seinem skeleton in the closet. Und mittlerweile war sie sich fast sicher, dass es sich dabei wohl in der Tat um ein weibliches Skelett handelte.
»Woran denkst du, Liebling?«
Jetzt musste ihr dickfelliger Trampel, dieses britische Walross, auch noch mit dieser in so einer Situation verfänglichsten aller Fragen kommen! Aber bitte: Warum sollte sie lügen?
»Daran, dass du mir heute noch etwas Wichtiges sagen wolltest.«
»Richtig. Aber ob dieses Schiff der geeignete Ort dafür ist?«
»Ein Ort ist so gut wie jeder andere.«
»Richtig …« In diesem Moment vibrierte es in ihrer Handtasche. »Augenblick bitte!« Cathy griff in die Tasche und holte ihr Mobiltelefon heraus. Die Nummer des Anrufers war unterdrückt. Sie hätte auch nicht rangehen könnten. Aber heute war ihr Geburtstag.
»Ja, Wong, hallo?«
»Hier ist Kim, Kim Park. Alles Gute, Cathy. Kannst du sprechen? Es ist wichtig.«
»Coco!«, jubelte Cathy in den Apparat, »nein, nein – du störst überhaupt nicht … Wir sind gerade auf dem Rückweg nach Pudong – Jeremy hat mir einen tollen Geburtstagsausflug spendiert!« Sie warf einen kurzen Blick auf Jeremy, der lächelnd abwinkte. Coco war eine Freundin von Cathy. Keine gemeinsame Freundin. Ihm kam der Anruf gelegen; ja, er war erleichtert: Da konnte er sich zum x-ten Male noch einmal alles zurechtlegen.
Kim hatte verstanden. Er würde sich kurzfassen. »Tut mir leid wegen gestern Abend«, sagte er mit gesenkter Stimme. »Aber deshalb ruf ich nicht an. Hör zu: Ich bin da auf etwas Merkwürdiges gestoßen. Es betrifft Jeremy. Ich behellige dich ja ungern an deinem Geburtstag damit, aber …«
»Das ist ja suuuper!«, sagte Cathy, »dann kommst du jetzt doch auch zum Moto-Empfang?«
»Aus dir wird noch eine Spionin«, lachte Kim leise, bevor er zum eigentlichen Zweck seines Anrufs zurückkehrte: »Also: Tu dir und mir einen Gefallen und frage Jeremy noch heute, ob er einen gewissen Julian Peek kennt.«
»Wer soll das sein?«, fragte Cathy. »Kenn ich nicht. Ein Mitarbeiter von Yohji Yamamoto sagst du? Dem berühmten Modedesigner?« Julian Peek? Den Namen hatte Jeremy ihr gegenüber noch nie erwähnt. Was verheimlichte er ihr? Gleichzeitig kam sie sich vor wie eine Verräterin. Jeremy starrte nach wie vor hinaus auf die Küstenlinie. Vor ihnen wuchs die Science-Fiction-Skyline der Pudong New Area immer höher in den rötlichen Abendhimmel.
»Bitte vertraue mir, Cathy, und achte nur genau darauf, wie er reagiert. Okay? Ansonsten bist du ahnungslos.«
»Gut, Coco, das sind ja wirklich tolle Neuigkeiten, dann sehen wir uns ja. Aber weißt du was: Das Boot legt gleich an … Genau. Stell dir vor: Wir essen heute im ›M on the Bund‹! Cool, was?«
»Guten Appetit«, knurrte Kim ins Telefon. »Julian Peek – der Autor heißt Julian Peek – hast du verstanden? Sag, du hättest mal ein tolles Buch von dem Typ gelesen, wüsstest aber den Titel nicht mehr.«
»Ja ja, Coco. Aber jetzt muss ich wirklich Schluss machen. Wir telefonieren morgen früh – ganz in Ruhe. Ja, ich dich auch. Und grüß Singapur von mir.« Cathy klappte ihr Mobiltelefon zu. »Und was sind die tollen Neuigkeiten?«, brummte Jeremy, hörbar desinteressiert.
»Ach, wieder so eine typische Coco-Geschichte. Sie kommt nun doch zum Moto-Empfang übermorgen im World Financial Center, und das muss sie mir natürlich gleich auf die Nase binden. Die Einladungen sind äußerst rar, aber sehr begehrt, musst du wissen, und sie wollte da doch unbedingt hin. Sie kommt mit einem namhaften japanischen Modedesigner, den sie in Singapur getroffen hat. Offenbar ein Verehrer … Du kennst doch Coco!«
»Kennen ist ein wenig übertrieben. Aber wolltest du da nicht auch hingehen? Ist das nicht der Empfang, von dem du gestern Yoshi Satori erzählt hast?« Cathy nickte. Jeremy fuhr fort: »Ich könnte mir, ehrlich gesagt, was Besseres vorstellen, als mit einem Haufen steifer Japse meinen Tag zu verbringen – mit all den sonderbaren Zeremonien, die die haben. Ein seltsames Völkchen.«
»Soll ich dir mal was verraten, Jeremy? Ich könnte mir auch was Besseres vorstellen. Aber das ist nun mal mein Beruf, Honey. Ohne solche Kontakte könnte ich meinen Job gleich an den Nagel hängen.«
Tokio, 2. Mai 2012. 18:00 Uhr
Yoshi Satori hatte mit viel Glück noch einen Platz in der Mittagsmaschine nach Tokio ergattern können. Dafür hatte er ärgerlicherweise First Class fliegen müssen – wo die Firma ihren Angestellten doch schon seit langem nur noch Economy-Plätze zahlte. Der finanzielle Ärger gehörte momentan freilich zu seinen geringsten Belastungen. Er hatte ganz andere Sorgen.
Drei Stunden und vier doppelte Beruhigungswhiskys später war er gelandet und hatte sich per Taxi zum Prudential Tower im Tokioter Stadtteil Akasaka fahren lassen. Dort stieg er aus, blieb einen Moment stehen, blickte die kalte Hochhausfassade empor, seufzte leise und beschloss, noch eine Zigarette zu rauchen.
Vielleicht war es die letzte Zigarette seines Lebens. Er hatte versagt. Genauer gesagt hatte Kumiko versagt, aber diese Feinheiten spielten jetzt keine Rolle mehr. Kumiko, die als anonyme Tote jetzt wohl starr und ihrer noch verwertbaren Organe beraubt in irgendeiner Leichenhalle lag und eines Tages vermutlich als Übungsmaterial im Präparierkurs für angehende Mediziner enden würde. Und für das Desaster, das sie auf dieser dummen Geburtstagsparty veranstaltet hatte, musste nun er sich verantworten. Satori hatte genau gesehen, wie Jeremy Gouldens zusammengezuckt war, als die betrunkene Japanerin ausgerechnet das scheinbar so harmlose Kinderliedchen vom gelben U-Boot angestimmt hatte. Hatte sorgfältig beobachtet, wie es ihn erschreckt hatte, von dieser Fremden mit einer Vergangenheit konfrontiert zu werden, die er doch meinte, vor aller Welt verborgenen gehalten zu haben. Noch viel mehr würde Gouldens allerdings erschrecken, wenn er wüsste, wie gut jene Männer, denen Yoshi Satori gleich gegenüberknien würde, über ihn und seine Sache im Bild waren. Und wie wenig sie goutierten, was dieser ahnungslose, tapsige Gaijin da in die Wege geleitet hatte. Ein mattes Grinsen schlich auf Satoris schmale Lippen, das schnell wieder verschwand – zu groß war seine eigene Angst. Er konnte davon ausgehen, dass die da drinnen bereits über alles Bescheid wussten, was sich gestern auf der Party ereignet hatte. Dafür würde John Huang schon gesorgt haben. Ob er wohl wirklich versucht hatte, ein gutes Wort für ihn einzulegen? Satori hatte allen Grund zu zweifeln. Was wussten Haifische wie Huang von »guten Worten«? Deren gute Worte waren »Zeig deine Zähne« und »Beiß zu«.
Zehn Minuten später betrat Yoshi Satori im 20. Stockwerk des Prudential Towers einen mit Reisstrohmatten ausgelegten Raum und schob die Schiebetüren aus Papier beiseite. Sehr geschmackvolle Shoji, dachte er noch, als er schon auf die Knie sank, zum Tisch rutschte und sich jeweils tief vor den drei Männern verbeugte, die um den Tisch knieten. Sie trugen weiße Nylonhemden. Unter der Kunstfaser schimmerten dunkelblaue Drachen. Die kunstvollen Tätowierungen der drei Männer reichten vom Halsansatz bis zu den Handgelenken.
»Honto ni shipai shimashita, gomen nasai«, murmelte er unablässig. Sie ließen ihn schmoren. Er wusste, dass es nur zwei Möglichkeiten gab. Entweder man ließ ihn gehen und er konnte am Leben bleiben. Vorerst. Oder sie würden alle drei wortlos aufstehen und ihm ein Samuraischwert präsentieren. Die entschieden unangenehmere Alternative. Yoshi Satori hegte keinerlei Ambitionen, durch Seppuku zu sterben, den rituellen Selbstmord der Samurai, bei dem sich der Todeskandidat das Schwert vier Daumenbreit unter dem Nabel in die Eingeweide stoßen und ohne jedes Zeichen von Schmerz in Würde dahinscheiden musste, wollte er nicht für immer entehrt sein.
Er hörte, wie hinter ihm die Shoji zur Seite geschoben wurden. Ein junger Bursche, den er hier noch nie gesehen hatte, betrat auf leisen Sohlen den Raum, trat neben Satori und breitete vor ihm auf dem Tisch ein großes weißes Taschentuch aus Leinen aus. Darauf legte er ein weiteres Tuch sowie ein rasiermesserscharfes Kurzschwert und einen handtellergroßen, glatt geschliffenen Stein. Dann verschwand er so lautlos, wie er gekommen war.
Yoshi Satori verstand, was die drei Männer von ihm erwarteten. Das Ritual des Yubitsume bietet dem Yakuza, der eine Verfehlung begangen hat, eine Möglichkeit zur Sühne. Nicht, dass die Verfehlung dadurch vergessen gemacht wäre. Im Gegenteil: Bis ans Lebensende trägt er nun das Zeichen seiner Schande offen zur Schau. Satori wäre fortan, wenn man so will, »angeschlagen«, aber am Leben. Doch zuerst musste er da durch. Die Zeremonie in Würde hinter sich bringen.
Schweiß trat ihm auf die Stirn, doch er beherrschte sich eisern, während er seine linke Hand auf dem Stein platzierte, den kleinen Finger abgespreizt. Dann griff er entschlossen nach dem Wakizashi und setzte die Klinge direkt hinter dem ersten Glied des Fingers auf die Haut. Ohne zu zögern und einen einzigen Laut von sich zu geben, schnitt er sich das Fingerglied ab. Es knirschte, als die Klinge durch den Knochen fuhr. Kunstvoll wickelte er das Taschentuch um den blutenden Stumpf und zog mit den Zähnen den Verband fest. Dann senkte er die Stirn auf den Tisch und schob mit der rechten Hand das zweite Taschentuch mit dem abgeschnittenen Glied über den Tisch. Die drei Männer verneigten sich kurz vor ihm. Nicht so tief wie Yoshi vorhin.
Erneut wurden die Shoji zur Seite geschoben. »Wie hat Mister Gouldens reagiert, als alles schiefging?«, fragte eine sonore Stimme.
Yoshi war angesprochen worden. Er durfte sich wieder aufrichten. Und antworten. »Er wirkte verwirrt – verwundert – verschreckt. Ich bin mir sicher, dass er nicht das Geringste von dem verstanden hat, was vorging. Immerhin haben wir nun absolute Gewissheit, dass er unser Mann ist.«
»Ja – das habt ihr fein angestellt. Der einzige noch plumpere Weg wäre vermutlich gewesen, ihn direkt zu fragen.«
»Wie hätte ich denn ahnen können, dass sie sich so gehenlässt?«
Sein neues Gegenüber, ein Bulle von Mann mit einem gewaltigen Stiernacken und prankenartigen Händen, musterte ihn kritisch. Satori erkannte ihn fröstelnd. Der Mann aus Kobe, über den viel gemunkelt wurde, trug den Spitznamen »der Metzger«.
»Und was war in dem Päckchen der Murata-Tochter?«
»Ich weiß es nicht«, antwortete Yoshi Satori wahrheitsgemäß. »Es war mir leider unmöglich, es verschwinden zu lassen; seine Schlampe ist mir dazwischengekommen. Aber soweit ich seine Reaktion beobachten konnte, geriet er völlig aus der Fassung.« Wenn ich hier noch lange verhört werde, könnte mir dasselbe passieren, dachte er. Der frische Stumpf pochte herauf bis in seinen Kopf.
»Hat er es denn geöffnet?«
»Nicht vor unseren Augen, nein. Ich glaube, er ahnte, was drin war.«
»Er wird von dieser Frau kein zweites Päckchen mehr erhalten.«
Wieder machte sich Stille im Hinterzimmer breit. Satori versuchte, gleichmütig dreinzublicken. Er konnte immer noch nicht genau abschätzen, ob seine Opfergabe als ausreichende Entschuldigung angenommen worden war. Kumikos Selbstmord war zwar konsequent und ehrenhaft gewesen, machte die Situation für ihn aber nicht besser. Er beschloss, in die Offensive zu gehen. »Noch ist nichts verloren«, sagte er leise zum Stiernacken. »Ich werde die Produktion dieses Films zu verhindern wissen.« Höchstens seine tonlose Stimme verriet, dass er einer Ohnmacht inzwischen unangenehm nahe war.
»Davon gehe ich aus«, sagte der Stiernacken. »Und wir müssen unbedingt verhindern, dass dieser Engländer in Besitz der Aufzeichnungen gelangt. Aber dazu müssen wir auch herausfinden, wo sie sind. Und was Gouldens darüber weiß.« Der »Metzger« verfiel in ein bedrohliches Schweigen. Als er zu sprechen fortfuhr, war es Satori, als ob ihm seine Worte direkt ins Fleisch schnitten. »Man ist sehr ungehalten über Sie, Satori-san. Es darf uns kein weiterer solcher Fehler unterlaufen. Es sind schon zu viele Fehler passiert. Dafür hat Japan bitter bezahlen müssen. Die Größe und Ehre unseres Vaterlandes steht auf dem Spiel. Das Land ist in seiner schwersten Krise seit seine Helden im Weltkrieg untergingen, und wir haben keine Zeit mehr zu verlieren. Aber die momentane Schwäche ist auch eine Chance für die wahren patriotischen Kräfte, das Ruder herumzureißen und Nippon zum alten Ruhm zurückzuführen. Scheitert unsere Mission, ist auch unsere Heimat, das alte Japan, dem Untergang geweiht. Und dafür bezahlen Sie als Erstes, Satori-san.«
Heftig pochte sein Herz, schlug mit jedem Puls schmerzhaft über den linken Arm bis in den kleinen Finger hinab. Auf dem weißen Taschentuchverband bildete sich ein runder, roter Fleck: wie eine japanische Flagge, die rasch größer wurde.
Stiernacken bedeutete ihm mit einem verächtlichen Nicken, dass die Audienz beendet war. Satori erhob sich und ging langsam rückwärts zur Tür. »Isshokenme ganbari-masho«, sagte er mit einer tiefen Verbeugung, »ich werde alles in meiner Macht Stehende tun. Banzai – lang lebe der Kaiser!« Und schlüpfte hinaus. Draußen auf dem Flur, vor den Fahrstuhltüren, verharrte er noch einen Augenblick. Niemand folgte ihm. Er bekam also noch eine Chance. Yoshi Satori schwor bei den zwei Gliedern seines kleinen Fingers, dass er diese Chance nutzen würde. Er zündete sich eine Filterlose an. Er musste sofort zurück nach Shanghai.
Shanghai, 2. Mai 2012. 18:45 Uhr
Natürlich hatten sie sich wieder ein wenig verspätet, und Jeremy bangte um den reservierten Tisch. Wenn dort jetzt schon jemand anderes saß, wäre das die nächste Katastrophe.
Tatsächlich war das berühmte Kolonialrestaurant »M on the Bund« wie zumeist bis auf den letzten Platz besetzt. Kein freier Tisch für Cathy und Jeremy. Die Sache klärte sich aber rasch auf. Der nächste frei werdende Tisch sei für sie bestimmt, erläuterte ein dienstfertiger Kellner, der sich immer wieder sehr schuldbewusst vor ihnen verbeugte. Wenn sie wollten, könnten sie noch einen Moment in der »Glamour Bar« Platz nehmen, Getränke gingen selbstverständlich aufs Haus.
»Gegen einen kleinen Whisky vorab hätte ich nichts einzuwenden. Was meinst du, Cathy? Es ist ja schließlich dein Geburtstag.«
Sie willigte seufzend ein.
Er bestellte seinen Lagavulin und sie ein kleines Glas Chardonnay. Jetzt ist vielleicht die richtige Gelegenheit, dachte sie. Also los.
»Jeremy. Ich habe da kürzlich so ein Buch gelesen. Von einem englischen Autor, wie hieß er nochmal …«
»Es gibt Unmengen von englischen Autoren. Erster Buchstabe?«
»Warte, mir liegt es auf der Zunge. Etwas mit Jot. Jedenfalls der Vorname. J wie Jeremy.«
»James Joyce? Der war aber Ire.« – »Nein, nein. Julian …«
»Julian Green war Amerikaner, der auf Französisch geschrieben hat, da verwechselst du was, Schatz. Außerdem hast du ja – ich hab’s! – Room with a View von E. M. Forster gelesen. Nichts mit Jot. Lag doch wochenlang auf deinem Nachttisch. Na ja, ein ›Zimmer mit Aussicht‹ haben wir mit diesem prächtigen Blick über den Bund auch hier, nicht? Und, wie fandest du Forsters alten Schinken? Also, ich kann mit diesen Liebesverwicklungsgeschichten ja nicht besonders viel anfangen, das ist mehr was für Frauen, denke ich. War übrigens auch ein Lieblingsautor meiner Großmutter, der Forster. Wenn sie nicht gerade ihren alten Goethe las. Sie war ja gebürtige Deutsche, weißt du.«
Cathy gab es auf. Das mit dem Buch war so eine Schnapsidee von Kim gewesen. Und was sie zu hören bekam, war nun wieder so ein nervöser, unkoordinierter Redeschwall, wie er dergleichen den ganzen Tag schon fabrizierte.
»Wann ist deine Großmutter denn eigentlich gestorben?«, fragte Cathy, nur um irgendwas zu sagen. Sie wusste, dass Jeremy, der ein Einzelkind war, eine enge Beziehung zu seiner Großmutter väterlicherseits gehabt hatte, bei der er aufgewachsen war, nachdem er seine Eltern im Alter von 12 Jahren durch einen tragischen Autounfall verloren hatte.
»Am 5. Februar 1999. Da war ich noch in Japan.«
»Und deine Großmutter war Deutsche, sagst du?«
»Ja, weißt du doch. Berliner Bankierstochter.«
»Warum hat sie dann im November 1938 das Land verlassen?«
»Cathy, viele Deutsche haben in den dreißiger Jahren das Land verlassen. Thomas Mann, Sigmund Freud, Marlene Dietrich, Billy Wilder, Albert Einstein …«
»Aber ich dachte, sie sei Jüdin gewesen.«
»Nein, sie war Deutsche. Sie fühlte sich immer als Deutsche. Sie war voll assimiliert. Gut, später war sie dann Engländerin – als sie meinen Großvater geheiratet hatte.«
»›Voll assimiliert‹, sagst du? Sie war also doch Jüdin.«
»Ich sage doch: Sie war deutsche Staatsbürgerin. Sie fühlte sich immer als Deutsche. Das spielte keine Rolle für sie.«
»Für die Deutschen spielte es offensichtlich eine Rolle.«
»Für das deutsche Regime, ja. Für Hitler und seine willigen Vollstrecker. Die hätten sie wohl umgebracht.«
»Jeremy, du weißt, ich habe nichts gegen Juden. Ich versteh bloß nicht, wieso du auch darum so eine Heimlichtuerei betreiben musst.«
Jeremy seufzte. Dieses bösartige »auch«. Zeit, behutsam ein wenig Contra zu geben. »Schau mal, Cathy: Wie ist es denn mit dir?«
»Was soll denn auf einmal mit mir sein. Willst du jetzt persönlich werden? Jeremy, ich bin amerikanische Staatsbürgerin. Born – in the USA!«
»Siehst du. Genau wie meine Großmutter.«
»Wieso? War sie denn amerikanische Jüdin? Von Brooklyn nach Berlin? Das wird jetzt aber kompliziert. Gerade hast du noch gesagt …«
»Nein. Ich wollte ausdrücken: Genauso wie du amerikanische Staatsbürgerin bist, war meine Großmutter deutsche Staatsbürgerin. Bis dann dieser Österreicher an die Macht kam und entschied, dass Millionen Deutsche von heute auf morgen keine Deutsche mehr waren. Weil plötzlich irgendein obskures ›Blut‹ der Menschen mehr zählte als ihr Kopf – dieser ganze Rassenirrsinn eben. Und anders als dir hat man es meiner Großmutter nicht einmal angesehen. Sie war blond, Cathy. Wenn der Ku-Klux-Klan in Kalifornien die Macht übernimmt, kann dir dasselbe passieren.«
»Was sind denn das für Sprüche, Jeremy? Anders als mir? Man sieht mir also nicht an, dass ich Amerikanerin bin, he? Und dem Präsidenten sieht man das wahrscheinlich auch nicht an, was? Meinst du nicht, dass du gerade ein klein bisschen rassistisch wirst? Wenn es nach dir ginge, ist man wahrscheinlich nur ein richtiger Amerikaner, wenn man 1620 mit der Mayflower von Plymouth herübergekommen ist. Ja, ihr Engländer seid natürlich die Allerbesten!«
Jeremy hatte das Gefühl, dass sich das Gespräch im Kreis gegen ihn drehte, und beschloss, rasch das Thema zu wechseln. Aber jetzt zu fragen: »Willst du meine Frau werden?«, schien ihm auch kein passender Anschluss. Glücklicherweise kam da lächelnd der schuldbewusste Kellner, um ihnen unter neuen Verbeugungen mitzuteilen, dass der gewünschte Tisch nun frei sei. Jeremy kippte seinen Whisky, während Cathy ihren Weißwein nahezu unangetastet stehen ließ.
Der gewünschte Tisch entpuppte sich als einer der hochbegehrten Plätze an den Fenstern, was Jeremy – wie Cathy mit stiller Genugtuung konstatierte – nur mit einem astronomischen Vorab-Trinkgeld geschafft haben konnte. Sollte er nur bluten, sie hatte seinetwegen in den vergangenen 24 Stunden genug leiden müssen. Bei der Auswahl der Speisen gab sie sich daher alle Mühe, Jeremy weidlich zu schröpfen. Sie bestellte Rindfleisch Quilin Ganshao Niu, Acht-Juwelen-Chilipaste, rot gebratenen Mandarinfisch und rasch noch gebackenen Karpfenschwanz Quingyu Shuaishui mit Shengbian Caotou-Gemüse. Auch beim Wein hatte sich, sehr zu Jeremys Leidwesen, Cathy durchgesetzt, die auf einen 2006er Kistler Chardonnay aus dem Sonoma Valley bestanden hatte, der Jeremy absurd überteuert schien. Dann lehnte sie sich zurück und harrte der Dinge, die da kommen sollten.
Jeremy hatte sich noch einmal seinen Lieblingsmalt als Aperitif bestellt, Cathy einen Sex on the Beach-Cocktail. Er nahm einen großen Schluck, den er viel zu rasch hinunterschluckte, und räusperte sich verlegen. »Cathy, Darling: Ich möchte dir etwas sagen … ich hoffe, dass jetzt nicht wieder dein unseliges Telefon klingelt … ich muss zugeben, dass ich etwas nervös bin …« Da er nun wieder ins Stocken geriet, das Telefon tatsächlich nicht klingelte und ihm nichts weiter einfiel, blickte er etwas hilflos hinüber zur Hauskapelle, was der Bandleader als das vereinbarte Handzeichen interpretierte. Im nächsten Augenblick ertönte der Shanghai Blues, ein Schlager aus den dreißiger Jahren. Cathy war verblüfft. Dieses Stück hatte sich Jeremy damals auch von der Jazzband der alten Männer im »Peace Hotel« gewünscht. An ihrem ersten Abend, kurz nachdem sie sich kennengelernt hatten. Gleich am nächsten Morgen hatte sie Coco telefonisch davon berichten müssen, dass sie die Liebe wie ein Blitz – ein coup de foudre – ereilt hatte. Die seit Jahren vergeblich gesuchte Kombination philosopher’s mind in the body of a Greek God, von der sie beide immer gesprochen hatten, sei nun endlich, endlich in ihr Leben getreten und sie sei wild entschlossen, von ihrem Philosophengott um keinen Preis mehr loszulassen. Mochten alle anderen – Coco eingeschlossen – doch sagen, was sie wollten. Und sie sagten so manches.
»Das ist aber nicht so richtig der griechische Gott, den du immer gesucht hast«, hatte zum Beispiel Coco gesagt, nachdem sie Jeremy zum ersten Mal in Augenschein genommen hatte.
Oh doch, das war er. Auch wenn das nicht für alle Augen sichtbar war. Auch wenn er, zugegeben, nicht im eigentlich »klassischen« Sinn schön war. Und wenn er auch kein Apoll war, so war er Hephaistos: Der Gott des Feuers, der als der liebenswürdigste und freundlichste aller Griechengötter galt. Und wenn der auch der Einzige auf dem Olymp war, den man jedenfalls nicht für seine Wohlgestalt rühmte, hatte Hephaistos doch die Begehrenswerteste von allen zur Frau: Aphrodite, die Göttin der Liebe. Aber all das waren Dinge, die jemand wie Coco nicht verstehen konnte. »Nun ja, Sokrates soll ja auch hässlich gewesen sein«, lautete deren Vorschlag zur Güte. »Und solange dein Jeremy nicht wie ein chinesischer Gott aussieht, ist ja alles in Ordnung.« Und, wärmer geworden: »Bestimmt hat er auch seine Qualitäten. Wahrscheinlich nicht nur im Bett. Aber findest du nicht, dass er etwas zu alt für dich ist?«
Der Shanghai Blues, ihr Lied. Jeremy war sich sicher, dass ihm damit ein großer Coup gelungen war. Eigentlich hatte er vorgehabt, die Sache mit der Hauskapelle doch noch abzublasen. Doch dann war alles Hals über Kopf gegangen, eins hatte ins andere gegriffen, und jetzt gab es kein Zurück mehr. Jetzt musste er, sozusagen, auf den roten Knopf drücken. Aber hatte er Cathy nicht erst sein Geständnis machen wollen? Konnte er sich jetzt hier hinstellen und sagen: Bitte Cathy, heirate mich, verbindliche Zusage erwünscht, das Kleingedruckte wird auf zwei DVDs nachgereicht? Konnte er nicht. Aber jetzt lief ihr Lied und sie sah ihn so schmelzend und froh aus ihren Rehaugen an.
Konnte er doch.
»Cathy! Wie wäre es mit einem Geschenk, das dir und mir Freude bereitet? Etwas, das so verrückt und gleichzeitig schön ist, dass wir uns noch lange daran erinnern werden? Vielleicht für den Rest unsrer Tage?« Cathy rutschte unruhig auf ihrem Stuhl hin und her und versuchte unbeteiligt auszusehen. »Was meinst du damit?«, fragte sie und schob die Unterlippe vor.
Jeremy beugte sich verschwörerisch nach vorn und blickte langsam nach links und rechts. Dann zog er etwas aus der Tasche und schob es über den Tisch. Es war eine kleine rote Lackschachtel. »Ich habe dich heute ein bisschen lange auf die Folter gespannt«, sagte er feierlich. »Ich hoffe, du bist nicht an mir und meinen Absichten irregeworden.«
Cathy widerstand der Versuchung, die kleine Schachtel augenblicklich aufzureißen. Sie wusste sofort, was dieses Schächtelchen enthalten würde. Da war er, der Ring. Sollte sie oder sollte sie nicht? Eigentlich wollte sie ja schon. Fördernd ist Beharrlichkeit. Komme, was wolle. Fördernd ist, zu haben, wohin man gehe. Aber es ärgerte sie ein wenig, dass er seine dunklen Enthüllungen jetzt anscheinend doch auf danach verschieben wollte. Nachdem er sich den ganzen Tag davor gedrückt und ihr damit den Geburtstag verdorben hatte. Und bevor sie Ja sagte, wollte sie erst wissen, was er vor ihr verbarg. Schließlich kauft man nicht die Katze im Sack. Wollte er sie mit der Schachtel nun in Zugzwang bringen? Damit sie es war, die ihnen diesen entscheidenden Moment verdarb? ›Willst du mich heiraten, Cathy?‹ – ›Oh, kommt ganz darauf an. Erzähl mir erst dein dunkles Geheimnis. Bis dahin kannst du deinen Ring behalten.‹ Nicht sehr romantisch. Sollte sie oder sollte sie nicht? Sie sollte nicht. Sie schob das Schächtelchen zur Seite.
»Willst du es nicht aufmachen?«, fragte Jeremy beklommen.
»Nach dem Essen«, entschied sie.
»Es ist nicht das, was du vielleicht denkst.« Er lächelte geheimnisvoll. »Noch nicht.«
Diese Antwort irritierte sie nun aber doch. Nicht, was sie dachte? Das wollte sie aber sehen!
Während sie vorsichtig die Lackschachtel öffnete, stellte Jeremy ihren Cocktail wie unabsichtlich ein Stückchen zur Seite. Als wolle er verhindern, dass sie das Glas umstoßen könnte. Dass er ihr dabei den Ring vorsichtig ins Glas warf, bekam sie nicht mit. Zwei hochkarätige Delfine in der Luft, über einem königsblauen Meer.
Cathy wunderte sich. Außer einem kunstvoll gefalteten Briefchen enthielt die Schachtel nichts. Sie wusste nicht, ob sie nun enttäuscht oder erleichtert sein sollte. Sie war wohl beides. Enttäuscht und erleichtert faltete sie das Papier auseinander und las: Gutschein für eine Reise … bis ans Ende der Welt und noch über den Horizont hinweg …
»Na, was sagst du?«
Seine schriftstellerischen Versuche hatten sie noch nie überzeugt. »Hm, etwas kitschig formuliert, findest du nicht?«, bemerkte sie spitz. »Und das ist jetzt also dein Geburtstagsgeschenk?«
»Ich dachte, wir lösen den Gutschein ein und fliegen für ein paar Tage nach Hainan. So bald wie möglich. Sobald es sich bei mir in der Kanzlei irgendwie einrichten lässt. Was meinst du?«
Verstand sie das richtig? Langsam dämmerte ihr ein Verdacht. Hatte er die ganze Sache also kurzerhand verschoben? Weil er sich noch immer nicht traute? Jetzt also noch mindestens zwei, drei Wochen warten und dann eine Woche mit einem herumdrucksenden, nervösen, verschlossenen Jeremy auf Hainan in der Hitze schmoren und Däumchen drehen, bis er sich endlich mal traute, Klartext zu reden? Das hielt sie nicht aus. Nein, sie konnte mit all diesen Ungewissheiten nicht mehr leben. Sie war im besten Alter und gerade beruflich am Durchstarten. Sie musste ihre Zukunft planen. Wollte sie Kinder? Wenn ja, wann? Von wem? Wie viele? War Jeremy wirklich der richtige Vater für ihre Kinder? Wie würde sie Kinder und Karriere unter einen Hut bringen? Wie würde sich ihr Mann da einbringen? Sollten die Kinder als kleine Chinesen in Shanghai aufwachsen oder sollte sie besser nach Kalifornien zurück? Möglicherweise erhielt sie bald ein Angebot, für Vanity Fair nach London zu wechseln und die nächste Sprosse ihrer Karriereleiter zu erklimmen. Würde Jeremy dann mitkommen und mit ihr in die Luxuswohnung seiner Eltern ziehen, von der er immer so schwärmte? Fragen über Fragen, die geklärt werden mussten; die sie lieber heute als morgen beantwortet haben wollte. Jetzt saß sie hier mit diesem englischen Drückeberger, der bei allen wichtigen Entscheidungen die Reaktionsschnelle eines Faultiers aufwies, und er hatte an ihrem Geburtstag nichts Besseres zu tun, als sie auf einen noch in der Ferne liegenden Kurzurlaub auf einer schwülen Tropeninsel zu vertrösten, wo sie sich wahrscheinlich das Gelbfieber oder sonst was holen würde. Sie hatte es so satt! Sie hatte gute Lust, ihm jetzt eine Szene zu machen, hier vor allen Leuten, die ohnehin schon begonnen hatten, ihr neugierige Blicke zuzuwerfen. Aber sie wusste etwas Besseres. Sie musste die Dinge jetzt selbst in die Hand nehmen. Sie musste in die Offensive gehen. Jetzt und hier.
»Jeremy«, sagte sie statt einer Antwort und blickte ihn scharf an. »Jeremy. Wer ist Julian Peek?«
Schade um den teuren Lagavulin. Sie reichte ihm ihre Serviette.
Sie hatte ihn selten so aufgeregt gesehen. Sie hatte ihn, wenn sie es sich recht überlegte, das ganze Jahr nicht so aufgeregt gesehen. Abgesehen von den letzten 24 Stunden vielleicht. Da war es nun das zweite, wenn nicht gar schon dritte Mal.
Woher sie das wisse. Ob sie sein privates Aktenschränkchen durchstöbert habe. Woher sie denn überhaupt den Schlüssel habe. Wem sie schon davon erzählt habe. Und so weiter.
Sie habe ja nur gefragt. Er solle sich abregen.
Dass er ihr alles erzählen wolle. Meinetwegen gleich heute. Zu Hause. Aber nicht hier. Nicht beim Geburtstagsessen. Sie wolle sich doch jetzt nicht durch so etwas den Abend verderben lassen. Und dass die Sache mit Julian Peek mit ihnen beiden und dem Anlass des Abends sowieso nicht das Geringste zu tun habe. Höchstens am Rande. Da schon.
Gut, dann eben gleich die zweite Frage. Das Feuer war eröffnet; es gab kein Zurück mehr. Sie wusste nicht, wo das enden würde, aber auch wenn das Ende wieder ein fürchterliches Debakel sein musste – es gab kein Zurück mehr.
»Jeremy. Ist es eine andere Frau?«
Julian Peek? Nein, Julian Peek sei keine andere Frau. Im Übrigen gebe es überhaupt keinen Julian Peek. Aber jetzt bitte das Thema wechseln.
Als ob es für ihn, seit sie ihm gestern Abend das Päckchen neben den Teller gelegt hatte, nicht ohnehin nur noch ein Thema gab, das ihn nicht losließ. Und jetzt musste er auspacken, Klartext reden.
»Jeremy. Ist es eine andere Frau?«
»Nein. – Nein, nein. Das heißt … ja. – Aber nicht … Na ja, wie soll ich sagen. – Also schon, aber nicht direkt, jedenfalls nicht das, was du jetzt vielleicht denkst, weißt du.«
Sie wusste nicht.
»Also, beruhig dich: Cathy, ich kann dir alles erklären …«
In dem Moment war bei ihr der Kragen geplatzt. Jetzt, wo sie ihn endlich da hatte, wo sie ihn den ganzen Tag schon hatte hinbringen wollen, da, wo auch er hingewollt hatte, aber hinzukommen nicht den Mut fand – jetzt konnte sie nicht mehr. Sie kapitulierte vor der unrettbar verfahrenen, völlig absurden Situation, in der sie sich gerade verstrickt hatten. Gerade heute und hier, wo es endlich einmal nicht um ihn und seine ganzen Geschäfts- und Anwaltssachen gehen sollte, wo sie endlich einmal der Mittelpunkt sein sollte, wo sie gefeiert und umsorgt sein wollte, wo sie auf einen Heiratsantrag gewartet hatte, nur um wieder einmal vertröstet zu werden – gerade heute und hier sollte sie nun dasitzen, sich bei Kerzenlicht teures Essen und noch teureren Wein schmecken lassen und sich geduldig und verständnisvoll von ihrem Herzallerliebsten irgendwelche endlosen Beichten über andere Frauen anhören. Das ging nicht. Nicht hier, nicht jetzt. Tut mir leid, Jeremy.
Sie sprang auf. Sollten die Leute nur gaffen. »Jeremy. Ich habe heute Geburtstag, und du kannst dir deine Erklärungen sparen. Soll das dein Geburtstagsgeschenk sein, Jeremy? Dass du mich ins teuerste Lokal der Stadt einlädst, um mir dein Herz zu öffnen und von einer anderen Frau zu erzählen? Hast du nicht die Spur von Taktgefühl im Leib, du britisches Rhinozeros? Ich bin doch nicht der Abladeplatz für deinen Seelenmüll. Ich pfeif auf deine Erklärungen, Jeremy! Ich pfeif auf deine Erklärungen!«
Als sie spürte, wie ihr die Tränen kamen, sprang sie rasch auf, schnappte ihre Handtasche, und ehe Jeremy überhaupt begriff, was hier vor sich ging, war sie schon draußen. Ihr in diesem Zustand zu folgen, war zwecklos. Da war er ein gebranntes Kind. Ihr Feuergott.
Nachdenklich, ein wenig versteinert, blieb er sitzen. »Bitte zahlen«, sagte er irgendwann zum dienstfertigen Kellner, der die ganze Szene über danebengestanden und sich höchst verbissen bemüht hatte, korrekt zu wirken. Schade um das sündhaft teure Essen, dachte Jeremy, schade um ein Essen, das sie beide nicht angerührt hatten. Das sie nicht einmal zu Gesicht bekommen hatten. Da sollten zumindest die Getränke nicht verkommen.
Nachdenklich überprüfte Jeremy seinen Whiskyschwenker. Bis zur Neige. Dann schnalzte er mit der Zunge, griff nach dem herrenlos gewordenen drei viertel gefüllten Cocktailglas und leerte es in einem einzigen großen Zug. Was war da Metallisches in seinem Mund? Ach richtig, da war ja noch was.
Nein, er schluckte nicht. Er tat, als wolle er sich mit den Fingern einen Fleischrest – wovon? – zwischen den Zähnen entfernen, packte den Ring und verstaute ihn wieder in der kleinen roten Lackschachtel. Zwei hochkarätige Delfine in der Luft, über einem königsblauen Meer.
Vielleicht würde er ihn eines Tages ja doch noch brauchen.
Kyoto, 30. Dezember 1998. Später Nachmittag
Jeremy hatte die Weihnachtstage allein in Tokio verbracht, in der Kanzlei, wo er ungestört an seinem Fall arbeiten konnte. Er war nervös, die Zeit drängte. Während seiner letzten beiden Treffen mit Yukiko hatten sie nicht über ihren Vater oder die Einheit 731 gesprochen. Unausgesprochen hatte das Thema im Raum gestanden und ihre Unterhaltungen schleichend vergiftet – ihre Worte umschlungen, das Gespräch allmählich erwürgt, bis sich Totenstille zwischen sie legte. Jeremy hatte nicht den Mut aufgebracht, um nachzufragen, ob sie bei ihrem Vater etwas hatte in Erfahrung bringen können. Dass der alte Murata mit ihm, Jeremy, nicht über seine Vergangenheit sprechen würde, stand für ihn fest. Darüber machte er sich keine Illusionen. Aber würde er auch für die drängenden Fragen der eigenen Tochter nur ein taubes Ohr haben? Mittlerweile waren fünf Wochen verstrichen, seit er sie gebeten hatte, ihm bei seinen Recherchen zu helfen und Erkundigungen einzuziehen. Heute, dachte er, muss ich einmal nachbohren. Vor Monaten schon hatten sie ausgemacht, dass er heute nach Kyoto kommen würde, um den Jahreswechsel mit ihr zu verbringen.
Yukiko holte ihn am Bahnhof ab. Es war ein nasskalter Wintertag. Der böige Wind war unangenehm. Aber es war nicht nur das Wetter, was ihn frösteln ließ. Sie hatte sich verändert. Ihr Gesichtsausdruck war starr, ihre Körperhaltung seltsam versteinert. Steif und gehemmt fiel auch ihre Begrüßung aus. Der Kuss, den sie ihm auf die Wange hauchte, fühlte sich eisig an. Sie entschieden sich, in den Norden Kyotos zu fahren, zu einem ihrer Lieblingstempel, dem Jakko-in in der Nähe des Örtchens Ohara, der ihnen wegen der meditativen Stille im Tempelgarten besonders zusagte. Während der Fahrt fiel Jeremy auf, dass Yukiko häufiger als sonst in den Rückspiegel blickte.
Als sie den Tempel erreichten, hatten sie noch kaum ein Wort miteinander gewechselt. Nur leere Belanglosigkeiten. Sie schritten zwischen den bemoosten Bäumen des Gartens hindurch. An den kleinen Wasserfällen, dem Teich und der alten eisernen Laterne vorbei. Heute sagte Jeremy die Stille im Garten weniger zu. Nicht meditativ – lähmend war sie. Endlich fasste er sich ein Herz. »Liebling, erinnerst du dich noch, als ich dir von der Einheit 731 erzählte …«
»Frag mich bitte nie wieder danach«, entgegnete sie in einem scharfen, fremden Ton, den er noch nie von ihr vernommen hatte.
»Was hast du denn, Liebes?«, fragte er erschrocken, wollte sie beruhigen, umarmen und schützend an sich heranziehen. Aber als er sie berührte, zuckte sie zusammen, als hätte sie eine giftige Schlange gebissen, und entwand sich seinem Griff. Dabei entwich ihr ein leises Stöhnen. »Itai …« Jeremy blickte in ein schmerzverzogenes Gesicht. »Hab ich dir wehgetan?«, fragte er besorgt.
»Nein. Du hast mir nicht wehgetan.« Das »Du« hatte sie, wohl unbeabsichtigt, kaum hörbar betont.
»Aber du hast Schmerzen. Was ist passiert? Rede mit mir …!«
»Ich möchte jetzt gern zurückfahren, Jeremy. Mir ist kalt.« Yukiko sah sich verängstigt um. Sie wirkte wie ein gehetztes Tier. Wie in die Enge getrieben. Sie presste ihre Arme wärmesuchend an ihren zitternden Leib und ordnete mit einigen hastigen Bewegungen den langen Seidenschal, den sie heute eng um ihren Hals gewickelt trug. Nur für einen winzigen Moment konnte Jeremy den breiten blaulila Striemen sehen, der ihr vom Hals herab über die linke Schulter lief. Jeremy erinnerte sich daran, dass er einen ähnlichen Striemen schon einmal an ihr gesehen hatte. Vielleicht war es nicht der einzige Striemen an ihrem so makellosen Leib.
Entschuldige, eigentlich wollte ich dich da nicht mit hineinziehen.
Plötzlich spürte er ein lähmendes Druckgefühl in seinem Kopf. Was für ein gedankenloser Idiot er doch war. Und wie wenig er dieses Land und seine Sitten offensichtlich kannte. Und wie wenig Yukiko. Wie ein fernes Donnergrollen überkamen ihn die ersten Vorboten der sich anbahnenden Erkenntnis. Niederschmettern sollte sie ihn erst später. Die Erkenntnis, dass er einen riesengroßen Fehler mit möglicherweise unübersehbaren Folgen begangen hatte. Noch glaubte er, alles wiedergutmachen zu können.
Auch die Rückfahrt verlief größtenteils schweigend.
Etwa eine Stunde später gingen sie, zurück in der Stadt, Hand in kalter Hand durch den Botanischen Garten im Bezirk Sakyo-ku. Von hier aus war es nicht allzu weit zum Haus ihres Vaters am Kamo. Yukiko hatte den Wunsch geäußert, mit Jeremy noch einmal ihre Bank aufzusuchen, der sie seit über einem Jahr keinen Besuch mehr abgestattet hatten. Es begann schon zu dämmern. Der große Ginkgo streckte schwarz und drohend seine kahlen Äste in die aufziehende Dezembernacht, wie den Himmel um Erbarmen anflehende Hände.
Er spürte, dass sie ihm noch etwas zu sagen hatte, aber mit den Worten rang. Hatte sie es sich doch anders überlegt? Sollte sie begriffen haben, dass das Opfer ihrer Schmerzen nicht umsonst sein durfte? Wollte sie ihm helfen?
Dann sagte sie schnell: »Jeremy, du must heute Abend wieder nach Tokio zurück.«
»Wieso? Ich bin doch diesmal extra mit Gepäck da. Ich dachte …«
»Es tut mir leid. Ich kann nicht. Ich treffe mich mit einem anderen Mann. Vertrau mir, Jeremy.«
»Aber …« So viel war zu sagen. So viel, dass er nicht wusste, wo anfangen. Sie verschloss seine Lippen, traurig lächelnd, mit ihrem Zeigefinger. »Pass auf dich auf, Geliebter. Versprichst du mir das? Ich meine es ernst: Pass auf dich auf! Mehr als warnen kann ich dich nicht.« Dann drehte Yukiko sich um und ging langsam davon. »Vertrau mir, Jeremy.«
Jeremy wollte ihr folgen, aber irgendetwas hielt ihn zurück. Sooft er auch später an diesen Moment zurückdachte: Er konnte sich nicht erklären, was es war. Ein Gefühl der Angst und der Machtlosigkeit, der Fremdheit, das seine Beine und seinen Willen lähmte. Er solle ihr vertrauen, hatte sie gesagt. Sie würde schon zurückkommen.
Er blickte ihr hilflos hinterher, bis sich ihre zierliche Gestalt in der trüben Abenddämmerung verlor.
Für immer.
Shanghai, 2. Mai 2012. 22:15 Uhr
Er hatte etwa eine halbe Stunde am Stück geredet, und sie hatte schweigend zugehört. Jetzt schwieg auch er und wartete auf ihr Urteil. Freispruch oder Verbannung. Sie sagte immer noch nichts. Immerhin hatte sie sich äußerlich wieder beruhigt und ihr schien die Szene vorhin im »M on the Bund« nun doch eher peinlich zu sein.
»Magst du mich trotzdem noch ein bisschen?«, wagte er schließlich vorsichtig.
»Ach Jeremy«, sie schüttelte seufzend den Kopf. »Meinst du, das ist etwas, was man auf Kommando einfach an- oder abstellen könnte? Ich glaube, ich mag jetzt erst mal was zu trinken.«
»Ich hole uns was.« Jeremy stand auf. »Den kalifornischen Chardonnay?« Cathy trank bevorzugt die opulenten, gerne auch süßen Kreszenzen ihrer amerikanischen Heimat, auch wenn – oder gerade weil – Jeremy sie beständig als »industrielles Bubblegum« schmähte.
»Ich glaube, heute brauche ich ausnahmsweise auch einen Whisky.«
Jeremy nickte und stampfte davon; grimmig entschlossen, ihren ungewohnten Whiskywunsch als eine Art Zeichen des Willens zur trotz aller widrigen Prüfungen durchgehaltenen Treue zu interpretieren.
Sie blieb nachdenklich sitzen. Keine ermordeten Frauen. Kein Seitensprung. Kein HIV. So eine Art Studentenliebelei vor 13 Jahren, sich die Hörner abstoßen, weiter nichts. Sie könnte eigentlich ganz erleichtert sein, aber sie war es nicht. Er hatte damals in Japan eine andere Frau geliebt, was soll’s? Aber das war es nicht. Ihre Intuition sagte ihr, dass es nicht um dieses damals ging. Dass vielmehr diese Frau, oder was sie verkörperte, noch immer eine Bedrohung für sie beide war. Das sei längst Vergangenheit, hatte Jeremy beteuert. Aber jetzt kam diese grün-weiße Sendung, und auf einmal war die gesamte Gegenwart gleichsam wie vom längst Vergangenen aufgesogen. War das der Mann, mit dem sie ihr Leben teilen wollte? Wenn es Jeremy nicht gelang, mit dieser Vergangenheit fertigzuwerden, dann würde auch ihre Beziehung keine Zukunft mehr haben, das wusste sie. Sie könnte ihn heiraten und fortan dafür sorgen, dass sie sein weiteres Leben völlig unter Kontrolle hatte. Das konnte sie. Aber seine Vergangenheit würde sie nie unter Kontrolle haben. Die entglitt ihr, und das machte sie wütend. Sie war eifersüchtig auf diese Vergangenheit.
Und dann war dahinter natürlich noch diese ganze merkwürdige Geschichte mit seinem Pseudonym und dem Filmdrehbuch, den alten japanischen Kriegsverbrechen und den rätselhaften Leuten, die plötzlich auftauchten. Eine beängstigende Geschichte, gewiss. Vielleicht war Jeremy in Gefahr. Sie hatte das alles noch gar nicht begriffen. Wie auch – hatte er bei allem Ernst und aller Offenheit doch genauso fahrig und sprunghaft erzählt, wie er das den ganzen Tag schon tat. Da klafften noch große Lücken in seinem Bericht. Sie würde nachher dringend noch weiterfragen müssen. Jetzt beschäftigte sie erst einmal die Zukunft ihrer Beziehung.
Jeremy kam mit einer Flasche und zwei Kristallgläsern zurück. »Das Beste, was ich habe. Ein ganz besonderer Lagavulin. Die ›Distillers Edition‹ von 1979. 1997 abgefüllt. Fürs Finish einige Monate in speziellen Pedro-Ximenez-Sherryfässern gelagert.«
Danke, genau das, was sie im Moment brennend wissen wollte. Wenn er in anderen Bereichen nur auch so erzählfreudig wäre. Männer!
Sie schwiegen eine Weile, nippten an ihren Gläsern – schmeckte wie Whisky, befand sie, rauchig und scharf. Ein Faustschlag von Torf, Teer und Schwefel. Etwas für Masochisten. Sie war keiner. Sie gab gern den Ton an. Dann begann sie.
»Jeremy. Du hättest ein Jahr Zeit gehabt, mir davon zu erzählen, und du hast es nicht getan. Weißt du warum?«
»Es hat sich nicht ergeben …«
Sie beachtete ihn nicht. »Weil du dich schämst. Und warum schämst du dich? Kein Mensch schämt sich dafür, dass er vor 13 Jahren einen anderen Menschen geliebt hat als heute. Das ist die Regel. Du aber schämst dich. Soll ich dir sagen, warum?«
»Ich bitte dich darum, Cathy.«
»Weil das für dich gar keine Vergangenheit ist. Weil du sie immer noch liebst.«
Jeremy saß einen Moment stumm, dann schüttelte er den Kopf. »Nein, ich liebe sie nicht mehr. Menschen ändern sich, Cathy. Nach 13 Jahren ist kein Atom in deinem Körper mehr am gleichen Platz. Selbst wenn ich mir einbilden würde, dass ich sie noch liebe, würde ich doch nicht sie lieben, sondern die Erinnerung an etwas, das vor 13 Jahren gewesen ist. Ich bin kein nostalgischer Träumer, der sich an einer unwiederholbaren Vergangenheit aufgeilt.«
Cathy überlegte. »Mag sein, aber für mich spielt das letztlich keine Rolle, Jeremy. Ob du deine Erinnerung an eine andere oder die andere selbst mehr liebst als mich, ist mir scheißegal, verstehst du?«
Jeremy verstand. Sie war so eifersüchtig wie der Gott Israels. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben.
Wieder schwiegen beide. Dann fragte sie hart: »Hast du mit ihr geschlafen?« Jeremy schüttelte den Kopf. »Nein. Sie wollte jungfräulich in die Ehe gehen.«
»Gut.«
Gut. Was war denn daran gut? Dass Frauen immer so viel Wert auf die Äußerlichkeiten legen müssen. Er hatte mit diversen One-Night-Stands geschlafen. Er hatte mit Yukiko nicht geschlafen. So what? Zumindest das war nach 13 Jahren nun wirklich Vergangenheit.
»Ich will, dass du das endlich in Ordnung bringst, Jeremy.« Mit diesen Worten stand sie auf und verließ den Raum.
Hast du mit ihr geschlafen? Nein. Hatte er sie angelogen? Nein. Warum aber blieb dieses dumme Gefühl, trotzdem nicht die ganze Wahrheit gesagt zu haben? Schließlich hatte sie nicht gefragt, ob er mit ihr Sex gehabt hatte. Sex haben und miteinander schlafen – in Japan war das ein himmelhoher Unterschied. Das war wie mit der Prostitution. Die war in Japan streng verboten. Käuflicher Sex aber nicht. Verboten war einem Mann, gegen Geld mit einer Frau »zu schlafen«: Koitus. Was machte er also, wenn ihn die Sehnsucht quälte, er sich aber nichts Verbotenes zuschulden kommen lassen wollte? Er ging in ein Soapland oder einen Image Club, praktizierte Sumata oder ließ sich im Pink Salon, während er an der Bar sein Bier trank, ein Stockwerk tiefer umsorgen. Er ging befriedigt nach Hause, ohne etwas Ungesetzliches getan zu haben. Denn verbotene Prostitution war das ja nicht, er hatte mit der Frau nicht geschlafen. Und Jeremy hatte mit Yukiko nicht geschlafen. Doch er war kein Japaner und für ihn machte das keinen Unterschied. Vielleicht hätte er vorhin auf Cathys Frage doch Ja sagen müssen. Aber hätte er dann nicht gelogen?
Cathy kam zurück, scheinbar um sich nachzuschenken. »Ich möchte sie sehen.«
Was?
»Ich möchte sie sehen. Du hast doch sicher ein Bild von ihr.«
»Auf meinem Laptop«, sagte er mühsam. »Ich glaube, ich habe es heut Nacht im Suff als Bildschirmhintergrund eingerichtet.«
»Sagte ich’s doch«, sagte sie. »Ich bin ja so froh, dass du kein Nostalgiker bist.« Es klang eher spöttisch als patzig. Er brauchte nicht zu merken, wie verletzt sie sich fühlte.
Jeremy stand langsam auf, schlurfte hinauf ins Arbeitszimmer und kehrte nach einigen Minuten mit dem eingeschalteten Laptop zurück.
»Darf ich vorstellen«, sagte er. »Yukiko Murata.« Cathy starrte auf das Foto einer lächelnden zierlichen Japanerin mit dunkel glänzenden Augen und langem schwarzen Haar. »Sie ist sehr hübsch.« Ihre Stimme zitterte. »Jetzt weißt du es wenigstens«, sagte Jeremy leise.
»Was weiß ich?« Cathy musterte ihn kalt.
»Mein … dunkles Geheimnis.«
»Und jetzt?«, fragte Cathy.
»Jetzt ist sie tot. Wahrscheinlich. Vielleicht. Ich weiß es nicht. Aber egal: Ich fühle mich schuldig.« Cathy sah mit Unbehagen, wie ihm Tränen in die Augen traten. Er schniefte durch die Nase und wischte sich mit dem rechten Handrücken rasch über die Wangenknochen.
»Warum? Wem gegenüber?« Cathys Stimme war schneidend.
»Dir und ihr. Versteh mich bitte, Cathy: Ich habe sie damals in etwas hineingezogen. Ich hab das nicht gewollt. Zuerst hab ich das ja gar nicht erkannt. Oder zumindest nicht wirklich ernst genommen. Und als ich gemerkt habe, was ich angerichtet hatte, war es zu spät. Plötzlich hat sie sich nicht mehr gemeldet. Nach unserem letzten Zusammentreffen war sie wie vom Erdboden verschluckt. Und eine Woche später kam dieser Brief.«
»Welcher Brief?«
»Ihr Abschiedsbrief. Den habe ich noch hier. Aber wenn du hier überall rumwühlst, müsstest du ihn eigentlich schon längst kennen.«
»Jeremy!« Sie starrte ihn entrüstet an. »Ich wühle nicht in deinen Sachen! Ich war noch nie an deinem geheimen Aktenschränkchen. Das mit Julian Peek hab ich von Kim. Er hat mich vor dir gewarnt.«
»Kann ich mir denken, dass der dich vor mir warnt. Der große, selbstlose Kim! Wahrscheinlich hat er dir auch angeboten, dich gleich noch vor mir zu retten. Aber wieso weiß er von dem Drehbuch?«
»Keine Ahnung.«
»Das ist seltsam. Und diese betrunkene Japanerin wusste es auch …«
»Du bist da in irgendwas reingeraten, Jeremy, das macht mir Angst! Du must mir alles erzählen. Was hat das alles mit Yukiko zu tun?«
»Ich weiß es nicht. Willst du ihren Brief lesen?«
»Nein. Ich lese nicht die Liebesbriefe anderer Frauen an dich.«
»Es war, wie gesagt, ein Abschiedsbrief. Sie hat mit mir Schluss gemacht. Sie habe begriffen, dass unsere Beziehung keine Zukunft habe, schrieb sie. Dass wir uns zu fremd seien und unsere Kulturen zu verschieden. Ich solle ihr nicht böse sein, aber wir könnten uns nie wieder sehen.«
»Und du hast das natürlich sang- und klanglos so akzeptiert. Wahrscheinlich war sie einfach eingeschnappt, weil du sie wegen deiner Arbeit so vernachlässigt hast, und wollte dir eben mal einen Schuss vor den Bug geben, um zu sehen, ob du es auch wirklich ernst mit ihr meinst. Mein Gott, ich an ihrer Stelle hätte dich damals längst schon verlassen!«
»Nein, Cathy. Deine weibliche Intuition in Ehren – aber so war es nicht.« Er nahm einen neuen Schluck Distillers Edition. »Sie war plötzlich wie vom Erdboden verschluckt. Ihre Telefonnummer existierte nicht mehr, Briefe kamen zurück mit dem Vermerk ›Unbekannt verzogen‹, und auch im Promovierendenverzeichnis wurde sie nicht mehr geführt. Bei ihrer Kanzlei, wo sie ein Praktikum machte, war sie von einem auf den anderen Tag nicht mehr erschienen. Ich rief all ihre Freundinnen an, die ich kannte. Es waren nicht viele. Ich rief sogar bei ihrem Vater an. Mehrmals. Wenn dort überhaupt mal jemand an den Apparat ging, so legte er auf, sobald ich mich meldete. Nach mehreren Wochen der Trauer, der Wut, aber vor allem der Angst fasste ich mir endlich ein Herz und fuhr noch einmal nach Kyoto, begab mich hinaus an das alte Holzhaus am Kamo-Fluss, wo er wohnte. Mir öffnete eine hübsche junge Frau. Aber es war nicht Yukiko. Vielleicht eine entfernte Cousine. Sie sah mich angstvoll an und wollte mich wegscheuchen. Ich ging aber nicht. Dann kam der Alte.«
»Und? Hat er dir ordentlich den Hintern versohlt?«
Jeremy ging auf Cathys spitze Bemerkung nicht ein. »Im ersten Moment schien er sich auf mich stürzen zu wollen. Dann jedoch nahm er Haltung an und wurde auf eine eigentümlich eisige Art höflich. Seine Tochter sei zu einer fernen Tante gezogen, wo sie sicher sei vor meinen Nachstellungen. Ich solle sie bitte nie mehr belästigen. Sie habe mir doch klipp und klar mitgeteilt, dass sie nichts mehr mit mir zu tun haben wolle. Wenn ich es dennoch wagen sollte, Nachforschungen anzustellen oder ihr hinterherzureisen, würde es nicht nur mir schlecht bekommen. Er drohte also mit neuen Misshandlungen seiner Tochter oder Schlimmerem. Das hat er auch so gemeint.«
»Und du lässt dich von einem klapprigen Greis derart einschüchtern?«
»Ich weiß nicht, warum – und vermutlich klingt es unwahrscheinlich –, aber ich habe ihm geglaubt. Da schwang so ein Unterton mit in seiner Stimme … Da war nicht einfach nur Wut und Ausländerhass, Hass auf mich … sondern auch die Sorge eines Vaters um das Leben seiner Tochter.«
»Du meinst, das war gar nicht er selbst, der ihr diese Verletzungen zufügte, von denen du vorhin erzählt hast?«
»Cathy, ich weiß es nicht. Es gibt viele Väter, die ihre Töchter prügeln, weil sie Angst um sie haben. Ich weiß nur, dass ihr Vater nicht alleine war. Selbst dann, wenn die Striemen wirklich von ihm waren.«
»Und dann hat er dich aus dem Haus gejagt.«
»Wo ich schon einmal da war, wollte ich natürlich diese einmalige Gelegenheit nutzen, und so fragte ich ihn, ob er etwas Näheres über die Einheit 731 wüsste. Und ob er wirklich damals in Nanking war.«
»Und? Was hat er geantwortet?«
»Er sei Arzt gewesen und habe seinem Vaterland gedient. Er habe sich nichts vorzuwerfen. Doch sollte ich noch einmal über seine Türschwelle treten, sei ich ein toter Mann.«
Cathy war bemüht, sich nicht anmerken zu lassen, dass die Erwähnung der Stadt Nanking auch bei ihr Beklemmungen auslöste. Diese Yukiko hatte sich allem Anschein nach dafür eingesetzt, dass das Leid, dass man ihrer, Cathys, Familie zugefügt hatte, aufgeklärt würde. Und sie hatte teuer dafür bezahlt, vielleicht sogar mit dem Leben. Sie hatte aus Liebe Tabus gebrochen, sich für ihren Gaijin mit allen angelegt und das höchste Gut riskiert, das ein Japaner zu verlieren hat: seine Ehre. Sie hatte es nicht verdient, von Cathy behandelt zu werden wie ein bösartiger Eindringling, eine gemeine Nebenbuhlerin, die ihr ihren Jeremy wegschnappen wollte. Sie hatte Cathys Respekt und Mitgefühl verdient. Das wusste Cathy. Auch wenn sie momentan weder das eine noch das andere für sie empfand.
»Und dann? Du hast ihm also gehorcht. Und nicht weiter nach ihr gesucht?« Sie könnte nie so sein wie diese tapfere Japanerin, dachte Cathy. Gleichzeitig ärgerte sie, dass sie in ihrem Innern statt Hochachtung noch immer nur Eifersucht fühlte.
»Ich habe sie nicht mehr gefunden, Cathy.«
»Ach ja? Wahrscheinlich hast du nur nicht richtig gesucht, Jeremy. Sie hat dich gefunden. Nach all der Zeit. In einem anderen Land.«
»Stimmt.« Daran hatte er noch gar nicht gedacht. Wie war sie an seine Adresse gekommen? Er überlegte. »Es gibt jetzt Internet, Cathy. Und ich arbeite auch heute bei Lexman & Lexman. Mich kann man finden, wenn man will. Bei ihr war das damals anders. Es gab keine Spur. Und vielleicht hatte er ja sogar recht, ihr Vater. Bei unserem letzten Treffen war sie sehr eigentümlich. Kalt und, na ja, nicht direkt abweisend – aber distanziert. Irgendwie weit weg. Und sie sagte etwas von einem anderen Mann, was ich nicht verstanden habe. Ich hab es damals nicht ernstlich als Bedrohung aufgefasst, aber es hat mich beunruhigt. Und ihr Brief war völlig plausibel; vielleicht empfand sie wirklich so, du sagst ja selbst, du hättest in dieser Situation auch mit mir Schluss gemacht. Aber trotzdem war da irgendetwas … Etwas, was sie verbarg, was nicht angesprochen wurde.«
»Na, du bist ja selbst ein großer Spezialist im Nicht-Ansprechen …«
Was, wenn Jeremy die Liebe dieser Frau nur ausgenutzt hatte? Was, wenn Jeremy auch Cathys Zuneigung nur zu seinem eigenen Vorteil ausnutzen wollte? Vielleicht, weil er doch bloß einen einigermaßen intelligenten, attraktiven Bettwärmer benötigte? Um dann eines Tages auch von ihrer Seite zu verschwinden – wenn sie ihren Zweck erfüllt hatte.
»Das war jedenfalls alles nicht die ganze Wahrheit. Und deshalb wollte ich mich nicht zufriedengeben, suchte weiter nach ihr, wollte einfach nur noch ein einziges Mal direkt und offen mit ihr über alles sprechen. Das ging ein paar Monate so, bis …« – »Bis?« – »Es hing ja alles zusammen. Yukiko, ihr Vater, Einheit 731, Kuroi, der Prozess, meine Beförderung zum Partner bei Lexman & Lexman …«
»Mir ist immer noch nicht ganz klar, was das eigentlich für ein Prozess war, Jeremy.«
»Du, so ganz ist mir das selbst nicht klar. Prozesse sind kompliziert, Cathy. Es ging um viel Geld und vor allem um Gerechtigkeit für viele Menschen, die durch ein fehlerhaftes Medikament geschädigt oder gar getötet worden sind. Und Kuroi, die Firma, gegen die wir klagten, ist so ein riesiger japanischer Mischkonzern, der vor allem in der Chemie- und Pharmabranche operiert. War erst kürzlich wieder in den Schlagzeilen, weil Kuroi ein Medikament gegen Strahlenschäden entwickelt haben will. Zufällig gerade jetzt, nach Fukushima. Wahrscheinlich haben sie wieder nur so ein zweifelhaftes Präparat aus ihren alten Kriegsforschungen ausgegraben, dessen Nebenwirkungen größer sind als dessen Nutzen – an dem diese Halunken aber wieder Milliarden verdienen werden.«
»Ja, ich erinnere mich, da was gelesen zu haben. Aber bleib jetzt bitte beim Thema, Jeremy. Und bleibe sachlich.«
»Okay, Entschuldigung, Cathy. Wie gesagt, das ging noch ein paar erfolglose Monate so weiter mit meiner Sucherei nach Yukiko, bis mir das Ganze einfach über den Kopf wuchs und die Kanzlei nicht mehr mitmachte. Als ich im April noch immer kein neues belastendes Material in der Hand hatte, gab man bei Lexman & Lexman die Sache auf. Verstehst du? Ich hatte zwei Jahre meines Lebens mit der Angelegenheit zugebracht, von morgens bis nachts geackert und nicht nur meine Beziehung komplett vernachlässigt, sondern sie zum Schluss sogar regelrecht geopfert – und auf einmal sollte alles umsonst gewesen sein. Da habe ich hingeschmissen. Ihr könnt mich alle mal, hab ich gesagt. Und bin ausgestiegen.«
»Moment, du arbeitest doch immer noch bei Lexman & Lexman.«
»Richard Koo hat mich wieder in die Kanzlei geholt. Allerdings erst nach über zehn Jahren …« Cathy riss ihre Augen auf. Jeremy lächelte hilflos. »Ich hab dir doch manchmal von meiner Jacht erzählt und von meinen Fahrten in der Südsee. Das waren keine Urlaubstrips. Das waren diese zehn, zwölf Jahre. So viel zum Thema lückenloser Lebenslauf. Ich hatte das Leben satt. Ich hatte mich von meinen Idealen verabschiedet. Ich wollte kein gutverdienender Pseudo-Weltverbesserer mehr sein, der letztlich alles doch nur komplizierter und schlimmer macht. Und weil ich eigentlich nicht arbeiten muss, entschied ich mich dazu, die Jacht ›Hebridian Spirit‹ zu kaufen und auf den Routen Jack Londons durch die Südsee zu schippern. Ich hatte gedacht, ich könnte mir wie er mit einem Drink in der Hand meinen ganzen Weltschmerz von der Seele schreiben. Da kam dann Julian Peek ins Spiel. Aber zum Schriftsteller hat es nicht gereicht. Julian Peek hat noch nie ein Buch veröffentlicht. Seine Manuskripte wurden abgelehnt. Immerhin habe ich in der Zeit drei Japan-Romane verfasst – und ein Drehbuch.«
»Und wie kommt ausgerechnet Kim Park auf deinen Künstlernamen?«
»Hab ich doch schon gesagt: Keine Ahnung. Meine Manuskripte habe ich hier verschlossen in meinem Aktenschränkchen. Wenn nicht du oder ein anderer da rangegangen ist, dann wird es eng. Selbst die Verlage, die ich damals angeschrieben habe, wussten nicht, wer ich wirklich bin – hat die auch nie interessiert. Wenn ich es mir überlege, gibt es nur einen einzigen Menschen, dem ich das Drehbuch je gezeigt habe.«
»Einer reicht. Und wer ist das?«
»Wir haben uns vor ein paar Jahren auf Samoa kennengelernt. Ich habe ihm damals einen großen Gefallen getan, aber das ist eine andere Geschichte und gehört jetzt nicht hierher. Irgendwie wusste er wohl über meine frühere Tätigkeit bei Lexman & Lexman Bescheid, denn plötzlich fing er an, mir Dinge zu erzählen, die entfernt mit der Kuroi-Sache zu tun hatten. Und irgendwann fing dann auch ich an zu erzählen. Und so haben wir uns allmählich angefreundet. Wir treffen uns heute noch regelmäßig.«
Cathy seufzte. Sie hatte gedacht, einen recht guten Überblick über Leben und Kontakte ihres Butterstinkers zu haben. Und jetzt tauchten wie selbstverständlich ständig neue gute Bekannte auf, von denen sie noch nie etwas gehört hatte.
»Darf ich bitte wissen, was das für ein Freund ist?«
»Ein reicher Chinese.«
»Geht es noch etwas genauer? Wieder eine von deinen vielbeschäftigten und öffentlichkeitsscheuen Bekanntschaften? Wie unser zwielichtiger Vermieter? Wie viele von diesen merkwürdigen Leuten kennst du denn noch?«
»Wie du schon sagst: Einer reicht.«
»Du sprichst also von unserem Vermieter – Gao Feng?«
»Du sagst es.«
»Okay, Jeremy. Weiter: Julian Peek, Gao Feng, Kim Park – was haben die alle miteinander zu tun?«
Nachdenklich knetete Jeremy seine Unterlippe. »Gao Feng ist außer Richard Koo der einzige Mensch, der von meinem Japan-Desaster weiß. Irgendwann habe ich ihm sogar meine Romanversuche zu lesen gegeben. Er fand es sehr interessant, wie ich darin diese Japan-Geschichte verarbeite, und ermunterte mich dazu, es mal mit einem Drehbuch zu versuchen. Etwas, was den Stoff neutraler und prägnanter auf den Punkt bringt. Er hat mir sogar ein paar Lehrbücher mitgebracht. Und mich immer wieder mit neuen Hintergrundinformationen gefüttert. Der hat da ein ganz umfangreiches Archiv. Also habe ich mich hingesetzt und ein Drehbuch über die ganze Sache geschrieben, so wie ich es sah. Eine wütende Generalabrechnung mit Japan.«
»Yellow Submarine.« – »Exakt. Als wir uns dann später auf Fidschi getroffen haben, habe ich es ihm zu lesen gegeben. Und Gao fand’s gut. Allerdings auch äußerst brisant. Er bat mich sogar um eine Kopie.« – »Und dann?« – »Dann habe ich von ihm nie mehr etwas über den Film gehört. Und auch von sonst keinem Menschen. Bis heute. Oder vielmehr gestern Abend.«
»Du weißt, dass Kim Park Filmproduzent ist?«
»Natürlich. Und mit Gao bin ich … morgen zum Lunch verabredet. Ganz entgegen unserer sonstigen Gewohnheit, sozusagen außerplanmäßig.«
»Hat er dir einen Grund genannt?«
»Gao nennt nie irgendwelche Gründe. Nicht vorab jedenfalls. Und jetzt habe ich genügend Gründe. Er wird sich morgen schon ein paar Fragen von mir gefallen lassen müssen.«
Cathy runzelte die Stirn. »Du sagtest doch eben ›eine Abrechnung mit Japan‹. Und dann hat dieses betrunkene japanische Pseudo-Schulmädchen Kumiko Satori auf meiner Party Kim Park zutiefst beleidigt und danach ausgerechnet Yellow Submarine gesungen … Wie hängt das zusammen? Wollte sie dir drohen?«
»Cathy, ich habe nicht die geringste Ahnung.«
»Warum sollte ich diesen Satori eigentlich einladen?«
Jeremy kratzte sich an der Nase. »Jetzt, wo du es sagst, fügen sich ein paar Puzzleteile zusammen – aber richtig zu passen scheinen sie noch immer nicht. Nehmen wir mal an, Satori ist Statthalter der Yakuza in Shanghai oder agiert im Auftrag sonstiger dubioser japanischer Interessengruppen und wird von seinen Auftraggebern auf unsere Kanzlei angesetzt – genauer gesagt auf mich. Den Japsen kann es ja nicht recht sein, wenn ein Film wie Yellow Submarine produziert wird. Wie er vom Drehbuch Wind bekommen haben soll, ist mir allerdings noch schleierhafter als im Fall von Kim Park; aber egal – offenkundig wussten jedenfalls auch Satori und Frau davon. Und nehmen wir weiter an, hinter Satoris Firma, dieser angeblich so einflussreichen, aber tatsächlich kaum bekannten Waguni, verbirgt sich in Wahrheit eine einflussreiche Firma ganz anderer Art: Nehmen wir also an, dass es sich dabei tatsächlich eher um so etwas wie ein Geldwäsche-Unternehmen der Yakuza handelt, so eine halblegale Tarnung für die kriminellen Machenschaften irgendwelcher verwickelter Netzwerke innerhalb der Japan Inc. Wenn dem alles so ist, dann … dann habe ich mir da ein paar mächtige Feinde gemacht. Diese Typen fackeln nicht lange.«
»Und just in diesem Moment bekommst du zu allem Überfluss auch noch Post von deiner tragisch unerfüllten Liebe aus Japan.« Cathy nippte an ihrem Whisky. Schließlich richtete sie sich auf. »Jeremy. Da braut sich irgendwas zusammen, und meine journalistische Nase sagt mir: nichts Gutes.« Beide saßen sie einen langen Moment schweigend. Jeremy stand auf und schloss das Fenster. Er schien zu frösteln.
Plötzlich fuhr Cathy zusammen und tippte sich an die Stirn. »Er hat es in der Hand gehalten! Ja: Er hat dir wirklich hinterherspioniert.«
»Wer? Was?«
»Na, dieser Satori. Auf der Party. Ich wollte dich anrufen, und da stand er im Flur und hatte das Päckchen in der Hand. Es lag ja zuerst offen auf dem Frisiertisch. Dann erst habe ich es weggeschlossen.«
»Was? Um Himmels willen – ich muss gleich morgen früh diesen Joe anrufen. Warum hast du mir nicht davon erzählt?«
»Jeremy. Ich hab gedacht, das sei ein harmloses Geburtstagsgeschenk. Von dir. Für mich. Da war überhaupt nichts verdächtig. – Und wer ist jetzt plötzlich Joe?« Sie hatte endgültig genug von diesen ständig neu auftauchenden unbekannten Namen.
»Joe? Anscheinend ein Bruder, von dem sie mir aus irgendeinem Grund nie erzählt hat. Weißt du, wenn dieser Satori tatsächlich ein krimineller Japaner ist, der mich ausforschen wollte, dann ist Yukiko jetzt in größter Gefahr!«
»Wenn sie tot ist, wie du sagst, dann hat sich diese Gefahr ja wohl erübrigt, oder?«
»Ich weiß nicht, ob sie tot ist. Sie hat ihrer Sendung ein Blatt mit einem einzigen handgeschriebenen Satz beigefügt: ›Lieber Jeremy, wenn Du diese Zeilen liest, habe ich endlich meinen Frieden gefunden.‹ Das hört sich doch nach dem Abschiedsbrief einer Lebensmüden an, oder?« Er hielt inne. »Es könnte aber auch heißen, dass … dass …«
»Dass sie dir gegenüber eine Verpflichtung gefühlt hat, die sie nicht zur Ruhe kommen ließ. Vielleicht weil du ihr einmal eine Art Auftrag erteilt hast, und den hat sie jetzt endlich erledigt. Der lag ihr die ganze Zeit schwer auf der Seele, und jetzt, wo sie’s hinter sich hat, hat sie ihren Frieden gefunden. Warum sollte sie sich gerade in dem Moment umbringen?«
»In Japan hat der Selbstmord eine große Tradition, Cathy, und gilt in einer ganzen Reihe von Situationen letztlich als der einzige einigermaßen ehrenhafte Ausweg. Lieber Selbstmord als Schande.«
»Sie hat also für dich irgendeine Schande auf sich genommen …« Cathy lag mit ihren Vermutungen und Schlussfolgerungen demnach ganz richtig. »Ihre Ehre geopfert. Was wäre denn eine solche todeswürdige Schande?«
Jeremy sah sie mit gequältem Blick an. »Zum Beispiel die Ehre und das Andenken der eigenen Familie zu verraten. Das ist nämlich, wie du vielleicht mittlerweile begriffen hast, in gewisser Hinsicht genau das, was ich damals von ihr verlangt habe: Sie sollte ihren eigenen Vater ausforschen, damit ich die Ergebnisse in meinem Prozess verwenden kann. Ihren Vater, der höchstwahrscheinlich ein hochdekorierter Kriegsverbrecher war. Ein Verbrecher gegen die Menschlichkeit.«
Sie fixierte ihn starr. »Jeremy, du machst mir Angst. Ich weiß nicht, ob ich einen Menschen heiraten würde, der bereit ist, für seine Arbeit über Leichen zu gehen. Und nicht irgendwelche Leichen!« Leiser fügte sie hinzu: »Die Leichen der Frauen, die sich für ihn aus Liebe opfern. Aber ich bin nicht wie deine Yukiko.«
»Cathy, jetzt mach aber mal einen Punkt! Tu doch nicht so dramatisch! Ich war jung und naiv – und allzu unbekümmert, meinetwegen. Gedankenlos. Aber ich habe von alledem doch nichts geahnt. Erst, als es zu spät war. Erst hinterher, als sich die ganze rechtliche Situation um die Kuroi-Klage zu unserem Ungunsten zuspitzte und ich immer mehr Einblick in die Verquickung von Politik, Wirtschaft, Bürokratie und Yakuza bekam, in dieses ganze System aus Korruption und Gemauschel, das die Japan Inc. charakterisiert, da begriff ich wirklich, in was ich sie mit meiner unbedachten Bitte hineingezogen hatte. Und, glaube mir, ich habe bitter dafür bezahlt.«
»Deine instrumentalisierte Freundin anscheinend auch.«
»Ich habe sie nicht ›instrumentalisiert‹ … Ich hab sie nur um Hilfe gebeten. Und sie etwas gefragt, was ich nicht hätte fragen sollen.«
»Wie auch immer: Jedenfalls scheint sie ihren Auftrag letztlich doch noch erledigt zu haben.« Sie musterte ihn ernst. »Und was ist jetzt dein Auftrag?«
»Wie meinst du das?«
»Was ist denn genau in dem Päckchen? Zwei DVDs sagtest du? Ich nehme an, es handelt sich nicht nur um lauschige Erinnerungsfotos von damals? Was will sie noch immer von dir?«
Jeremys Körper straffte sich. »Mag sein, dass ich dich zutiefst enttäuscht haben sollte, Cathy. Mag sein, dass ich dafür alles Mögliche verdient habe. Du kannst mich strafen, wie du willst. Aber sie hat damit nichts zu tun, und ich verbitte mir, dass du weiter in diesem schnippischen Ton über sie redest.« Jeremy hatte leise, aber bestimmt gesprochen. Cathy schwieg. Doch sie forderte ihn mit ihrem Blick auf, fortzufahren.
Jeremy räusperte sich. »Ich habe das Material bisher nur ganz oberflächlich sichten können. Zu mehr war ich gestern Nacht nicht mehr fähig. Aber wie es scheint, hat sie die ganzen Jahre dazu genutzt, heimlich neue Informationen zu sammeln. Sie hat brisante Dokumente entdeckt, die belegen, dass Kuroi-Juchi das schadhafte ›Virovital‹-Medikament im Wissen um dessen verheerende Nebenwirkungen auf den Markt gebracht hat. Und die haben noch sehr viel mehr Dreck am Stecken. Es scheint, wenn ich es recht verstanden habe, eine Verbindung des Topmanagements zur Einheit 731 und den Massakern von Nanking zu geben. Und ihr Vater, die rechte Hand von Firmengründer Ishii, war da mittendrin.«
»Also kennst du deinen Auftrag?«
»Ja. Ich soll die Wahrheit ans Licht bringen und Gerechtigkeit herstellen. So lautet ihr Auftrag an mich – ihr Vermächtnis. Das bin ich ihr schuldig.«
»Ihr und mir und den Opfern von Nanking. Diese ganze Sache mit den japanischen Verbrechen an China geht schließlich auch mich etwas an; Yukikos Vermächtnis ist eine ehrenwerte Sache. Das weiß ich ja selbst. Sorry, wenn ich manchmal schnippisch bin.« Es kostete sie sichtlich Überwindung, das zu sagen. »Ich ärgere mich nur, weil ich … weil ich nicht so – groß bin wie sie.«
Sie blickte ihn scharf an. »Jeremy. Ich erwarte, dass du diesen Auftrag annimmst. Nimm ihn an, weil du sonst niemals zur Ruhe kommst – und begrabe dann deine Vergangenheit. Du bist schon viel zu lange mit deiner idiotischen Lebenslüge herumgelaufen.« Mit Erschrecken nahm sie wahr, dass Jeremy zu schluchzen begann. Es gab kaum etwas, was sie so abgrundtief verabscheute wie heulende Männer. »Wirst du jetzt endlich ein Mann sein?«, herrschte sie ihn an. »Was wirst du jetzt tun?« Jeremy blickte hoch. Er wischte sich mit dem Hemdsärmel seine Tränen ab, sah sie an und zuckte die Schultern.
»Also«, sagte sie, plötzlich wieder in einem sehr gefassten, sachlichen Ton. »Fassen wir noch einmal zusammen: Du hast damals in Japan diese Frau kennengelernt, dich in sie verliebt, mit ihr ein Verhältnis begonnen und zugleich versucht, daraus einen Vorteil zu ziehen, indem du sie in deinen Prozessangelegenheiten auf ihren eigenen Vater angesetzt hast. Daran ist eure Beziehung zerbrochen und du hast vermutlich mehr oder weniger ihr Leben zerstört. 13 Jahre später meldet sie sich wieder, schickt dir neues brisantes Material und kündigt ihren Selbstmord an. Oder was auch immer. Sie hat dich also nie vergessen, der Fall ließ ihr offenbar keine Ruhe, und dann hat sie irgendwann doch das Verbot ihres Vaters ignoriert – vielleicht als er tot war. Und jetzt hast du ihr endgültiges Abschiedsgeschenk: neue Details über Kuroi, diese ganzen Nanking-Gräuel, die teuflische Einheit 731 und hoffentlich Aufschlüsse, wie das alles zusammenhängt. Mit anderen Worten: Sie hat dir alles vererbt, was sie hatte. Und du hast jetzt einen Auftrag. Eine Sendung.«
»Was soll ich also deiner Meinung nach tun?« Jeremys Stimme klang heiser.
»Du weißt viel besser, was zu tun ist: Flieg nach Japan, klär die ganze Sache auf und komm erst wieder zurück, wenn du dir sicher bist, den ganzen Fall neu aufrollen zu können.«
»Und was ist, wenn Yukiko noch lebt? Was ist, wenn ich sie in Japan treffe?« Cathy schnaubte verächtlich. Auch wenn ihr beklommen zumute war. »Hast du etwa Angst? Das wolltest du doch. Hast du vorhin nicht gesagt, du wolltest noch ein einziges Mal direkt und offen mit ihr sprechen? Dann tu’s! Nach allem, was ich heute Abend begriffen habe, hast du in Japan sicher Schlimmeres zu befürchten als eine lebende Yukiko. Pass auf dich auf, Jeremy.«
Sie warf einen Blick auf die Standuhr. Es war mittlerweile weit nach Mitternacht. Sie stand auf, streckte sich und gähnte herzhaft. Dann sah sie Jeremy an und sagte ruhig: »Tja, aus unserer kleinen Reise nach Hainan wird wohl nichts.«
Jeremy nickte. »Vielleicht später?« Sie zuckte die Schultern. »Ich weiß es nicht. Flieg jetzt erst mal nach Japan. Alleine. Klär deine Vergangenheit. Mach dir klar, was du willst. Ich werde das auch tun. Gute Nacht.« Mit diesen Worten verließ sie das Wohnzimmer.
Jeremy nahm alle Kraft zusammen. »Cathy?«
Im Türrahmen drehte sie sich noch einmal um.
»Ich wollte dir heute auch noch etwas anderes sagen.«
»Wirklich?« Sie sah ihn mit einem unendlich mitleidigen Blick an. »Weißt du was: Sag’s mir auf Hainan, ja?« Schon auf der Treppe, fiel ihr noch etwas ein. »Ach ja – und mir wäre es ganz recht, wenn du heute Nacht auf der Couch schlafen würdest.«
»Natürlich. – Klar.«
»Sind ja genug Decken da.« Jeremy hörte, wie die Türe des Schlafzimmers in Schloss fiel; etwas lauter als vielleicht notwendig. Er hörte auch, wie sich, leiser, ein Schlüssel drehte. Beinahe schon automatisch griff er nach seinem Glas. Distillers Edition, 1997 abgefüllt. »Du musst dein Leben ändern, Kumpel«, flüsterte er sich zu, »und zwar ganz schnell.« Er dachte an Cathy, dann Yukiko. Dann Cathy. Cathy und Yukiko. Vergangenheit und Gegenwart. Zwei Lieben, von denen die eine noch immer nicht verblasst war und die andere noch nicht gereift. Vielleicht nie mehr reifen würde. Cathy oder Yukiko. Vergangenheit und Gegenwart drohten ineinander zu verschwimmen. Genauer: wie verschlingende Tsunami-Wogen von zwei Seiten über ihn hereinzubrechen. »Nein, Jeremy«, fuhr er fort, »sag nicht, dass du dein Leben ändern musst. Sag lieber, dass du das möchtest.«
Was sollte er jetzt tun? An Schlaf war nicht zu denken, auch wenn er schon die Nacht zuvor wenig geschlafen hatte. Jeremy entschloss sich, mit dem Rest der Nacht etwas Sinnvolles anzufangen und Yukikos Material zu sichten. Dafür müsste er nicht einmal in sein Arbeitszimmer hinaufgehen. Das aufgeklappte Laptop lag in Griffweite und glotzte ihn schwarz an. Er drückte den Knopf, und es erwachte aus dem Stand-by-Modus.
Da waren sie immer noch, die leuchtenden Augen Yukikos.