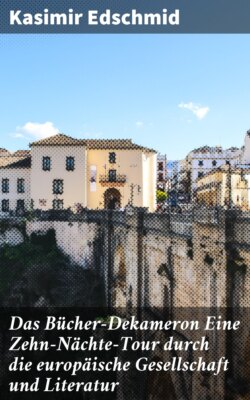Читать книгу Das Bücher-Dekameron Eine Zehn-Nächte-Tour durch die europäische Gesellschaft und Literatur - Kasimir Edschmid - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Die erste Nacht
ОглавлениеInhaltsverzeichnis
Die Mäuse huschen unter den Heizungsrohren durch die Zimmer. Erschrecken Sie nicht, wenn die Fallen klappen. Elf Uhr. Die elektrischen Bogenlampen draußen auf den Fahnenmasten für die Verirrten dringen keine zwanzig Meter in diese Nacht.
Das dumpfe Dröhnen sagt, daß der Neufundländer Bary vom Hebelhof diese Nacht nicht im Schnee schlafen kann und morgen nicht seine Geliebte, die Wolfshündin auf Herzogenhorn besuchen wird. Als wir vom Blösling das erstemal in der Lawinenzeit unter den Wächten herkamen und uns die schöne Frau mit dem Monocle und die beiden Badener von der Terrasse des Blockhauses, das unten mitten in der Ebene stand und jede Minute weggewischt ward von Schneewehen, mit Posaunen und Reiterdrommeln begrüßten, wie lachten wir vor Wonne über die Musik, die man wie ein Geschoß uns entgegenknallte . . . . . . aber wie entsetzten wir uns, als über der Grafenmatte mitten im Schußfeld wir Bary zum erstenmal erblickten, der unfehlbar einem schwarzen Bären glich, und wie umfuhren wir ihn mit entsetzten Schwüngen.
Denn der Wechsel von Licht und Schnee war so gespenstisch, daß uns kein Tier der Urzeit erstaunt hätte, wäre es aus diesem von Sonnenkanonaden und Luftspiegelungen durchwehten Tag aus der Landschaft herausgetreten, über die wir wie Götter herabkamen, achtzig Kilometer Stundengeschwindigkeit, auf Hickorys, immer neue schier unabsehbare Terrassen von Hängen hinunter. Nun sitzen wir auf den Fenstern und starren bei Kerzenschein in die Nacht. Kommt uns ein Echo zurück aus dem Brausen?
„Was nun ist deutsch?“, fragt Ihr Auge, Mijnheer, frug es schon oft an meinem. Frug es, als man den jungen Springer vom Hügel gestern brachte, der, als die Chirurgen die scharfen Knochenenden in den Oberschenkel zurückspießten, Ziehharmonika spielte. Es war schneidig, doch ich sah dasselbe bei Blériot. Sie frugen, ohne zu reden, das Gleiche, als hinter Konstanz ein Rotbart ins Coupé schaute und ehe er Platz nahm, schrie: „Sind Juden drin?“ Das war nur untermenschlich. Sie sagten einmal, daß in Ihrer Jugend in Grénoble, als französische Studenten den wahren Mut der Deutschen bezweifelten, ein alemannischer Skulptore vor Ihren Augen am Tisch des Cafés sich die Brust aufschnitt. Das war barbarisch aber nett. Nicht deutsch. Nun fragen Sie ernstlich und wollen eine Antwort, rund und klar und voll Verantwortung. Das ist nicht leicht. Das ist unmöglich.
Was ist italienisch, was spanisch? D’Annunzio oder Michelangelo? Cervantes oder Goya? Ein Teil jeder Nation würde jeden dieser Reflektanten bestreiten. Die Deutschen haben aber sogar in der Gesamtheit den Sinn für das wirklich nationale Grundgefühl verloren und sich falsche Götter aufgebaut. Goethe ist eine völlig romanische Mischung. Und Schiller hat das Pathos, nach dem sie sich vergeblich sehnen, weil sie es nicht wie die Romanen im Blut besitzen. Die Weimarer Tradition hat mit keiner deutschen Vergangenheit irgend etwas zu tun. Diese Klassik ist der stehengebliebene Wunsch der deutschen Germanen nach der südlichen Erlösung, der sie früher mit Schwerten und Kreuzzügen dienten. Rodin, der bestimmt Germanisches in seinem Wurf besaß, hielt die griechische Kunst nicht für mehr als gute Geometrie. Ein wahrhaft innerlich deutscher klassischer Stil würde nie bei dem von Pelasgern bewohnten Griechenland anfangen, die uns bei allem Neid auf ihre Vollendetheit so wesensfremd sind wie Chinesen und uns nur durch die Renaissance als Blutsbrüder vorgetäuscht wurden. Sondern er würde sich in jener Herbe erfüllen, die von den Domportalen her, von Mäleskirchner und Cranach, den Sängern des Nibelungenliedes, von Ekkhart, von Fischart, von Grünewald ausgeht und aus einer barocken Fontäne in einen stillgewordenen Himmel hinein sich formt.
Eher ist der Bamberger Platz bei all seinem Chaos deutsch, der immerhin einen Riesenwurf darstellt von dem romanischen Geist des Doms an über die Paläste der Renaissance und des Barock bis zur Schlußgestaltung des monumentalen Raums, als daß Deutsch sich offenbare in jener nichts-als-harmonischen Geste, auch wenn sie die größte Begabung, die je den Deutschen ward, zelebriert.
Dazu braucht es anderes Klima und anders vor Wonne des reinen Seins geschüttelte Himmel. Das Deutsche hat immer als Reiz, selbst in seiner landschaftlichen Atmosphäre den unbestimmbaren Hintergrund getragen, und war immer fern der farbigen Plastik, mit der die Südländer ihre Gebärden schließen. Constant, der gescheiteste Franzose, der gleichzeitig Deutschland, in dem er Jahre lang hörig hinter der Staël herreiste, heiß liebte, hat Goethes zentrale Schwäche rasch durchschaut. Denn er spürte unfehlbar, wo das schönste Genie der Deutschen abbog von seiner Bestimmung, die Menschen in Liebe zueinanderzuführen, indem es keine Stellung nahm zu ihren kriegerischen Konflikten, und statt in den geistigen Kampf zu jagen, einbog in die Verherrlichung einer Klarheit, die bei Deutschen nie Inhalt sondern nur Fassade sein konnte. Constant hielt den „Faust“ daher für eine Verhöhnung des Menschengeschlechtes und stellte Voltaires „Candide“ darüber, den er zwar gleich unmoralisch und dürftig aber geistreicher und besser gemacht fand. Teutonische Ajaxe werden dies Urteil unerhört finden, weil sie die Welt nur zwischen Elbe und Rhein und mit viel Vorurteilen gemalt sehen. Es ist jedoch nur gerecht. Denn andere Völker sehen mit Puppille, wie ihre Leidenschaft am idealsten sich in der entsprechendsten Form löst.
Die Deutschen haben aber keinen Sinn mehr für ihre Eigenart, verehren Götter, die keine sind und Heroen, die sich als Puppen aus falschen Sentiments entschleiern. Deutsch ist daher fast nie, was die heutigen Deutschen lieben, deren Andachtsheißhunger vor allem Anders-Seienden sie in Ideale hineinreißt, die andere, nur nicht sie selbst besitzen. Sie lieben entweder das Sentimentale, das klassisch aussieht, im Grunde aber Lüge ist. Oder sie verehren das unvollkommen Dunkle, das nicht das groß Barocke, sondern die eitle Ohnmacht von Narren ist, die ihre Schwäche damit verbergen. Stellen sie aber einmal ein Denkmal von Qualität auf ihre Landschaft, in der die verlogenen Feldmarschallbilder des Tuaillon mit erbärmlicher Glätte neben dem Kölner Dom stehen, so stellen sie Figuren Meuniers auf die Frankfurter Mainbrücke, die zwar Kunst sind, aber den nationalen Ausdruck wallonischer Fischer und nicht deutscher Seeleute ausdrücken.
Deutsch ist nicht das unvollkommen gestaltete Klare, sondern das im Dunkel ringend Gebaute. Deutsch ist nicht der magyarische Melancholiker Lenau aber etwas an Grabbe. Deutsch ist nicht Herr von Münchhausen, der einfach einen Panzer umtat und blödsinnig mit kriegerischem Gebrüll das Maul aufriß, wie er es für adlig hielt, aber sicher etwas von Richard Dehmel. Deutsch ist nicht etwa jener mit Kothurn auftretende Gott der Langeweile, der mit Paul Ernsts gesammelten Schriften am Arm erscheint, aber sicher etwas von der Malerei des Max Beckmann. Deutsch ist nicht das dumme hohle Zeug, das mit klassischem Jambus Herr von Wildenbruch in anständigster Gesinnung verbrach, aber sicher etwas in den tollen Phantasien des Architekten Poelzig, dem Deutschland keine Bauaufträge gibt. Deutsch ist vor allem nicht Gerhart Hauptmann, aber sicher etwas in Wedekind.
Was hat gerade diese sehr starke Begabung des Naturalismus, dieser Schlesier Hauptmann Unrechtes getan, daß ihn die jüdischen Literaten aus Respekt vor seiner arischen Rasse als Repräsentanten deutschen Wesens der Welt mit begeistertem Finger zeigen? Er ist der blendendste Beweis für den Irrtum, alles Halbe und Sentimentale, alles Greise und Weibisch-menschliche sei Deutsch, wenn es nur von Mondschein und einer gewissen hellen Hilflosigkeit übergossen sei . . ., während der blitzende Genius Wedekind, der sich ohne weiteres in die Kette der barocken Meister einordnet und der aus dunkelster Wirrung ein metallisches Werk hingab, von allen Hunden und Untermenschen Deutschlands noch heute zerfetzt wird. Was hat die badische Exzellenz, der Wirkliche Geheime Rat Dr. Hans Thoma Unrechtes getan, daß er, der den Schwarzwald wahrlich mit einer Fülle des Gefühls wie wenige malte, aber ungeheuerliche Dinge an Heiligen und Madonnen nebenher, daß an ihm bewiesen ward, Mondschein und Geige und jene penetrante Innigkeit der falschen Sentimentalitäten sei alleinig deutsch. Ach die Deutschen haben, als ihre Gesellschaft sich scheinbar in kleinbürgerlichen Behausungen konsolidierte, sich Markenschilder und Klischees ihres Wesens so anfertigen lassen, wie es ihren wirtschaftlichen Sehnsüchten am geeignetsten schien und sie sind vom Heroischen mit kalkiger Angst zum Sentimentalen gelaufen und haben der Antike, die sich ihnen in den Klassikern offenbarte, einige Denkmale der Huldigung unter der Adresse des deutschen Genius gesetzt.
Man schuf eine Waffenbrüderschaft für alles Dilettierende und Epigonenhafte, das sich „naiv“ gebärdete und erschlug die fabelhaften Wölfe der Sprache, wo sie in die Wälder kamen. Man verdarb mit falschem Zucker den Geschmack und hetzte die Mittelmäßigen auf das Ungewöhnliche. Man begann alles Unzureichende, soweit es auf Klarheit oder Erlösung sich färbte, als deutsch zu flaggen und alles Dramatische und Glühende zu hassen. Man liebt den Jungnickel mit den Papierblumen in der Hand, aber man will nicht den jungen elsässischen Dionysos Schickele. So war man für Freytag und gegen Nietzsche. Man schwärmte für Paul Heyse aber ließ den Günther krepieren. Man liebt die koiffierten Sänger des Rheins von dem Scheffel bis zu den Lauff und Bloem und Herzog, aber man ist gegen Heinse, gegen den Büchner, gegen den Eisenkonstrukteur Georg Kaiser und man nimmt Romantik (wo es ins Übersinnliche schon geht), nur durch die Verlegenheitsform der Musik.
Die Deutschen halten es mit der Dichtung wie die Weiber mit den Männern, die, wie Jean Paul meint, stets mehr den Bürger als den Menschen achten. Sie haben sich deutschem Wesen ganz entfremdet, haben sich von den Stilen entfernt, die ihr vielspältiges unruhvolles Wesen am deutlichsten geben, haben sich gegen die großen Formen erklärt, in denen germanischer Wuchs heroengleich in den Horizont sich trotzte und haben aus angestrichenen Fellgermanen mit Lippenrouge und Trikotbäuchen sich eine germanische Vergangenheit im Stile Richard Wagners, und aus unbestimmbaren qualvoll süßlichen Stimmungen klassischer Schlichte eine Gegenwart gezimmert für den Begriff des Deutschen, der niemals, der eine wie der andere, auch mit einer Ahnung nur am Leib der deutschen Dichtung war.
Es ist leichter zu sagen, was nicht deutsch ist, als das, was es ausmacht. Die Deutschen halten sich für schlicht und sind immer Verzweifelte gewesen. Sie haben keine Kultur, aber einzelne Herrlichkeiten. Ihre Haltung ist jener der Skandinaven unterlegen, ihre Grazie jener der Österreicher, ihre Motorräder, Tennisschläger, Kleider jenen der Engländer, ihr Weltdrang selbst dem der dickblütigen holländischen Germanen, ihre Parfüms den Franzosen, ihre Tänzerinnen den Russen, ihre Boxer den Niggern. Auf ihren Theatern pissen die Akteure, wie Heine sagt, mit den Herzen, während die Briten mit den outrierten Bewegungen der Shakespearezeit, die der Franzosen mit dem durch Ironie durchsüßten Pathos des Racine spielen. Ihre Maler malen den Kosmos, aber nicht nationale Farben und nicht ein gelungenes Weltbild ihrer Rasse. Der Kunsthändler Flechtheim hatte nicht unrecht, als er, der völlig französisch orientiert war, durch eine Ausstellung wildester moderner Kunst der Deutschen gehend, ausrief: „Herrlichkeiten, meine Herren, zwar keine Malerei und ich ahne es nicht, was es sein soll, aber ich glaube, daß es vorzüglich ist!“ . . . denn er zollte unbewußt neben dem Spott dem dunklen Trieb der echten Deutschen, sich mit Figur und toll aus dem Dunkel hochzuwühlen, den Tribut.
Da erscheint die Erinnerung jener Fanatiker wieder, die von den Dombauern bis zu Jean Paul sich zu jenem Barock im Ausdruck durchzuschlagen wußten, das auch die Strenge der Gotik und die Süße des Mittelalters umschließt. Damit seien aber im selben Atem die Überläufer gestäupt, die aus dem Unvermögen, sich auszudrücken, in jenes gescheite problematische Dunkel des Geschwätzes sich hüllen, das ein deutsches Publikum genau so begeistert und unverstehend aufnimmt, wie es erregt die Hände faltet, wenn Herr Bonsels sich auf Seele und Idylle frisiert. Im Grunde sind das die gleichen Täuschungen, nur daß die verquollene Geste die raffiniertere und spekulativere ist, ihrer beider Verfasser aber Charlatane, die von den jüdischen Literaten wenigstens die Psychologie gelernt haben, die diese in die deutsche Dichtung importierten: ihr Publikum genau zu kennen und zu bewerten.
Es gelang ihnen auf der ganzen Linie. Denn da es tragisches Schicksal deutscher Dichtung ist, unvollendet und fast an der Spitze der Vollendung abzubrechen und Torso zu bleiben, vollbrachten sie das Fälscherstück, den Torso überhaupt als das typisch Deutsche auszuschreien. Diese Komiker, die als Hamlete auftraten, vergaßen, daß es dem Unbestechlichen immer noch leicht ist, unverständliches und aufgeblasen gemurmeltes Zeug zu unterscheiden von einem metallen geglühten Stück Kunst, das nur an der Kulturlosigkeit der Zeit zerbricht.
Ja selbst, wie das gemeinhin leicht, aus dem Wesen der Frau die Statur des Volkes farbenklar zu erkennen, ist uns versagt. Die germanische Rasse ist bei den Britinnen viel klarer in der Zeichnung, anmutiger bei den Wienern, von geistreichster Grazie bei den schönen Frauen der Skandinaven Schwedens gezüchtet. Dennoch traf ich in der Heimat unvergleichbar lichte Frauen, zusammengesetzt jedoch aus Unbegreiflichem, mit vernichtenden Widersprüchen selbst in ihrer Anmut, unbestimmbar in ihrer Rasse und ihrem Wesen schon eine Stunde nach ihrer Entfernung.
Aber aus Erinnerung an sie formte sich plötzlich nachträglich die Idee: das war die Deutsche. Doch es war ein Hauch nur, unerklärlich. Aus einer Handlung der Gegangenen kam plötzlich ein Echo: das war sie. Schon entflohen, schon nicht mehr gestaltbar. Fast ein Traum und doch eine Gegenwart. Ein Abglanz vielleicht, der bleibt und den man nicht sieht. Aber man weiß dennoch, auch wenn man es nicht bestimmt, wenn man es nicht enträtselt: das gibt es. Das ist schon viel!
In Lyon traf ich in einer gebildeten Gesellschaft einen Kaufmann, der dachte, preußisch und deutsch sei zweierlei. Er hatte Recht wider Wissen. Preußisch ist leichter zu fangen als deutsch, es ist auch an Tiefe nicht so dunkelschön. Immerhin, es besteht, wenn auch nur als Erbteil von Potsdam. Mein Vermögen, meine geliebtesten Dinge gäbe ich, wenn ich auf Monate in fernes Ausland müßte, eher dem preußischen Granden, dem älteren General der aussterbenden Generation als einem der in Gesinnung der Menschenliebe bramarbasierenden Internationalen, so nah diese Ansicht mir steht. Ich bin für die Tradition und ich weiß, daß diese Ehre früher über den Tod hinaus unverbrüchlich als Weltbild der Samuraikaste der Preußen eingebrannt war, während ich nicht ahne, ob hinter dem Gesicht der Bruderliebe dieses oder jenes mehr steckt, als daß damit alles zu gewinnen und nichts zu verlieren ist. Das Ehrgefühl des preußischen Offiziers hatte früher Weltgeltung wie eine gewisse Treue der Germanen und darum ist Lessings „Minna von Barnhelm“ das beste deutschgeschriebene Lustspiel, weil wahrhaftiges auf beiden Beinen aufgepflanztes Weltgefühl hier tragisch gegen alle Seiten der Windrose rennt . . . so langweilig und trocken das Stück auch sein mag, und so sehr die Franzosen sich unter ihm krümmen, denen seine Klarheit und Gescheitheit überhaupt erst die Voraussetzung zu Dichtung scheint, während sie hier das Ende und Ziel schon ist. Man darf sich nichts vormachen. Wir sind, ohne Boden unter uns, um Jahrhunderte gehandikapt.
Es gab keinen Olymp bei den Deutschen, wo der Chor des Volkes und der Götter sich mit den Musen band, um im Zug vereint immer wachsend in einem unbeschreiblichen Hymnus die Kraft eines ganzen Zeitalters, die Götter und Heroen an der Spitze, zu gestalten. Einmal nur spielten in der Feinheit des Glücks die Dinge und die Menschen in organischer (nicht goethescher) Harmonie aus dem Bodenschoß des Landes her kurz ineinander, als in geheimnisvoll durchbluteter Fülle die Kraft seines Geistes so ungeheuer glänzte, daß die gotischen Götter von den Kirchen niederschritten, daß fromm und tapfer das gleiche Wort schien, daß in Schöpfungsmut die Vögel diesen kurzen Sommer mit den steinernen Heiligen um die Wette musizierten und die Engel Zeitgenossen der Erde geworden zu sein schienen.
Damals war das Helle und das Dunkle geeint, und die barocke Kraft hatte eine Flut von Licht in die Dunkelheit deutschen Wesens gesprengt, daß das Jahrhundert schwebte, wie von seidiger Luft gebildet aber wie von Stahl in der Rundung genietet. Die Wage war aufgestellt zwischen der Kraft und der Seligkeit, und wie auch das Ringende tobte, gesellte sich zu endgültiger Form ihm die Idylle. Die Strophen des Vogelweiders hatten jenes unersetzliche Gleiten aus den mythischen Schatten in die kristallene Lichte. Und wo sie geschliffen wie Glas in Bögen sprangen, war hinter ihnen noch das Blau der Schatten sichtbar, aus denen heraus sie sich rangen. Und über dem Rhein stand ihren hellsten Lichtern das dumpfe Schwälen Wolframs gegenüber, den aus dem Leichten es in wundervollem Abwägen schicksalshaft stets ins Dunkle zurückzwang.
Eine Kreatur blieb dann zurück, durch die Jahrhunderte der Zersplitterung hindurchgerissen, deutsch genannt, nicht mehr bestimmbar mit Kreis und Logik, mehr kühn wie gelassen, mehr zerbrechend als weise, schon etwas lorbeergeschmückter Barbar aber nie ganz Christ, doch stets voll Leidenschaft nach Erkenntnis in seinen besseren Exemplaren. Das gab Temperatur, aber noch nicht Guß und Statur. Das ward wohl aufgebrochener Acker, aber nicht Ernte. Es gab durch die Jahrhunderte hindurch keine Kette von jungen Helden, aber Kreise, die ohne Zusammenhang, aber wie die Jahrringe der Bäume umeinander gegürtet, die ewigen Quellen umringten. Und in der Isoliertheit voneinander gab es mehr mörderisch Verzweifelte als Jauchzende und es gab die kleine Menge derer, die zwischen den Pfäffischen und Geschickten, zwischen den Satrapen und Gauklern der Dichtung mit Genie das wirre Schicksal in Figur zu bringen suchten, in dem unsere beste Hoffnung liegt.
Sich ins Groß Barocke hinein zu äußern ist sowohl Schicksal als auch der gemäße Stil für das Deutsche. Die Chauvins, die ihm die aufgemalte italienisierende Statuenpose zuerteilen wollen, möchten am liebsten, es gebe nur Eichendorff, wobei sie beschränkt und heuchlerisch, wie alle falschen Radikalen, den Stoff mit der Melodie verwechseln und das für deutsch halten, was nur Anlaß zur Kunst ist. Denn Eichendorff ist eine jener graziösesten Verzierungen in der Architektur der deutschen Dichtung, deren oberste Ornamente (die über den dunklen Fittigen der Kreuzschiffe sich erheben) manchmal vor liedhafter Reinheit beben, als seien sie nicht mehr dem Bau zugehörig, sondern lägen wie die Falter frei in der Luft.
Es blieben immer nämlich einige Reiter und Figuren an den Firsten der Kathedrale deutscher Dichtung durch jede Epoche hindurch übrig und genau erblickbar, in deren Bewegtheit und linder Anmut man alle Helden des goldenen Zeitalters wieder erkannte, dessen schönster Ritter der von der Vogelweide war. Über den Eschenbacher Vaganten, über Günther und Hölty und Klopstock und Malermüller und Eichendorff geht es bis zu Heine. Zwischen den wilden Streitrufen des Thomas Murner und der Weltflucht des Silesius haben sie den Ton und das Vollendete weiter getragen und sich begnügt, etwas zu sein, was zwischen Schriftstellern und Dichtern die Deutschen allein als „Poeten“ besitzen, und was nicht das Deutsche, aber eine Spielart des Deutschen ist und im Ausgleich der beiden Wagen, die die Melodie bestimmen, die höchste und hellste Stimme ist, die der dunkelsten und schwersten Grundmelodie entspricht.
Sie haben etwas von Beschaulichkeit, manchmal von Weisheit an sich. Mit unmöglichen Vorstellungen von den Dingen dieser Welt beladen, sind sie jederzeit bereit beim Anblick des Meeres, des Frühlings und der Wiesen die Zahlenstaffel ihres Jahrhunderts zu vergessen. Aber sie sind in ihren sinnierenden und klaren Klängen niemals jenen Rotten verschrieben, die als Elegiker ihrer mißlungenen Karriere Hunger und Abstinenz als die Privilege der Dichter rühmen oder als Erfolglose neidig die Nutzlosigkeit des Ruhmes verkünden oder als klassizistische Epigonen, die zufällig in einer romantische Periode geboren wurden, Agitatoren ihrer Impotenz werden, welche sie dann von kleinen Schreibern und Eunuchen der Kritik als diskrete Erfüllung deutscher Mission in allen Blättchen loben lassen.
Sie haben nur die eine Absicht: zu musizieren. Ohne das stürben sie. Ihre schönste Stimme hat der Dauthendey. Er war so empfindsam, daß er in Tränen ausbrach, wenn ihn etwas störte. Er starb mit Fünfzig wie ein Kreuzfahrer auf Java (während in Deutschland alles verhungerte) bei guter Nahrung inmitten phantastischer Natur, vor Heimweh. Vielleicht, daß die Seele eines Schülers des Vogelweiders in ihn geflogen war, und daß Herr Ulrich von Singenberg oder der Brennenberger Reinmar aus ihm sang wie die verzauberten Vögel seiner Geschichten.
Nach soviel mißlungenen Skulpturen endlich ein Maler der Sprache, endlich einer, der so tief aus dem Dämmrigen kam, daß er das Schaumhelle spielmannshaft beherrschte. Er war so schön und so wichtig für seine Zeit, daß die Deutschen ihn auf der Stelle vergaßen.
Seit „Ardinghello“ aber hatte kein Deutscher diese helle Farbigkeit. Bei den Romantikern verschwamm zwar eine gewisse Leuchtkraft in ewig schönen Nebeln, Jean Paul hat Farbe gewiß zu riesigen Wolken jahrhundertgroß aufgewühlt. Die hellen glatten Farben hat seit Heinse keiner mehr so gehabt. Schon seine Valeurs bringen ihn nah ans Märchenhafte: Weiß, Perlmutter, Silber, Gold, Elfenbein. Er kam aus dem Kreis des lyrischen Dandy George, dessen Zucht sein Formgefühl anzog und wollte zu den glühenden Südseefarben des Malers Gauguin. Dazwischen lag der deutsche Naturalismus. Er hat von ihm seine Saloppheiten und das Banale einiger unkünstlerischer Wendungen. Er stellte ihm aber eine Prosa entgegen, die voll duftigem Atem, voll dichterischer Anmut und voll buntem Pathos war.
Endlich malträtierte Einer deutsche Erzählersprache nicht zu Ackerdienst, sondern ritt sie in die hohe Schule. Nun fing auch die Luft zwischen den Sätzen wieder einmal an zu leben, zu zittern und zu glänzen. Die Taumorgen und die Rosen und der Frühling bekamen das Geheimnis beispielloser Neuheit. Was war das Grau der Schilderer seiner Zeit, was war die Prosa der Wildenbruch und Schlaf und Beyerlein gegen diesen Glänzer!
Er kennt endlich wieder die Musik der Farben, er setzt sie mit den leichtesten Kühnheiten und bekommt immer Grazie und Melodie. Seine Farben, die ungebrochen von Weiß zu Gold gehen, wären ohne dieses Musikalische die kühlen Schilder irgendeiner nachempfundenen Klassik. Die schwälenden Farben von Purpur bis Mond-Orange haben schon die Romantiker aller Länder ins Übersinnliche geführt. Bei Dauthendey jedoch wandelt sich Weiß sofort zu Perlmutter, zu Lotos, zu Rose, zu Elfenbein, zu tausend Spiegelungen, die so leicht zueinander gesetzt sind, daß aus ihrer Helligkeit und ihrer Klarheit auch in der träumerischsten Luft nichts anderes als das Märchen sich entwickeln kann, das den Vorzug hat, ebenso deutlich wie unwirklich zu sein.
Das hat seit den „Serapionsbrüdern“ auch keiner vermocht. Deren Dichter hatte den Märchenton allerdings durch den romantisch besinnlichen Stoff und die Form des Erzählens und eine gewisse gedämpfte Dämonie zu beschwören vermocht. Der Dauthendey hat ihn schon von vornherein in der Atmosphäre, in die er lediglich hineinfabuliert. Seine Sprache ist nämlich derart ausdrucksvoll durch die mit allen träumerischen Schattierungen, aber auch durch alle Sinnlichkeiten phantastisch gefüllte Leuchtkraft, daß seine Figuren und Handlungen immer ohne Bemühung ins musikalisch Unwirkliche schweben, wo die Gesetze des Denkens aufhören, aber in einer liebenswürdigen Freiheit die Begebenheiten sinnbildhafte klare Schönheit annehmen.
Das Geheimnis des Märchenhaften liegt in der Tat nicht im Stoff, sondern im Ton. Der E. T. A. Hoffmann hatte ihn nach der dramatischen Wirkung hin, der Dauthendey nach der lyrischen. Aber es kommt nur auf den Ton an. Es kommt nicht auf die Naivität an und sicher nicht auf die Einfalt nationalen Gemüts, wie Annexionisten dieses Literaturgebietes so gerne träumen, und zwischen Vollmond und der Ausgabe von Grimm, zwischen Hans Thoma und Rotkäppchen die Erde als deutsches Terrain buchen. Die besten deutschen Märchen sind aus Asien gekommen, und ihr Ton ist wie der aller großen Literatur international. Zwischen Negern und Eskimos gibt es nur Unterschiede da in den Färbungen, nicht im Klang, wenn die Bäume einmal anfangen zu reden und der Mensch durch Zaubereien mit den Elementen kokettiert.
Von außenheran ist an das Märchenmotiv nicht zu kommen. Wer das denkbar Einfache, das in Wirklichkeit das unausdenkbar Raffinierte ist, versuchte, scheitert wie Oskar Wilde, der die Naturlaute mit Spitzenhosen und manikürten Rosanägeln maskierte. Neben Dauthendeys Neuheit ist selbst der Däne Jakobsen nur ein nervöser Empfindling, der doch dem Märchenhaften sehr nahe kam und selbst gegen Andersen, der, wirklich berufenen Tons, die alten Fabeln in seiner kindhaften Sprache ohne Eitelkeit noch einmal erzählte, hat Dauthendey eine unwahrscheinlich schöpferische Modernität.
Man war aber, als Dauthendey antrat, an das landläufige Klischee so sehr gewöhnt, daß man groteskerweise den Ton hinter dem neuartigen Äußern nicht erkannte. Welche Revolte, als „Der brennende Kalender“ und „Die in sich versunkenen Lieder im Laub“ erschienen! Als der Mann, der die Tradition der Märchenerzähler deutscher Erde weiter trug ins Neue, auftrat, warf man ihm wie einem exotischen Teufel alle Bannflüche entgegen, mit denen man den heiligen Herd schützt.
Dauthendey hatte aber alles gute Deutsche als Erbschaft in sich und nicht zum Geringsten die Sehnsucht nach der Welt, die er durchwandert. Er hat in seiner Heimatstadt Würzburg nicht nur die Helligkeit der Sonne auf dem Main, sondern auch die Inbrunst der Linien des Holzbildhauers Riemenschneider gesehen, er hat die tanzende Freudigkeit der Weingärten und das Katholische einer flötenhaften Gotik erfahren, und er hat das Spielmannhafte der Franken ebenso verschwenderisch wie ihre gut fundierte Eleganz. So kommt das Mystische zu dem Sinnlichen und die Heiterkeit des Lichtes zur Grazilität der Form, aber auch die Einfalt des künstlerischen Blickes zu einer fast unbegrenzten Möglichkeit der Farben. Und da er den Ton hat, der dies alles erst instrumentiert, ergibt sich, nicht ganz erlesen oft und im einzelnen sicher nicht vollendet, als Erscheinung aber erstaunlich, eine Prosa von nicht genügend erkannter Bedeutsamkeit.
Auch vermochte er, was bloß die besten deutschen Epiker des Mittelalters konnten, die ganze Welt zu sehen und in seinem Ton zu fangen, ihr nicht nachzulaufen in allen ihren Wundern, sondern sie, fast offenen Mundes, zu bestaunen, daß vor soviel Hingabe sie sich dem Stauner ergab. Dauthendey hat mit heidnischster Freude, animalisch und dichterisch zugleich, das Exotischste aus Asien und seinen Reisen gezogen, aber seine Musik, die mit der Schönheit und der Eleganz eines ritterlichen Spielmannes gelenkt wird, erzählt es nicht anders wie eine Aventure aus Herrn Walthers Lusamgarten in Würzburg. Die deutschen Dichterreisenden hingegen haben sich nur hingegeben, wenn sie die Welt durchfuhren, und nichts dagegen eingetauscht: es war nicht der deutsche Ton, aber wahrlich nicht die Stimme der fremden Völker; der Schwabe Hesse nicht und nicht der Rheinländer Ewers, der Breslauer Ludwig nicht und nicht der Holsteiner Bonsels, der Luxemburger Norbert Jacques nicht und nicht der Frankfurter Schmitz und nicht der Schlesier Hauptmann. Der Franke Dauthendey hat es gekonnt.
Dabei hat er nie Märchen geschrieben, indem er die bekannten Puppen tanzen läßt. Er konnte auch dies und hat von Java her noch in den „Heiligen Nächten“ das Innigste dieser Art seit vielen Jahrzehnten den Deutschen geschrieben. Er hat die kleinen malaiischen Kokotten und die Chinesen und die Wunder des „Bivasee“ und die sinnlichste Ausschweifung der genußfrohen Phantasie geschrieben. Er ist einer der unbekümmertesten Erotiker unserer Sprache, da seine Voraussetzungen so natürlich sind, daß selbst die nacktesten Frivolitäten sein Liebreiz kostbar macht. Aber er hat nie hinter fremden Stoffen herexerziert, sondern aus dem heißesten Morgenland seinen zeitlosen Zauber gemacht, zum Lotos den Tannenbaum, zum Stillen Ozean den Main gefügt und nichts besonderes dabei empfunden, da es harmonisch war. Es gibt nur in diesem Sinn einen Vergleichspunkt in der Gegenwart, das ist René Schickele, der, vom Elsaß kommend, aus Rhein und Ganges den gleichen Ton zu machen versteht, weil auch er als Nachkomme Gottfried von Straßburgs die Melodie hat und die Farbe, die alles in sich einbezieht.
Welch ein Musikant, welch ein Farbenkenner, der Dauthendey! Welch blitzende Haut auf all seinen Sachen und dabei in der Kontur (wie bei Schickele) diese weiße, helle Reinheit. Er, der sich nach Schwanken zwischen Malerei und Dichtung für die Literatur entschied und dessen „Singsangbuch“ noch die selbstgemachte Silhouette seines Kopfes schmückt, der von Würzburg aus die Welt immer wieder durchmaß und kein Schillern der Luft, den Geruch keiner indischen Frau und den Abenddampf keines Tierzwingers zu schildern vergaß, der den Mond liebte und um die Spiegelung aller Meere ebenso wußte wie um die Flamme jeder Leidenschaft, dieser Dauthendey hat — seltsamerweise — nichts groß und nichts vollendet gemacht. Auch ist Unterschiedliches im Verlauf selbst seiner besten kleinen Geschichten, die deshalb klein sind, weil sie nur Anlaß sind, zu fabulieren, nicht etwa, weil sie bescheiden an Umfang sind.
Zwischen Naturalisten und artistisch gesalbten Versmachern brachte er deutscher Prosa Licht und schwebende Farbe, Duft, Eleganz und Arom. Endlich war ein Erzähler leicht und dichterisch, glatt und voll Welt. Wie umschmeichelt er die Sätze, wie körperlich hautnah reibt er sich an den Hauptworten, wie poliert er die Adjektive und wie prall und voll Farbe setzt er das Verbum an! Zwischendurch erlahmt er zeitweise im Geschmus. Mitten in verzauberten Worten und bei höchster Eleganz trägt er den Vollbart seiner Epoche. Er ist trotzdem der schönste farbige Deutsche seiner Zeit. Allerdings hat er von den Ahnen, die er fortsetzt, wohl den Ton, aber, um gerecht abzugrenzen, nicht das Format. Gegen die ungeheuerliche Schönheit des Mittelalters hat er nur den Sinn einer lichten Erinnerung. Er ist vollendet, aber wie ein Schmetterling, nicht wie ein Gott. Er hat wohl den Schmelz, aber nicht die Heftigkeit der Couleurs. Er hat Bedeutendes, aber nicht den Zusammenhang mit der tiefen Tragik. Er ist Aquarellist, aber nicht ein flammender Entfacher. Er ist in seiner Mission vollendet, wenn auch nicht als groß geratene Figur über der Dichtung seiner Zeit, sondern als sanfter Chimärenreiter der Erinnerung, der, fast schon in Luft sich lösend, ins Spielerische seiner Art vom Dach der Kathedrale unserer Dichtung hineinsprengt.
Hinter ihm her tummelt eine kleine Eskorte, die, wenn sie auch im Einzelnen nicht großer Dichtung zugehört, die Liebe zum Schönen doch voll besitzt und auch im kleinsten Werk bewußt ist, daß ihr Ehrenwort Trouvere nichts anderes bedeutete, als den Könner der Phantasie und der Musik des Gedichts. Ins Gigantische begabt war ein Jean Paul aus ihrem Saft geworden. Der beste Bohème der Deutschen, Peter Hille, war aus der Schar. Als die Fabrikhausse um ihn rauchte, die sozialen Fragen alle deutschen Dichter fraßen (sie hatten keinen Zola), die Automobile anfingen mit offenem Auspuffrohr durch die Landschaften zu jagen, sang ein reiner Musikton aus ihm durch die Wälder. Er war ein Hüter des Wortes, er lebte an Lagerfeuern und in Kabaretts und auf dem Boden seines Landes. Aus seinen Briefen noch, die Pfennigaffären, kindische Unwichtigkeiten stammeln, steigt, wie über die ganze Misere seiner Person und seiner Zeit der Perlmuttglanz seiner Prosa. Sein Leben zersprang ohne Ordnung und sein Werk kam nur auf einige Splitter, aber wo er unterging, blieb das Durchleuchtende in dem Grau seiner Epoche, als wüßte man nichts weiter, kaum den Namen, kaum seine Gedichte . . . . nur daß einer der Chimärenreiter hier an deutsches Wesen streifte. Es geht nicht verloren.
Sein südlicher Bruder in der vagierenden Weise, Zeitgenosse wie Hille der Wallot, Bleibtreu, Hart, Henckell, Mackay, Wille, Oswald, Puttkamer, der Kretzer, Hartleben, Hirschfeld, Halbe, Bierbaum, Gumppenberg, M. G. Conrad (wo sind sie außer dem wüsten Panizza und dem tapferen Conradi?) sein südlicher Genosse in der Masse der Übergangsbegabungen, von denen keiner der deutschen Dichtung auch nur Anstoß oder sich selbst die Berechtigung seines Daseins zu beweisen verstände, sein südlicher Bruder ist Altenberg. Es ist fast, als breche hier die Spitze ab der Entwicklung, denn, obwohl er den Ton hat, bohrt er ihn in alles moderne Gekröse hinein, läßt wie zum Scherz durch Sanatorien und Pathologien ihn zwitschern und postuliert seine seltsame Figur zur Sehenswürdigkeit der Großstadt, daß bald der Ruf seines Gehabes, seiner Einfälle und seines Treibens mit Dirnenverehrung und narrenhaften Vermummungen seines Leibes fast mit Unrecht seine dichterische Note übertraf. Ja er versuchte wohl, schlau wie die Naturkinder, den raffinierten Europäer dieses Jahrhunderts durch seine Späße zu zwingen, sein Leben zu zahlen, jedoch, indem er seinen Lebensstil in den Vordergrund bluffte, hielt er seiner Dichtung eine verzweifelte Wacht. A corsaire corsaire et demi. Als Spaßmacher entriß er dem modernen amusischen Menschen sein Geld, dahinter schuf er neben Eduard Keyserling den einzigen Versuch eines Impressionismus in Deutschland, der sich neben Bang und Jakobsen halten könnte und führte eine neue, etwas alberne Drolerie in die deutsche Dichtung. Aus Nervenschwäche und Spielmannston, aus Menschenliebe und Verrücktheit, aus einer zeitlosen Heftigkeit seiner Gesichte und bescheidenen Anmut des Stils machte er seine Komik, die in der inneren Klarheit des Tons über Paul zu den tumben Sängern besserer Epochen führt.
Auch er hielt die Hand in der Luft und in der Luft hing ihm entgegen das geheimnisvolle Schlagwerk, das auch den Verschnittenen und Buckligen erscheint, wenn sie erlesen sind. Die Deutschen sind ein Volk der Zufälle, und selbst an den Unmöglichsten kann die Stunde herantreten, zu der er auserlesen ist. Sie sind mit einer gewissen Haltung irgendwo gestört und auf der anderen Seite voll Glanz. Sie haben, was Bonaparte von Murat sagte, er sei ein Narr aber der beste General der Kavallerie, oftmals scheinbar als eine der sichersten Tugenden ihrer unbestimmbaren nationalen Eigenschaften.
Manchmal hat sich jene deutsche Melodie, da die Erwachsenen sie nicht verstanden, zu den Knaben geflüchtet und dort mit einer Zartheit des Empfindens den Einzug gefeiert, der, wie dem genußsüchtigen Smyndiridus das gefaltete Rosenblatt, jede Berührung mit der Welt die Wollust trübte. Da kommt dann in der Gebärde ästhetischer Zärtlinge, mit primitiven aber samtenen Worten weltunwissende Unschuld des Gefühls wie im Paradies heran. Selbst das Homosexuale hat bei Eckart Peterich einen stillen Adel erreicht und ein idyllisches Entsetzen entsteht, wenn der junge Dichter, dem ein sanftes Weib in der Schlafstube erscheint, zum Lavoir flieht und mit Wasser sich begießt, statt von der Großäugigen sich verführen zu lassen. Denn wie Kurzbold, des nahen Limburger Domes Gründer, haßt er die Weiber wie das Äpfelessen, und aus dem Dunkel seiner Hintergründe taucht die Welt der silbern bestickten Gobelins mit Heiterkeit und Ruhe. Fragen der Kunst scheiden aus, wo nur die Atmosphäre des geteilten Lichtes spricht. Man zerstört nicht den Charme, wenn man nicht aufspießt und, indem man sich des Vergnügens nicht beraubt, rührt man nicht an die Zerbrechlichkeit der Werte.
Etwas viel Künstlicheres ist von derselben Farbe unter dem Schweizerhut des Robert Walser, der schon aus der unliterarischen Heiterkeit dieses Knaben tief in die Literatur springt. Das ist ein Maler, wenn er anhebt, und ein eitler Wissender wenn er aufhört, denn wenn er wie in ein Stereoskop die Welt bunt hineingepappt hat, hat sie den Glanz des Salomon Geßner verloren, dem sie nachgebildet ist, weil statt ihrer eigenen Einfalt die gespreizte Jünglingshaftigkeit ihres Dichters darin sitzt. Das Geckentum Walsers, der nur in ewiger Schlankheit die Welt nicht gläubig erleben, sondern in seine Tirolerjodler hinein blasen will, ist das gleiche wie das des Wilhelm Schäfer, nur daß der Schäfer mit seiner breiten Brust und seinem enormen Können ein böser Raunzer ist, der seine Verkanntheit mit naturburschenhafter Eitelkeit verbrämt.
Der Schäfer hat prachtvolle Sachen über Pestalozzi geschrieben, aber die Dunkelheit seines Blutes genügt nicht, ihn anders als einen Epigonen des Keller gefärbt zu sehen. Auch in den „Kammachern“ Kellers sinniert jedoch derselbe Vogelsang wie in den Jugendträumen Hermann Hesses. Und selbst der ungeschlachte Schlesier Stehr, dieser rührende Zu-Nichts-Kommer, hat manchmal den Wunsch, wie ein Füllen aus seiner Elefantiasis auf die Weide zu springen. Es scheint manchmal, die Deutschen vermöchten, wenn ein Kunstgriff ihnen die Änderung der Natur erlaubte, sofort aus ihren Gegensätzen sich zu lösen und mit Vorzug in der Lage zu sein, auch in der Form der Vögel zu existieren.
Aber auch die Prinzen haben sich an dem Rand der großen Symphonie deutscher Dichtung eingestellt. Aus den Märchen schon hob sich die leichte Grazie der mit seltsamer Jugendwürde verzauberten Edlen und manchmal trägt einer den unsichtbaren Kranz noch durch unser Jahrhundert. Sie sind bestimmt rasch zu sterben. In den Briefen des Zeichners Thylmann, der Bäume und Felsen geliebt und gezeichnet hat, hält einen Augenblick diese geheimnisvolle schlanke Würde. Er kam ebenfalls aus dem Kreis des Dichters George, der die Barbarei beging, so sehr es seiner salbentrunkenen Weltentrücktheit widersprach, durch Vergewaltigung in Taggesängen und Minneliedern das Mittelalter zurückzwingen zu wollen, das er selber nicht besaß. Seinem Schüler Thylmann aber gelang es, auch den märchenhaften Farbton neben die überlegene Würde des unbewußt erlesenen Menschen zu setzen und seiner Prosa eine schicksalshafte Kindlichkeit zu geben, die der schlanken Maße und der Reinheit der Haltung nicht vergaß.
Wurden die Prinzen früher verzaubert, genügte es ihnen, die Welt zu durchstreifen als Bettler oder Hirtenjungen von uns unverständlicher Grazie. Als sei des abgeschossenen Thylmann Seele in die Augen eines anderen getreten, geht sein Geist, nur ein wenig verwildert, durch die Sehnsucht Hans Siemsens. Denn auch dieses Vaganten Stimme hat die gleiche Kurve, in der der Fall von Glück und Traurigkeit und das Sichablösen der Stimmungen von der Landschaft hin und herschwingt und wo jede Frage schon ohne Erwartung ihres Echos angestimmt wird. Denn es ist bestimmt, daß diese Menschen unbegreiflicherweise dem Zustand ihres Glückes am nächsten sind, wenn es ihnen am entferntesten schaukelt. Denn es genügt ihnen, nichts zu haben, nichts zu erreichen, nichts zu wünschen, sondern nur großäugig zu staunen und zu bewundern und höchstens ihrer Besitzlosigkeit eine gewisse Gepflegtheit ihrer Körper wie ein heimliches Erkennungszeichen hinzuzufügen. Wäre sein Ansehen und sein Einfluß nicht zu deutlich, würde man den Meister in der Erziehung zur Schönheit dieser Jünglinge, den Sammler des Maler-Zöllners Rousseau, Wilhelm Uhde, leicht von ihnen weg zu den reinen Ästheten stellen. Es wäre ein Irrtum. Die Breite seines Romans von „Fortunat“ entspricht allerdings nicht seiner Gewalt, und seine Ründe sicher nicht seinem Aufbau, und es ist überhaupt bezweifelbar, ob der ein Künstler ist, der ihn schrieb, und nicht ein Bewahrer ausgezeichneter Traditionen, die, wenn auch überkultiviert und ein wenig blaß in der Farbe, dennoch die leichte Lösung unserer Krämpfe eher begünstigen, als daß sie sie bekämpften. Denn in der Ansicht mehr als im Ausdruck und in der Pflege seiner Idee von der Melodie mehr als in ihrer Ausübung ist hier die schlanke Grazie alter Farben gehütet, und wenn all diese Jünglinge auch Zärtlinge sind und Wollüstige und ihre kleinen Begabungen mehr als Lohn einer gewissen Verweibtheit als tiefer Abgründigkeitsqualen um die Kunst tragen, so nimmt ihnen kein Vorwurf die Anerkennung ihrer Existenz, mit der sie, wohl schmaler und feiner und unmännlicher als andere aber lebend und existierend mit ihren Melodien hinter den Reitern des Mittelalters her ziehen. Manche als Kavaliere wie Uhde in der Berline mit sechs Pferden, manche mit Kindertrompeten und Drachen, die über ihren Händen im Herbstwind steigen, manche auf gezüchteten Pferden oder bukolischen Ziegen oder auf den Rücken ihrer Freunde, in einer fast immer schon in dem Blau verschwimmenden Bewegung, mit dem die Luft sich unter ihre Körper schiebt und sie entführt.
Auch auf den geschnäbelten Wikinger-Schiffen der Dichtung hat sich der Ton gehalten, und als ob seine Galeere sich piratenhaft vom Domfirst höbe, schwingt René Schickele seine fast kämpferisch helle Melodie. Er ist der schönste und bewundernswerteste deutsche Dichter der Gegenwart. Wie Schickele schreibt keiner das Deutsch, daß es Prosa bleibt von aquamariner Dichte und doch Gesang. Sein Buch „Mädchen“ sind die schönsten und reinsten Erzählungen unserer Sprache seit Jahrzehnten. Er hat die Fülle seiner elsässischen Heimat zu der fliegenden Kraft seiner Sätze gezogen, und was die anderen alle an Kunst nicht erreichten, sondern an Anmut nur wiesen, hat er mit einer schmetternden Kühnheit auch an dichterischer Gewalt noch seiner Eleganz hinzugefügt. Hinter ihm wendet mancher sein Gesicht um in die Zeit. Da beginnt schon Gegenwart und manchmal grenzt das Träumen der Jünglinge schon an die Weite der Welt und nimmt den Kopf in die Hand und denkt nach. „Karlos und Nikolas“ ist die Geschichte zweier Jungen von einem gewissen aus Argentinien gekommenen nach ihm zurückgekehrten Rudolf Johannes Schmied, aber die Deutschen sollten dies Buch kennen wie die Franzosen Daudets „Lettres de mon moulin“ oder den „Tartarin“. Hätten sie Sinn für die Bescheidenheit und zugleich Sicherheit gegenüber der Welt, für Phantastisches, das mit Belehrendem sich mischt, für die Eleganz ihrer Schwächen und die Größe der Welt und die Anmut selbst in der Verzeichnung ihrer Typen, in Schulen und Auswärtigen Ämtern würde dieses Buch aufgestapelt. Ach die Deutschen flüchten lieber, weil sie den Glanz ihres tieferen Wesens auf dem Grund der Dinge nicht mehr sehen, zu den Plakaten, reißen sich um antisemitische Schmarren des Herrn Dinter, um erbärmliche Schlachtgeschichten des Bloem, um Borussiaden, die nur das Fatale, nicht das Edle der Preußen zeigen und wenden sich wie von läppischem Unrat von ihrem eignen Herzen. Seltsames Volk, das sich mit den Klappern der Wilden Götzen baut, wo es Götter hat.
Einmal mischte sich die alte zärtliche Melodie sogar mit Handlung und Urteil. Über Schmieds Distanz zur Welt geht Robert Müller zum Angriff. Er ist primitiv und raffiniert. Seine Frische hat eine sportlich gepflegte Gedanklichkeit. Aber sein Naturburschentum ist nervös. Wo er an die Grenze des landschaftlichen Dichters kommt, fängt der in großen Zusammenhängen kombinierende Journalist an. Wo die Gefahren des Reporters liegen, steht seine Tatkraft aufgepflanzt. Denkerisch bringt er im „Barbar“ manche Kühnheit, handelnd einen Pfauenschwanz von Zeit.
Dazwischen geht der Ton des Dauthendey wie auf Wiesen und läuft, bestimmend zwar und wichtig, aber fast unsichtbar zwischen trainierten Muskeln und geschultem Hirn in die europäische Arena, einer Troyka gleich, deren Außenpferde ziehen und deren drittes nur schön ist und die Richtung gibt, sonst nichts.
Ich bin nicht der Chargé d’affaires der Süßlinge. Ich erwarte kein Heil der Zeit von den Troubadouren, und meine Zweifel an der Kraft der Gefälligen sind wie meine Eigenliebe groß. Ich glaube nicht, daß die Homosexualen uns in das Glück führen, wie die heilige Schar der Thebaner, die nur aus sich Liebenden bestand, aber ich weiß, daß ihre Manieren besser sind und ihre Instinkte manches Männliche behielten, was die Robusten vergaßen. Absurd zu denken, daß ich den Knaben die Flöte halte, um deutschen Himmel damit zu ersingen. Selbst Don Quichote mußte sich gegen die Galeerensklaven sofort verteidigen, denen er selbst die Freiheit gab und ich muß die Winkel richtig stellen zur Schau.
Indem ich den Irrtum nehmen wollte, Klassisches oder Naives sei typisch deutsch, verlangte es mich die Verzierungen zu zeigen, die den wahren stillen Ton der Deutschen tragen neben den Falschen, die die Masse hört. Diese Sänger, die die Kette zum Vogelweider irgendwo selbst in der einfältigsten Blässe immerhin binden, sind nicht das Bild des Deutschen, sondern sie sind die leichten Schönheiten des Schaumes, die nur anzeigen in ihrer Anmut, mit welchen gigantischen Donnern das Element darunter liegt. Die schönen Chimärenreiter blasen die rosane Melodie auf den Firsten, um die dunkle Schönheit der Kathedralen unter ihnen und ihr gewaltiges Wachstum um so schöner zu beweisen. Ihre Töne kamen wie Blasen manchmal ins Urbane, sogar bis ins Bewußte. Aber unter ihnen liegt die unentbundene und ach vielleicht nie entbindbare wilde Kraft der deutschen Bestimmung.
Ach was wissen Sie nun, Mijnheer? Sie haben geträumt, gerochen, aber nichts gefaßt. Wie sieht ein Deutscher aus? Sie wissen es nicht. Ein Dicker, ein Bemonocleter, ein Tapferer, ein Schmalhüftiger, ein Zärtling, ein Hanswurst, einer mit Blumen am Hut, ein Amokläufer? Ich weiß es nicht. Ich ahne es kaum. Wenn Sie mich gut verstanden haben, werden Sie ihn dennoch erkennen in der Welt, des bin ich gewiß.
Manchmal, nicht selten, begab sich nämlich das Geheimnisvolle, daß mir war in der Fremde, ich träfe Deutsches unter den Söhnen anderer Nationen. Ich vertraute, ich liebte, ich wurde wieder geliebt, und ich erklomm die Höhe manches Glückes. Aber ich fand dagegen unter den Kindern meines Volkes, am Rhein, am Neckar und den Seen meiner Segelzeiten alle Fehler gehaßter Völker, ich wurde gehaßt und bekämpft und verleumdet. Ich starrte oft, wenn ich die Gaffel am Mast nach den Launen der Böen studierte, in einen namenlos entfremdeten Himmel über Bayern, aber ich fand in der Welt der Fremde oft deutschen Himmel voll Reife und Glück, die ich in Deutschland nie sah. Deutsches zu finden kann heißen vielleicht, in die Welt zu gehen und ist nicht abzumessen und anzugliedern vorerst nach Bau und Hand. Deutsches zu gestalten wird heißen, es aus der Welt und gereift zurückzutragen in die Heimat, aus der wie ein zersprungener Stern sich das Volk der Germanen über die Erde stürzte und Afrika, den Norden, Spanien, Asien und die Slawen mit seinem Blute düngte. Europäische Luft dringt durch die Kerzen herein, die unter dem Bewußtsein des Sturmes allein schon beben.
Sie sind fast abgebrannt. Wir haben lang geredet, selbst die Mäuse schlafen und die Vögel haben sich beruhigt. Die Alpen waren gegen Abend einen Augenblick lang aufgebrochen mit entflammter Idee, ihre Figuren geteilt wie Heroen, dann sank die rote Dämmerung über die Bäume, die unter den Lasten des Schnees schon tropischen Wäldern gleichen. Phantastische Palmen haben sich den großen Fichten gesellt und die Weiden tragen eine gläserne Gespenstigkeit, als kämen sie wie ein Traum von Hawai, wo die Bäume nicht nur die Form der Orchideen, sondern auch die Vielfalt und tolle Kraft der Träume tragen.
Ich liebe die Eifel, die Rhön, die Vogesen, den wilden Karwendel, die Alpspitze, den Schwarzwald, ich liebe alle Gebirge der Heimat, die ich durchwandert, befahren, überflogen seit meiner Kindheit. Aber oft stieß ich an Berge der Fremde, an Meere, die daran mit Größe und funkelnd sich schlossen, an Prärien der Freude, und ich dachte nicht der fremden Namen und der anderen Sprache, sondern dachte: auch hier ist Deutschland.
Und ich empfing die gleiche hinreißende Liebe wie zu einer Eroberung der Schönheit und ich verstand immer wieder den Wandertrieb der Germanen, die so sehr schließlich ihre Heimat überall empfanden, daß sie glaubten: wo auch immer es gut gehe, sei Deutschland gepflanzt. Es gibt keine deutsche Sehnsucht, die nicht in die Welt hineinführte, aber keiner hat verstanden, sie erfüllt aus der Welt zurückzutragen und damit an ihren Menschen zu bauen. Darüber zu trauern, ist chagrin de luxe. Es ist Bestimmung und Tragödie, das ändert kein Gefühl.
Wie sollte der Deutsche aussehen, den ein Wunsch im Innern unbewußt gestaltet? Der Fürst Pückler Muskau hatte etwas von ihm, der zur Melodie der alten Sänger die Bildung eines Seigneurs legen konnte und dem noch die Haltung des Briten und die Gewandtheit des Romanen hinzufügte. Ich vertrieb einmal, in den Gartenpavillon eines englischen Diplomaten tretend, den Besitzer, allein ich sah noch, daß er im Kimono floh, um sich anzuziehen. Neben dem Tisch seines Frühstücks aber lag eine Karte der Welt mit allen Festungen, Flüssen und Schiffahrtslinien und den Küsten und Städten aller Kontinente neben einem diplomatischen Bericht und den Oden des Horaz.
Das war ein Mann, der das Leben, das Geschäft und die Muse mit überlegener Würde anmutig zusammenhielt. In Schumanns Briefen steht er unbewußt einmal im Umfang ähnlich, an Figur noch klarer gezeichnet, wo dieser Musiker träumt von einem Mann, der zu Fuß Moskau, Rom, Marseille, Hamburg und die Welt dazwischen durchwandert habe, gut sich kleide, Thukydides lese, Algebra treibe und musiziere. Das ist die Zukunft, die wir hoffen, aber zuviel schon der Hoffnung. Die Kerzen sind aus. Aber der Sturm hat kein Ende.