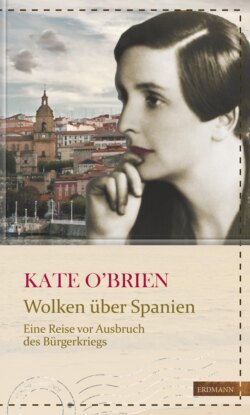Читать книгу Wolken über Spanien - Kate O'Brien - Страница 9
VERDRIESSLICHKEIT
ОглавлениеWo ließen wir die sentimentalen Touristinnen am Ende des letzten Kapitels an Land gehen? Sagen wir in Santander, um keine Zeit zu verschwenden. Der Himmel weiß, dass schon genug verschwendet wurde, seit wir uns zuletzt mit diesen Geschöpfen beschäftigten. »Die Zeit schreitet voran«, wie sie uns neuerdings unnötig salbungsvoll in der Kinowochenschau mitteilen. Wo wir auch erfahren, dass die Arbeiterarmee ebenfalls voranschreitet und dass Francos Männer in Erwartung der Mauren10 und ironischerweise ausgerechnet in Toledo den Alcázar mehr als sechzig Tage lang gegen die Kastilier gehalten haben. Das aber ist kein Reisebericht, sondern gerade »Aktualität«, wie ein Spanier sagen würde, und die Zeit hat nichts von ihrer Härte verloren. Aber Santander ist vergleichsweise sicher, um dort Erinnerungen nachzuhängen. Auch lebendig. Lebendig genug, um es der Autorin zu erleichtern, den störenden Touristinnen aus dem Weg zu gehen. Lassen wir sie also ziehen – es wurde langweilig mit ihnen. Jetzt sind wir selber dran.
Kurz und gut, liebe Leser – aber werden Sie mir diese altmodische Anrede gestatten? Eine Freundin sagte mir einmal, als sie das Werk eines bedeutenden und unterkühlten Essayisten auseinandernahm, dass »größere Autoren als Alice Meynell11 sie mit ›liebe Leserin‹ angeredet hätten«, also gehe ich ganz bescheiden das Risiko ein, zu diesen gezählt zu werden. Liebe Leser, ich konfrontiere Sie direkt mit der ersten Person Singular. Ich werde Sie mitnehmen auf meine eigene Reise und in direkter Rede von allem erzählen, woran ich mich erinnere und was ich gern wiedersehen möchte. Ich glaube, so ist es am besten.
Meine Reise wird allerdings ein Patchwork aus vielen Reisen sein und ohne überflüssigen chronologischen Bezug. Die Route wird sich aus vielen Routen zusammensetzen; Jahreszeiten und Städte werden nach meiner Erinnerung folgen, ziemlich sicher war es in Wirklichkeit nicht so; Begleiterinnen oder zufällige Reisebekanntschaften werden in ungenauer Reihenfolge auftreten, sich einschalten, verschwinden und wiederkehren, ganz ohne Absicherung durch all die nützlichen Tagebücher, die ich nie führe. Ihre Rollen, an den entsprechenden Orten, werden so getreu sein, wie die Erinnerung sie gestalten kann – so lange niemand nach dem Datum fragt.
Ich befinde mich also in Santander, und sagen wir einfach, dass es sich um eine Zeit handelt, die mehr als zwei Jahre zurückliegt und weniger als drei. Und während ich im üblichen Café vor dem Regen Schutz suche und in die Hände klatsche, um Eduardo auf mich aufmerksam zu machen, höre ich neben mir aufgeregtes englisches Gerede und stelle bestürzt fest, dass die Schornsteine, die sich draußen im Hafen schwach abzeichnen, die der »Cordillera« oder der »Reina del Pacífico« sein müssen, und dass soeben eine neue Ladung von Urlaubern, knapp bei Kasse und ahnungslos, auf den klatschnassen Paseo de Pereda gekippt wurde – Urlauber, die ganz aus dem Häuschen sind, jetzt endlich in Spanien zu sein – »in Spanien, meine Liebe!« – und dreizehn Sommertage vor sich zu haben.
Mir wird schwer ums Herz. Denn mir scheint, dass sie getäuscht werden, und Spanien nicht minder. Es verhält sich nämlich folgendermaßen: Die Leute, die in der Touristenklasse von Southampton oder Dover zu einem der nähergelegenen spanischen Häfen aufbrechen, sind hauptsächlich hart arbeitende Lohnempfänger, denen die jährliche vierzehntägige Freiheit sehr kostbar ist, und die alle eher wenig Reiseerfahrung haben, da ihnen seit der Schulzeit nur vierzehn Tage pro Jahr fürs Reisen zur Verfügung stehen. Mit dem zunehmenden Tourismus sind sie bemerkenswert unternehmungslustig geworden – dafür, dass sie so wenig Geld und Zeit haben, können sie erstaunlich weit wegfahren. Und in diesem Jahr ist Spanien dran. Man kann die Gespräche förmlich hören, in Ein-Zimmer-Wohnungen und Bungalows, in den Reiseagenturen. »Die Peseta steht dies Jahr so günstig, und die Schiffe sind fantastisch. Hat mir Mabel gesagt. Pro Strecke etwa sechsunddreißig Stunden – genau das Richtige für dich. Und Spanien! Komplett was anderes. Der Arzt sagt, du musst einmal alles hinter dir lassen, Liebling, die Kinder und alles. Sie werden wunschlos glücklich sein in Broadstairs, bei Mutter. Du weißt, wie sehr sie es liebt, sie mal für sich zu haben. Spanien! Was könnte aufregender sein! Bestimmt werden wir uns einen schönen Sonnenbrand holen. Oh, es ist also nicht ganz so heiß im Norden? Die Hotels sind in Ordnung, nehme ich doch an? Das hier scheint mir sehr günstig zu sein. Oh, ich denke, das ist eine fabelhafte Idee, George. Wo liegt Toledo? Sollen wir uns Toledo ansehen – oder die Alhambra? Ach, egal. Spanien ist Spanien. Und wir werden immerhin dreizehn Tage dort sein. Besorg besser einen Sprachführer, Daisy …«
Würden sie mit den Kindern nach Broadstairs fahren, dann wäre das für sie nicht sehr aufregend, aber sie kämen in den Genuss bestimmter Annehmlichkeiten und Freuden, die ihnen vertraut sind – das übliche Strandglück, das sich bei den meisten Menschen todsicher einstellt. Aber wenn sie plötzlich sagen: »Der Arzt meint, ich muss einmal alles hinter mir lassen«, und: »Spanien! Wie herrlich!«, verlangen sie etwas, das, sofern überhaupt käuflich, nicht für ihre wenige Zeit und für ihr Geld zu haben ist. Sie verlangen Zutritt zur Welt der Plakate, einer Welt aus Kunststoff und Kobaltblau, aus Singen und Nichtstun, mit einer Nelke im Mundwinkel. Sie möchten – da die Peseta so günstig ist – endlich sehen, was sie sich in ihrer Kindheit vorgestellt haben und was in ihnen lebendig geblieben ist.
Aber Spanien – wie man jetzt vielleicht mitbekommt – ist keine Kinderfantasie, nicht die Welt der Plakate. Es ist ein Land mit Tiefe, sehr real und mit verstörenden Schatten. Und Santander, wohin so viele Ahnungslose in Scharen strömen, auf der Suche nach ihrem so nötigen Ferien-Glamour-Intermezzo, Santander ist vielleicht die nüchternste, die am wenigsten theatralische aller spanischen Hafenstädte. Sie besitzt nicht einmal Coruñas Atmosphäre närrischer Verwegenheit oder Bilbaos pockennarbige Erscheinung, völlig ruiniert durch den pausenlosen Ringkampf zwischen Gier und Elend. Nein, Santander ist eine schlichte, nüchterne Stadt von respektabler Bedeutung und Redlichkeit. Sie ist die Hauptstadt einer sehr interessanten Provinz, schön gelegen, blickt auf eine beachtliche Geschichte zurück, hat einige berühmte Kinder und kämpft nun, wie das restliche Spanien, mit akuten sozialen Problemen. Das regnerische und gemäßigte Klima gleicht dem von Devon oder Kerry; die Landschaft ist grün, fruchtbar und beschaulich; die Stadt liegt an der Biskaya, nicht am Mittelmeer. Die Menschen, aufgewachsen zwischen Bergen und Küste, besitzen in der Regel die Gesundheit, wie solche Bedingungen sie mit sich bringen, und den entsprechenden Mut. Sie sprechen ein gutes Kastilisch, sind zuvorkommend, humorvoll und freundlich; sie und ihre Lebensweise sind muy español, sehr spanisch, wie sie sagen würden.
Aber werden das auch die Dreizehn-Tage-Ausflügler sagen? Nein, denn sie haben keine Zeit herauszufinden, ob es stimmt. In diesen Ferien werden sie nur die Zeit haben, die Welt ihrer Plakate zu verlieren und nichts Realeres zu finden, um sie zu ersetzen. Denn solange man nicht sehr viel länger hier ist und vielleicht ein wenig Spanisch spricht, solange man sich nicht vorab richtig informiert, gut vorbereitet und keine sture, vorgefasste Meinung zu Spanien hat, solange wird man wenig Neues oder Denkwürdiges in La Montaña, wie die Region um Santander genannt wird, entdecken. Ist man allerdings Bergsteiger und weiß Bescheid, dann wird man sich gerade einmal für einen kurzen Drink auf dem Paseo aufhalten – gleich darauf den ersten Bus nach Reinosa oder Potes nehmen und dort seine Vorkehrungen treffen, um sich in den prachtvollen Picos de Europa den Hals zu brechen; als halbwegs aufgeweckter Tourist hat man auf der Landkarte entdeckt, dass man sich in der Nähe einer Perle Kastiliens befindet – Burgos –, und man wird den Bus nehmen – nicht den Zug – und dort mindestens eine Nacht verbringen; wenn man malt, hat einem sicher jemand von der Höhle von Altamira erzählt; ist man aber ein Träumer, ein melancholischer Jaques12, ein Eskapist, wird man an den verlorenen Ort San Vicente de la Barquera fliehen und seine zwölf Tage damit verbringen, dem Meer dabei zuzuschauen, wie es sich an den lecken Booten bricht, die Bögen der makellosen Brücke zu zählen und über die Schönheit der umherwimmelnden hungrigen, wilden Kinder zu staunen.
Aber angenommen, man ist ein völlig zielloser Urlauber, weiß nichts, außer dass man in Spanien gelandet ist, und versteht nichts von dem, was um einen herum vorgeht. Man hat vielleicht ein Zimmer irgendwo an einem der kleinen Strände von La Magdalena oder El Sardinero gebucht, Küstenvororten Santanders, die vor einigen Jahren von Alfons XIII. entdeckt wurden und denen die Stadt die anhaltende Beliebtheit als Urlaubsort verdankt. Man wird sein Hotel finden, und ich wette, man wird angenehm überrascht sein. Sollte man nicht wirklich Pech haben, ist es weiß gekalkt, sauber und karg wie ein Kloster. Im Zimmer gibt es fließend Wasser, und auch wenn das, was aus dem Warmwasserhahn kommt, nicht immer warm ist, so wird es doch fließen – und draußen vor dem großen Fenster erstreckt sich das Meer, blaugrau und freundlich wie das Meer vor Scarborough. Aber wenn man hinausgeht und in Richtung Casino und Musikpavillon, die man von der Straßenbahn aus sah, als man auf die Küste zufuhr, wenn man das große Café entdeckt, das über den Strand hinausragt, dann gibt es dort nur einen einzigen weiteren Gast – einen Mann in deutscher Tweed-Kleidung, der sich niedergeschlagen an seiner Kamera zu schaffen macht. Und wenn man auf der zugigen Terrasse sitzt und den dünnen Tee möglichst vorsichtig durch ein entsetzlich kleines Sieb gießt, das von der Tülle baumelt, wenn man sich laut über den leeren Musikpavillon wundert und den einsamen Strand, dann stellt sich vielleicht heraus, dass der Kellner mit der ernsten Miene in Chicago gelebt hat und einem erklären kann, dass die Saison noch nicht begonnen habe, oh nein, erst in ein paar Wochen – man sei zu früh dran. (In den kantabrischen Ferienorten ist man immer zu früh dran für die Saison. Nie war eine Wartezeit so schwer totzuschlagen.) Ja, wird ihnen der Kellner sagen, morgens sind Leute am Strand, Einheimische – die schicken Madrileños noch nicht. Zu früh für sie. Das Casino öffnet erst, wenn sie auftauchen – zum Tanzen, Señorita. In Spanien gibt es kein Glücksspiel. Und die Musik spielt samstags im Pavillon – oh ja, die Señorita wird schon sehen, gran baile, gran verbena. Ein großes Fest. Hier auf der Terrasse, ja. Wie schade, dass die Señores so früh gekommen sind. Und der Kellner geht. George und Daisy schauen sich an und befinden, dass es kühl ist, sie sollten besser ein Stückchen laufen. Sie spazieren zwischen Tamarisken und Fackellilien im kleinen Park über dem Meer. Sie haben ihn für sich, bis auf einen Jungen, der sie damit quält, irgendetwas mit dem Messinggriff an einem merkwürdigen, rot lackierten Gefäß zu tun, das er vor sich her trägt. Er öffnet es und zeigt ihnen die seltsamen Kekse darin – aber sie haben noch immer keine Ahnung, warum sie am Griff drehen sollen. Er seufzt und geht. Sie schauen aufs Meer und denken an die Kinder in Broadstairs, bei Mutter. Sie beschließen, noch einmal mit der Straßenbahn nach Santander hineinzufahren und ein wärmeres Café zu suchen, wo man drinnen sitzen kann. Von der Straßenbahn aus sehen sie, wie das Schiff, das sie an diesem Nachmittag hergebracht hat, ohne sie wieder ablegt. Vielleicht gibt es ein Kino in Santander.
Das gibt es. Sie finden ein besonders luxuriöses, wo ein Film läuft, den sie beide ein Jahr zuvor im »Granada« in Tooting genossen haben. Und wieder gefällt er ihnen. Auch ihr Abendessen genießen sie – sie sind ziemlich hungrig, als es endlich auf dem Tisch steht – es ist zehn Uhr. Sie genießen ihre Flasche Rioja und ihnen gefällt, dass sie so billig ist. Und anschließend, in Stimmung, gehen sie zum Café oberhalb des Strands, trinken Likör und sprechen mit dem unbeschäftigten Kellner, der früher einmal in Chicago gelebt hat. Während sie reden und die flackernden Lichter der Sardinenboote in der Bucht beobachten, hören sie in weiter Ferne die Stimme eines Jungen, ein wilder, ungewöhnlicher Gesang. Sie wissen nicht, dass es sich um einen Flamenco handelt. Er macht Daisy traurig und George nervös.
Aber der nächste Morgen ist schön und warm, so schön und warm wie vor drei Sommern in Ilfracombe. Erinnerst du dich, George? Und es sind Leute am Strand – wie es der Kellner vorausgesagt hatte. George und Daisy schlüpfen in ihre Bademäntel und gesellen sich dazu.
Von nun an hängen ihre zwölf Tage ausschließlich von ihrer Persönlichkeit ab. Wenn sie initiativ genug sind und ihre Befangenheit in den Griff bekommen, werden sie am Ende dieser Zeit feststellen, dass sie eine Reihe wirklich interessanter Dinge unternommen und ein Stückchen des wirklichen Spaniens entdeckt haben, das an die Stelle des Spaniens ihrer Fantasie treten kann. Und auch wenn sie lediglich Beobachter sind und sich dabei nicht in Vorurteilen verfangen, werden sie ebenfalls viel gelernt und sich gut durch das beste aller Schauspiele unterhalten haben, das sich einem überall bietet – alltägliches Leben, menschliches Leben wie es Leute, deren Gewohnheiten und Eigenschaften unserem Auge neu sind, deren Wesen sich jedoch nicht beängstigend von dem unseren unterscheidet, eben so leben. Aber Initiative und Übersicht sind nicht unbedingt die beiden Dinge, die wir zwangsläufig einpacken, wenn wir planlos und aufgekratzt zu zwei kurzen Wochen aufbrechen, die vor promptem Vergnügen, pittoreskem Nervenkitzel und dem Glanz und Rausch eines kurzen, kostbaren Urlaubs überquellen sollen. Deshalb bin ich eigentlich der Meinung – und ich habe in Santander mit vielen Touristen gesprochen –, dass die vierzehn Tage an der kantabrischen Küste ein Reinfall sind, und wenn die Urlauber ganz ungeduldig zur »Orinoco« zurückdrängen, sind ihnen wahrscheinlich zwei Dinge widerfahren, mit denen sie nicht gerechnet haben – sie wurden in ihrer unschuldigen Suche nach Ferienvergnügen enttäuscht und zum Ausgleich in ihrer unseligen nationalen Selbstgefälligkeit gestärkt. Zwei schlechte Dinge – das zweite noch schlechter als das erste. Wenn ich also sehe, wie sie die Gangway ihres Linienschiffs hinunterstürmen, wenn ich ihre erwartungsvollen, noch ganz frischen Stimmen im Café del Boulevard höre, stimmt mich das traurig, für sie und für Spanien.
Während ich nun die Shrimps aus ihren hübschen Schalen befreie, lausche ich dem Geplapper dieser neuen Schar. Ich mag Shrimps nicht besonders – obwohl ich sie früher gern gefangen habe –, doch hier in Santander gehören sie zum Aperitif fast zwangsläufig dazu. Die Leute aus Sevilla erzählen einem, sie seien bei ihnen besser als im Norden. Dass die camarones, die Garnelen aus Santander, aber weltberühmt sind – und Eduardo sagt, das sind sie –, geht auf einen durchreisenden Bischof zurück, der im vierzehnten Jahrhundert vom Bürgermeister der Stadt verköstigt wurde und feststellte, dass er sie vergnügt und ohne Angst vor Folgen in großen Mengen verspeisen konnte. Worauf er ihre Brut für immer und ewig segnete. Während ich meine Finger mit diesen geweihten Meeresfrüchten beschmutze, noch immer unsicher, ob sie der Segnung des Bischofs oder meiner Mühe wert sind, höre ich, wie die Neuankömmlinge Pläne machen. Ein paar von ihnen – jugendlich, mit kurzgeschorenen Haaren oder mit Knickerbockern, was die örtlichen Señoritos begeistern wird, die derzeit Gefallen an diesen unvorteilhaften Hosen finden – wollen die Sommerschule besuchen. Eine gute Idee. Der Unterricht ist einwandfrei und international ausgerichtet, und sie werden dort so viele Schweizer und Deutsche treffen, dass es für sie bald keine Rolle mehr spielt, ob sie in Spanien sind oder nicht. Einige andere wollen »sonnenbaden und braun wie die Spanier werden und das schöne warme Meer am liebsten gar nicht mehr verlassen«. Jemand hat ein Skizzenbuch zur Hand. Einer der jungen Männer überlegt, Gitarre spielen zu lernen. Bis auf die Studenten sind alle auf Glamour aus, oder das, was sie sich darunter vorstellen. Und alle wollen den Konsul sehen. Ja, wir müssen den Konsul finden.
Das wird ein ewiges Rätsel der Auslandsreisen bleiben. Was wollen die Briten nur immer von ihrem armen Konsul? Der Konsul in Santander ist wirklich ein sehr freundlicher und zuvorkommender Mann, aber wie oft – vielleicht ganz unnötig – habe ich ihn bemitleidet. Schwärme junger Mädchen, die keinen Ton herausbringen, in Cafés begleiten, sie in Straßenbahnen setzen; magenkranke Städter zur englischen Apotheke führen; Marmelade für britische Matronen besorgen; erklären, dass Briefmarken nicht im Postamt gekauft werden – ja, sehr sonderbar – und dass das Wasser Marke Solares genauso gut ist wie Vichy. Ein aufgewecktes zehnjähriges Kind könnte all diese Entdeckungen innerhalb von zwölf Stunden in einer fremden Stadt ganz allein machen und drauf los leben – aber nein. Wir müssen den Konsul finden. Plagen andere Nationen ihre bevollmächtigten Vertreter im Ausland auch in so infantiler Weise? Nun – ich werde ihnen nicht sagen, wie sie den Konsul finden. Gebt dem Mann eine Chance. Das ist seine Hochsaison.
Ein Guardia Civil geht vorbei, mit Gewehr und gelbem Bandelier. Gebeugt und zusammengeschrumpft, kein fesches Exemplar der Träger des berühmten Lacklederhutes, doch der zukünftige Gitarrenspieler, der die anderen Touristen über ihn lächeln sieht, tadelt diese. Die Guardia Civil ist eine prachtvolle Vereinigung von Männern, hat er gehört. Ein englischer Bursche unten am Kai – irgendein Kerl, der für seine Firma hier ist – hat ihm gesagt, dass diese Männer, die Bürgergarde, augenblicklich die einzigen Menschen sind, die zwischen Spanien und der absoluten Anarchie stehen. Alle sehen sehr beeindruckt aus.
Du lieber Gott! Die Guardia Civil hat wirklich eine lange Tradition der Loyalität zum Boss und darin, ihn rücksichtslos zu verteidigen und seine Gegner zu attackieren. Aber hat niemand diesem jungen Menschen, der für seine Firma hier ist, von der paramilitärischen Guardia de Asalto erzählt, der Sturmgarde, deren Einrichtung die junge Republik für nötig hielt? Auf diese neue Polizeieinheit, gegründet allein auf der Tradition spanischer Männlichkeit, soll die spanische Bevölkerung sich nun verlassen, sie soll sie vor den Übergriffen der Bosse bewahren? Abgesehen davon ist es keine irgendwie geartete Polizeitruppe, egal, welchen berühmten Hut sie auch trägt, die zwischen Spanien und den Ideen steht, auf deren Erprobung es aus sein könnte. Das komplizierte spanische Temperament ist nicht von der Gnade eines Polizisten abhängig. Es kämpft mit sich selbst und zwar einen Kampf des Geistes. Und wenn es die Absicht hat, diesen Kampf nach außen zu tragen, dann wird es das tun, wie hoch der Preis auch sein mag – wie wir ja gerade sehen. Würde es einen Engländer freuen, wenn Spanier, die Manchester besuchen und einen Bobby auf Streife sehen, einander belehrten, dass nur Leute wie er zwischen England und der absoluten Autokratie stünden? Überhaupt, »absolute Anarchie« – oh, mein Freund, der du das Gitarrenspiel niemals lernen wirst, weißt du nicht, dass jene unmögliche Lebenslage der Himmel wäre – der Himmel auf Erden?
Ich sollte diese Leute zu einem bestimmten Leuchtturmwärter mitnehmen – keine tausend Kilometer entfernt von dort, wo wir uns gerade befinden. Don Ángel, der dickste Mann in La Montaña. Als ich einmal an der Küste entlangwanderte, sah ich ihn neben seinem Leuchtturm in der Sonne sitzen und fragte ihn, ob ich zum Lampenhaus hinaufsteigen könnte. Ein seriöser älterer Herr – ein Journalist aus Saragossa – hatte gerade dieselbe Bitte geäußert. Also stiegen wir hinter Don Ángel hinauf, dessen Körperfülle es uns unmöglich machte, die nächste Windung abzusehen, oder auch nur den nächsten Schritt vor uns auf der Treppe. Endlich standen wir oben auf der Plattform des Lampenhauses und beugten uns über die hohe Brüstung. Die Plattform war schmal, und Don Ángel klemmte wie ein weicher Ballon zwischen Lampenhaus und Brüstung. Ich bin keine Nymphe, und auch der Herr aus Saragossa war nicht der schlankste. Wir müssen einigermaßen komisch ausgesehen haben, da oben auf der Plattform, aber da war niemand, der über uns hätte lachen können. Don Ángel ist ein sehr ernsthafter Mann, und er und der andere Gentleman vertieften sich in ein Gespräch über politische Theorien. Von denen Don Ángel keine einzige besaß. Er ist ein Anarchist, und während ich ihm zuhörte, dachte ich, dass der großzügige Chesterton13 begriffen hätte, dass es sich bei ihm, zumindest seiner Rede nach, um einen Heiligen handelte. Trotzdem, wegen seines verrückten Traums von Perfektion würde er die gnadenlose Zerstörung aller Zeitalter Spaniens mit ihrer konfusen und herrlichen Kultur, ihrem uransässigen und unbeschreiblichen Glauben befürworten. Spanien muss verschwinden, sagt Don Ángel, es muss den Märtyrertod sterben, es muss in Blut ertränkt werden. Ich brachte gerade genug Spanisch zusammen, um ihm zu widersprechen, aber der Journalist aus Saragossa schüttelte nur den Kopf. Die anarchistische Idee bringt keinen nüchternen Spanier aus dem Konzept. Und während Don Ángel weiterredete, von Dezentralisierung, von der Beseitigung der Obrigkeit und ihrer Symbole, von Lenins schweren Vergehen, von der Bedeutung eines jeden einzelnen Menschen und der Herrlichkeit und Freiheit des Todes sprach, dachte ich weiter über den Katholiken Chesterton nach und darüber, wie man ebenso an Anarchie wie an die Idee des Katholizismus glauben kann, schlicht und einfach deshalb, weil es unmöglich ist. Wie ein Mensch in Christus vernarrt sein mag, so mag er auch in seinen Mitmenschen vernarrt sein, und wenn er verrückt ist nach der Liebe zu Gott, so auch verrückt nach der Liebe zum Menschen. Credo quia absurdum – ich glaube, weil es absurd ist – ein tautologisches Axiom. Du glaubst nicht an den Faschismus. Du hast ihn vor Augen, und es ist schwer, so mystisch damit zu verfahren wie der ältere Herr, der eine Giraffe betrachtete und heftige Zweifel an ihrer Existenz äußerte. Du kannst den Faschismus mögen, wenn es das ist, was du magst. Aber du musst dich nicht dazu zwingen, an ihn zu glauben. Genauso wenig musst du an den Kommunismus glauben. Aber, wie Don Ángel sagte, niemand hat je das Reich Gottes gesehen. Keine menschliche Institution hat je den Beweis dafür erbracht, deshalb kann man nur daran glauben. »Es wird Tote geben, und Blut wird fließen«, sagte Don Ángel sehr freundlich. Und der Gentleman aus Saragossa, ein besorgter Anhänger von Azaña14, schien mit ihm einer Meinung zu sein.
Nun, in jenem Sommer waren Samper15 und die CEDA an der Macht, und es gab weiß Gott genug Probleme, die in Spanien hochkochten. Der Herbst sollte uns das zeigen. Doch der Sommer war schön und die Spanier so zuvorkommend und humorvoll wie immer. Die Basken machten wegen einiger ihrer alten Rechte gegen die Zentralregierung Front, und alle baskischen Bürgermeister wanderten ins Gefängnis, jeder war auf ihrer Seite und ganz einverstanden. Eine einzelne Fremde allerdings, deren Spanisch binnen Kurzem vor den langen politischen Leitartikeln in El Sol kapitulierte, zog es vor, die Berichte über den Stierkampf zu lesen oder die Bilder in der Zeitschrift Estampa zu betrachten. Man war sich in diesem Sommer – oder, Gott vergib, selbst wenn man im darauffolgenden wiederkam – nicht bewusst, ob man beim Sterben zuschaute, oder bei einer riesigen unabsehbaren Geburt. Es war herrlich, in jenen Nächten vor einem bestimmten kleinen Gasthaus zu sitzen, dem sanften Rauschen der Wellen zu lauschen und zu spüren, wie der Verbenenzweig einem sanft über die Stirn strich, während die Dorfjungen – jede Nacht dieselben drei oder vier – an der Veranda lehnten und einander neue Flamencos beibrachten. Der Brandy war spanisch und brannte auf der Zunge, der Gesang wild, doch Spanien schien ganz ruhig, obwohl wir uns gar nicht weit von Asturien befanden. No pasa nada, dachten wir. Es wird schon nichts passieren.
Und im Hotel – wir lachten über zimperliche alte Damen aus Barcelona mit ihren katalanischen Banditengeschichten, wir sprachen mit dem gebildeten Don Perú über französische Literatur, wir hörten teilnahmsvoll zu, wenn uns Consuelo, das hübscheste Zimmermädchen, das je einen Staubwedel in der Hand hatte, von ihrem Bräutigam in den baskischen Bergen erzählte, von seiner Konditorei und seiner Mutter und von der Hochzeit, die zu Ostern geplant war. Und wir diskutierten mit enttäuschten Touristen und versuchten, sie auf genüssliche Wege zu lenken.
Einige hatten ihr Vergnügen. Es gab einen Engländer und seine Frau, die ihr Vergnügen daran hatten, sich nicht zu vergnügen. Und einen Iren und seine Frau, die gerade begannen, die Zeit zu genießen und sich wie Urlauber zu fühlen, als ihr unbarmherziger Dampfer eintraf, um sie nach Hause zu bringen. Aber sie waren eben keine normalen Kurzreisenden. Erstens hatten sie mehr als einen Monat Zeit, und zweitens – sie kamen aus Dublin – waren sie freundlich gesinnt und geneigt, das Leben so nehmen, wie es kam. Anfangs waren sie scheu. Die Gäste, die Señora, der Portier, der Page, die reizende Consuelo, wirklich alle saßen sie auf der Veranda und unterhielten sich, sofern es nichts anderes zu tun gab, was das Kommen und Gehen für einen Fremden, der die Skala aller Arten von Begrüßungen und Höflichkeiten durchlaufen musste, ohne durch Besseres als ein Lächeln oder ein vages si oder ah gewappnet zu sein, durchaus unangenehm machen konnte. Harry, der Ire, fragte mich eines Tages ziemlich gereizt: »Warum fangen sie immer an, über Hochzeiten zu reden, wenn sie meine Frau und mich sehen?« Das Ola! Qué tal el matrimono? der alten Señora hieß nichts anderes als »Hallo! Wie geht’s dem Ehepaar?«. Auf Englisch mag das ein wenig anzüglich klingen, im Spanischen dagegen in keiner Weise, aber bei Harry kam es so an, als wolle sie mit ihm eine Diskussion über das Verheiratetsein führen. Harry und seine Frau kamen aber gut mit den Spaniern aus, und es war schön zu sehen, wie munter sich der Mann mit den fünf oder sechs Brocken, die er gelernt hatte, verständigen konnte.
Die beiden waren unternehmungslustig. Sie machten sich zu Picknicks auf, nahmen die Fähre nach Pedrosa, fuhren nach Solares und weiß Gott wohin. Sie bereiteten ihren Tee in Maisfeldern und Eukalyptuswäldern zu. Sie saßen in Tavernen und lernten von Arbeitern, wie man Wein aus der langen Tülle des porrón trinkt. Sie begleiteten die Señora und mich in den Zirkus, und noch immer höre ich amüsiert Harrys Stimme, als er der alten Dame gegenüber die Limousine lobte, die sie für unseren Ausflug gemietet hatte. »Chrysler coche – sehr bonito.« Sie gingen zum Tanzen ins Casino. Die schwer zu beschreibende sagenhafte Saison, an die Harry seinen Glauben beinahe schon verloren hatte, fing gerade an, als sie abreisen mussten. Sie verbrachten einen ausgelassenen Tag bei einer Romería in einem der Bergdörfer. (Ein Volksfest für einen örtlichen Heiligen, alles inbegriffen, man kommt und geht, wie und womit man will. Romería heißt Wallfahrt.) Sie kauften einen niedlichen Blaumann als Mitbringsel für ihren kleinen Sohn. Ich half ihnen dabei und hoffe, dass sie ihn immer noch haben, obwohl sie ihren Sohn nun vielleicht lieber nicht mehr darin sehen möchten. Ich fürchte, dass Harry nie auf der Seite der kämpfenden Arbeiter stehen wird.
Gemeinsam gingen wir zu einem Stierkampf. Ich war bis dahin noch bei keinem einzigen gewesen – hatte mich nie dazu entschließen können. Hemingways »Tod am Nachmittag« lag ungelesen in meinem Koffer – und würde noch eine Zeit lang ungelesen bleiben. Es handelte sich nur um eine Novillada, einen Kampf mit Jungstieren. Unter den Matadoren war außerdem eine Frau – Juanita Cruz16. Die Ängstlichen hielten es vermutlich für die einfachste Art des Stierkampfs. Ohne Pferde. Kleine Stiere. Eine Frau unter den Matadoren. Ruth, ein siebzehnjähriges englisches Mädchen, bat mich, sie auch mitzunehmen. Ich überlegte, was ihre Mutter, eine sehr liebe Freundin, wohl dazu sagen würde. Heutzutage allerdings eine etwas altmodische Überlegung. Ich nahm sie mit.
Ich hatte bis dahin noch nie etwas über den Stierkampf gelesen, außer bei D. H. Lawrence in Die gefiederte Schlange. Bei meinen Aufenthalten in Spanien hatte ich mich bislang geweigert, mir einen Stierkampf anzusehen. Nun gut, wir gingen hin, Harry und seine Frau, Ruth und ich. Ich erinnere mich, wie ich vor Beginn auf meinem Platz saß und mich kläglich fragte, was in aller Welt mich bloß dazu getrieben hatte, hierherzukommen. Und hörte Ruth, die all den sonnenbeschienenen Flitter ringsum betrachtete, in stiller Verwunderung vor sich hinmurmeln: »Ich bin wirklich in einer spanischen Stierkampfarena.«
Ehrlich gesagt war es ein schlechter Kampf, obwohl Juanita sich wirklich gut schlug und drei von uns sehr feministisch wurden und sich für sie stark machten. Aber es gab viel törichtes Zeug und einen jungen Matador, der sich blamierte. Schwer zu glauben, dass man nach der Erfahrung jenes Nachmittags Lust gehabt hätte, noch eine Corrida zu sehen. Harry hatte keine mehr. Das stand fest. Er betrachtete die Sache als Sportler, und nach den nationalen Jagdregeln und so weiter lehnte er den Stierkampf als dumm und brutal ab. Ich war interessiert und hingerissen ab dem »Los!«. Ruth war still und, wie ich vermute, verunsichert, aber ihre Fantasie kapitulierte, während sie noch mit sich selbst verhandelte. Harrys Frau war völlig aus dem Häuschen, aufgeregt, begeistert und auch amüsiert, als wäre sie eine Spanierin. Sie ließ sich alles erklären und bejubelte Juanita wie verrückt. Sie mussten am Abend der großen feria mit fünf kompletten Corridas abreisen, worüber sie sich sehr ärgerte. Ich hoffe, sie erinnert sich noch an ihre einzige Novillada und wie sich Harry angesichts der Brutalität der drei ihn begleitenden Damen empörte. Nun, sie fuhren zur festgesetzten Zeit auf ihrem Dampfer davon – »Adiós, el matrimonio!« Mir tat es leid, sie gehen zu sehen. Ich frage mich, ob sie in dem regnerischen, alles andere als extravaganten Spanien, das sie erlebten, irgendeine dauerhafte Entschädigung für das Postkartenspanien fanden, nach dem sie gesucht hatten.
Das Theater in Nordspanien ist zuweilen bemerkenswert. Wenn es in Madrid zu heiß wird, um den Schauspielern noch eine ordentliche Zuschauerzahl zu bescheren, zieht es einige der erstklassigen Truppen an die etwas kühlere Küste, und ich sah in Santander eine köstliche Aufführung von Benaventes Lo Cursi. Es handelt sich um eines seiner früheren Stücke, eine zugestandenermaßen etwas altmodische Comédie des mœurs, doch in den verschiedensten Verkleidungen werden die Schwächen, die Benavente in dieser Sittenkomödie aufs Korn nimmt, über die Generationen hinweg weitergetragen, sodass der Schwung, der Reiz und die unterschwellige Bosheit des Stücks das Publikum auf ewig unterhalten wird. Ein anderes seiner Stücke, El Pan Comido en La Mano, konnte ich nicht wirklich beurteilen, denn da es neu und noch nicht veröffentlicht war, hatte ich keine Chance, vorab den Text zu lesen, und durch die extrem naturalistische Spielweise konnte ich der Aufführung sprachlich nur schwer folgen. Das Stück war ernster und emotionaler als die frühe, hinreißende Satire. Die Spielweise wirkte in beiden Fällen wunderbar ausgeglichen, wenn auch ein wenig verhalten und etwas zu sehr à la Du Maurier17.
In jenem Sommer wurden in Santander auch Musikkomödien gegeben. Ich erinnere mich an eine, oder vielmehr erinnere ich mich daran, eine abgesessen zu haben. Ein importiertes, ins Spanische übersetztes Ding, das in Madrid das ganze Frühjahr lang für Aufsehen gesorgt hatte. Die Sache war so langweilig wie Musikkomödien es nun mal sind. Die Handlung erinnerte vage an No, No, Nanette18, aber die Melodien leider nicht. Ich erwähne das nur, um Santander Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, da solche Vergnügungen, nach allem, was ich weiß, zu den Attraktionen der Stadt zählen. Mir ist das bequeme neue Kino lieber, wo sie den Film in der Mitte unterbrechen – wie Gielgud19 den Hamlet unterbrochen hat – und man köstliche Eiscreme bei hübschen kleinen Jungs kaufen kann. In diesem Kino gibt es im Freien ein schattiges Café mit einem Brunnen und breiten Sofas, auf denen, als ich da war, Novios mit ihren sagenhaft herausgeputzten, seltsamerweise durch die Bank blonden Queridas tuschelten.
Aber die Erinnerung an diese untadelige Stadt wird langsam langweilig. Zeit, den Touristen und dem quirligen Paseo zu entfliehen, der sich breit und lang zwischen den Hafenbecken und den hohen, mit Balkonen besetzten Häusern erstreckt. Zeit, diesem verflixten Musikpavillon zu entfliehen. Es gibt keinen Zweifel daran, dass Spanier nach Lärm dürsten. Sie können nie genug davon bekommen. Was sonderbar ist, wenn man bedenkt, wie auffallend ruhig sie sind und wie leise sie sprechen, Mann für Mann. (Nicht Frau für Frau. Die spanischen Frauen sind von Natur aus Rowdies, sie mögen mir das verzeihen.) Man findet keinen spanischen Mann, der einfach nur zum Vergnügen Lärm macht. Ein Grund dafür könnte sein, dass man ihn nie betrunken sieht; die Spanier sind die nüchternsten Menschen, die man sich nur vorstellen kann – wenn aber mehrere oder auch nur ein paar von ihnen zusammenkommen, wird irgendwie oder aus einem nur ihnen bekannten Grund Lärm gemacht. Sie produzieren ihn nicht selbst – sie sorgen dafür, dass er gemacht wird. Menschengruppen, das Geklingel der Straßenbahnen, Pfeifkonzerte, Autohupen, Akkordeons, Frauen – und jetzt noch ihre allgegenwärtigen Lautsprecher. Ich glaube, es gibt keinen einzigen Baum mehr in Spanien, an dem nicht so ein fürchterlicher altavoz befestigt ist. Sie sind verrückt nach Radio. Es ist äußerst schwer, sie zu einem vernünftigen Umgang damit zu bringen, ohne ihnen großen Kummer zu bereiten.
Allerdings habe ich noch nie einen altavoz in Santillana20 wahrgenommen. Ich stehe jetzt auf und gehe. (Und man halte mich jetzt bitte nicht für einen Fan des »Früher war alles besser«, ich bin auch keine Verfechterin der Kunsthandwerks-Bewegung, eine, die die Uhr zurückdrehen will. Nein, ganz bestimmt nicht. Ich bin durchaus für die Annehmlichkeiten unserer modernen Welt – genau wie die Spanier auch. Aber meine Beziehung zum Radio ist wie die zu einer guten Toilette – und ich schätze es da, wo es hingehört, und selbst dann nicht so wie eine gute Toilette.)
Die Toiletten in Santillana sind in Ordnung, wenn man weiß, wo man sie findet und ein paar Peseten hat. Doch selbst, wenn das nicht der Fall wäre, man würde Santillana ganz gewiss verzeihen. Dieser Stadt müsste man selbst dann noch verzeihen, wenn sie ihre altavoces noch rund um das Sanktuarium der Collegiata befestigte. Ich wünschte, ich hätte Harry und seine Frau nach Santillana mitgenommen – obwohl Architektur nicht ihr Fall zu sein schien, und der Ort nichts anderes ist als ein verregnetes, zerbröckelndes, schmutziges Museum aus romanischen und Renaissancegebäuden.
Der Bus verlässt den Paseo in Santander. Er hält vor der Statue von Concha Espina21, eine bedeutende und nun in die Jahre gekommene Tochter der Gegend, deren gefeierte Romane ich seit Ewigkeit lesen will. Irgendwie mag ich ihre Statue – sie hat mich zu vielen schönen Ausflügen aufbrechen sehen. Weiter unten auf dem Paseo steht ein zweites furchterregendes Monument – das Denkmal für einen anderen Romancier, Pereda, ein stattlicher Vertreter des neunzehnten Jahrhunderts. Ich besaß die Kühnheit, zwei oder drei seiner Bücher zu kaufen. Er schrieb Heimatromane über die Montaña, und ich glaube, die Spanier halten ihn immer noch für einen großen Schriftsteller. Er war muy regional, sagen sie stolz. Er war es, würde ich sagen und schätze einmal – aufgrund meiner beträchtlichen Kenntnis weniger bedeutsamer Seiten –, dass er zu sehr moralisierte, dass er in seinem Regionalismus übertrieb, und dass er sentimental war. Aber seine Statue ist bemerkenswert. Er steht hoch oben auf einem großen Granitbrocken der Montaña, ganz rau und realistisch, und um den unbequemen Hügel drängen sich die Früchte seiner Feder – bärtige Bauern, weinende Mädchen, Vögel und Strohgarben, Fischernetze, Sicheln, Greisinnen. Alles aus Granit. Aber es gibt in Spanien jede Menge interessante Statuen dieser Art.
Mein Bus gondelt gerade an Pereda vorbei. Adiós, Santander! Wie das Mädchen in dem Lied weiß auch ich, wohin die Reise geht. Sie geht durch deine schöne, sittsame genügsame Provinz, wo ich dein verlorenes Juwel22 besichtigen werde.
10Es handelt sich um die maurischen Einheiten, die »Regulares«, ein Elitegroßverband des spanischen Heeres, damals rekrutiert aus der einheimischen Bevölkerung von Spanisch-Marokko, die im Spanischen Bürgerkrieg (Juli 1936 – April 1939) auf Seiten der faschistischen Aufständischen unter Francisco Franco (1892–1975) kämpften.
11Alice Meynell (1847–1922), englische Dichterin, Schriftstellerin und Literaturkritikerin.
12Der »melancholische Jaques«, eine Art Anti-Narr, ist eine der Hauptfiguren in Shakespeares um 1599 verfasster Komödie Wie es euch gefällt.
13Der englische Schriftsteller und Journalist Gilbert Keith Chesterton (1874–1936), bekannt vor allem durch seine Kriminalromane um »Pater Brown«, setzte sich zu seiner Zeit so intensiv mit modernen Philosophien und Denkrichtungen auseinander, dass seine Denkweise plakativ als »geistiger Husarenritt« bezeichnet wurde.
14Manuel Azaña y Diaz (1880–1940), von Mai 1936 bis April 1939 zweiter und letzter Präsident der Zweiten Spanischen Republik.
15Ricardo Samper y Ibañez (1881–1938) war vom 28. April bis zum 4. Oktober 1934 spanischer Ministerpräsident mit der Confederación Española de Derechas Autónomas, der Spanischen Konföderation der Autonomen Rechten.
16Die »Torera« Juana oder Juanita Cruz (1917–1981) gilt als Pionierin der weiblichen spanischen Stierkampfkunst. Mit 15 kämpfte sie zum ersten Mal in der Arena und erhielt gleich darauf Auftrittsverbot durch die Regierung. Zwei Jahre später hatte sie sich unter Berufung auf die spanische Verfassung – Gleichberechtigung der Geschlechter und freie Berufswahl – durchgesetzt.
17Anspielung auf die britische Schriftstellerin Daphne du Maurier (1907–1989), die 1931 schon mit ihrem ersten Roman Der Geist von Plyn einen großen Erfolg bei Publikum und Kritik erzielte, obwohl – vielleicht auch weil – ihr Stil zeitlebens als melodramatisch galt.
18No, No, Nanette ist ein berühmtes Musical – Musik: Vincent You-mans, Liedtexte: Irving Caesar und Otto Harbach –, das nach einer Aufführungsserie 1924 in Amerika in einer Neufassung am 11. März 1925 im Londoner Palace Theatre seine eigentliche Uraufführung erlebte.
19Der britische Schauspieler John Gielgud (1904–2000) stand 1930 zum ersten Mal als Hamlet auf der Bühne und galt bald als einer der bedeutendsten Interpreten der großen Shakespearefiguren.
20Santillana del Mar ist eine kleine Stadt im nordspanischen Kantabrien am Golf von Biskaya, eine Station am Jakobsweg.
21Concha Espina (1869 o. 1877 o. 1879–1955), geboren in Santander, war eine berühmte spanische Schriftstellerin, die 1928 für den Literaturnobelpreis nominiert wurde.
22Kate O’Brien bezieht sich womöglich auf ein kurzes Poem von Emily Dickinson, The Lost Jewel: »I held a jewel in my fingers / And went to sleep. / The day was warm, and winds were prosy; / I said: ›T will keep.‹ // I woke and chid my honest fingers, – / The gem was gone; / And now an amethyst remembrance / Is all I own.«