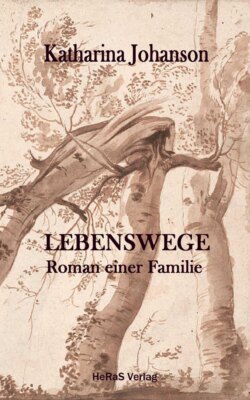Читать книгу Lebenswege - Katharina Johanson - Страница 4
KAPITEL I
ОглавлениеEs war der 12. Februar des Jahres 1840 auf Schloss Schönhof im tief verschneiten, wunderschönen Böhmischen Wald. Auf Schönhof, was zum Wiener Hof gehörte, hatten sich damals die Herren und Damen Chudenitz breit gemacht und führten das genauso nutzlose wie anmaßende Leben feudalabsolutistischer Monarchen. Zu dem Schloss aus Haupt- und Nebengebäuden, Repräsentationsbauten, Lustgarten, Stallungen für die Pferde, Übungsgelände für Reit- und Kampfspiele gehörten an die sechshundert Mann Bedienstete. Diese Domestiken waren dem Schlossherrn bedingungslos unter getan. Die Chudenitz hielten ihre Leute in tiefster Sklaverei und Unwissenheit. Jedes auf Schönhof geborene Kind ererbte von seinen Eltern genau diese Lebensumstände und wurde innerhalb kürzester Frist in den schier nie enden wollenden Lauf von schwerer Arbeit und völliger Rechtlosigkeit hinein gepresst. Von einer Schule auf Schönhof wissen die Geschichtsbücher nichts. Allerdings führte sich der Schlossherr dem damaligen Zug der Zeit entsprechend recht aufgeklärt auf. Er verhieß seinen Untertanen völlige Glaubensfreiheit. Da mischten sich also Juden unter Christen. Und es schafften Deutsche, Tschechen und Slowaken in dem weiten Rund der herrlichen Anlagen und in den Gebäuden. Dem Chudenitz konnte es egal sein, wessen Geistes Kind einer war, wenn der nur treu diente, denn es sprang für den Herrn auch ein Nutzen aus der Glaubensfreiheit heraus. Zum Beispiel feiert ein Christ am Sonntag. Ein Jude lobt seinen Gott am Sonnabend. Damit hatte der Chudenitz an jedem Tag der Woche immer genug Leute im Dienst. Der ständig schwelende Glaubenszwist unter den Untertanen hielt den Chudenitz den Rücken frei. Ein uneinig Volk regiert sich leicht.
Nun war der 12. Februar des Jahres 1840 gekommen und ein Kindchen, ein kleiner Junge, dem man den Namen Leopold gab, war der Domestiken-Familie Stein geboren worden. Der Rabbiner kam auf den Hof, denn der Junge musste innerhalb der ersten zehn Lebenstage beschnitten werden. Die Steins waren getaufte Juden. Für sie war die Zugehörigkeit zur jüdischen Gemeinde ein Muss. Immer und immer wieder hatte ihnen der Rabbiner, der ihnen geistigen Beistand gewährte, auseinandergesetzt, wie wichtig es war, zu ihrem Gott zu halten und innerhalb der jüdischen Gemeinde zu bestehen. Wie den Juden vor nunmehr fast zweitausend Jahren der Salomonische Tempel überm Kopf angezündet worden war, wie sie vertrieben und verfolgt wurden, wie sich über ihnen stets aufs Neue der Hass der Andersgläubigen in Pogromen entlud, das alles schilderte der Rabbiner in dunklen Farben, so dass den Steins der innere Zusammenhalt ihrer, wenn auch weit verstreuten aber doch immer präsenten Gemeindemitglieder als einzige Lebensgarantie erschien. Nichts wussten sie von dem raffenden, fressenden, alles aussaugenden, parasitären Priesterstand der Juden. Diese Priester wiederum hielten um ihrer selbst willen an den verstaubten Ritualen fest. Denn jeder Gläubige der europaweit an die Hunderttausende zählenden Juden war zugleich auch zahlendes Mitglied. Und wenn es nur ganz kleine Münzen waren, da kam dann doch einiges zusammen. Der Klerus drückte seine Anhänger in tiefe Abhängigkeit. Diese Abhängigkeit wurde über die von Ort zu Ort wandernden Rabbiner verfestigt, wie der eine auch auf Schönhof regelmäßig erschien. Dieser Rabbiner war der niedrigste und am elendsten bezahlte Mann der jüdischen Gemeinde. Während er die bitterböse Verfolgungsgeschichte der Juden vor den Steins erneut ausbreitete und damit die Angst und den Schrecken in den Köpfen dieser einfachen Menschen verfestigte, wurde den Steins das konservierte, archaische rituelle Mäntelchen derart zur Fessel, dass diese Leute vor anderen als sonderbar erschienen. Manche dachten auch, die Steins sind ja nicht ganz dicht. Die Christen auf Schönhof erlebten die Steins als weltfremd. Das Judentum war den andersgläubigen Leuten nicht fasslich. Für die einen konnten Juden Wundertäter sein, für die anderen waren die jüdischen Nachbarn die Reinkarnation des Bösen schlechthin.
Die Steins ihrerseits dienten zwei Herren: Ihrem Heiland und dem Chudenitz. Der wandernde Rabbiner, wenn er nach Schönhof kam, kontrollierte nicht nur die Einhaltung der jüdischen Lebensformen und trieb den Tribut für den Klerus ein, sondern, wenn er das strenge Amtsgeschäft erledigt hatte, setzte er sich gemütlich zu den Leuten und plauderte über Gott und die Welt. Er kam viel herum und kannte sich aus. Der Rabbiner war Zeitung und Rundfunk in einem. Auf diese Weise erfuhr der heranwachsende Leopold, dass es mehr auf der Welt gab, als bedingungslos zu dienen. In anderen Gegenden hatte die kapitalistische Entwicklung kräftig Einzug gehalten und ermöglichte dem Mutigen und auch dem Skrupellosen großartigen Aufstieg. Leopold träumte sich in die Rolle eines reichen Händlers hinein und ahnte als Knabe noch kaum, dass er wirklich einmal recht weit oben in der gesellschaftlichen Hierarchie ankommen sollte. Der Junge wuchs zur Freude seiner Eltern heran und auch der ein oder zwei Mal im Jahr hier auftauchende Rabbiner hatte seinen Narren an dem aufgeweckten Kinde gefressen. Da musste man dann eines Tages über die Zukunft des Jungen nachdenken. Der Rabbiner wuchs zu Höchstform auf und erfüllte eine weitere Mission: Geeignete Knaben für den klerikalen Dienst auswählen.
Leopold Stein war überhaupt nicht traurig, als er am 16. September des Jahres 1856 an der Seite des Rabbiners seine Heimat auf Schönhof verlassen musste. Diesmal reiste der Rabbiner mit Pferd und Wagen. Leopold saß oben neben dem Alten auf dem Kutschbock. Er besah sich tief sinnend ein letztes Mal die schön geschwungenen Berge und die bereits mattgelben Fluren. Die Bequemlichkeit des Reisens mit Pferd und Wagen war den beiden vom Priesteramt gestattet und bezahlt worden, weil der Weg weit und die Jahreszeit ungünstig waren. Leopold sollte unbeschadet im immerhin sechzig Meilen entfernten Prag ankommen. Was der Junge als glücklichen Aufbruch empfand, hatte den Rabbiner einige Kopfschmerzen bereitet. Auch wenn er sich stets wohlgelaunt und überlegen gab, so war die Ablösung des Kindes aus dem Chudenitzschen Dienstverhältnis alles andere als ein Vergnügen gewesen. Der Hofmeister von Schönhof hatte den Rabbiner zu sich rufen lassen und bestand auf der Einhaltung des Vertrages: Der Knabe Leopold war auf dem Anwesen geboren worden, hatte das Brot seines Herrn gegessen, hatte alle notwendige Ausbildung zum Pferdewirt erhalten und war nun mit seinen sechzehn Lebensjahren als vollwertige Arbeitskraft anzusehen. „Da kann ja jeder kommen und einfach einen Domestiken mitnehmen“, stellte der Hofmeister entrüstet fest. Der Rabbiner war nicht rat- oder mittellos, aber er scheute den Aufwand und wollte die Kosten möglichst gering halten. „Nun denn, ich will nicht kleinlich sein“, beteuerte der Mann und zeigte ein blankes Goldstück hervor. Des Hofmeisters Augen glänzten. Er gierte nach dem Gelde und spekulierte richtig: Wo eins ist, kann auch ein zweites sein. Der Hofmeister trieb den Preis in die Höhe: „Nein, nein, so billig ist der Junge nicht zu haben. Bedenkt doch, immerhin sechzehn Jahre gefüttert und gepflegt.“ Der Rabbiner reichte ein zweites Goldstück rüber. Da wurde der Meister williger, spekulierte aber immer noch auf etwas reichere Beute. Der Rabbiner überlegte, wie er den leidigen Geldfluss stoppen könne, denn er wollte ja auch selbst einen guten Schnitt bei der Sache machen. Zehn Goldstücke hatte der Mann in die Tasche seines weiten Rockes gesteckt. Das Priesteramt war nicht kleinlich gewesen. Ein Goldstück war als Reisespesen zu veranschlagen, zweie hatte der Hofmeister soeben weggesteckt, ein viertes Goldstück war an den alten Vater Stein gegangen. Jetzt war es genug! Der Rabbiner rechnete sich selbst sechs Goldstücke als Vermittlungsgebühr an. Das war wohlverdient. Schließlich hatte er alle Arbeit und Überredungskünste aufbringen müssen. Niemals war er reich gewesen. Sechs Goldstücke konnten seinen Lebensabend versüßen.
Kurz entschlossen änderte der Rabbiner seine Taktik. Den Hofmeister auf andere Gedanken bringen, ohne weitere Aufwendung hier fortkommen. Weitschweifig erklärte der Mann: „Nun geht der Junge mit mir, aber ich habe Euch auch eine neue Arbeitskraft gerade hierher gebracht. Wie Ihr wisst, ist dem alten Vater Stein vor einem Jahr die Frau gestorben. Da saß er dann mit sieben kleinen Kinderlein allein und sorgte sich schwer und war auch wenig zu gebrauchen. Ihr erinnert Euch?“ Er machte eine Pause im Redeschwall und schaute, ob der Hofmeister ihm folgen wollte. Der folgte sehr wohl und der Rabbiner entwickelte seinen Faden weiter: „Nun ja, die Frau, die ich von weit her brachte und dem alten Stein anvermählte, ist noch jung, recht fest im Fleische, wird gut arbeiten, den Vater Stein entlasten und ihm viele Kinder gebären.“
Hier endete der Rabbiner und war gespannt. Hatte er den Meister auf den rechten Pfad geführt? Und ob! Dem Hofmeister schwoll der Kamm. Eine frische junge Frau im Domestikenstall. Das war so ganz nach seinem Geschmack. Er lehnte sich zurück, fühlte genüsslich die Spannungen in seiner Hose und lies dann hören: „Man müsste schauen, ob die junge Stein wirklich was taugt. Wie soll ich das von hier aus einschätzen? Bringt mir das Mädel her. Und ich schaue, ob sie für den Hof zu gebrauchen ist. Taugt sie, lasse ich Euch mit Leopold ziehen. Taugt sie nicht, bleibt der Knabe hier.“ Da eilte der Rabbiner hinüber ins Gesindestübchen der Steins und brachte die junge Frau zum Hofmeister. Die erschrockene, blasse, dunkelhaarige und großäugige Frau stand mit ihrer schmalen Gestalt anmutig, zurückhaltend und zitternd vor dem allmächtigen, fetten, feisten Hofmeister. Der befragte sie nach Eltern und bisherigem Lebensweg. Allein, sie konnte keinen Ton herausbringen. Da sagte der strenge Mann zum Rabbiner: „Ihr habt sie völlig eingeschüchtert! - Lasst mich mit ihr allein! - Später rufe ich Euch und teile meine Entscheidung mit.“
Der Rabbiner ging. Sechs Goldstücke klimperten in seinem Rock. Jetzt war er frohen Mutes. Er wusste, was geschehen würde. Und es geschah: Der Hofmeister fiel wie ein Tier über die junge Frau her, befriedigte seinen Geschlechtstrieb und stieß anschließend das geschundene Menschenkind wie eine Fuhre Dreck aus seiner Stube. Dann goss er sich ein Becherglas voll Brandwein ein, stürzte das Gesöff hinunter und warf sich auf die soeben besudelte Bettstatt.
Nach einer Weile schlich der Rabbiner herein und fragte schmierig: „Nun, was wird, Herr?“ Der andere lag immer noch auf dem zerwühlten Bette, hob kaum den Kopf und schrie wütend: „Hau ab, Du dreckiger Jude!“ Der Rabbiner war verunsichert und fragte nach einer Weile noch einmal: „Was wird denn nun, Herr?“ Der Hofmeister ernüchterte augenblicklich und sagte mit etwas Wehmut in der Stimme: „Ihr könnt gehen, Du und der Junge.“
So zog der Leopold Stein mit dem Rabbiner seines Weges und schaute hoffnungsvoll in die Zukunft.
Prag war ein Schmelztiegel von Geschichte und Kultur aus Ost und West, aus Nord und Süd. Da trafen sich Menschen aller Nationen und Glaubensrichtungen und schafften mit den Handwerkern aller Gewerke die wunderschönsten Tempel, Schlösser und Bürgerhäuser. Am Rande der Stadt wuchsen auch Armenviertel für die Mittellosen.
Leopold war nun längst kein armer Schlucker mehr. Er hatte durch das Priesterseminar Bildung, Einfluss und die Aussicht auf eine den Mann ernährende Stellung erworben. Der zwanzigjährige Leopold Stein war der Liebling seiner Lehrer geworden. Er memorierte seine Lektionen ausgezeichnet und hatte sich auch in allen Lebensfragen bewährt. Als die Priester dann seine weitere Verwendung diskutierten, kamen sie überein, den jungen Stein nicht etwa in den Klerus einzubinden, sondern ihm eine Handelsfirma anzuvertrauen. Man würde ihm ein Startkapital von einhundert Goldstücken mit ruhigem Gewissen anvertrauen können, und er würde es binnen kurzer Frist auf das Doppelte ja Dreifache vermehren. Der Gewinn, abzüglich eines Salärs für angemessenen Lebensstandard des Kandidaten, fließt dann in die hohe Rabbiner-Kaste zurück.
Leopold Stein hatte die jüdische Geschichte bis ins Detail studiert. Er konnte sich die Frage beantworten, woher das viele Geld kam, das hier so großzügig investiert wurde und wohin es zu welchem Zwecke floss? Zum einen kam das Geld aus den Opfergaben der vielen armen Gläubigen. Zum anderen aber, und das war der größere Teil des Kapitals, hatten die Juden bar aller politischen Rechte während ihrer Jahrhunderte langen Verfolgung erfolgreich den Handel mit allen nützlichen Dingen sowie den puren Geldhandel betrieben. Man hatte ihnen die Ausübung jeglichen Handwerks untersagt, man hatte sie vom Grundbesitz im Großen und Ganzen ausgeschlossen. Da blieb den Gläubigen nur der Handel. Auf den spezialisierten sie sich. Darin bewährten sie sich. Handel wurde die hohe Kunst und Schule der Juden. Schließlich entschieden sie den Konkurrenzkampf zwischen Fürsten sowie Bürgertum auf der einen Seite und Handelskapital auf der anderen Seite, der als Glaubenskrieg zwischen Christen und Juden ausgefochten wurde, für sich. Die christlichen Fürsten und das aufstrebende Bürgertum in der Mitte des 19. Jahrhunderts, nicht nur zu dieser Zeit, aber ganz besonders dann, neigten zu politischer Unfähigkeit und zu Verschwendungssucht. Ihre Geldbeutel waren immer klamm. Da war die Zeit der Juden gekommen. Der reiche Jude war als Geldgeber gefragt, und er kaufte sich in die Politik ein. In allen europäischen Metropolen, mehr oder minder rasch, mehr oder minder komplett, errangen sie Bürgerrechte, also die völlige Gleichstellung mit der übrigen Bevölkerung.
Der angehende Händler Leopold Stein fasste zusammen: Wir Juden haben also Geld. Sogleich drängte sich ihm aus eigenem Erleben die Frage auf: Alle Juden? Gab es nicht arme und reiche zugleich? Die Masse der Juden blieb bettelarm, und sie wurden von ihren Priestern weiterhin in geistiger Dunkelheit und völliger Abhängigkeit vom Glauben gehalten, so wie Leopolds Eltern auch. Sicher war mit den Jahren die erdrückende Rechtlosigkeit formal aufgehoben und erschien als eine Art Befreiungsschlag. Der einfache wie der vermögende Mann konnte sich in allen Berufszweigen üben. Aber die Bilanz sah doch so aus, dass nur der, der Geld hatte oder von den Priestern bevorzugt wurde, wie eben Leopold selbst, es zu etwas bringen konnte. Für Stein stand daher fest, sich den Priestern ewig dankbar zu zeigen und eine innige Verbindung zur jüdischen Gemeinde immerwährend aufrecht zu erhalten, aber im Stillen doch auch dafür zu sorgen, dass sein eigenes Geldsäckchen immer prall gefüllt sein würde.
Die Priester entließen Leopold Stein nicht in die Welt, ohne ihm eine Ehe zu arrangieren, die den Fortbestand der Juden garantierte. Das passende Mädchen aus gutem Hause mit ausreichend intensiver Bindung ans Jüdische wurde für ihn ausgewählt. An einem schönen Sommertag des Jahres 1860 wurde Leopold Stein in der Pinkas-Synagoge in Prag dem Mädchen Karoline Pfau angetraut. Beide verließen ausgerüstet mit gutem Geld und solider Ausbildung Prag, um in Wien eine Handelsniederlassung zu gründen. Leopold handelte künftig mit Lederwaren. Karoline handelte von da an mit Menschen. Beider Geschäft lief mustergültig, warf ordentlich Gewinn ab. Nach einigen Jahren hatten sie gutbürgerlichen Lebensstandard erreicht, unterhielten ein großes Hauswesen und ihre drei Kinder schauten einer materiell gesicherten Zukunft entgegen.
Ihren Menschenhandel nannte Karoline Stein „Dienstleistungs- und Gouvernanten-Vermittlungsbüro“. Das war eine wichtige Sache: Der sich rasch entwickelnden Industrie und den sich ausbreitenden Haushaltungen des bürgerlichen Mittelstandes führte Frau Stein die notwendigen Arbeitskräfte in geordneter Form zu. Aus den ökonomisch mithin politisch schwer unterdrückten Ländern Ost- und Südeuropas kamen massenhaft frei werdende Arbeitskräfte in die großen Produktionszentren Österreichs und Deutschlands.
Es entstanden riesige Wanderbewegungen mittelloser junger Männer und Frauen. Die waren oft tagelang unter großen Entbehrungen zu mehreren oder einzeln zu Fuß unterwegs. An Knotenpunkten unterhielten die Arbeitsvermittler Herbergen. Hier fanden die Flüchtlinge und die Saisonarbeiter Kost und Logis. Hier wurden sie von den Agenten der Vermittlungsbüros entsprechend den Bedürfnissen der Industrie angeworben, registriert und in Gruppen weitergeleitet. Für all das riefen die Arbeitsvermittler unverschämte Preise auf und pressten den armen Menschen die letzten Silberlinge ab. Karoline Stein richtete ihre Herberge in Lazy Puchow direkt an der slowakisch-tschechischen Grenze ein. Hier war der Übergang von tausenden Wanderarbeitern, die nach Österreich unterwegs waren und zum Teil auch auf der Rückreise diesen Ort durchquerten.
Die Inhaberin der immerhin zweihundertfünfzig Kilometer von Wien entfernten Herberge ließ sich in dem Nest niemals blicken. Dafür hatte sie ihre Leute. Großspurig bezeichnete sie diese Anlaufstelle der Arbeitssuchenden als Hotel. In Wirklichkeit war das aber nur ein ganz mieser Schuppen, in dem die Männer und Frauen in großen Schlafsälen untergebracht wurden, sie ihre wenige Habe als Kopfkissen auf schlecht gezimmerten Bettgestellen ablegten und unter verschlissenen, dünnen Decken nächtigten. Freilich gab es am Abend der Ankunft eine ausreichende warme Mahlzeit und am Morgen vor der Abreise bekam jeder ein halbes Brot als Wegzehrung ausgehändigt. Der Karoline Stein war nicht daran gelegen, die wertvolle Wahre vor der Verwertung in der Industrie verrecken zu lassen.
Auf Schönhof, von wo der Leopold Stein seinerzeit aufgebrochen war, ging das Leben in gewohnter Weise weiter. Der alte Stein lebte nicht mehr lange. Die Sorge und die Mühe um das tägliche Brot ließen ihn schnell altern. Still und zurückgezogen verbrachte er seine letzten Tage und ging dann unbeachtet ins Schattenreich der Ahnen über. Auf dem abgelegenen Waldfriedhof gruben sie ihm ein Grab, ließen den dünnwandigen Sarg in den Boden gleiten, schaufelten Erde darüber und errichteten aus Feldsteinen einen niedrigen Hügel. Für ein Grabmal fehlte es an Mitteln, und so verlor sich bald seine Spur.
Seine zweite Ehefrau, die junge Stein, brachte zwar viele Kinder auf die Welt und kümmerte sich redlich auch um die älteren Sprösslinge der Steins, aber sie hatte nicht viel Freude an ihnen. Das eine und das andere starb noch vor dem siebenten Lebensjahr eines Unfalles oder einer Krankheit wegen. Die ihr verbleibenden Kinder liefen in die Weltgeschichte hinaus, sobald sie halbwegs für sich sorgen konnten. Als Mutter Stein das vierzigste Lebensjahr erreicht hatte, war auch sie erschöpft und enttäuscht von ihrer Lebensbilanz, starb ebenfalls einen stillen Tod, und wurde von lieben Mitmenschen an der Seite ihres Mannes im schönen Grund beigesetzt. Ein Pfarrer oder Rabbiner war in diesen Tagen absolut nicht aufzutreiben gewesen. Da halfen sich die Leute selbst. Die kleine Trauergemeinde sprach ein flüchtiges Gebet, halb jüdisch, halb christlich, verharrte minutenlang im stillen Gedenken und zog dann ab.
Kurz nach der Beerdigung der Frau Stein inspizierte der Hofmeister die Gesindestube. Er wollte prüfen, inwieweit der Raum zu einem guten Preis an neue Dienstleute zu vermieten sein würde. Da entdeckte er auf seinem Rundgang zwischen alter Kleidung und Gerümpel ein wimmerndes, verdrecktes, etwa drei Jahre altes Kind. Barsch fluchte er: „Haben die Juden ihr Balg hier sitzen lassen?“ Das Kind, es war ein Mädchen, erschrak heftig und versuchte sich zu verstecken. Einem Geistesblitz folgend wurde der Hofmeister milde, hob das Menschlein behutsam in die Höhe und sprach beruhigend: „Nicht weinen, mein Kind. Wir werden schon was für Dich finden.“ Der Hofmeister brachte die Kleine, die dann nach ihrer Mutter Emilie gerufen wurde, oben im Schloss bei einer Küchenmagd unter, befahl ihr, für das Kind zu sorgen, es aufzuziehen und später als Hausgehilfin auszubilden.
Der Hofmeister war ein Fuchs in Geldsachen. Die kleine Emilie sollte für ihn zur Springquelle von Wohlstand werden. „Die Juden halten doch zusammen wie Pech und Schwefel“, redete er sich ein. Er knüpfte über den jüdischen Klerus Beziehungen bis nach Wien und rechnete den Steins vor, wie wertvoll das junge Leben sei, wie gewissenhaft er für Emilies Ausbildung sorgen würde und wie nützlich eine gute Magd künftig sein könne. Der Plan ging auf. Leopold Stein zahlte Unterhalt, der Hofmeister steckte das Geld ein und das Kind ernährte sich von den Resten aus der Küche.
Damit hatte Emilie eine relativ gute, vor allem freudvolle Kindheit. Zwischen den meistenteils allein stehenden Dienstmägden und Knechten wurde sie hin und her gereicht und von allen verwöhnt, niemand wagte, das Kind allzu derb anzufassen, da es unter des Hofmeisters Schutz stand, der seine „Goldmarie“ argwöhnisch überwachte. Das Mädel erwies sich tatsächlich bald als gelehrige Schülerin der Hauswirtschaft. Emilie war der hell aufleuchtende Stern unter den Domestiken von Schönhof. Weil es ihr einfach gut ging, konnte sie ihre besten Anlagen hervorragend entfalten, so dass sie auch von den Herrschaften des Schlosses gern gesehen und auch von denen bevorzugt wurde.
Zum Jahresende 1885 unterzogen die Steins in Wien ihr Unternehmen der jährlich fälligen Revision. Bei der Abschlussabrechnung waren alle Plätze im Kontor mit Akten belegt, lose Rechnungen und Lieferbescheinigungen wurden abgeheftet, die Schreiber schwitzten, der Prokurist rechnete nach und die Steins überwachten diesen wichtigen Vorgang mit der notwendigen Strenge. Hier und da tauchten Unstimmigkeiten auf, die wurden schnell aufgeklärt, man kam zu einem guten Abschluss: Eine große Summe bildete die Grundlage für weitere Investitionen, ein guter Teil des Hereingekommenen konnte an die jüdische Gemeinde abgeführt werden und das restliche Geld floss dem Steinschen Schatz zu. Am Ende dieser anstrengenden Arbeit bekamen die Angestellten eine kleine Prämie. Man entließ die Leute wohlwollend in ein paar Tage Ferien. Karoline und Leopold gönnten sich ein Gläschen teuren Weines. Sie fühlten sich sowohl ausgelaugt als auch befriedigt. Man hatte eine Schlacht geschlagen und gewonnen. Karoline Stein war eine Geschäftsfrau, die nie eine Investition tätigte, ohne den Gewinn zu kalkulieren oder die Sache etwa aus den Augen zu verlieren. So präsentierte sie ihrem Mann heute eine Rechnung: „Wir sollten uns der Emilie annehmen. Immerhin hast Du jetzt fast zwanzig Jahre für sie gezahlt. Ich denke, jetzt kann Emilie uns von Nutzen werden.“
Leopold brauchte einen Moment, um auf den Gedankengang der Frau einzuschwenken. Während sie schon weiter referierte: „Wenn Emilie, wie der Hofmeister von Schönhof regelmäßig berichtet, eine so gute Ausbildung genossen hat, müssen wir sie aus diesem Kaff wegholen und für unsere Firma einsetzen.“ Leopold entgegnete: „Ich sehe den momentanen Nutzen nicht.“ Daraufhin Karoline: „Ich denke an mein Hotel in Lazy. Dem geht es zunehmend schlechter. Nicht, dass ich da ein Ende sehe. Das nicht. Aber es kommen weniger Leute durch, und die, die kommen, werden knausriger, sind nicht so gut bei Kasse, oder sie sind so gut informiert, dass sie unserer Vermittlung nicht bedürfen und so weiter und so fort.“ Leopold hörte gespannt zu. Sie sprach weiter: „Wenn also die Emilie wirklich so gut geworden ist, wie der Hofmeister berichtet, sollten wir sie nach Lazy rufen, und sie dort ein gut gehendes Hotel für die gut zahlende Mittelschicht einrichten lassen.“
Leopold zweifelte und fragte nach: „Sie soll aus einer Absteige für arme Schlucker ein gut gehendes Hotel für die Mittelschicht machen? Punkt eins. Und zweitens: Woher willst Du gutes Personal nehmen? Sowas kostet doch!“
Karoline konnte seine Befürchtungen entkräften: „Erstens: Emilie kostet uns keinen müden Heller. Die muss erst einmal abarbeiten, was wir Gutes an ihr geleistet haben. Und Personal nehme ich aus meinem Dienstleistungs- und Gouvernanten-Vermittlungsbüro. Die schicke ich in unser Haus nach Lazy. In erster Linie denke ich an Frauen. Die sind billig. Und sollte ein Hotelgast Extrawünsche haben, sind die Weiber auch gern bereit, solche zu erfüllen.“
Leopold verzog angewidert den Mund. Er mochte es nicht, wie Karoline die jungen Mädchen in die Prostitution zwang. Diese Art von Arbeitsvermittlung lehnte er ab, obwohl seinem Geschäft daraus durchweg gute Mittel zuflossen. Es war seiner Meinung nach besser, über diesen Punkt zu schweigen, wenn es sich schon nicht verhindern ließ, dass die Mädchen sich für Geld hinlegten. Ausweichend antwortete Leopold: „Nun gut, der Plan kann so akzeptiert werden. Die Feinheiten erledigst Du.“ Er prostete seiner Frau zu. Später unterzeichnete er einen Brief nach Schönhof zur Emilie und einen zweiten Brief für den alten Hofmeister des Schlosses. Nach ein paar Wochen holte ein Agent die Emilie nach Lazy Puchow. Dort traf sie am 1. April 1886 ein.
Was Emilie vorfand, war einerseits erschreckend, anderseits faszinierend. Faszinierend war der lebendige Ort mit seinen fast zweitausend Einwohnern, mehreren kleinen Kirchen unterschiedlicher Konfessionen, die schön gepflegten Bürgerhäuser, das Rathaus, der Marktplatz. Das waren alles Dinge, die Emilie zuvor so nie gesehen hatte, denn Schönhof mit Schloss und Domestiken war doch eher ein abgeschlossener Kosmos und recht beschränkt gewesen. Hier in Lazy brauste das Leben. Emilie fühlte sich aufs Angenehmste erregt und angeregt. Hier war Bewegung drin. Hier trafen sich Gott und die Welt.
Erschreckend war der Zustand des Hauses. Das sollte Emilie in Eigenregie aufpäppeln und bewirtschaften? Da half ihr ihre Erfahrung von Schönhof. Sie hatte ein großes Anwesen zu versorgen und zu überblicken gelernt. Der Hofmeister von Schönhof hatte seinen Pflegling oft zu sich genommen, ihm alles erklärt, auf vieles hingewiesen. Emilie war eine wissbegierige Schülerin gewesen. Wenn sie sich zuweilen ihrer herausgehobenen Stellung unter den Domestiken bewusst wurde und dem Hofmeister für seine Freundlichkeiten dankte, winkte der stets mit den Worten ab: „Bist mir wie ein eigenes Kind.“
Emilie ahnte nicht, wie dicht diese Bemerkung an der Realität des Alten war. Der hatte in den zurückliegenden Jahren noch recht oft die Nähe der jungen Frau Stein aufgesucht und sie zur Befriedigung seiner sexuellen Wünsche gezwungen. Das alles wusste Emilie nicht. Jetzt registrierte sie wohlwollend, dass sie des Hofmeisters Ziehtochter war und die hiesige große Aufgabe stemmen konnte. Ihr Erschrecken über die Herberge in Lazy hielt nicht lange an. Die junge Frau machte Pläne, leitete an, packte überall mit zu, lernte mit Handwerkern umgehen, überwachte das Baugeschehen, bis schließlich ein kleines, feines, bescheidenes Mittelklassehotel entstanden war. Es kamen gut zahlende Kurgäste in diese schöne Gegend der Nordslowakei, aber auch Dienstreisende stiegen hier ab, und kein noch so armer Wanderarbeiter wurde abgewiesen.
Letztere logierten zwar nicht in den Betten der Beletage, aber ein trockenes Plätzchen bei den Lagerräumen nahe der Küche fand sich alle Male. Den durchreisenden Arbeitsburschen nahm Emilie zwar kein Geld für das Nachtlager und ein warmes Abendessen ab, aber sie richtete es immer so ein, dass die jungen Männer gern fällige Reparaturen im Haus erledigten. Auf diese Weise sparte Emilie die Kosten für ständige Handwerker oder einen Hausmeister ein, was ja wiederum bei den Steins in Wien positiv zu Buche schlug.
Als eines Tages der Antoni Kulka an die Pforte klopfte und um ein Nachtlager sowie eine preiswerte Mahlzeit bat, waren gerade einige Fensterrahmen zu streichen. Emilie taxierte den Menschen von oben bis unten und fragte offen heraus: „Kann er den Pinsel schwingen?“ Der Mann lachte und antwortete keck: „Und ob. Noch mehr als das.“ Schnell war der Handel perfekt, und Kulka turnte geschickt auf der Leiter von Raum zu Raum. Bald war die ganze Fensterfront am Vorderhaus neu und schön. Des Malers Blick fiel auf das kleine Fenster des Dachkämmerchens. Er fragte die Hausdame: „Soll ich da oben auch noch ran.“ Emilie wehrte verlegen ab: „Nein, nein. Das sind Privaträume.“
Da wurde Antoni dreist: „Zu so einer schönen Wirtin gehört doch ein anständiger Rahmen.“ Wie wahr! Der junge Mann bekam den Schlüssel zur Kammer der Emilie, strich den Fensterrahmen und verbrachte die folgende Nacht nicht im Lagerraum bei der Küche, sondern in Emilies weichem, warmem Bett. Längst hatte Antoni schon wieder auf der Landstraße unterwegs sein wollen, aber im Haus gab es stets aufs Neue für ihn zu tun, und Emilie mochte sich auch gar nicht vorstellen, jemals wieder ohne diesen Handwerker auskommen zu müssen.
Der Antoni Kulka schwebte wie auf Wolke Nummer sieben. So gute Tage wie hier hatte er noch nie gesehen. Alles war Mühe und Qual gewesen. Vom Landarbeiter bis zum Maurer hatte er schon alle Berufe durch und noch nirgends Fuß gefasst. Da kam es ihm bei Emilie wie im Märchenland vor, auch wenn die Kammer schmal und die Nächte viel zu kurz waren.
Kulkas Blick war von der Liebe eingetrübt. Er hatte sehr wohl schon bessere Tage gesehen. Sein Kinderbett hatte in dem Schlafzimmer des wohlhabenden Baumeisters Kulka in Waldenburg im Schlesischen gestanden. Antoni war der Mittlere der drei Kulka-Söhne, seine Brüder waren Joseph und Marcus. Der Vater hatte Arbeit im Ort und in der Umgebung, beschäftigte sogar regelmäßig drei bis vier Gesellen, die Mutter stand einem gutgehenden Haushalt vor, den Kindern fehlte es weder an Kleidung noch an ausreichend Nahrung, ihr Tag war Spielen und Lernen, auch Unsinn treiben. Das ging so lang so gut, bis der Baumeister seiner Menschlichkeit stattgab. Weihnachten 1879 hatten die Bergleute der umliegenden Gruben bereits seit Wochen für höhere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen gestreikt. Es war bitterkalt in den Bergen und durch die kleinen Hütten der Leute pfiff der Wind. Heizung war bei denen kaum noch vorhanden, Brot war Luxus geworden. Während die Kulkas den Baum schmückten, die Geschenke verpackten und die Speisekammer auffüllten, saßen die schlecht gekleideten Bergarbeiterkinder frierend und hungernd in ihren Stuben. Das dauerte den guten Meister.
Er erfuhr, dass Streikunterstützung kaum gewährt wurde und die schmale Streikkasse mit Spenden erhalten wurde. Da griff der Mann beherzt zu, gab von seinem Geld reichlich in die Kasse der armen Kämpfer, lief herum, gewann Gleichgesinnte und brachte ein kleines Kapital zusammen. Das war sicher nicht viel für jeden Einzelnen, aber immerhin so viel, dass den Bedürftigsten geholfen werden konnte. Kulkas Gesellen ließen ihn hochleben.
Der Streik zerbrach nicht am Hunger, sondern am Einsatz preußischer Gewalt. Hinterher sperrten sie die Rädelsführer von der Arbeit aus und verwiesen sie des Landes. Die Stadtkamarilla Waldenburgs zeigte Meister Kulka auf perfide Art und Weise, wer die Macht im Staate hatte. Sie entzogen ihm die Bauaufträge.
Des Meisters Sohn, Antoni, war damals gerade fünf Jahre alt. Der Baumeister saß nun zu Hause rum, die Gesellen wanderten fort, denn ohne Lohn konnten sie schlecht bleiben, und die Familie zehrte ihre Ersparnisse auf. Die Mutter klagte den Vater an: „Für alles und jeden hast Du Geld, nur um uns kümmert sich niemand.“ Der Vater suchte Lösungen. Allein, Lösungen fielen nicht vom Himmel. Sein Ruf war ruiniert.
Da raffte er sich zum Äußersten auf und belieh das Wohnhaus. Das hatte er selbst gebaut. Es stand auf altem Familienbesitz. Kulka glaubte, die Misere aussitzen zu können. Früher oder später würden sie wieder gute Leute brauchen. Sowie das Darlehen verzehrt war, ging der Meister erneut zum Pfandleiher und bat um eine Hypothek auf das Grundstück. Die Kinder mussten ja leben. Aber Aufträge kamen eben nicht rein, und nach nicht einmal zwei Jahren versetzten sie ihre letzte Habe, behielten nur das, was sie auf dem Leibe trugen, und der Vater lief um Ausweispapiere zum Meldeamt. Auswandern war das Ziel.
Der Beamte fragte den Kulka leutselig: „Wo soll`s denn hingehen, Meister?“ Kulka antwortete: „Amerika.“ Der Beamte: „Ist doch schon aus der Mode gekommen.“ Kulka: „Mag sein, aber hierbleiben geht auch nicht.“
Nun schrieb der Mann gewissenhaft die Papiere aus. Kulka sah dem Schreibenden zu. Der Staatsdiener fragte: „Und was streiche ich bei Kirche an?“ Kulka überlegte, grübelte, machte sich die Antwort schwer. Der Mann hinterm Schalter wurde ungeduldig: „Nun, Herr Kulka, das ist doch eine einfache Frage: Kirche? Ihr müsst doch wissen, ob katholisch oder evangelisch!“ Kulka druckste rum: „Na ja, so leicht ist das nicht.“
Er rätselte im Stillen. Mit welcher Religion kommt man am besten bis Amerika? Jetzt hatte er es. „Jüdisch. Ja, wir sind jüdisch“, sagte Kulka entschlossen. Der Beamte hob erstaunt den Blick und schaute den anderen zweifelnd an. Dann strich er gewissenhaft das vorgedruckte „katholische/evangelische Kirche“ aus und schrieb auf den freien Platz daneben: Juden. Der Staatsdiener dachte bei sich: Also Juden. Na, das hätte ich nie geglaubt. „Da kennt man den Meister seit Jahren und dann sowas“, murmelte er vor sich hin und schob Kulka die Papiere rüber.
Die ruinierte Familie nahm die Landstraße Richtung Westen unter die Füße. Bis Amerika kamen sie nicht. Es fehlte den Kulkas nicht unbedingt an Mut, hinüber zu reisen, aber am nötigen Geld. Sie machten als Gelegenheitsarbeiter in vielen Orten halt, oft waren die Obdachlosenasyle ihr zu Hause, hin- und wieder fanden sie Aufnahme in den Armenherbergen christlicher oder jüdischer Gemeinden.
Die Kinder wuchsen zu Männern heran, die Eltern alterten Zusehens. Die Jungen hatten zwar nirgends lange verweilen dürfen, aber Einblick in alle möglichen Berufe erhalten, rasch zufassen gelernt und begriffen, dass die Gaben der einfachen Leute viel, viel mehr wert sind, als die Almosen der Reichen. Schließlich kamen die Kulkas bis nach Nürnberg. Die beiden Alten legten sich zum Sterben nieder. Die Söhne einigten sich mit dem Seelsorger der jüdischen Gemeinde auf ein schlichtes Begräbnis. Dann trennten sich die jungen Männer. Joseph und Marcus Kulka wurden in Nürnberg sesshaft. Sie waren des Wanderns müde, hatten dann auch Glück mit ständiger Arbeit und gründeten einen normalen, bescheidenen Hausstand.
Antoni trieb es fort. Er verabschiedete sich mit den Worten: „Ich gehe nach Hause zurück.“ Was immer er auch darunter verstehen wollte, und wanderte Richtung Osten. Nach einigen Monaten traf er im Hotel in Lazy auf die schöne Emilie. Arbeiten und Leben an ihrer Seite erschien ihm tatsächlich wie das Himmelreich auf Erden.