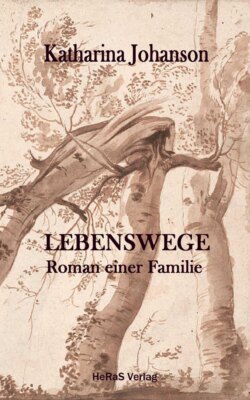Читать книгу Lebenswege - Katharina Johanson - Страница 5
KAPITEL II
ОглавлениеDie Zeit floss dahin. Inzwischen kam das Jahr 1895 ins Land. Die Steins in Wien hatten ihre Geschäfte auf ihre Kinder übertragen. Vater Leopold Stein ruhte nach einem langen, erfüllten Leben nun bereits seit drei Jahren auf dem städtischen Friedhof in Wien. Seine Frau Karoline Stein stand zwar noch formal dem Wiener Hause vor, war aber bereits reichlich senil geworden und hatte nichts mehr zu entscheiden. Da traf aus der gut gehenden Kapital-Quelle in Lazy eine Hiobsbotschaft ein. Emilie will heiraten! Emilie heiraten? Niemals! Mit Emilies Arbeit stand und fiel der ganze Hotelbetrieb. Emilie war der „Gute Geist“ der Branche. Die drei Stein-Erben und jetzigen Geschäftsführer, Olga, Ida und Arthur, saßen im Kontor des Wiener Stammhauses zu Rate. Was war zu tun? Man hatte Emilie jahrelang in tiefer Abhängigkeit gewusst. Sie hatte weder Lohn noch eigene Papiere erhalten. Da hatten sich die Wiener sicher gefühlt und ihre Pfründe aus dem Hotelunternehmen abgezogen. Jetzt mussten sie auf das Freiheitsbegehren der Emilie reagieren. Eine Freiheit, die überall in Europa Einzug hielt und offenbar jetzt auch bei der kleinen Magd angekommen war. Mit etwas Cleverness konnte man Emilie einschüchtern und bei der Stange halten. Es kam also darauf an, Stärke zu zeigen: Emilie durfte nicht heiraten. Sie durfte schon gar keine Erben in die Welt setzen. Und es war vor allem zu verhindern, dass sie dem jüdischen Glauben abschwor. Der Familienrat beschloss, Olga Stein nach Lazy auszusenden, um die Emilie zur Raison zu bringen. Notfalls mit Drohungen und Gewalt.
Olga Stein kam verstaubt, verschwitz und müde in Lazy an. Mit Kutscher und Wagen war sie vom Bahnhof abgeholt worden. Ihr standen das beste Zimmer und ein Bad zur Verfügung. Als sie sich hergerichtet hatte, traf sie die Hausdame Emilie Stein im Büro. Die beiden Frauen waren etwa gleichaltrig. Emilie war von der kräftigen Statur einer Arbeitsfrau und Olga war das zarte Püppchen der Aristokratie. Olga führte folgende Rede: „Du willst uns also aufkündigen. Überleg es Dir gut! Mit Deiner Heirat wirst Du aus unserem Dienstverhältnis ausscheiden und ziehst mittellos auf die Straße. Was erhoffst Du Dir davon?“ Emilie hatte solchen Angriff nicht erwartet. Sie wollte doch nur gültige Papiere haben. Also antwortete sie: „Ich will gar nicht kündigen. Ich will nur den Mann Antoni Kulka heiraten. Und dann sind wir zweie, die hier schaffen wollen.“ Olga nahm den Faden auf und antwortete spitzfindig: „Dann wollt Ihr Euch also zu zweit auf unsere Kosten durchschlagen? Ist das so?!“
Emilie stockte der Atem. Das war der Gipfel der Unverfrorenheit! Wie konnte die nur so mit ihr reden? Durchfressen, durchschlagen, nassauern. Das gibt es doch gar nicht. Hatte sie nicht alles für die Firma Stein gegeben? Emilie stemmte sich gegen die anmaßende Art der anderen: „Mein Antoni und ich werden hier rechtschaffend wirtschaften. Nur darum geht es, um nichts anderes. Und ich will die ehrbare Frau bleiben, die ich schon immer war. - Also Heirat!“ Olga begriff schlagartig, dass Emilie eine fest im Leben stehende Frau war, mit der man einerseits rechnen musste. Andererseits dachte die Emilie gar nicht daran zu kündigen. Sie war treu ergeben. Wenn sie den angehenden Ehemann zu den gleichen Konditionen wie sich selbst ins Geschäft einbrachte, konnte die Firma Stein nur gewinnen. Olga lenkte ein: „Wenn Dein Mann hier arbeiten will, mag das gut gehen. Wir beschaffen Dir Papiere.“
Emilie war erleichtert. Sie strahlte. Olga fragte noch sicherheitshalber: „Und Ihr werdet jüdisch heiraten?“ Emilie nickte stumm. Olga war zufrieden. Das Haus würde also jüdisch bewirtschaftet bleiben und der jüdischen Gemeinde von monetärem Nutzen sein. Olga trat den Heimweg an. Emilie Stein und Antoni Kulka gaben sich im Spätherbst des Jahres 1895 vor der kleinen jüdischen Gemeinde in Lazy das Jawort.
Sowie Antoni Kulka realisiert hatte, dass er hier wie ein Haussklave gehalten wurde, stieß es ihm gallig auf. Bei allen Mühen der letzten Jahre, hatte er doch wenigstens immer seinen Lohn in der Hand gehabt und konnte darüber frei verfügen. So lieb ihm Emilies Bett war, sowenig mochte er diese völlige Mittellosigkeit. Das klagte er eines Tages seiner Frau. Die hielt ihm vor: „Was willst Du denn? Du hast doch alles.“ Kulka entgegnete: „Ich habe noch nie ohne Lohn gearbeitet.“ Emilie erwiderte: „Wir haben essen, schlafen und uns. Was, um Himmels Willen, willst Du noch?“ Da sagte Kulka eindringlich: „Mensch Mädel, ich will leben!“ Emilia konnte es nicht fassen. Was wollte der Mann? Der erklärte: „Leben. Leben ist doch mehr als nur arbeiten, essen, schlafen. Mädel, es gibt Bücher, Theater, herrliche Wälder. Man will lesen, sich freuen, wandern gehen. Du kannst mir doch nicht weiß machen wollen, dass das hier alles, dieser Reichtum, für den wir schuften, nur für die anderen da ist. Wo bleibt denn mein Anteil? Diesen Anteil würde ich mir gern kaufen. Kann ich aber nicht, weil ich keinen Lohn bekomme.“ Emilie schaute ihn ungläubig an. Er spürte, dass er nichts bewirkt hatte.
Sie gingen traurig, schweigend ihrem Tagwerk nach. Als es Abend war, hatte sich im Hotel herumgesprochen: Die Chefin hat Krach mit ihrem Kerl. Und obwohl das gar nicht stimmte, denn die beiden redeten ja nur nicht miteinander, bauschten die Klatschmäuler das Gerücht gehörig auf, so dass die Situation schließlich unerträglich wurde. Alles drängte auf Aussprache. Emilie rief in ihrer diensteifrigen Art zu später Stunde ihre Leute zusammen. „Hört“, hielt sie Rede, „damit hier keine Irrtümer umlaufen und morgen wieder alles seinen gewohnten Gang geht: Es gibt keinen Grund, sich das Maul zu zerreißen oder Unruhe zu stiften. Der Antoni und ich haben sicher Meinungsverschiedenheiten, aber es gibt keinen Krach, keine Krise, nichts Schlimmes ist passiert.“
Man schaute betreten beiseite, man war neugierig und eine Küchengehilfin sagte offen heraus: „Dann können Sie uns ja auch sagen, was los war.“ An Emilies Stelle antwortete Antoni: „Ich will nicht mehr ohne Lohn arbeiten. Aber hier schweigen alle wie die Dussel. Das ist die reinste Sklaverei!“
Unter Zimmermädchen, Küchenpersonal, Kellnern und Laufburschen brach zustimmender Tumult aus. Emilie wurde hochrot vor Entsetzen. Alles schrie, fluchte, krähte durcheinander. Einer verstand den anderen nicht mehr. Allmählich erkämpfte sich die hohe Stimme eines Zimmermädchens das Vorrecht, gehört zu werden.
Die anderen beruhigten sich. „Da hat der Antoni recht. Wo er recht hat, hat er recht. Jawohl. Wir arbeiten hier für einen Hungerlohn, können froh sein, überhaupt Arbeit zu haben. Fürs Alter oder eine Familie kommt nix rüber. Ich finde, wir sollten uns das nicht länger gefallen lassen. Wir stellen unsere Forderungen auf. Und wenn das nicht fruchtet: Streik!“ Das letzte Wort schlug wie eine Bombe ein. Angestaute Wut, erlittene Demütigung, Kampfeslust, auch Angst entluden sich in einem noch größeren Lärm denn zuvor. Emilie schlug die Hände vors Gesicht und warf sich schräg über ihr Schreibpult. Das Personal veranstaltete einen wahren Kriegstanz. Emilie jammerte: „Sie ruinieren mir das Hotel.“ Sie wurde nicht gehört.
Im Stammhaus der Steins in Wien fand Krisensitzung statt. Olga sagte: „Sie ruiniert mir das Hotel.“ Arthur meinte: „So schlimm kann es doch nicht gleich werden.“ Ida fluchte: „Man hätte sie gleich rauschmeißen sollen!“ Olga zischte: „Was weißt Du denn?“ Arthur bat sich Ruhe aus und unterbreitete dann seinen Plan: „Lasst sie ein paar Tage streiken. Bis unser Agent eingewiesen und vor Ort handlungsfähig ist, vergeht sowieso etwas Zeit.“ Ida: „Emilie fliegt!“ Arthur: „Nein. Emilie bleibt! Ich stelle mir das so vor“, entwickelte er weiter, „also das Personal streikt. Die Gäste reisen ab. Sowas spricht sich rum. Wir können ja auch dafür sorgen, dass es sich schnell herumspricht. Buchungen werden storniert. Das Haus steht leer. Keine Gäste, kein Personal. Logisch.“ Olga und Ida lauschten gespannt. Er erläuterte weiter: „Jetzt haben wir, was wir wollen. Die Leute werden entlassen beziehungsweise gehen von selbst. Es fließt ja kein Geld mehr rein. Wieder logisch.“
Olga fragte: „Und was hast Du nun gekonnt? Das Haus steht leer.“ Arthur voller Eifer: „Mädel, Du musst die Zeitung lesen und ein bisschen die Ohren aufsperren. Passt auf: Wir machen ein Sanatorium auf. Ganz konkret ein Sanatorium für Lungenkranke. Wir investieren ein bisschen ins Gesundheitswesen.“
Olga lehnte sich zurück und schimpfte: „Himmel, was das kostet!“ Arthur wusste es besser: „Seit Jahren saniert der Fiskus die großen Städte. Die hygienischen Verhältnisse sind ja auch ein Skandal. Krankenhäuser, Siechenheime, Pflegeanstalten entstehen massenhaft und so mancher verdient sich damit schon eine goldene Nase.“
Olga unterbrach ihn ganz naiv: „Woher kommt das Geld?“ Arthur weiter: „Olgachen, Olgachen, wie dumm Du manchmal bist. - Na, aus Steuermitteln selbstverständlich.“ Arthur lächelte siegessicher. „Wir machen also eine Lungenheilstätte auf und leiten ganz geschmeidig die Steuern in unser Unternehmen um. Zwei Fliegen mit einer Klappe: Wir tun ein gutes Werk und verdienen dabei.“
Die Frauen schauten ihn bewundernd an. Ida hatte dann doch noch eine Frage: „Woher nehmen wir Krankenschwestern, Ärzte, eben das ganze medizinische Personal?“ Auch darauf war Arthur schon vorbereitet: „Die laufen uns massenhaft aus der jüdischen Gemeinde zu. Und ich sage Euch, die sind noch billiger als die bisherigen Leute und arbeiten, ohne zu streiken, jemals Lohnforderungen zu stellen und ohne dieses ganze Brimborium. Die arbeiten nämlich für unseren Heiland.“ Die drei steckten die Köpfe zusammen und besprachen noch ein paar Einzelheiten.
Der Steinsche Agent Emanuel Hirsch traf mitten ins Chaos hinein in Lazy ein. Kulka und Genossen hatten ihre Forderungen formuliert, ein Ultimatum gestellt und nach abgelaufener Frist den Streik ausgerufen. Wie die Steins vorausgesehen hatten, reisten die Gäste innerhalb weniger Stunden ab. Die örtlichen Transportunternehmen waren überfordert, in geregelter Manier die Gäste zum Bahnhof zu bringen. Panische, hysterisch kreischende Bürgerpüppchen, geschniegelte, steife Herren rannten zu Fuß zur Bahn, hastig zusammengeschnürtes Gepäck fand sich auf der Straße, Koffer brachen auf und gaben den Inhalt frei. Man stolperte, man fiel, man brüllte und geiferte. Der Spießer von Lazy schrie „Hilfe! Revolution! Rette sich, wer kann!“, knallte das Haustor zu und verriegelte die Fensterladen. Das Hotelpersonal hielt sich ruhig hinter Antoni. Sie streikten! Sie hatten auch Freude daran. Endlich unternahmen sie mal was.
Agent Emanuel Hirsch betrat das Haus und fragte nach der Hausdame. Emilie war nirgends zu finden. Da bat der Mann um ein Zimmer. Das Mädchen am Tresen wies ihn zurecht: „Hier wird aber nicht bedient.“ Der Hirsch sicher und freundlich: „Ich will nur ein Zimmer, bedienen kann ich mich selbst.“
Er bekam den Schlüssel von Nummer dreizehn. Das Hauspersonal besah sich mit belustigender Genugtuung den Abzug der Reichen und Schönen, dann setzten sie sich in den Gastraum und hielten gelangweilt Streikwache. Nichts ereignete sich. Die Stunden dehnten sich. Etliche gingen auf ihr Kämmerchen, Antoni und ein Laufbursche hielten die Stellung. Der nächste Tag kam und ging. Es ereignete sich wieder nichts. Der Herr von Nummer dreizehn strich ab und zu durchs Haus, ging zu den Mahlzeiten in die Bahnhofswirtschaft und verhielt sich ansonsten unauffällig.
So verging eine Woche. Keine Nachricht, keine Post. Emilie erschien im Gastraum. Sie sah und hörte ihren Antoni nicht. Stumm drückte sie sich an den Streikenden vorbei zum Büro. Nach einer Weile kam sie wieder heraus und fragte im üblichen Geschäftston: „Ist denn keine Post gekommen? War der Geldbriefträger noch nicht da?“ Man schüttelte den Kopf. Emilie wurde nervös. Um diese Zeit war doch immer der Briefträger mit dem Geld gekommen. Er brachte wöchentlich einmal das Geld, mit dem sie die Lieferanten bezahlen musste. „Das verstehe ich nicht“, sagte Emilie laut vor sich hin.
Der Herr von Nummer dreizehn trat hinzu und sagte freundlich: „Ich verstehe schon. Wenn ich erklären darf?“ Er zog einen Stuhl heran und setzte sich zu der Gruppe. Emilie stand etwas abseits. Alle schauten gespannt auf den Unbekannten. „Das Haus ist mit sofortiger Wirkung geschlossen. Mein Name ist Emanuel Hirsch. Die Steins haben mich bevollmächtigt, Ihnen mitzuteilen, dass sie das Hotel aufgeben werden.“
Betretenes Schweigen, vages Begreifen, aufkommende Tränen, mühsam niedergerungene Wut, Erstaunen, Erschütterung zeichneten die Gesichter der Leute.
Antoni raffte sich zu Widerspruch auf: „Wer berechtigt Sie?“ Der Herr nahm gelassen einen Briefbogen aus der Tasche, faltete ihn auf und ließ das Blatt auf den Tisch segeln. „Vollmacht“ war weithin sichtbar zu lesen. Den Rest konnten sie sich denken. Keiner zuckte. Der Agent stand auf und sprach jetzt knallhart: „Ich bitte Sie, innerhalb von, nun sagen wir, in drei Stunden, das Gebäude zu räumen. Sie befinden sich auf fremdem Besitz. Ihre persönlichen Sachen dürfen Sie mitnehmen. Lohnforderungen können nicht geltend gemacht werden. Sie haben ein Woche lang nicht gearbeitet.“ Erschlagen zog das kleine Trüppchen ab. Hirsch begab sich zum Büro. In der Tür sagte er streng: „Frau Kulka, zu mir! Wir gehen noch die Bücher durch.“ Emilie gehorchte.
Emilie stand furchtsam neben der Tür. Der Agent schritt selbstsicher durch den Raum. Er atmete durch und war deutlich erleichtert. Die Sache war glimpflich abgegangen. Er war auftragsgemäß die Leute losgeworden. Es hätte zu Tumult kommen können. Das war ihm völlig klar gewesen. Auch das hätte er sicher mit Hilfe der Polizei zurechtgebogen. Seine Spaziergänge hatten ihn regelmäßig in die Wachstube am Rathaus geführt. Der nötigen Schützenhilfe verstand er sich mit einer Finanzspritze zu versichern. Nun war die Sache rasch und stillschweigend erledigt. So war es gut. Ohne viel Aufheben. Der Agent wendete sich zu Emilie um und redete freundlich, langsam wie zu einem Kinde: „Also, Frau Kulka, da sind Sie ja in eine böse Sache reingeraten. Das hätte ich nicht von Ihnen gedacht. So wie Sie mir von den Steins beschrieben wurden, sind Sie doch eine geschäftstüchtige, fleißige, ehrliche und vor allem umsichtige Frau.“
So wie Emilie den warmen Ton wahrnahm, brach sie in Tränen aus. Ihre Aufregungen der letzten Tage lösten sich in einem Sturzbach. Der Mann reichte ihr ein Taschentuch und geleitete sie am Arm zu einem Stuhl. „Nicht weinen, gute Frau. Wir werden uns schon einigen.“ Emilie schaute ihn von unten aufblickend an, schöpfte Mut, nahm sich zusammen und erhob sich diensteifrig: „Die Bücher. Ich will Ihnen die Bücher zeigen. Die sind alle in Ordnung.“
Er drückte sie auf den Stuhl zurück und sagte derb: „Um die Bücher geht es doch gar nicht!“ Der Ton fuhr Emilie messerscharf in die wunde Seele, und sie durchdachte blitzschnell: Der ist ja unberechenbar. Vorsicht! Sei auf der Hut, Emilie! Schon hatte sich der Agent wieder auf Freundlichkeit umgestellt. Emilie hörte: „Nun, mit Ihnen haben wir Folgendes vor: Nachdem wir das Pack aus dem Hause haben, werden hier Umbauten erfolgen. Zwei große Schlafsäle. Einer für Männer, einer für Frauen. Wir bauen ein Sanatorium auf.“
Hirsch entwickelte vor der Frau den Steinschen Plan. Über Geld sprach er nicht. Darüber war er nicht informiert und das ging Emilie ja auch gar nichts an. Als er sicher war, verstanden worden zu sein, änderte er erneut den Ton ins Grobe und fuhr gegen die Frau los: „Sie wissen es hoffentlich als familiäre Rücksicht und Gnadenbeweis zu schätzen, wenn die Steins Sie weiterhin hier als erste Wirtschafterin beschäftigen. Kost und Logis sind weiterhin frei. Kann ich der Familie Stein nun positiv berichten? Ja oder nein?“
Emilie zuckte zusammen und nickte zustimmend. Sie war froh, ihr Dach über dem Kopf zu behalten. Hirsch: „Sie sind entlassen. Ich fahre in wenigen Stunden nach Wien. Sie warten hier alles weitere ab.“
Emilie schlich zur Tür und blieb dort unsicher stehen. „Was ist denn noch?“, fragte der Agent barsch. Emilie: „Ich bin verheiratet. Mein Mann, der Antoni“, weiter kam sie nicht. Hirsch winkte großspurig ab: „Der kann bleiben. Aber treiben Sie ihm die Flausen aus dem Kopf!“
Emilie schlich in ihre Kammer, warf sich auf das Bett und weinte Tränen der Erlösung. Mitten in der Nacht spürte sie ihren Mann im Raum. Er war da. Sie hob die Decke auf, er schlüpfte zu ihr, sie legte ihren Kopf an seine Schulter und flüsterte: „Gott sei Dank, wir dürfen bleiben.“ Antonis verzweifelte Züge konnte sie im Dunklen nicht sehen.
Das Stammhaus der Familie Stein in Wien diente nur noch als Bürohaus. Mit den Jahren hatte sich das Gebäude für eine Doppelnutzung zu Wohn- und Geschäftszwecken als zu klein erwiesen. Zwar hatte man zwei angrenzende Grundstücke günstig erwerben können, den Bau erweitert, die Anzahl der Räume vermehrt und hinten einen kleinen Garten angelegt, aber insgesamt zog mit den vielen Besuchen von Agenten und Partnern, den ständigen Buchhaltern und Sekretären doch so viel Unruhe ein, dass die Steins ihren Wohnsitz nach außerhalb auf einen Landsitz am Ufer der Donau verlegten. Jeden Morgen ließ sich Arthur in die Metropole kutschieren und abends kehrte er auf das ruhige Anwesen zurück, es sei denn, wichtige Geschäfte hielten ihn in Wien auf. Dann nächtigte er im Stammhaus.
Olga und Ida kamen nie mehr in die Kaiserstadt. Sie kümmerten sich um das ländliche Hauswesen und verbrachten ihre Zeit mit schöngeistiger Erbauung. Das Geschäft lag gut in Arthurs Händen. Er hatte es zu schwindelerregender Höhe hinaufgebracht. Der noch nicht ganz dreißigjährige Arthur zählte zu den wichtigsten Oligarchen des österreichisch-ungarischen Imperiums. Arthur zeigte sich wie sein Kaiser gern in der Offiziersuniform der k. u. k. Monarchie. Schneidig, zackig, mit kurz abgehackten Formeln gab er seine Ratschläge und Anweisungen bekannt. Damit erzeugte er ein mildes Lächeln hinter vorgehaltener Hand bei seinen Partnern und Untergebenen, die sich ihre sprichwörtliche Wiener Gemütlichkeit zu Gute hielten.
Allein seiner Schreibkraft, der Wally, diktierte er ganze, wohlgeformte Sätze. Der Schriftverkehr musste plausibel und nachfühlbar sein. Da gab sich Arthur wortreich, diplomatisch, freundlich, überzeugend. Überhaupt war die Wally der einzige Mensch, der den Arthur als herzlichen, offenen und geistreichen Mann kennen durfte. Arthur hatte mit dieser Angestellten einen Glücksgriff getan, denn sie war sehr anziehend anzuschauen, überaus klug, fleißig, verschwiegen, und sie wusste schließlich auf seine erotischen Wünsche geschickt einzugehen. Allein der Wally waren Arthurs weitreichende Verbindungen in vollem Umfang bekannt. Handelsbeziehungen, die sich über ganz Süd- und Osteuropa erstreckten, von dort nach Österreich liefen, im Wiener Stammhaus verknüpft wurden und dann den Kaiser so wie seine Minister an die lange Strippe nahmen. Arthurs Geschäftspraxis war, jeden nur so viel wissen zu lassen, wie er für die Erfüllung seines Auftrages nötig hatte. Das machte ihn als Alleinherrscher unersetzbar, und er konnte die Figuren manipulieren und jederzeit austauschen.
Bei der Geliebten verlor er die Beherrschung. Ihr berichtete er ausführlich, vor ihr gab er an, hier steigerte er sich in seine wahre Größe hinein. Eine Schwäche. Zugegeben, eine Schwäche. Er gestand sich diesen wunden Punkt ein. Bei Wally durfte er Mensch sein und war es in ihrer Nähe gern. Die Wally wusste zum Beispiel zu welch barbarisch niedrigen Preisen er die Tierhäute in Kroatien einkaufen ließ, um sie dann in Gerbereien in der Slowakei von Frauen und Kindern ebenfalls wieder zu einem Spottpreis veredeln zu lassen. Die feinsten Leder wanderten dann in die Sattlereien und Nähereien des Möbel- und Bekleidungshandwerks Mitteldeutschlands. Hier erzielte Arthur Gewinne, von denen man nur träumen konnte. Allerdings war das noch gar nichts im Vergleich zu seinem jüngsten Verhandlungserfolg: Arthur hatte sich das Monopol auf die Versorgung des Heeres mit Ledererzeugnissen gesichert. Er hatte alle anderen Anbieter derart schamlos unterboten, dass selbst die schlauesten Füchse in der Branche die Hände überm Kopf zusammenschlugen.
Vor der Wally schilderte Arthur die eine oder andere Verhandlungsszene noch einmal und sog seinen Erfolg selbstsüchtig in sich auf. Und wieder durfte er nur bei der Wally richtig groß sein. Draußen gab er sich bescheiden und zurückhaltend, ließ oft nur seine Agenten an vorderster Front auftreten. Seinen Größenwahn, den er im Höhenrausch immer noch durchaus bewusst wahrnahm, wusste Arthur immerhin soweit zu zügeln, dass er nach außen nie zeigte, wie reich er wirklich war und welche Trümpfe er im Ärmel hatte. Auch die Wally wusste er dahingehend zu beherrschen. Er gewährte ihr ein bescheidenes Einkommen, gerade ihrer Stellung als Schreibkraft angemessen. Er versprach ihr nichts und heizte ihren monetären Ehrgeiz niemals unnötig an. Ganz nach dem Motto: Kleine Geschenke erhalten die Freundschaft.
Im entfernten Lazy war Herbst geworden. Der Herbst des Jahres 1897. Das Wetter tobte, die Temperaturen fielen über Nacht schon mal unter null, und die beiden Hausbesorger, Emilie und Antoni, harrten der Dinge die da kommen sollten. Es sah düster aus. Außer dem Auftrag, das Haus solange in Eigenregie zu hüten, bis die Umbauten einsetzen würden, war keine Nachricht von den Steins aus Wien hier eingetroffen. Die beiden Menschen saßen buchstäblich auf verlorenem Posten. Es war kein Geld im Haus und es mangelte an Nahrung. Heizmaterial war vorhanden. Dafür hatte das Personal während der Sommermonate gesorgt, denn das gut belegte Hotel sollte auch im Winter eine anheimelnd, wohnliche Stätte sein. Emilie und Antoni gingen sparsam mit Holz und Kohle um, es war ja nicht ihr Eigentum. Die Frau unterhielt nur ein ganz kleines Feuer in der Küche. Aber Nahrungsmittel fehlten eben. Es gab keine Reserven, die man jetzt hätte aufbrauchen können. Den kleinen, in jeder Haushaltung üblichen Vorrat an Mehl, Graupen, Zucker, Salz hatte Emilie bis zur Neige ausgeschöpft, abwechselnd in Wasser mal einen gesüßten, mal einen gesalzenen Kleister gekocht, den sie widerwillig runter würgten. Nun war auch das zu Ende. Fleisch, Fett, Gemüse hatten sie seit Wochen nicht auf dem Teller gehabt.
Antoni fasste zusammen: „Die lassen uns hier verrecken. Wer soll uns denn jetzt noch hier ablösen, auslösen, verpflegen, bezahlen? Im Winter wird nicht gebaut. Wenn erst der Schnee kommt, passiert hier gar nichts mehr.“ Er schaute auf Emilie, die nur noch der Schatten ihrer selbst war, erschöpft und missmutig vor sich hin starrte. Zu allem Unglück wuchs unter ihrem Kleid der Bauch heran, indem ein kleiner, neuer Erdenbürger nach Nährstoffen gierte.
Antoni wurde wütend: „Nix zu fressen im Haus, keine Nachricht, keine Hilfe, und Ihr verreckt mir alle beide.“ Emilie schwieg. Antoni: „Es muss doch was geschehen. Ich fahre nach Wien und rücke Deiner feinen Verwandtschaft auf die Bude.“
Jetzt lächelte Emilie unwillkürlich und machte den Mund auf: „Wovon willst Du die Reise bezahlen?“ Antoni hatte eine Eingebung. Er zog die Jacke über, stapfte auf den Hof, ging zum Schuppen, lud eine Kiepe voll Holz und verschwand im Ort. Nach nicht mal einer Stunde kam er freudestrahlend heim und hielt seiner Frau siegestrunken einen kleinen Beutel mit Kartoffeln, vier Eier und ein winziges Zipfelchen Schlackwurst unter die blasse Nase. „So, und jetzt wird geschlemmt.“ Emilie fragte entrüstet: „Du hast doch nicht etwa gestohlen?“ Antoni: „Oh ja, ich habe gestohlen! Ich habe dem Stein das Holz geklaut, es zu Leuten gebracht und dafür dies bekommen. Und das mache ich jetzt solange, bis der reiche Sack sich meldet oder alles verbraucht ist.“
Emilie, so sehr sie nach dem bisschen Essen verlangte, haderte mit ihrem Gewissen und klagte ihren Mann an: „Du bist ein Dieb!“ Antoni lachte böse auf: „Ja, ich bin ein Dieb. Aber der andere ist ein Mörder.“ Und noch einmal jede Silbe betonend: „Der andere ist ein Mörder!“ Emilie aufstöhnend: „Das kann nicht gut gehen.“ Sie bereitete das Mahl und beide aßen sich satt. Dann lächelten sie sich an und Antoni sprach ganz lieb auf seine Emilie ein: „Kindchen, wir müssen doch überleben. Das Kleine doch auch.“
In den nächsten Wochen entwickelte Antoni einen richtigen Tauschhandel. Er inspizierte die Lager und schleppte mit seiner Kiepe Wäsche, Gläser, Besteck, eben alles, was sich irgendwie verscherbeln ließ, aus dem verwaisten Hotel fort. Essen kam ausreichend ins Haus. Dabei wucherte Antoni nicht, denn Hochmut kommt vor dem Fall. Außerdem musste er sich auch vor der Polizei immer in Acht nehmen. Er hatte ja keine Handelskonzession. Sie überlebten.
Sie überlebten zwar mit einem schlechten Gewissen, aber so leidlich ging es schon. Als der Frühling zögernd ins Land kam, entband Emilie von einer gesunden Tochter. Der stolze Vater lief zum Rabbiner der kleinen jüdischen Gemeinde und ließ seine Emma Kulka unter dem Datum 13. März 1898 ins Geburtenregister eintragen. Er war stolz und glücklich, wiegte das Kind in den Armen, herzte und drückte die Kleine, bis Emilie ihn lachend zurecht wies: „Du wirst sie erdrücken oder ungebührlich verwöhnen. Beides möchte ich nicht.“ Antoni antwortete genauso lachend: „Und ich möchte mit Euch bis ans Ende der Welt so leben. Der Stein kann uns gestohlen bleiben. Wir richten hier unser eigenes Geschäft ein.“
Als hätte der Stein in Wien die Worte gehört, sendete er in diesen Tagen seinen Agenten Emanuel Hirsch erneut Richtung Lazy aus. Der traf mit diversen Anweisungen und einem Trupp junger Bauleute Mitte April hier ein. Während die Baumänner Mauern abtrugen, Fußböden herausrissen, neue Dielen verlegten, hier und da Trennwände errichteten, Durchgänge verschlossen, saß der Agent im Büro und prüfte die Bücher. Dann kroch er in alle Lager, nahm die Bestände auf, führte Listen, rechnete, verglich und rief am Ende die Wirtschafterin und deren Hausmeister zu sich herein.
Die ganze Zeit über hatte Emilie das Unheil kommen sehen. Jetzt war es da! Am Pult stehend sagte der Allgewaltige mit strenger Mine: „Ich sehe da gewisse Differenzen im Lager. Wie erklären Sie das, Frau Kulka?“
Antoni senkte scheu den Blick. Emilie schaute dem Agenten offen ins Gesicht. Sie holte tief Luft, ließ sich Zeit mit der Antwort. Der trommelte nervös mit dem Bleistift auf die Schreibplatte. Endlich öffnete Emilie den Mund: „Nun, die Sache war die: Als Sie, Herr Hirsch, vorigen Sommer hier waren, wollte ich Ihnen die Bücher zeigen. Eine ordentliche Inventur wäre fällig gewesen. Zumal Sie das Haus geschlossen hatten. Sie entschieden anders. Herr Hirsch, Sie ließen die Leute gehen, ohne zu prüfen, ob jeder nur seins mitnimmt. Sie stellten auch keine Arbeitspapiere aus. Lohn gab es nicht mehr. Nun, da war auch für mich nicht mehr klar, wem was gehört. Alle waren auch aufgeregt. Die Leute sind über alle Berge. Wir haben hier auf alles, so gut es halt ging, dann aufgepasst, mein Mann und ich.“
Respekt, dachte Antoni bei sich, so kenne ich meine Emilie ja gar nicht! Hirsch machte ein derart dämliches Gesicht, dass Antoni sich krampfhaft das Lachen verbeißen musste. Dunkel ahnend, was hier vorgefallen sein könnte, schob der Agent lauernd nach: „Und wovon haben Sie das halbe Jahr lang gelebt?“
Antoni: „Ich war beim Bauern arbeiten.“ Jetzt musste sich Emilie das Lachen verkneifen, denn welcher Bauer stellt im Winter eine Aushilfskraft ein? Der Agent kam ihnen nicht drauf. Er entließ beide in ihr Alltagsgeschäft und schloss die Bücher. Antoni und Emilie gingen hinauf in ihr Dachkämmerchen zu ihrem Kind, stellten sich rechts und links neben dem Bettchen auf und taten aus tiefster Seele den feierlichen Schwur: „Lieber Gott, lass uns um des Kindes Willen immer ehrlich bleiben.“
Mitte Mai zog ein Tross vom Bahnhof die lange Straße hinauf durch das Städtchen zum Hotel. Neugierige sammelten sich am Wegesrand und machten staunende, manchmal mitleidige Gesichter.
Emilie eilte auf die Vortreppe und empfing die Ankömmlinge. Vier Fuhrwerke hielten vorm Haus. Die Menschen stiegen ab und stellten sich zu Grüppchen auf. Nun unterschied Emilie die in Weiß gekleideten Krankenpflegrinnen, deren stattliche Oberin, zwei herrschaftlich aussehende Herren im gesetzten Alter und die in Sackleinen eingehüllten Patienten. Die Oberin kam auf Emilie zu, begrüßte die Hausdame, wendete sich dann an die Fuhrknechte, Koffer, Kisten, Säcke, Möbelstücke, Gerätschaften abzuladen und ins Haus zu schaffen.
Die Pflegerinnen, alles durchweg sehr junge, zarte Mädchen, wurden mit den Worten „Kinder, zupacken! Aber schnell!“ an die Arbeit gescheucht. Die beiden Herren, welche sich als die zuständigen Ärzte zu erkennen gaben, beteiligten sich am Abladen, Verteilen, Einrichten nicht. Sie erkundigten sich bei Emilie nach den vorbereiteten Wohnräumen für das Personal und eilten, für sich ein gutes Zimmer zu belegen.
Die Patienten standen lange scheu, verlegen, in ihrer erbärmlichen Verfassung und Kleidung im Freien. Als das Haus endlich halbwegs eingerichtet war, kümmerte sich das medizinische Personal um diese armen Gestalten und beorderte sie in die Betten der beiden großen Säle: Frauen hierhin, Männer dorthin. Neben jedes Bett wurde ein Stuhl gestellt. Darauf legten die Patienten ihre wenigen persönlichen Gegenstände ab.
Emilies erster Eindruck verfestigte sich von Minute zu Minute: Das sind ja wirklich sehr, sehr kranke Menschen: Zusammenfallende Statur, schmale Schultern, nach innen gewölbte Brust, blasse ausgemergelte Gesichter und dazu dieser pfeifende, rasselnde, schnorchelnde von stetigem Husten unterbrochene Atem. Ihres Sputums entledigten sich die Kranken in kleine, blecherne Schüsseln, die ihnen ans Bett gegeben worden waren. Emilie bedauerte diese Menschen aus tiefstem Herzen. So ein Elend hatte sie noch nie gesehen. Ob die wohl wieder gesund werden?
Die Betriebsamkeit eines Bienenstocks verbreitete sich im ganzen Haus. Ständig putzen die kleinen, weißen Schwestern auf allen Möbeln, Fensterbrettern, Fußböden herum. Die Oberin lief durch die Räume, kontrollierte die Qualität der Arbeit mit einem sauberen Läppchen und gab leise, kurze Anweisungen. Alle Arbeiten waren schweigend zu erledigen, so dass sich Grabesstille ausbreitete. Man hätte schon an einen Friedhof denken können, wenn nicht dieser würgende, kratzende, prasselnde Husten der Patienten gewesen wäre. Die lagen starr in ihren Betten, bis oben hin fest in Decken eingehüllt und zeigten nur die spitzen Nasen sowie tief in den Höhlen liegende, traurige Augen. Der eine oder andere richtete sich zuweilen halb auf, griff nach seinem blechernen Schüsselchen, spie die kranke Last hinein und sank dann erschöpf hinten über. Die sind ja schon vom Tode gezeichnet, dachte Emilie.
Die Oberin, das war Schwester Maria, nahm das Zepter im Hause fest in ihre Hand. Und während Emilie sich noch fragte, welche Rolle im Steinschen Unternehmen sie ab jetzt spielen würde, rief Maria die Emilie schon zum Gespräch. Sie eröffnet mit der Frage: „Was haben Sie gelernt?“ Emilie: „Ich kann verwalten, Arbeiten einteilen, die Bücher führen, waschen, kochen, putzen, einkaufen ...“ Die Oberin, Maria, unterbrach Emilie: „Also nichts!“ Selbstbewusst hielt die einfache Arbeitsfrau entgegen: „Ich habe dieses Haus mit rund zehn Angestellten all die Jahre erfolgreich geführt. Es ist da nie was vorgekommen, das heißt, ich kann schon einiges.“
Maria lenkte ein: „Das will ich gern glauben“, und ergänzte, „nur, da ich erstens beauftragt bin, Sie hier weiter zu beschäftigen, und Sie zweitens keine Vorbildung in Medizin haben, ist mir angezeigt, Sie in der Küche als Helferin einzusetzen.“ Emile schwieg. Sie konnte nichts erwidern. Sie hatte überhaupt keinen Plan. Es ging weiter: „Also werden Sie den kochenden Schwestern, die reihum für unser leibliches Wohl sorgen, zur Hand gehen.“
Die ehemalige Hotelchefin war zur Küchenhilfe degradiert. Niemand hatte jemals daran gedacht, ihr ein Zeugnis auszustellen. Eine dunkle Ahnung kam in ihr hoch: Sie fühlte sich wie von Fäden gezogen und immer an die Stelle versetzt, wo die Familie Stein sie gerade hinhaben wollte. Eine Alternative sah sie nicht. Emilie ging in die Küche.
Am Donnerstag, das war gerade drei Tage nach der Ankunft der neuen Hausbewohner, steigerte sich die Emsigkeit der Schwestern zum Exzess. Emilie registrierte, dass nicht eine einzige Pause gemacht wurde und die Oberin Maria sichtlich zufrieden durch die Räume streifte. Am Abend rief Maria das Personal im Büro zusammen und hielt eine kleine Rede: „Kinder, ich lobe Eure Arbeit. Wieder hat sich gezeigt, wie sehr Ihr im Dienste unseres Heilands jede Aufgabe selbstlos zu meistern versteht.“ Die jungen Frauen lächelten dankbar. Ihre Augen glänzten. Andächtig schauten sie zu der Mächtigen auf. Die ging zum Pult, nahm einen Bogen Papier hervor, stellte eine Kassette neben sich und verkündete huldvoll: „Nun wollen wir beginnen.“
Die Schwestern stellten sich in einer Reihe an. Emilie, die von dem Getue befremdet war, wollte sich still aus dem Büro verdrücken. Maria sah die Magd gerade noch so entschwinden und rief rasch sie zurück: „Bleiben Sie, Emilie. Das gilt auch für Sie.“ Emilie huschte als letzte ins Glied und beobachtete staunend, wie jeder der jungen Frauen ein kleiner Lohn von wenigen Hellern ausgezahlt wurde, sie mit ihrer Unterschrift das Erhaltene quittierte und dann still hinaus ging. Emilie war an der Reihe. Fünf Münzen legte Maria aufs Pult, Emilie schrieb ihren Namen in die Liste und strich dann das Geld ein. Sie stand erfreut, verwundert, verdattert da und konnte es nicht fassen: Sie hatte das allererste Mal in ihrem Leben Lohn erhalten.
Schwester Maria schloss das Quittungspapier und die Geldkassette in den Wandschrank ein und wendete sich dann freundlich an die immer noch verdutzt im Raum herumstehende Emilie: „Nun, wie steht Ihr zum Sabbat?“ Emilie fühlte sich unsicher vor dieser Jüngerin Gottes und antwortete unbeholfen: „Wir feiern eigentlich nie. Das einzige Mal, wo wir gefeiert haben, war, als uns der Rabbiner zu Mann und Frau zusammen tat, meinen Antoni und mich.“
„Das ist gut“, lobte Maria und erklärte in vertraulichem Ton: „Dann werde ich Dir künftig immer am Freitagabend und am Sonnabend tagsüber unsere lieben Kranken anvertrauen. Sieh mal, meine Kinder brauchen die Zwiesprache mit Gott und wohl auch etwas Ruhe zur inneren Einkehr. Das wirst Du verstehen. Es ist ja auch nicht schwer, ab und an durch die Säle zu gehen und nach dem Rechten zu schauen.“
Die Allgewaltige verschwieg, was für ein riesiger Berg Arbeit es war, an die zwanzig schwerkranke Menschen mit Essen zu versorgen, ihre Leiden zu lindern, sie halbwegs sicher und liebevoll über den Tag zu bringen. Emilie nickte und wurde dann zu ihrer Arbeit entlassen.
Am Sonnabend feierte das Pflegepersonal seinen Gott und Emilie flitzte von Krankenbett zu Krankenbett. Dieser Dienst war zwar schwer, aber Emilie strömte die Dankbarkeit der vom Tode gezeichneten wärmend ins Herz. Das öffnete ihr die Lippen und sie sang, zwitscherte, trällerte bei der Arbeit, sie erzählte hier und da eine lustige Episode, machte witzige Bemerkungen, so dass sich die Gemeinde der Siechenden belebte. Die nebeneinander liegenden Patienten begannen erst flüsternd, später lauter, Gespräche zu führen, lächelten und lösten sich aus ihrer verordneten Bewegungslosigkeit und Zurückhaltung. Es wurde ein guter Tag.
Am Abend rief eine Frau nach Emilie. Wie sie zu diesem Bett herantrat, sagte die Kranke: „Emilie, können Sie nicht ein kleines Gebet für uns sprechen? Es ist doch Sabbat.“ Emilie bedauerte: „Ich kenne keine Gebete.“ Die Frau gab nicht auf: „Oder vielleicht etwas vorlesen?“
Emilie hatte keine Bücher. Oder doch? Die Magd rannte in die Gerümpelbude, in der altes Zeug aus dem Hotel aufgestapelt war, und zog eine Christenbibel hervor. Als sie zu den Kranken zurückkam, hoben die Menschen erwartungsvoll die Köpfe. Emilie schob einen Stuhl in die Mitte des Raumes, setzte sich nieder, schlug das Buch auf und las: „Und Gott schuf den Menschen aus dem Staub der Erde ...“ Die Bibel ist dick, es folgen Kapitel auf Kapitel. An jedem Sonnabend ließ Emilie eine neue Episode folgen. So huldigten sie Gott auf ihre Weise.
Emilies gewöhnlicher Arbeitsplatz war die Küche. Die lag im Souterrain des Hauses, mit einem Ausgang zum Hof, von wo die Lebensmittel und Heizung hereingeholt wurden. Diese Tür stand meistens offen, so dass die frische Luft hinein und das Lachen der jungen Frauen hinaus wehen konnten. Hier unten wirkten die ruhigen, verschüchterten, fleißigen Schwestern wie ausgewechselt. Was oben als oberstes Gebot für Genesung und Heilung galt, nämlich die Enthaltung von allen kräftigen, guten wie schlechten Lebensäußerungen, wucherte hier unten ungebremst. Die Mädchen erzählten sich kleine Geschichtchen, neckten einander, waren über Trauriges tief betrübt, ließen ihrer Jugend also einfach freien Lauf.
Für Emilie bekam jede von ihnen Gestalt, Profil, Persönlichkeit. Während die Schwestern bei ihrem Dienst am Kranken zu durchscheinenden, unwirklichen, dienstbaren Geistern herabgewürdigt wurden, entfalteten sie in der Küche menschliche Lebensart in den schönsten Farben.
Emilie, als die viel Ältere, wurde sehr schnell zu der so dringend benötigten, liebevollen Mutter unter den schwer ausgebeuteten und doch sosehr das Leben herbeisehnenden Krankenschwestern.
Noch mehr wuchsen die Jungen und die Alte zusammen, als heraus kam, dass Emilie ja wirklich Mutter war. „Und wo ist das Kind?“, fragten die Schwestern neugierig und erschaudernd. Emilie gestand, das Mädchen viele Stunden allein oben im Kämmerchen zu verwahren. Was konnte sie mit der Kleinen bei der Arbeit anfangen?
Kurz entschlossen wurde Emma aus ihrem Gefängnis befreit, unter den Schwestern herumgereicht, geherzt und verwöhnt. Sie bekam in der Küche ihren Platz, war unter freundlichen Menschen und vermittelte den ansonsten mit Krankheit und Sterben bis zur Grenze des Erträglichen konfrontierten jungen Frauen glückliche Momente. Natürlich kam die Sache eines Tages raus. Die Oberin, Schwester Maria, inspizierte die Küche nicht oft, aber hin und wieder rauschte sie herein, steckte ihre Nase in Töpfe und Pfannen, kontrollierte die Arbeit, gab Anweisungen, wies zurecht. Und wie sie dann das Kind entdeckte, glaubte sie einem Herzschlag nahe zu sein. Ihre erste Reaktion: „Das Kind kommt weg!“
Aber so einfach ging das nicht mehr. Alle hatten die Emma lieb gewonnen. Und wie Maria das Urteil verkündet hatte, ließen die jungen Frauen die Hände ruhen, senkten den Blick, verharrten still, und sie taten nichts mehr. Sie taten nichts mehr! Ganz leise, zögernd, langsam wie ein Nebelschwaden verbreitet sich im Hause die Nachricht, „Das Kind kommt weg“.
Die Schwestern im Saal erstarrten zu Säulen. Na ja, Säulen nun nicht gerade. Die zarten Schwestern im Saal hatten nicht die Statur für Säulen. Sie erstarrten zu steifen Stöckchen. Keine Arbeit wurde mehr erledigt. Das Wischwasser wurde kalt, die Feudel blieben liegen, die Putzlappen hingen trocken am Haken. Selbst die Kranken schienen weniger zu husten, niemand richtete sich auf. Alles war still, stumm, bewegungslos. Jetzt glich das Ganze erst recht einem Totenhaus.
Das hatte Maria nicht gewollt. So konnte die Sache nicht ausgehen. Bei aller Liebe zu den gängigen Doktrinen des Gesundheitswesens. So ging es nicht. Maria lenkte ein: „Das Kind darf bleiben.“ Da lebten die Frauen auf und schwirrten wieder emsig wie in einem Bienenstock. Emma wurde der Liebling und die ganze Freude aller Bewohner des Sanatoriums in Lazy.