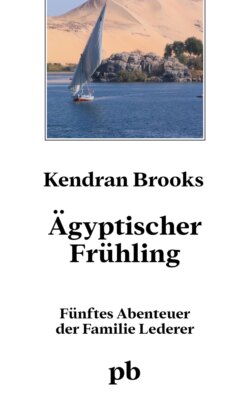Читать книгу Ägyptischer Frühling - Kendran Brooks - Страница 5
Die Suche
ОглавлениеSie trafen spät nachts auf dem Cairo International Airport ein, lösten am Schalter ihr Visum, reihten sich in eine der Schlangen vor der Einreiseabfertigung ein. Der Beamte stellte die üblichen Fragen. Chufu beantwortete sie wie ein gewöhnlicher Urlauber. Sie bekamen die Visums-Briefmarke in ihre Pässe geklebt und den Stempel darauf gedrückt, konnten zum Gepäckband weitergehen. Ihre beiden Rollkoffer waren bereits von hilfsbereiten Händen vom Band gehoben und in die lange Gepäckreihe gestellt worden. Mei und Chufu nahmen ihre Koffer auf und gingen in einem Schwarm von deutschen und niederländischen Touristen unbehelligt durch die Zollkontrolle.
Chufu war nicht zum ersten Mal in Ägypten. Die Lederers hatten vor drei Jahren gemeinsam das Land der Pharaonen besucht, dabei die Sehenswürdigkeiten von Gizeh und Sakkara ebenso gesehen, wie das koptische Viertel, die großen Märkte und die muslimische Altstadt mit seinen tausend Moscheen. Da sie meistens zu Fuß unterwegs gewesen waren und Chufu einen recht guten Orientierungssinn besaß, fühlte er sich der Hauptstadt mit ihren zwanzig Millionen Einwohnern und einem nicht zu bändigenden, kaum durchschaubaren Verkehrsgewühl gewachsen.
Die Taxifahrer bestürmten alle Urlauber, sobald sie aus dem Flughafengebäude traten, drangen auf sie ein, riefen ihr Angebot in Englisch, Französisch und Arabisch, veranstalteten ein wilden Tohuwabohu. Chufu erkannte, wie es Mei neben ihm immer unsicherer und banger wurde, sah, wie sie ihre Schultern wie zur Abwehr hochzog und sich ängstlich umblickte.
»So ist nun einmal Arabien, Mei«, er musste sie beinahe anschreien, so laut war der Tumult, »stell dir einfach vor, du seist Sindbad der Seefahrer und auf dem Markt der Tausend Diebe. Mit dieser Einstellung kommst du in ganz Ägypten gut zu Recht. Sieh es als ein Abenteuer in einer fremden Welt. Du brauchst als Frau auch niemals Angst haben, denn kein Ägypter mit einem Funken Stolz wird zulassen, dass deine Ehre von einem anderen Muslim beschmutzt wird.«
Chufu wählte als möglicher Fahrer einen jungen Mann aus, der zurückhaltend in der zweiten Reihe stand. Er suchte seinen Augenkontakt und rief ihm zu: »Sprechen Sie Englisch?«, und als dieser erfreut grinsend zustimmend nickte, »wir müssen ins Ramses Hilton.«
Dann drängte der Philippine mit Wucht durch die gedrängte Menge, zog Mei an der Hand hinter sich her. Endlich waren sie durch die Traube der einheimischen Fahrer gestoßen, folgten dem mit langen Schritten vorauseilenden Ägypter, verließen das hell beleuchtete Flughafengebäude in Richtung der Parkplätze, die im Halbdunkel lagen. Das Fahrzeug des jungen Ägypters stand nicht bei den offiziellen Taxis, sondern auf einem Besucherparkplatz. Es war ein weißer, nicht allzu neuer Hyundai Accent. Weder ein Taxischild noch eine Beschriftung verlieh ihm den Status eines offiziell zugelassenen Transportfahrzeuges. Mei sah darum Chufu fragend und auch etwas verunsichert an.
»Alles in Ordnung, Liebling, die wilden Unternehmer sind die allerbesten«, gab er altklug bekannt.
Zusammen mit dem jungen Fahrer hievte er das erste Gepäckstück in den Kofferraum, das zweite wurde auf der Rückbank verstaut. Mei stieg hinten ein, Chufu vorne.
»Chufu Lederer«, stellte er sich ihrem Fahrer vor, reichte ihm die Hand.
»Achmed«, meinte dieser und griff nach ihr, »Achmed Nagarin.«
Der Motor startete und der Hyundai setzte sich in Bewegung. Als sie auf der El-Orouba in Richtung Stadt unterwegs waren, begann Chufu eine Unterhaltung.
»Wir werden einige Tage in Kairo bleiben und suchen einen zuverlässigen Fahrer, der uns die ganze Zeit über betreut, der sich in der Stadt auch ganz besonders gut auskennt.«
Der fragende Blick von Achmed verriet vorsichtige Zurückhaltung.
»Falls Sie uns in Rekordzeit ins Hilton bringen können, dann haben Sie den Job.«
Bislang war noch keine Rede von Geld gewesen, auch nicht für die Fahrt vom Flughafen in die Stadt. Chufu wusste von seinem ersten Besuch her, dass die einfache Fahrt in einem offiziellen Taxi achtzig bis hundert Pfund kosten durfte. Private Anbieter lagen in der Regel zwanzig Pfund tiefer. Aufgrund des sicheren Auftretens des Philippinen war für Achmed klar, dass seine Fahrgäste die Preise kannte und Verhandlungen über die Tarife unnötig waren. Denn bei kundigen Besuchern lohnte sich meistens eine gewisse Zurückhaltung. Denn Leute aus dem Westen, die Kairo bereits mehrmals besucht hatten, belohnten die guten Fahrer mit außerordentlich hohen Trinkgeldern. Und falls man doch einmal an einen unfairen Knauser geriet, der einen am Zielort im Preis noch drücken wollte? - Insha’Allah. - Denn es lag doch alles in Gottes Hand und gegen sein Schicksal konnte man als schwacher Mensch nichts ausrichten.
Achmed wechselte von der El-Orouba auf die al-Nadi über, verließ diese jedoch nach dem Palast der Republik und kurvte durch einige recht enge Gassen seinem Ziel zu. Mei Ling im Fonds des Wagens begann sich immer mehr Sorgen zu machen, auch wenn Chufu völlig gelassen auf dem Beifahrersitz saß und vor sich hin zu träumen schien. Sie erreichten nach wenigen Minuten die Ramsis, die nur wenig Verkehr aufwies. Und so konnte Achmed stark beschleunigen, raste die Straße mit manchmal siebzig Kilometer pro Stunde entlang, verschaffte sich mit ständigem Hupen auch Platz zwischen den Minibussen, überholte Last- und Lieferwagen, drängte an westlichen Luxusschlitten und an östlichen Billigtransportern vorbei, strebte dem Hotel Ramses Hilton rasend schnell zu.
Nach knapp fünfunddreißig Minuten hielt er vor dem Eingang. Eine echte Rekordzeit und Chufu nickte Achmed anerkennend zu.
»Wenn Sie wollen, dann haben Sie den Job«, meinte er lächelnd und reichte dem jungen Ägypter eine hundert Pfund Note, »vierhundert pro Tag plus Benzingeld.«
Achmed schlug freudestrahlend in die dargebotene Hand ein. Irgendwie gefielen ihm die beiden Asiaten. Er stieg aus und öffnete den Kofferraumdeckel, damit der herbeieilende Gepäckträger des Ramses Hilton den Koffer herausheben konnte. Ein zweiter schnappte sich den anderen vom Rücksitz und die beiden trugen das Gepäck wie Beute in Richtung Rezeption davon.
»Und ab wann brauchen Sie mich morgen früh?«
»Wir haben einen langen Flug hinter uns und sind todmüde. Hinzu kommt der Jet-lag. Sagen wir am Nachmittag um zwei Uhr?«
»Fourteen hundred«, bestätigte ihm Achmed lächelnd.
Chufu lächelte ebenso zurück, wandte sich mit Mei der Eingangshalle zu.
*
Walid Gomaa war an diesem Morgen unkonzentriert, redete eine der neuen Schwestern sogar mit falschem Namen an, stand neben sich selbst. Um zehn Uhr brach er die Visite ab, ließ seinen Stellvertreter die Rotte an Assistenzärzten weiter von Zimmer zu Zimmer und Patient zu Patient führen, setzte sich brütend in sein Büro und ließ sich von seiner Assistentin einen Tee bringen.
Die Sorgen um Malika zehrten den Mann auf Dauer. Wenn er doch bloß wüsste, ob sie sich aus Wut von ihnen fernhielt oder ob sie von der Polizei oder der Armee verhaftet worden war. Die Ungewissheit, ob seine Tochter noch lebte und ob es ihr gut ging, war für ihn auf Dauer schrecklicher als eine Mitteilung über ihren Tod.
Walid machte sich immer noch große Vorwürfe. Warum bloß musste er so sehr auf sie eindringen, musste ihre Beweggründe für die Revolution ins Lächerliche ziehen, musste ihre Gesinnung verurteilen? Er war doch auch einmal jung gewesen, hatte damals Ansichten vertreten, über die er heute nicht einmal mehr lächeln konnte, kämpfte doch damals auch gegen die Windmühlen der Welt an und gegen andere unüberwindliche Hürden.
Im Eingangskorb stapelte sich seit Tagen die Post. Walid fühlte sich zu matt, um auch nur eines der Schreiben zu sich zu ziehen und zu lesen. Er saß bloß stundenlang hinter seinem Pult, starrte brütend vor sich auf die Platte, nippte gedankenverloren am Tee. Seiner Sekretärin hatte er wie jeden Morgen aufgetragen, keine Gespräche zu ihm durch zu stellen und alle Besucher abzuwimmeln. Als es trotzdem leise anklopfte und sich das Türblatt aufschob, sah er missmutig, ja, fast schon zornig hoch.
Dr. Arschloch schob sich mit einem entschuldigenden Lächeln in sein Büro, drückte hinter sich die Türe gleich wieder ins Schloss. Für einen kurzen Moment hatte Walid durch den Spalt seine Sekretärin Emile gesehen und wie sie mit böse blitzenden Augen und einer wegwerfenden, fast schon obszönen Geste für das freche Eindringen des Assistenzarztes in sein Büro protestierte.
»Bitte entschuldigen Sie meinen Besuch, lieber Dr. Gomaa, doch ich bin in großer Sorge um Sie. Geht es Ihnen gut? Sie haben doch noch nie eine Visite abgebrochen? Macht Ihnen Ihre Tochter denn immer noch so sehr zu schaffen?«
Seine Stimme klang weich, einschmeichelnd und seine Augen blickten dabei treuherzig. Doch Walid erkannte dahinter die Falschheit eines Karriere-Reiters nur allzu deutlich.
»Kümmern Sie sich um Ihre Angelegenheiten und lassen Sie mich in Ruhe«, drohte er seinem Mitarbeiter darum überdeutlich und sah ihn dabei strafend an. Doch dieser freche Kerl drehte sich nicht etwa um und ging, nein, er trat sogar noch zwei Schritte näher an Walids Pult heran, beäugte sein Opfer wie ein Adler von oben, nein, eher wie ein Geier.
»Aber Dr. Gomaa, ich muss mich doch sehr wundern«, drang er schmierig auf seinen Vorgesetzten ein, »warum sind Sie so unfreundlich zu mir? Wir wollen doch alle nur Ihr Bestes. Ihre Gesundheit liegt uns am Herzen und wir können es nicht ertragen, wenn es Ihnen schlecht geht. Schon im Interesse unserer Patienten darf ich nicht über Ihren derzeitigen Zustand hinwegsehen. Erzählen Sie mir doch, was Sie bedrückt. Öffnen Sie einem wirklichen Freund ihr Herz und es wird Ihnen danach bestimmt leichter sein.«
Walid sprang wütend von seinem Stuhl auf.
»Scheren Sie sich endlich zum Teufel, Dr. Hamal«, schrie er seinen Untergebenen an, »das ist ein Befehl.«
Dr. Arschloch lächelte ihn triumphierend an.
»Sie verlieren Ihre Contenance, Dr. Gomaa, und das steht Ihnen gar nicht gut zu Gesicht.«
Walid kam drohend um sein Pult herum, machte Anstalten, sich auf den aufdringlichen und aufsässigen Assistenzarzt zu stürzen. Auch wenn er gut zwanzig Jahr älter als dieser war, und bei einer körperlichen Auseinandersetzung sich kaum hätte durchsetzen können, so kümmerte ihn diese Tatsachen in seinem Zorn wenig.
»Verlassen Sie auf der Stelle mein Büro, Sie verdammter Wicht, oder ich werfe Sie eigenhändig hinaus«, polterte er den nun doch etwas ängstlich vor ihm zurückweichenden Mann an.
»Na gut. Ich werde bei der Klinikleitung meine Eindrücke über Ihren Gesundheitszustand schildern«, drohte er seinem Chef noch, bevor er sich fast fluchtartig zur Tür wandte, sie aufriss und hinausstürzte.
Emile stand betroffen an der Türe und sah Walid mit nicht gespielter Bestürzung an. So hatte sie den ansonsten stets so ruhigen und abgeklärten Chefarzt noch nie erlebt. Wütend warf Walid die Tür ins Schloss, ging mit dunklen Gedanken zu seinem Pult zurück und setzte sich dahinter.
Einen Moment lang dachte er über seine Position, über seine Situation an der Klinik nach, ob daran nun vielleicht gerüttelt wurde, tat dann die Angelegenheit mit einer wegwerfenden Handbewegung ab. Was sollte dieser Dr. Arschloch gegen ihn schon vorbringen können? Dieser Wurm von einem Christen, dieser Karrieremöchtegern? Den Klinikleiter kannte er seit fünfzehn Jahren und sie waren in dieser Zeit fast Freunde geworden, respektierten sich gegenseitig und hielten viel voneinander. Er würde Dr. Arschloch bestimmt zurechtweisen und damit die missliche Angelegenheit begraben. Und bestimmt fand sich rasch ein anderes Krankenhaus, in das man den Widerling versetzen konnte.
Das Telefon klingelte und auch wenn Walid seiner Sekretärin das Durchstellen verboten hatte, so kam ihm diese Ablenkung nun doch gelegen. Es war seine Frau Sana und sie teilte ihm mit, dass die Freundin von Malika, diese Mei Ling, eben angerufen hätte. Sie wäre mit einem Freund nach Kairo gekommen und würde gerne heute Nachmittag vorbeischauen und mit ihnen reden. Sana hatte sie bereits auf drei Uhr eingeladen.
Walid versprach, gleich nach Hause zu kommen, legte den Hörer nach einen zärtlichen »bis in einer halben Stunde, meine Blume« auf die Gabel, knöpfte sich den weißen Kittel auf und ließ ihn im Wandschrank verschwinden, zog dafür seine Jacke über, griff dabei wie immer kurz in die rechte Tasche und vergewisserte sich, dass der Schlüsselbund darin lag.
»Ich fühle mich nicht besonders, Emile«, verabschiedete er sich von seiner Sekretärin, »falls etwas Dringendes ist, ich bin zu Hause.«
*
Es war eine etwas seltsame Begrüßung, zwischen den Eltern von Malika auf der einen und Mei und Chufu auf der anderen Seite. Sie kannten einander nicht, hatten sich nie zuvor gesehen, ja, bis vor Kurzem noch kaum etwas voneinander gewusst.
Unten, am weit offenstehenden Hauseingang, hatte ein alter Ägypter gesessen, ein typischer Bawaab, der Türsteher, Hausmeister, Aufpasser und das Mädchen für alles in einer Person. Ein Bawaab war der mehr oder weniger ordentlich und regelmäßig bezahlte Angestellte eines Wohnhauses, der auch gerne Spitzeldienste für die Polizei oder für den örtlichen Imam übernahm. Er war der Zerberus der guten Sitten, der unterwürfige Diener bei guter Entlohnung, aber auch das hinterhältige Biest, wenn das von ihm erwartete Entgelt zu gering ausfiel. Mutig hatte sich Saleh den beiden Asiaten in den Weg gestellt, hatte sie unwirsch und auf Arabisch angeschnauzt und dafür bloß ein Schulterzucken des Jungen geerntet. Doch dann fiel aus dem Mund dieses Knaben der Name Walid Gomaa. Sein Fingerzeig auf die oberen Stockwerke tat das Übrige zur Verständigung. Trotzdem gab Saleh nur widerwillig den beiden Asiaten den Weg frei in den Flur und zum Treppenhaus, so ohne weiterführende Erklärung. Doch Familie Gomaa war zu angesehen, zu wichtig, zu einflussreich, als dass er, der kleine Bawaab einen Konflikt mit ihr hätte riskieren wollen. Wenigstens zollte ihm dieser gelbe, hoch aufgeschossene Ungläubige ein klein wenig Respekt, hatte ihm im Vorbeigehen eine fünf Pfund Note fast unauffällig hingestreckt, die sich Saleh mit einem raschen Griff geangelt hatte. Versöhnt mit Allah und seinem Schicksal ließ sich der Bawaab wieder auf dem alten Schemel links vom Hauseingang nieder, der zu dieser nachmittäglichen Stunde bereits in wohltuendem Schatten lag, betrachtete sich die an ihm vorbei hetzenden Passanten, hörte den Bruchstücken ihrer atemlosen Sätze zu und war mit sich und der Welt bald wieder im Reinen.
Walid Gomaa hatte nach dem Klingeln die Wohnungstüre aufgezogen, war dann erst einmal abwartend vor dem Eingang stehen geblieben, als Verteidiger seiner Wohnung, als skeptischer Vater einer vermissten Tochter, als Repräsentant der Oberschicht seines Landes, die ihren Einfluss in den Wirren der Revolution immer mehr zu verlieren begann und die das schmerzlich spürte.
»Dr. Gomaa?«, fragte Mei Ling unsicher und freudig zugleich.
Walid nickte, musterte die beiden Asiaten, ließ seine Augen von der Frau auf den bescheiden neben ihr stehenden Mann und wieder zurück zu ihr schweifen.
»Treten Sie bitte ein, Miss Ling, Mister Lederer«, und er gab die Türe endlich frei, machte auch eine einladende Armbewegung. Seine Augen blickten ernst und gefasst, wie Chufu und Mei feststellten. Sie zeigten eine Persönlichkeit, die sich von den Unbilden des Lebens nicht so leicht irritieren oder gar umstoßen ließ.
Walid führte sie ins Wohnzimmer für Besucher, ließ sie auf einem der breiten Plüschsofas sich setzen, fragte, ob sie etwas zu trinken wünschten, was beide verneinten.
Gomaa setzte sich ihnen gegenüber, auf das zweite Sofa, musterte sie ein paar Sekunden lang, bevor er mit leiser Stimme, doch ausgesprochen exakt formulierend zu sprechen begann, in einem Englisch, das von seinem Sing-Sang her an Oxford erinnerte.
»Warum sind Sie hier?«
»Weil wir in großer Sorge um Malika sind«, antwortete ihm Mei Ling heftig, »als ich von ihrem Verschwinden hörte, musste ich ganz einfach etwas unternehmen. Malika und ich sind sehr gute Freundinnen, müssen Sie wissen, Dr. Gomaa. Wir waren uns in Rio wie Schwestern.«
Walid warf einen etwas verunsicherten Blick auf Chufu, der bislang noch kein Wort gesprochen hatte, abgesehen von der Begrüßung. Dem Philippinen schien ein großer Kloß im Hals zu stecken.
»Das ist mein guter Freund Chufu Lederer«, erklärte ihm Mei Ling, den Blick des Ägypters richtig deutend, »wir sind ein Paar und wir leben zusammen, sind aber nicht verheiratet.«
Mei Ling wusste um die Sittenansprüche im Islam, dass eine Frau, die ohne Ehe mit einem Mann zusammenlebte, zwangsläufig als Hure galt. Malika hatte ihr darüber ausführlich erzählt, hatte ihr auch geschildert, wie in Ägypten Ehen zu Stande kamen, egal, ob unter dem Islam oder dem koptischen Christentum.
Über einen oder zwei Vermittler wurde die Angebetete im Vertrauen angefragt, ob von ihrer Seite her Interesse für den Mann bestand. Falls dem so war, ging man zu den Eltern der gewünschten Zukünftigen, bat sie um eine Besprechung. Man wurde von allen Seiten durchleuchtet, wobei die Familie, der Leumund, der Beruf, die Arbeit und vor allem die finanzielle Situation ausschlaggebend waren. Fiel die Untersuchung zur Zufriedenheit der möglichen Schwiegereltern aus, dann wurde man für ein Kennenlernen eingeladen, saß mit den anderen männlichen Familienmitgliedern beim Tee oder einer Speise zusammen. Gefiel man ihnen, wurde das Beisammensein regelmäßig wiederholt. Man tastete sich auf diese Weise über Monate hinweg ab, stellte sich gegenseitig im besten Licht dar, zeigte Bescheidenheit, wo angebracht, bewies Tatkraft, wo sinnvoll. Irgendwann wurde einem erlaubt, unter Aufsicht mit der erwünschten Braut spazieren zu gehen und dabei Händchen zu halten, Worte und flüchtige Küsse auf die Wange auszutauschen. Danach folgten die Monate oder auch Jahre der Bewährung, denn keine ägyptische Familie gab eine hübsche Tochter einem Habenichts. Ein Haus oder eine geräumige Wohnung musste her, vollständig eingerichtet und mit allem Notwendigen ausgestattet. Die Brauteltern kamen dann vorbei, inspizierten alles, lasen die Kaufverträge durch und gaben dann ihre Zustimmung zur Heirat. Vom Zeitpunkt der ersten Kontaktnahme bis zu diesem Tag waren in der Regel leicht ein paar Jahre vergangen und umso größer musste die Hochzeitsfeier ausfallen.
Eine wilde Ehe dagegen, wie sie im aufgeklärten Westen seit Jahrzehnten üblich war, gab es in Ägypten nicht, durfte es nicht geben, war gottlos und verwerflich.
Entsprechend finster blickte Walid drein. Die beste Freundin seiner Tochter war eine Hure. Sein Daheim schien ihm auf einmal beschmutzt von dieser Person, die frech in seine Wohnung eingedrungen war und nun auf seinem Sofa saß, zusammen mit ihrem Liebhaber. Unerträglich empfand Walid plötzlich die Tatsache, dass seine Tochter seit vielen Monaten nicht nur in diesem Sündenpfuhl in Brasilien lebte, sondern an jedem Tag ihres Studiums auch noch so direkt und unmittelbar in Kontakt mit all diesem Schmutz kam.
Ein Mann durfte die Blumen am Wegrand pflücken, machte sich dabei nicht dreckig. Doch eine Frau konnte dies niemals, unter keinen Umständen.
Plötzlich fragte er sich, wie gut er seine Tochter Malika eigentlich kannte. Hatte auch sie bereits sexuelle Erfahrungen gesammelt? War sie ebenfalls längst zur Hure geworden? Hatte sie die Ehre der Familie in den Dreck gezogen?
In einem ersten Anflug von Zorn wollte der Oberarzt aufbrausen, diese beiden sündigen Asiaten aus seiner Wohnung werfen, die Türe hinter ihnen zuknallen und damit die unsägliche Schmach wenigstens mindern. Doch dann dachte er an Malika, an ihr Lächeln, an ihre Standhaftigkeit in so vielen Fragen des Lebens, auch an ihren Trotz und ihren so eigenwilligen Kopf. Nein. Seine Tochter war bestimmt nicht vom rechten Weg abgewichen, besaß ihre Ehre noch. Sonst hätte sie ihm gegenüber und erst vor ein paar Tagen, am Küchentisch sitzend, nicht in dieser Weise von der armen Adilah Iswabad gesprochen.
Walid beruhigte sich wieder, sah in die beiden etwas bestürzt dreinblickenden Gesichter seiner Besucher, erkannte in ihnen, was in seinen Augen wohl zu lesen gewesen war, fühlte sich plötzlich wieder sicherer.
»Möchten Sie wirklich nichts trinken? Einen Tee oder ein Glas Wasser?«
»Nein, danke«, wehrten die beiden wiederum höflich ab. Die Stimme des Asiaten klang dabei rau, als müssten sich seine Stimmbänder erst wieder ans Sprechen gewöhnen.
»Ich weiß nicht, was Sie hier in Kairo für Malika bewirken könnten«, fuhr Walid fort, »oder kennen Sie jemanden in der Stadt? Jemand wichtigen, meine ich?«
Mei Ling und Chufu schüttelten beiden den Kopf.
»Nein, noch nicht«, meinte der asiatische junge Mann und seine Stimme gewann mit jedem der folgenden Worte an Festigkeit, »doch wir sind bereit, alles zu unternehmen, um Malika zu finden. Wir denken, dass wir als Studenten aus dem Westen einfacheren Zugang zu den revolutionären Kräften in Ihrem Land gewinnen können. Wir hoffen, dass wir auf diesem Wege etwas über den Verbleib von Malika herausfinden können.«
Walid Gomaa hatte mehr dem Klang der Sätze als ihrem Inhalt gelauscht, hatte die Betonung und die Intonation auf sich wirken lassen, ließ zu, dass sie sein Innerstes berührten. Er entschloss sich, die Unterhaltung noch nicht abzubrechen, spürte, dass die beiden Besucher wahrhaftig helfen wollten, dass sie es ehrlich meinten. Und er warf einen Anker aus, wartete gespannt, ob er auf Grund treffen würde.
»Vielleicht sollte ich Ihnen tatsächlich meinen Teil der Geschichte erzählen. Doch möchten Sie keinen Tee?«
Auf diese dritte Einladung hin reagierten nun beide Asiaten mit einem breiten Lächeln und nicken zustimmend.
»Ja, das wäre sehr nett, Dr. Walid.«
Chufu wusste von Jules und ihrem ersten Besuch des Landes, dass man in Ägypten als höflicher Mensch die ersten beiden Einladungen stets abzulehnen hatte. Sonst verlor man sein Gesicht vor seinem Gastgeber, galt als Profiteur und Egoist. Erst die dritte Einladung war entscheidend und auch wirklich herzlich gemeint. Walid registrierte ihre Zustimmung mit Wohlwollen. Überrascht fühlte er, dass er diese Mei Ling nicht mehr abwertend betrachtete, dass er sie zu respektieren begann, auch wenn sie mit diesem Chufu zusammen in Sünde lebte.
Leise ging die Türe zum Flur auf. Sana Gomaa kam mit einem Tablett herein, darauf vier Gläser mit dampfendem Tee. Die Mutter von Malika hatte wohl an der Tür der Entwicklung des Gesprächs gelauscht und war nach der dritten Einladung und ihrer Zustimmung sogleich in die Küche geeilt, wo das Wasser im Kessel schon lange am Kochen war und die Teegläser bereitstanden. Die beiden Asiaten hatten sich vom Sofa erhoben und Mei Ling gab der Frau die Hand, drückte sie sanft, während Chufu ihr zunickte und ein »sehr erfreut, Sie kennen zu lernen, Misses Gomaa«, mehr flüsterte als sprach.
Sana setzte sich neben ihren Mann, verteilte dann die Gläser. Walid begann zu sprechen, erzählte von der Ankunft seiner Tochter vor drei Wochen, wie sie voller Begeisterung zu den Versammlungen auf dem Tahrir-Platz gegangen war, wie sie nächtelang fortblieb, die Tage zu Hause verschlief oder Pamphlete verfasste, Twitter und Facebook-Beiträge schrieb, zu einer Speerspitze der Revolution werden wollte. Viele seiner Sätze quittierte Mei Ling mit staunenden Augen, denn sie hatte Malika eher als eine unpolitische Frau gesehen, die sich voll auf ihr Psychologiestudium konzentrierte, die zwar gerne mit ihr ins Kino oder zum Essen ging, sich jedoch von den Partys weitgehend fernhielt, so dass sie an der Uni längst als Spaßbremse und weiblicher Moralapostel galt.
Dass ihre scheinende Zurückhaltung auf eine unpolitische, islamisch geprägte Kindheit und Jugend beruhte, war für Mei Ling immer klar gewesen. Darum hätte sie ihrer ägyptischen Freundin diesen Wandel gar nicht zugetraut. Die Freiheitsbewegung in Kairo musste ihr einen neuen Lebenssinn eingepflanzt haben, vielleicht den einzigen, der für Malika derzeit noch zählte.
Walid Gomaa schilderte auch den letzten Streit mit seiner Tochter, wie sie am späteren Nachmittag desselben Tages das Haus verließ. Da Malika bei ihren Eltern weiterhin ein Zimmer mit genügend Kleidern, Wäsche und Toilettenartikeln zur Verfügung stand, brachte sie bei ihren Besuchen jeweils nur wenige persönliche Dinge mit, konnte mit Handgepäck reisen. In ihrer Tasche trug sie neben Handy und Brieftasche auch ihren Pass ständig mit sich. Aus diesem Grund kamen die Eheleute Gomaa auch auf die Idee, ihre Tochter könnte aus lauter Zorn über den Vater ohne Verabschiedung wieder nach Rio zurückgeflogen sein.
Sie gingen zu viert all die möglichen Schwierigkeiten und Situationen durch, in welche Malika geraten sein konnte. Vielleicht war sie bei einer Demo verletzt worden, lag nun als Namenlose in einem der vielen Spitäler der Stadt oder auch bei Freunden und Bekannten. Die Geheimpolizei konnte sie gefangen halten. Vielleicht musste sie sich auch vor den Schergen der Staatsmacht verbergen, vor all den Denunzianten, die so viele Jahrzehnte recht gut und auf Kosten von politisch engagierten Menschen gelebt hatten? Vielleicht kehrte sie nicht zurück, um ihre Familie nicht zu gefährden? Nach ihrem letzten Streit mit dem Vater wusste sie, dass sie von ihm keine Unterstützung zu erwarten hatte. Der Gang in den Untergrund konnte ihre Antwort darauf sein. Nicht zuletzt mussten sie auch die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass Malika einem gewöhnlichen Verbrechen zum Opfer gefallen war. Denn in turbulenten Zeiten suchen Gewalttäter stets die Nähe zum Geschehen, erhoffen sich genügend Ablenkung, um ihre Verbrechen ungestört zu begehen.
Es gab um das Ausbleiben von Malika viel mehr Möglichkeiten, als einer bangen Mutter oder einem besorgten Vater lieb sein konnte. Walid und Sana sprachen an diesem Nachmittag das erste Mal auch offen miteinander über alle möglichen Ursachen für das Verschwinden ihrer Tochter. Sie hatten sich bislang auf die Verhaftung durch den Geheimdienst versteift, wollten vielleicht dadurch ganz bewusst andere Möglichkeiten ausblenden. Doch nun kamen sie nach und nach offen auf den Tisch und während Walid immer wieder hart Schlucken musste, brachen Sana und Mei immer wieder in Tränen aus.
Später würde sich Walid Gomaa fragen, warum er den beiden asiatischen Studenten aus Rio de Janeiro so offen gegenübergetreten war, warum er ihnen sein Herz geöffnet hatte und ihnen vertraute. Lag es an ihrem Psychologiestudium, das sie auf heikle Lebenssituationen vorbereitete? Waren sie einfach fantastische Zuhörer, an die sich jeder bangende und verunsicherte Mensch gerne wandte? Er wurde sich nicht schlüssig über die Gründe. Doch er war sich selbst gegenüber ehrlich genug, einzugestehen, wie gut ihm das Gespräch mit Mei und Chufu getan hatte.
Gegen Abend trafen die anderen Geschwister von Malika ein. Man begrüßte sich mit Respekt, fasste für jeden Neuankömmling zusammen, was man gemeinsam erörtert hatte. Auch ihre Brüder und die Schwestern hatten sich wo immer ihnen möglich um Aufklärung bemüht. Leider ohne jeden Erfolg oder Spur. Walid erzählte Chufu und Mei auch von diesem Armeeangehörigen, dem Oberstleutnant Amjad Labib Nepherte von der Wüstenbrigade zwölf beim Wadi Bashrein. Chufu schrieb sich den Namen und den Ort auf, erkundigte sich dann, wie man dorthin gelangen konnte. Doch Walid schüttelte den Kopf.
»Nur mit einer Sondergenehmigung kann man sich derzeit der Grenze zu Libyen nähern. Wer nicht über den notwendigen Passierschein verfügt, wird bereits Hunderte von Kilometern vorher abgefangen und zurückgeschickt. Man könnte vielleicht von der libyschen Seite her zum Wadi Bashrein vordringen, würde jedoch mit großer Bestimmtheit an der Grenze entdeckt und verhaftet werden. Und als Gefangener hätte man sicherlich kaum eine Chance, den Oberstleutnant sprechen zu können.«
Chufu stimmte ihm zu, fragte nach anderen Bekannten im ägyptischen Militär. Walid winkte ab: »Die Armee wird in winzigen Abteilungen geführt, die kaum Kontakt zueinander halten. So schützte sich bereits Sadat vor einem neuerlichen Aufstand durch das Militär und Mubarak übernahm die Organisation, verfeinerte sie sogar noch. Die oberste Spitze der Armee sitzt wie eine Spinne in einem Geflecht von Truppen und Trüppchen, die sich gegenseitig beaufsichtigen und sich so jeder Möglichkeit berauben, eigenständig zu Denken oder gar zu Handeln.«
Erst tief in der Nacht verabschiedeten sich Mei und Chufu von Familie Gomaa. Zurück blieb ihr Versprechen, in den nächsten Tagen in Kairo zu bleiben, sich umzusehen und auf eigene Faust nach neuen Informationen zu suchen. Sie ließen bedrückte Menschen mit wenig Hoffnung zurück.
*
Vier ältere Männer saßen in einem der Hinterzimmer der Synagoge zusammen. Alle trugen sie die schwarzen Anzüge, die weißen Hemden, die langen Bärte und Zöpfe orthodoxer Juden. Rabbi Eli Ellstone schnäuzte laut in sein Stofftaschentuch, stopfte es nach dem Abwischen der Nase umständlich in die Jackentasche. Moshe Zuckerberg wartete ungeduldig darauf, wieder die volle Aufmerksamkeit aller Anwesenden zurück zu erhalten. Er war ein angesehener Kaufmann im Givat Ram Quartier, handelte mit Kunststoffprodukten, von der Gießkanne bis zum Swimmingpool. Seit einem Jahr führte sein Schwiegersohn Danijel das Geschäft zur Hauptsache und Moshe konnte sich seiner zweiten Leidenschaft, der Politik, vermehrt widmen.
»Also, Natan, wie vertrauenswürdig ist denn dieser Kontakt?«
Der Angesprochene Natan Singer, Professor für Quantenphysik an der nahen Hebräischen Universität von Jerusalem, räusperte sich.
»Meiner Meinung nach ist er recht zuverlässig und gleichzeitig auch leicht zu manipulieren.«
»Aber so viel Geld?«, warf der Vierte am Tisch ein. Doron Moskovitz war mit Mitte Fünfzig der Jüngste von ihnen. Er hatte sich aus kleinsten Anfängen hochgearbeitet, besaß heute ein halbes Dutzend Lebensmittelläden in und um Jerusalem mit über hundert Angestellten. Diesen Aufstieg hatte er nicht nur seiner Geschäftstüchtigkeit zu verdanken. Genauso wichtig war das große Beziehungsnetz, das er sich über die letzten zwanzig Jahre verschaffen konnte, mehrheitlich durch Anbiederung bei den unterschiedlichsten orthodoxen Gesellschaften und Gruppen. Nur aus diesem Grund war er mehr zufällig als gewollt in diese Runde von Entschlossenen geraten. Ihre radikalen Reden hatte er zu Anfang als einen weiteren Sturm im Wasserglas abgetan, wie er ihn schon oft gehört hatte. Doch mittlerweile war er von der Gefährlichkeit und der Unberechenbarkeit der anderen drei Männer überzeugt. Doch für einen Rückzug steckte er längst viel zu tief in der Sache drin. Und so war er in den letzten Wochen immer mehr zum Mahner und Zauderer geworden, zum Bremsklotz ihrer gerechten Sache.
»Eine halbe Million Dollar sind doch nicht wirklich arg viel«, meldete sich Zuckerberg zu Wort und sah den jüngeren dabei strafend an. Er hielt den Vorsitz bei ihren Zusammenkünften, war gleichzeitig ihr größter Einpeitscher und Antreiber, und er ergänzte mit funkelndem Blick: »Überlege doch, wie viel Aufmerksamkeit im In- und Ausland wir dafür erhalten werden?«
Die vier Männer versanken kurz in ihren eigenen Gedanken.
Sie stellten sich den Sturm der Entrüstung in der weltweiten Presse vor, nachdem an einem Sabbat und direkt an der Klagemauer die Explosion hochgegangen war, ausgelöst von einem dieser dreckigen, feigen, palästinensischen Selbstmordattentätern. Sie rechneten mit mindestens einem Dutzend, wenn sie Glück hatten auch ein paar Hundert jüdischer Opfern. Ihre Gedanken ließen sie innerlich erschaudern, nicht etwa vor der unmenschlichen Tat, sondern vor den möglichen politischen Auswirkungen.
Nach einem solchen Frevel an den Juden musste die Regierung geschlossen und zügig die Blockade zum Gazastreifen erneuern, musste die Palästinenser noch stärker Drangsalieren und vor allem endlich und vollumfänglich die Ausbaupläne in all den jüdischen Siedlungen unterstützen. Noch zögerte Netanjahu vor einem solchen Schritt, schien sich sogar mit dem verhassten Präsidenten der Palästinensischen Autonomiebehörde, diesem Mahmud Abbas, verständigen zu können.
»Für die gerechte Sache«, hob Rabbi Ellstone seine Stimme.
»Für die Sicherheit Israels«, bekräftigte Zuckerberg ihre Ideen.
»Gegen ein palästinensisches Palästina«, warf Moskovitz ein und bemerkte nicht einmal den Unsinn in seinen Worten.
»Gegen alle Araber«, fasste Natan Singer zusammen, »auf dass der jüdische Glaube auf ewige Zeiten über Jerusalem herrschen möge.«
An diesem Nachmittag beschlossen sie noch eine Spendenaktion. Zuckerberg mit seinen Kontakten zu einigen wirtschaftlichen Schwergewichten des Landes oblag es, den Hauptteil der Summe zu beschaffen. Moskovitz wollte aus seinem Privatvermögen immerhin Fünfzigtausend Dollar beitragen. Rabbi Ellstone und Professor Singer sollten mit ihren weitverzweigten Familien gleich viel auftreiben können.
In einer Woche wollten sie sich wieder hier treffen und die nächsten Schritte einleiten.
*
Chufu rief noch am selben Abend Alabima an. Normalerweise skypten sie einmal die Woche, jeweils donnerstags und immer um einundzwanzig Uhr nach Rio Zeit, wenn es acht Uhr morgens in der Schweiz war. Doch heute war Dienstag und so setzte er sich auf das Hotelbett, suchte sich die Nummer aus seinem Smartphone heraus, nahm den Hörer des Festanschlusses von der Gabel und wählte ihre Handynummer an, bekam seine Adoptivmutter nach zweimaligem Klingeln an den Apparat.
Alabima hatte nie versucht, den bloß fünfzehn Jahre jüngeren Philippinen wie einen Sohn zu Bevormunden. Sie war ihm mehr eine manchmal strenge, meistens aber gute Freundin und Vertraute. Auch Jules war dem Philippinen mehr Kumpel und älterer Bruder als Elternteil. Und trotzdem empfand er eine große Liebe zu beiden. Dass sie ihm, den Waisenjungen aus den Slums von Manila, den etwas verwilderten Schiffsjungen, in ihre Mitte aufgenommen hatten, ihm eine gute Ausbildung ermöglichten, ihn gleichermaßen förderten wie forderten, hatte in ihm das Bild einer idealen Familie entstehen lassen, in der man füreinander eintrat, in der man zu Gunsten der andern Mitglieder auch mal verzichtete, in der man sich aber stets wohl und behütet fühlen durfte.
Für Jules, der als Einzelkind nie ein intaktes Zuhause kennengelernt hatte und dessen Eltern sich schon bald nach seiner Geburt in planbare Karriere und persönliche Freiheiten aufspalteten, war das Zusammenleben mit Alabima und Chufu eine ebenso neue Erfahrung wie für den Philippinen, ebenso erquickend wie lehrreich. Die Verantwortung für einen jungen Menschen zu übernehmen, weckte in ihm Vatergefühle, die er gegenüber Chufu zwar nie auszuleben versuchte, deren tiefe Liebe er aber auf ihn übertragen hatte, genauso wie auf seine mittlerweile fünfjährige, leibliche Tochter Alina.
Die Lederers waren in den letzten Jahren zu einer Familie zusammengeschweißt. Dazu beigetragen hatten sicher auch erlebte Gefahrensituationen, doch ebenso die wunderschönen, gemeinsamen Momente. Einziger Wermutstropfen war seit gut einem Jahr die angeschlagene Psyche von Jules.
Chufu erzählte an diesem Abend am Telefon seiner Adoptivmutter Alabima vom Verschwinden von Malika, vom spontanen Flug von Mei und ihm nach Kairo, dem Gespräch mit der Familie Gomaa und all ihren Vermutungen und Befürchtungen, von den zu erwartenden Schwierigkeiten hier vor Ort und bei der anstehenden Suche nach der jungen Ägypterin.
»Du willst von mir bestimmt wissen, ob wir Jules einweihen sollen?«, fragte Alabima zurück.
Sie hatte sich über den Anruf von Chufu um diese Uhrzeit erst sehr gewundert. Denn in Rio mochte es zehn Uhr früh sein und Mei und Chufu auf dem Weg zu den Vorlesungen an der Universität. Dass die zwei stattdessen in Ägypten waren, tadelte sie mit keinem Gedanken, auch wenn für sie klar war, dass die beiden als Asiaten und ohne jegliche Arabisch Kenntnisse wohl kaum eine Chance hatten, vor Ort wirklich zu helfen. Doch als echtes Kind Äthiopiens schätzte Alabima die Familie und auch Freundschaften über alles. Was war das Leben wert, wenn man nicht füreinander eintrat? Es war vielleicht diese gradlinige, selbstlose und gleichzeitig völlig natürliche Auffassung von Alabima, die Jules, Chufu und sie selbst so rasch zu einer echten Familie vermengen ließ.
Chufu hatte die direkte Frage nach Jules noch nicht beantwortet, wusste vielleicht selbst nur zu gut, wie vermessen diese Idee war, angesichts der psychischen Probleme seines Adoptivvaters.
»Vielleicht kann er uns irgendwelche wichtigen Kontakte hier in Kairo vermitteln? Er kennt doch Gott und die Welt?«
»Du weißt ganz genau, dass er euch beide nicht allein in Ägypten herum stochern ließe«, meinte Alabima sogleich, »wenn er vom Verschwinden dieser Malika erfährt und euren Bemühungen vor Ort, dann sitzt er im nächsten Flugzeug nach Kairo. Das ist dir doch ebenso klar wie mir?«
Chufu stimmte ihr zu.
»Doch was sollen wir sonst unternehmen? Vielleicht können wir diesen Henry Huxley anrufen? Hast du seine Nummer?«
Henry Huxley war ein langjähriger Freund von Jules. Gemeinsam hatten die beiden einige Abenteuer bestanden, hatten sich stets als ein gut eingespieltes Gespann erwiesen, das auch schwierige und gefährliche Situationen zu meistern vermochte.
»Leider nein, Chufu«, zerstörte Alabima die Hoffnungen des Philippinen, »du weißt, dass die beiden in der Regel schon aus Sicherheitsgründen nur selten direkten Kontakt übers Telefon pflegen. Und du hast doch selbst in Kuwait gesehen, dass die beiden vor allem übers Internet miteinander kommunizieren. Fast wie im Agententhriller.«
Natürlich erinnerte sich Chufu daran, schalt sich einen Ochsen, dass er nicht längst auf diese Idee gekommen war. Vielleicht hatte Jules die Passwörter seitdem noch nicht geändert? Dann konnte er sogar selbstständig und ohne Wissen von Jules den guten Freund aus London kontaktieren.
»Also gut. Lassen wir Jules erst einmal draußen vor«, lenkte Chufu etwas zu rasch ein, worauf das Misstrauen in Alabima aufloderte.
»Unternehmt nichts, das euch in Gefahr bringen kann«, bat sie ihn inständig und mit sorgenvoller Stimme, »andernfalls lasse ich Jules von der Leine«, fügte sie drohend, aber auch scherzend hinzu.
»Mach dir keine Sorgen um uns, Labi«, meinte Chufu, »wir sind doch nicht verrückt genug, um uns in Schwierigkeiten zu bringen. Außerdem passt Familie Gomaa auf uns auf.«
»Skype mich bitte von heute an jeden Morgen, am liebsten jeweils so gegen zehn Uhr an, ja? Dann ist Jules in der Regel irgendwo beschäftigt und ich kann freisprechen. Okay?«
»Versprochen.«
»Bitte richte Mei meine herzlichen Grüße aus. Sie soll sich keine zu großen Sorgen um ihre Freundin machen. Sie muss einen klaren Kopf behalten, wenn sie ihr helfen will.«
»Ich richt’s ihr aus. Danke, Labi, und bis morgen.«
Nach dem Gespräch wählte sich Chufu sogleich ins Internet ein, suchte in seinen Erinnerungen die Web-Adressen und die Stichwörter und Passwörter, fand auf der Tauschplattform rasch das Lied der Wild Animals Girlfriends, lud es hinunter, kopierte es, gab dann die Adresse des Deep Purple Fanclubs in den Browser ein, eine Seite, die sich Jules vor Jahren für seine Zwecke eingerichtet hatte, startete von dort den versteckten Link auf das hinterlegte Kompilierprogramm. Dann erfasste der Philippine eine Mitteilung an Henry, schilderte ihre Lage, bat ihn um Hilfe, tippte dann einen langen Zahlencode ein und ließ das Umsetzungsprogramm laufen. Seine Worte wurden erst verschlüsselt und danach in das digitalisierte Musikstück der Wild Animals Girlfriends gepackt. Als der Vorgang abgeschlossen war, lud Chufu das Lied wieder auf die Musikplattform hoch.
Mei hatte ihm über die Schultern zugeschaut und zweimal ungläubig den Kopf geschüttelt.
»Spielst du Geheimagent?«, fragte sie etwas belustigt, als sich ihr Freund zu ihr umdrehte.
»So ähnlich«, meinte Chufu erklärend, »weißt du, Jules und Henry treten auf diese Weise miteinander in Kontakt. Regelmäßig schaut jeder von ihnen nach, ob eine neue Nachricht vom anderen abgelegt wurde. So können sie sich über das Internet austauschen, ohne dass irgendein Geheimdienst auf dieser Erde mithören kann. Nur in sehr dringenden Fällen benutzen sie PrePaid-Telefonkarten, vernichten anschließend sogar die benutzten mobilen Telefone, damit niemand sie später orten kann.«
Wieder schüttelte Mei ihren Kopf. Trotzdem Chufu ihr bereits einiges über Jules und seine Vergangenheit erzählt hatte und auch wenn sie im letzten Abenteuer selbst in große Gefahr geraten war, dieser Agentenzirkus wirkte auf sie äußerst befremdlich und fast schon unwirklich.
»Und wenn nun Jules als erster deine Nachricht liest?«
»Das wäre ein echt dummer Zufall. Doch Alabima hat mir bei meinem Besuch in der Schweiz erzählt, dass sich Jules für fast nichts mehr interessiere, dass Henry sogar schon mal direkt bei ihr angerufen und nachgefragt habe, warum Jules nichts mehr von sich hören ließe, auch keine Zusammenkünfte ihrer Freimaurerloge in London mehr besuche. Jules vernachlässigt nicht nur seine Familie, sondern auch seine engsten Freunde.«
»Und wann können wir mit einer Antwort von diesem Henry rechnen? Wer ist das?«
»Ich kenne ihn persönlich noch gar nicht, weiß nicht einmal, wie er aussieht. Jules hat ihn als typischen Briten beschrieben, als Mann, deren bewegte Vergangenheit er selbst nicht wirklich kennt. Er könnte früher für einen Geheimdienst oder für den militärischen Abwehrdienst gearbeitet haben. Mittlerweile muss er gegen sechzig Jahre alt sein oder etwas darüber. Laut Jules kennt Henry Huxley Gott und die Welt, besitzt auch viele internationale Kontakte, erkennt auch oft einen Weg, wo andere Menschen nur Schwierigkeiten sehen.«
»Und was genau hast du mit diesem Song und dem Programm da gemacht?«
»Das ist schnell erklärt. Das Musikstück ist doch digitalisiert, besteht also aus lauter Zahlenreihen. Die Software von Jules wandelt meine Mitteilung in Bytes und Bits um, vermischt sie nach einem Schema mit den elektronischen Daten des Songs. Nur wer den verwendeten Zahlencode kennt, kann sie wiederum mit Hilfe desselben Programms aus dem Song herausfiltern und korrekt zusammensetzen. Man muss also wissen, welcher Song mit einer Mitteilung geimpft wurde und wo im Netz er liegt. Dann muss man auch noch über das richtige Kompilierprogramm verfügen und den zwölf-stelligen Zahlenschlüssel kennen. Erst mit allen drei Komponenten zusammen gelingt die Entschlüsselung. Selbst wer zwei der drei in Händen hielte, hat kaum eine Chance das System zu knacken.«
»Aber wie kannst du dir bloß eine zwölfstellige Zahl merken?«
»Das ist leicht, denn es ist dieselbe Zahl, die man auch anwendet, um von jedem Datum den Wochentag auszurechnen. Du kannst dich sicher noch erinnern, an den Abend bei deinen Eltern, als ich zu allen von euch genannten Kalendertagen den Wochentag nannte?«
Mei nickte: »Ja, du hast uns damals auch erklärt, wie man sich das ausrechnen kann. Doch ich hab’s mir nicht merken können.«
»Zuerst musst du dir eine Zahl für jeden Monat im Jahr merken«, begann Chufu seine Ausführung, »1440 2503 6146 lauten sie von Januar bis Dezember. Du zählst die Zahl des entsprechenden Monats zum Tag des Datums. Also beim 5. Februar 1966 wäre das eine 4 für den Monat, die du zur 5 des Tages zählst. Das macht zusammen 9. Und die 66 aus 1966 teilst du durch 4, was 16 ergibt, mit dem Rest 2. Nun musst du nur noch 9 und 16 und 2 summieren und erhältst 27. Davon ziehst du aus der 7er Reihe die 21 ab und bekommst 6 heraus. Sonntag ist immer die 1, also ist die 6 ein Freitag. Der 5. Februar 1966 war somit ein Freitag.«
»Na, wenn du das sagst«, meinte Mei lächelnd.
»Für ein Datum im 21. Jahrhundert musst du übrigen immer zum Resultat noch 1 hinzuzählen, weil das Jahr 2000 ein Schaltjahr war. Die Regel lautet doch so: Wenn ein Jahr durch 4 teilbar ist, handelt es sich um ein Schaltjahr. Ausgenommen davon sind jedoch alle Jahre, die durch 100 teilbar sind, außer Jahre, die auch durch 400 geteilt werden können, wie eben 2000.«
»Du bist ja ein richtiger kleiner Erklärbär«, scherzte Mei lachend, »ich hoffe doch, du erwartest nicht, dass ich mir all den Unsinn auch noch merke?«
»Was heißt hier Unsinn?«, maulte Chufu und drückte ihr einen Kuss auf die Lippen und kam so ihrer nächsten, bestimmt spitzen Antwort zuvor.
Sie gingen zu Bett, standen am nächsten Morgen bereits um sechs Uhr auf. Chufu setzte sich hinter den Laptop und wählte die Tauschplattform an, sah, dass der Song eine neuere Uhrzeit aufwies, lud ihn herunter und wandelte ihn um. Dann las er die Mitteilung von Henry Huxley.
»Erwartet mich um Siebzehn hundert am Meeting Point des Flughafens in Kairo.«
Chufus Herz hüpfte vor Freude über die baldige Ankunft des Briten. Siebzehn hundert war Militärsprache und stand für fünf Uhr nachmittags. In wenigen Stunden würden Mei und er also von Huxley unterstützt werden.
Chufu lud die Kopie des Songs vom gestrigen Abend mit der ursprünglichen Version der Wild Animals Girlfriends wieder hoch. Auf diese Weise wurde die verräterische Nachricht von Henry gelöscht. Falls Jules in nächster Zeit also nachsehen ging, musste er ahnungslos bleiben.
*
Jules war fast den ganzen Morgen über in seinem Büro gehockt, hatte sich nur zweimal einen Espresso aus der Küche geholt. Stundenlang saß er hinter dem Schreibtisch, dachte nach, über sein bisheriges Leben, über seine Liebsten, über seine Zukunft.
Alabima hatte schon vor dem Frühstück die kleine Alina in die Kinderspielgruppe gebracht. Sie wurde dort bis um vier Uhr am Nachmittag betreut. Nicht, dass Alabima ihr Kind gerne loswurde. Doch möglichst häufiger und abwechslungsreicher Kontakt zu anderen Kindern und Erwachsenen förderte die positive Entwicklung ihrer Tochter.
Nachdem das Frühstücksgeschirr in der Spülmaschine verschwunden war und sie ein wenig im Haus geputzt hatte, ging sie gegen zehn Uhr in ihr Zimmer. Pünktlich meldete sich Chufu über Skype bei ihr. Sogleich erzählte er von Henry Huxley, auch dass dieser bereits am Nachmittag in Kairo eintreffen würde. Diese Entwicklung der Dinge passte der Äthiopierin keineswegs.
»Huxley wird vielleicht Jules informieren. Hast du daran schon gedacht? In diesem Fall hätten wir dann den Salat«, richtete sie vorwurfsvolle Worte an die Adresse ihres Sohnes.
»Nein, nein, keine Angst, Labi«, meldete der sich beruhigend, »ich habe Henry selbstverständlich gebeten, ihm vorerst nichts zu erzählen. Wenn alles gut läuft, wird Jules auch nie etwas davon erfahren.«
Alabima blieb skeptisch, bat wie zuvor um einen Anruf am nächsten Morgen und unterbrach die Verbindung. Nachdenklich ging sie in den Garten, zog sich im Häuschen neben dem Pool die Gummistiefel an, packte die Daunenjacke vom Haken und einen Spaten von der Wand und machte sich daran, eines der im Winter brach liegenden Blumenbeete umzugraben. Im letzten Herbst hatte sie darin Engerlinge entdeckt. Die wollte sie nun mit Hilfe der Januarkälte auf natürliche Weise bekämpfen. Heute war der richtige Tag dazu, knapp über null Grad, ausreichend kalt, um jede ungeschützte Larve zu töten, gleichzeitig warm genug, so dass die Erde dem Spaten keinen echten Widerstand entgegenbrachte. Nach einer guten Stunde war sie fertig, kehrte zufrieden ins Haus zurück und fing mit Kochen an. Pünktlich um halb eins rief sie Jules aus seinem Büro zum Essen.
»Und wie geht es Chufu?«, fragte der sie ganz direkt und nachdem er sich etwas umständlich an den Küchentisch gesetzt hatte.
Im ersten Moment erschrak Alabima zutiefst. Doch Jules Augen blickten ohne Argwohn und auch gar nicht spöttisch oder wissend.
»Du hast doch heute Morgen mit ihm geskypt, oder?«
Nun war Alabima doch alarmiert.
»Woher weißt du das?«, fragte sie ihn etwas unsicher zurück.
»Na, als ich mir um zehn Uhr aus der Küche was holte, hab ich im Flur doch gehört, dass du in deinem Büro sitzt und mit jemandem sprichst. Und um diese Uhrzeit tauscht ihr euch doch regelmäßig aus?«, fasste er seine Beobachtungen zusammen, »und? Geht es ihm und Mei gut? Haben sie das neue Semester erfolgreich gestartet?«
»Darüber haben wir gar nicht gesprochen«, meinte Alabima und blieb damit bei der Wahrheit. Sie wollte Jules um keinen Preis anlügen. Denn ein Betrug hatte nach ihrer Auffassung in ihrer Lebensgemeinschaft keinen Platz, selbst wenn man sich einreden konnte, er wäre nur zum Besten des anderen. Doch einem Menschen durch eine Lüge das Recht abzusprechen, selbst über sich und sein Empfinden oder sein Handeln zu entscheiden, war eine Art von Verachtung, die Alabima nicht kannte. Doch die Äthiopierin spürte die Gratwanderung, auf der sie sich befand.
»Du bist heute so schweigsam«, wurde sie nun sanft von ihm getadelt, »steckt der Junge oder Mei in Schwierigkeiten?«
Alabima schluckte.
»Nein, den beiden geht es gut.«
»Aber warum bist du dann so komisch? Irgendwas steckt doch dahinter?«
Alabima lächelte ihren Gatten etwas gequält an.
»Bloß eine Frauenangelegenheit.«
»Bei dir oder bei Mei?«, kam die erwartete Rückfrage.
»Bei Mei.«
»Etwas Ernstes? Müssen wir uns Sorgen machen?«
»Das ist noch nicht raus. Wir müssen noch abwarten.«
Jules schien sich mit ihren Antworten zufrieden zu geben, widmete sich dem Nudel-Auflauf mit den Erbsen und Karotten als Beilage. Alabima kochte gerne einfache Gerichte, so, wie sie in allen Gegenden der Schweiz gerne gegessen wurden. Die zuvor al dente gekochten Nudeln wurden in eine feuerfeste Schüssel gegeben und mit zwei aufgeschlagenen Hühnereiern durchtränkt. Dann kam noch eine dicke Schicht geriebener Käse darüber. Im Ofen bei 180° brauchte das Gericht zwanzig Minuten. Ein Teil des Rühreis war durch die Nudeln bis zum Boden der Schüssel getropft und dort zu einer hauchdünnen Schicht karamellisiert. Sie schmeckte leicht süßlich und bildete einen wunderbaren Kontrast zur würzigen Bergkäse-Schicht an der Oberfläche des Auflaufs. Die Nudeln dazwischen waren dank der Eier fest miteinander verbunden worden und stichfest. Man konnte Speckwürfel oder auch Schinkenstreifen zur Anreicherung hinzugeben. Doch Alabima und Jules waren sich darin einig, dass die Mischung aus gebackenem Käse, Rührei und der etwas angebrannten Eiweißkruste vollauf genügte, ja, dass jeder zusätzlich Geschmack das Gericht bloß gröber und damit gewöhnlicher machte.
Zum Auflauf hatte Alabima eine Kilobüchse Erbsen und Karotten aus einem Supermarkt heiß gemacht. Sie selbst mochte den Konservenduft nicht besonders. Doch Jules liebte ihn umso mehr, verband ihren Geschmack mit den glücklicheren Tagen seiner Kindheit, wie er ihr gegenüber mehr als einmal erwähnt hatte, damals noch, als er ab und zu im Pförtnerhaus des Anwesens seiner Eltern beim Verwalter-Ehepaar Amstutz gesessen war und mit ihnen zusammen zu Mittag essen durfte. Maria und Urs waren ihm damals mehr Vater und Mutter gewesen, als seine leiblichen Eltern und so hatte sich der damalige Geschmack bei ihm mit höchst positiven Gefühlen verbunden.
Im Radio lief irgendeine Sendung. Plätschernde Musikstücke wurden durch kurze, meist amüsante Kommentare des Sprechers unterbrochen. Jules und Alabima nahmen das Mittagessen mehrheitlich schweigend ein, sahen sich zwischendurch zwar immer wieder an, bedienten sich nach Bedarf aus den beiden Schüsseln, tranken Mineralwasser. Beide schienen ihren eigenen Gedanken nachzuhängen.
»Was hast du für Pläne für heute Nachmittag?«, fragte Alabima, nachdem Jules das Besteck schräg auf dem Teller abgelegt hatte.
»Ich weiß noch nicht. Vielleicht etwas Sport? Ich setz langsam Fett an.«
Und wie zur Bestätigung packte er mit Daumen und Zeigefinger der rechten Hand an seine Hüfte, klemmte dort die Haut unter dem Hemd zusammen und zog daran. Alabima sah wegen der Tischkante zwar nur den Oberarm, wusste jedoch sehr genau, dass Jules stark übertrieb, immer noch schlank war, mit schmaler Taille und breiten Schultern. Von einem Modellathleten unterschieden ihn seine sehr kräftigen Oberschenkel und der in den letzten Monaten dank einem ausgedehnten Kraft- und Ausdauertraining recht wuchtig gewordene Brustkorb. Der einst eher schmal und agil wirkende Jules war zu einem menschlichen Brocken mutiert. Seine Körpergröße von knapp eins achtzig milderte den Eindruck zwar und in einem gut geschnittenen Anzug sah Jules eher ein wenig verfettet als wirklich sportlich aus. Doch das war bei fast allen Kraftpaketen so, die sich auf dem Schenkeltrainer vierhundert Kilogramm auflegten und die Arm- und Schultermuskulatur mit dreißig Kilogramm schweren Hanteln formten.
Jules verschwand im Keller und Alabima räumte den Tisch ab, stellte das Geschirr in die Spülmaschine und schaltete sie ein, setzte sich danach mit einem Espresso ins Wohnzimmer auf die Couch, blättere in einer Modezeitschrift. In zwei Stunden würde sie Alina aus der Krippe abholen, vorher noch Einkaufen gehen. Plötzlich stand Jules unter der Türe. Sein T-Shirt und die Sporthose waren vom Schweiß durchtränkt, auf seiner Stirn, den Wangen und der Nase glänzten Tropfen und sein Haar klebte an seinem Kopf.
»Sag es mir«, verlangte er, »erzähl mir endlich, welche Probleme Chufu und Mei haben.«
Alabima erschrak über den wilden Blick ihres Ehegatten. Er schien innerlich äußerst aufgewühlt zu sein, fast schon in Panik oder voller Zorn.
»Stecken die verfluchten Amerikaner etwa dahinter?«, herrschte er sie an, als ihm ihr Zögern zu lange dauerte, »oder gar die Mexikaner?«
Alabima hob beschwörend ihre Hände.
»Ganz ruhig, Jules«, versuchte sie ihn zu beschwichtigen, erkannte gleichzeitig, dass ihn ihre Worte bloß weiter anstachelten und fügte darum rasch hinzu, »es ist wirklich nichts. Mach dir keine Sorgen.«
»Was verschweigt ihr vor mir? Ich bin doch nicht blöd? Irgendetwas ist im Busch. Red endlich, verdammt«, herrschte er seine Gattin an.
Alabima war zusammengezuckt, meinte dann in beschwörendem Tonfall: »Bitte reg dich nicht auf Jules. Es gibt nichts, was du wissen müsstest, keinerlei Gefahr. Nur du wirst immer nervöser, seit der Sache in Mexiko, siehst überall nur noch Feinde und Bedrohungen...«
Jules brauste nun auf, als hätte er seit Wochen auf solch offen ausgesprochene Vorhaltungen gewartet und womöglich sogar gelauert. Denn er spie die nächsten Sätze Alabima geradezu ins Gesicht: »Hast du eigentlich eine Ahnung in welcher Gefahr wir alle immer noch schweben? Vertraust du etwa den Beteuerungen der Amerikaner, dieser falschen Bande? Sie bespitzeln uns doch weiterhin, schon seit Monaten. Dieses Haus, das ganze Dorf. Ich spüre das doch. Es riecht förmlich danach. Die CIA ist noch lange nicht fertig mit uns, glaub mir. Die warten bloß auf eine günstige Gelegenheit, auf einen Fehler von mir. Wenn ich nicht auf der Hut bleibe, dann vernichten sie uns.«
Wahn glänzte in seinen Augen. Speichelbläschen hatten sich auf seinen Lippen gebildet, platzten dort während seinen letzten Worten. Alabima schüttelte traurig ihren Kopf. Der Schmerz ließ ihr schönes Gesicht verzerren.
»Ach, wenn du dich doch bloß selbst sehen und hören könntest, Jules. Du gehörst in ärztliche Behandlung. Du hast Wahnvorstellungen.«
Zornig und drohend zugleich ging Jules auf sie zu, hob sogar seine Hand wie zum Schlag, war wütend, jähzornig und unbeherrscht. Alabima blickte gefasst zu ihm auf, erwartete seinen Hieb, sah ihren Gatten trotzdem voller Verständnis an. Ihre ruhigen Augen ließen ihn stocken, hielten seinen Blick einen Moment lang gefangen. Langsam senkte sich sein Arm und die Irrlichter in seinen Pupillen verschwanden.
»Verzeih«, rief er plötzlich erregt aus, drehte sich abrupt um, verließ fluchtartig das Wohnzimmer, nahm sich im Flur im Vorbeigehen den Schlüsselbund und die Brieftasche, auch eine seiner Jacken vom Hacken, zog die Haustüre auf und ließ sie hinter sich ins Schloss fallen.
Wenig später hörte Alabima den Motor des Geländewagens aufheulen und das Fahrzeug entfernte sich rasch. Von ihr unbemerkt schüttelte sie nachdenklich ihren Kopf, dachte mit Wehmut an Jules, an seine verzweifelte Lage, an all die Hirngespinste, die ihn wohl seit Monaten quälten, auch an sein Unvermögen, sich endlich selbst klar zu erkennen und sich helfen zu lassen. Wie sollte das bloß weitergehen?
Heute war es das erste Mal, dass er sie in seinem Jähzorn beinahe geschlagen hätte. Nur mit allergrößter Mühe hatte er sich noch einmal unter Kontrolle gebracht. Doch wie würde es das nächste Mal ausgehen? Verlor er dann den inneren Kampf vollends? Durfte sie ihre Tochter Alina und auch sich selbst überhaupt noch länger der Gefahr eines im Wahn gefangenen Vaters und Ehemannes aussetzen?
Sie liebte Jules immer noch von ganzen Herzen, sah in ihm nur die Krankheit und sein Unvermögen, sich aus ihr selbst zu befreien. Schon einmal, vor einigen Jahren, hatte sie ihn mit der Tochter verlassen, damals aus Sorge um ihre Sicherheit. Noch heute spürte sie eine tiefe Schuld in sich, wenn sie an die Wochen der Trennung dachte. Alabima gestand sich auch ein, dass sie bei ihrer Rückkehr einen veränderten Jules vorgefunden hatte. Der früher so selbstbewusste Mann war während dieser Zeit innerlich zerbrochen und aus der Bahn geworfen worden. Die Trennung mochte ihn womöglich sogar zu Selbstmordgedanken getrieben haben.
Damals musste ihm bewusst geworden sein, wie wenig ihm an einem eigenen Leben ohne seine Familie lag. Ja, damals begann wohl der Bruch zwischen seiner bislang aufregenden Leichtlebigkeit und seinem absoluten Verantwortungsgefühl gegenüber seinen Lieben. Die Sache in Mexiko und später in Somalia, die Wochen der allergrößten Gefahren für Chufu, Mei, Alina und für sie selbst. Dies alles musste sein Innerstes getroffen haben, höhlte ihn aus, ließ ihn schreckliche Dinge, menschenverachtend Handeln. Chufu hatte sich ihr erst vor wenigen Tagen, kurz, bevor er seinem Rückflug nach Rio antrat, anvertraut. Denn er hatte als angehender Psychologe erkannt, wie zerrüttet das innere Gefüge seines Adoptivvaters war. Schonungslos berichtete er ihr erstmals von Mexiko und dem Geständnis von Jules ihm gegenüber, von den vier bestialischen Morden. Später las Alabima im Internet die damals weltweit bekannt gewordene Geschichte nach, erzitterte immer wieder, wenn sie daran dachte, was Jules auf sein Gewissen genommen hatte, um Chufu und Mei zu retten. Und wenn sie sich an das Töten der Mexikanerin in Somalia noch einmal vor Augen hielt, mit welch brutaler Konsequenz Jules vorgegangen war, ohne jeden Gedanken an Schonung, nur mit dem Willen zur Vernichtung der Gefahr für seine Familie, dann kroch es ihr immer noch kalt den Rücken hinunter.
Ja, sie liebte Jules weiterhin und verstand auch sehr gut, in welch einer Spirale von Pflichtbewusstsein und Schuld er gefangen gehalten wurde. Eine Abwärtsspirale, die er selbst kaum mehr allein aufhalten konnte, deren Ende aber noch bei weitem nicht erreicht war.
Alabima versuchte, ganz ehrlich in sich hinein zu lauschen, auf jede Nuance ihrer Gefühle für Jules zu achten. War vielleicht gar ein Selbstmord der Ausweg, auf den sich Jules zubewegte? Oder würde er sich bei nächster Gelegenheit in allzu große Gefahr begeben, um auf diese Weise umzukommen, im falschen Verständnis, er opfere sich damit für seine Familie auf? Oder würde er, wie manch andere aus der Bahn geworfene Ehemänner, sich auf einmal gegen die eigenen Lieben wenden, sie in einem Anfall von Irrsinn umzubringen versuchen, um sie auf diese Weise vor noch Schlimmerem zu bewahren?
Sie kannte all diese entsetzlichen Geschichten aus der Presse, versuchte sich vorzustellen, wie all diese Verirrten und Verwirrten wohl bis zu diesem Endpunkt ihres Lebens getrieben wurden.
Letzteres konnte sich die Äthiopierin allerdings nicht vorstellen, wollte diese mögliche Konsequenz eines gestörten Geistes nicht wirklich in Betracht ziehen. Trotzdem würde sie so rasch als möglich Kontakt zu einem guten Psychologen aufnehmen müssen. Denn sie fühlte, sie brauchte den Rat eines erfahrenen Fachmanns, eine möglichst objektive Beurteilung einer möglichen Gefahr. Und vielleicht konnte sie Jules ja doch noch irgendwie zu einer Therapie überreden oder zumindest ein erstes Gespräch vermitteln? Endlich stand die Äthiopierin vom Sofa auf und machte sich für den Einkauf zurecht.
*
Sami ad-Dim wurde unsanft aus seinem Mittagsschlummer geweckt. Er schnappte durch den Mund nach Luft, sperrte seine Augen auf, kam dann erst richtig zu sich und sah in das spöttisch grinsende Gesicht eines ihm fremden Mannes.
»Was soll das?«, knurrte Sami angriffslustig und schlug die Hand weg, die seine Nase quetschte. Dann betrachtete er sich den abfällig grinsenden Mann eingehender. Als einer der erfolgreichsten Baccha Baazi Organisatoren kannte Sami viele mächtige Männer des Landes, erkaufte sich immer wieder ihr Wohlwollen mit einem seiner stets jungen und frischen, feingliedrigen und höchst beweglichen Knabentänzern. Er brauchte zum Beispiel bloß mit den Fingern zu schnippen und der örtliche Polizeichef nahm sich einer ihm frech daherkommenden Person an, schüchterte sie ein oder nahm sie eine Zeit lang in Gewahrsam. Gründe dafür ließen sich immer finden. Drogenhandel oder auch der bloße Konsum gehörten zu den einfacheren Mitteln der Behörden, unliebsame Personen zurück zu binden oder auch dauerhaft verschwinden zu lassen. Afghanistan war im Umbruch und staatliche Willkür für die Bevölkerung längstens zum Normalfall geworden.
Das Grinsen im Gesicht des Mannes verschwand jedoch keineswegs unter dem strengen Blick von Sami ad-Dim. Dies verblüffte ihn nun doch ein wenig. Wusste der Kerl vielleicht gar nicht, mit wem er sich anlegte?
Sami hatte sich nach dem reichhaltigen Mittagessen auf der Veranda seines Stadthauses zur Ruhe gelegt und im Schatten des Balkons über ihm ein wenig gedöst, hatte wieder von diesem einen Knaben geträumt, von seinem Idealbild eines Tänzers, wie er ihn bislang noch nirgendwo in dieser Perfektion hatte finden können. Ein äußerst zarter und gleichzeitig makelloser Knabenkörper, mit langen, dünnen und zerbrechlich wirkenden Armen, schmalen Fingern mit entzückend langen Nägeln, von schwarzen, dichten Locken und einem unergründlich dunklen Augenpaar, das jede Seele bewegte. Ein frischer Mund mit wollüstigen Lippen, mit hohen Wangenknochen und kräftigen, weißen Zähnen.
Sami konnte diesen Knaben mit seiner Vorstellungskraft beinahe körperlich gespürt, wie der Junge seine Eichel sanft liebkoste, wie seine Zunge über sie glitt, wie sich seine Fingernägel leicht in die Haut seines erregten Penis bohrten, wie Sami stöhnend in den Mund des Jungen abspritzte und wie dieser ihn mit seinen plötzlich so leuchtenden Augen dankbar anblickte und genüsslich den Saft schluckte, auch noch nach mehr verlangte und ihn aussaugte, bis sich Sami völlig leer und wunderbar leicht fühlte. Der perfekte Liebesdiener, von ihm persönlich abgerichtet, eine Kreatur der Lustentfaltung, aber auch eine wirkungsvolle Waffe gegen jeden der Mächtigen im Land. Würde er dieses Idealbild von einem Knabentänzer wohl irgendwann in seine Finger bekommen? Wünsche waren doch da, um sie sich zu erfüllen?
Doch immer noch stand dieser freche Kerl vor ihm, der ihn so unsanft aus seinem süßen Schlaf gerissen hatte.
»Willst du nicht reden, Bursche? Warum dringst du in mein Haus ein, störst meinen Schlaf? Was fällt dir ein? Soll ich dir Beine machen? Willst du etwa Ärger mit dem Polizeichef bekommen?«
Endlich bequemte sich der Mann zu einer Antwort. Seine Stimme klang rau und stolz, als stünde der verdammte Kerl meilenweit über Sami.
»Wir wissen von deinen Geschäften, von deinen Bacchis, Sami ad-Dim. Und wir verurteilen dein schändliches Tun. Unser Gericht hat vor zwei Tagen das Todesurteil über dich gesprochen. Ich bin gekommen, um es zu vollstrecken.«
Mit diesen Worten zog der Mann sein Jambia aus der Scheide am Gürtel und drückte die Klinge leicht gegen den Hals des verstört blickenden, nun völlig erstarrten Sami.
»Bitte«, flüsterte der Zuhälter, »bitte, tu das nicht.«
Und als der Mann innehielt, um ihn weitersprechen zu hören, fügte er rasch an: »Ich gebe dir Geld, viel Geld. Fünfzigtausend Afghani. Jetzt gleich. Wenn du mich am Leben lässt, ...«
Das Grinsen des Mannes ließ den Zuhälter ängstlich verstummen. Gleich würde der Kerl seinen Ellbogen nach rechts ziehen und die scharfe Klinge seine Luftröhre durchtrennen, dabei gleichzeitig die wichtigsten Adern am Hals durchschneiden. Würde es sehr weh tun? Musste er lange leiden? Sami kniff seine Augenlider zusammen und begann, ohne Stimme zu beten, erzitterte gleichzeitig mit seinem gesamten Körper, wartete auf sein Ende.
Sekunden verronnen, ohne dass er einen Schnitt verspürte. Doch noch immer lag die Klinge auf seinem Hals.
»Mach deine Augen wieder auf, ad-Dim«, befahl ihm die raue Stimme des Mannes. Sami gehorchte zögernd, blinzelte in das grinsende Gesicht seines Mörders.
»Wir geben dir noch eine Chance. Eine einzige. Doch willst du sie?«
Sami brauchte zwei Sekunden, um aus seiner Todesstarre zu erwachen, um die Frage des Mannes überhaupt zu begreifen.
»Ja«, krächzte er atemlos, fügte rasch und voller Verzweiflung ein lauteres »JA« hinzu.
Der Druck der Klinge verschwand von seinem Hals, doch die Spitze berührte nun sein Brustbein, wie zum Zustoßen bereit.
»Dann hör mir gut zu, ad-Dim.«
Die Stimme des Fremden klang plötzlich süß und verheißungsvoll in den Ohren des Todgeweihten, egal, was auch immer sie sagen mochte.
»Du bringst doch heute Abend ein paar deiner Knaben zu Farid Rahimi.«
Es war keine Frage. Trotzdem nickte Sami ergeben.
»Während des letzten Tanzes schleichst du hinaus und öffnest uns das Tor zum Anwesen. Verstanden?«
Wiederum nickte Sami.
»Dir und deinen Knaben geschieht nichts«, unterstrich der Mann seine Forderung, »wir wollen bloß Farid Rahimi und seine Gäste. Verstanden?«
Das brave Nicken von Sami erfolgte erneut.
»Und kein Wort zu niemandem. Sonst bist du tot.«
Mit diesen Worten steckte der Fremde endlich seinen Dolch in die Scheide zurück. Dann ging er seelenruhig weg, verschwand hinter der Hausecke, wurde auf der belebten Straße von den vielen Passanten rasch verschluckt. Zurück blieb ein fiebrig schwitzender Sami ad-Dim, der noch keinen klaren Gedanken fassen konnte, in dessen Gesicht es immer noch zuckte, dessen Adrenalin sich nur langsam abzubauen begann und ihn zur Ruhe kommen ließ.
Sami war nie besonders mutig gewesen, hatte sein Leben mit Kompromissen zusammen gepflastert, wich bei starkem Druck stets zurück, hielt nie Stand, eroberte später lieber mit Schmeicheleien den verlorenen Einfluss zurück. Ihm war längst klar geworden, wer sein Besucher war. Doch konnte man gegen religiöse Eiferer überhaupt ankämpfen? Konnte man den rutschenden Berg etwa aufhalten, der einen zu zermalmen drohte?
Die Gedanken von Sami ad-Dim gingen nur in eine Richtung. Wie floh er möglichst rasch aus der Hauptstadt. Welche Wege sollte er nehmen, um unerkannt und unbehelligt das Land zu verlassen? Wie viel Geld konnte er bis morgen früh überhaupt auftreiben? Er seufzte angesichts seines Vermögens, das er in so kurzer Zeit gar nicht flüssig machen konnte, sein Mietshaus mit den zwölf Wohnungen, seine Stadtvilla und das Anwesen auf dem Land. Dazu all die wertvollen Tanzkostüme. Unsummen hatten sie verschlungen, damit seine Knaben den Mächtigen und Einflussreichen des Landes gefielen. Und nicht zuletzt sein wichtigstes Kapital, die fünf jungen Tänzer und Lustdiener. Auch sie würde er zurücklassen müssen, wenn er unerkannt entkommen wollte. Was für ein hoher Preis für sein Leben und doch so wenig.
*
Jules hatte sein Haus beinahe fluchtartig verlassen, brauste dann mit seinem Wagen durch das Dorf, steuerte die Autobahn auf kürzestem Weg an, wählte dort aber eher unbewusst die Richtung nach Lausanne und nach Genf, fädelte sich geschickt in den flüssigen Verkehr ein. Die nächstgelegenen Ausfahrten beachtete er noch nicht, konnte bislang keinen klaren Gedanken fassen. Noch immer sah er die bittenden und gleichzeitig verständnisvollen Augen seiner Frau vor sich, wie sie sogar feucht wurden und er sie trotzdem fast geschlagen hätte, wie ihn nur der Blick in ihre Seele dieses Mal noch zurückgehalten hatte.
»Verdammt«, rief er plötzlich und immer noch voller Zorn aus und er schlug mit der Faust auf das Lenkrad, »was lügt sie mich auch an? Und warum zum Teufel melden sich Chufu und Mei mit ihren Problemen nicht bei mir? Weshalb schalten sie Henry ein? Schmieden die irgendein Komplott gegen mich? Oder nehmen sie mich einfach nicht mehr ernst? Verdammt, ich bin immer noch Jules Lederer, der Problemlöser, der an keiner Sache scheitert. Ich bin immer noch der Mann, an dem sich sogar die US-Geheimdienste ihre Zähne ausgebissen haben. Verdammt.«
Erst in Nyon verließ Jules die Autobahn, steuerte nun zielstrebig eine bestimmte Adresse in der Chemin d’Eysins an. Er stellte den Wagen mehr als hundert Meter vor seinem Ziel entfernt ab, ging dann direkt zur Hintertür des Geschäftsgebäudes, drückte für zwei Sekunden den Klingelknopf und wartete ungeduldig auf das Öffnen. Klackende Schritte waren erst zu hören, dann das leichte Schaben der Blende vor dem Türspion. Endlich wurde der Schlüssel gedreht und ihm geöffnet. Eine Frau von vielleicht vierzig Jahren, immer noch recht hübsch anzusehen, begrüßte ihn im seidenen Morgenmantel, der vorne einen Spalt weit offenstand und nicht nur den Ansatz ihrer Brüste, sondern auch ihre blank rasierte Scham zeigte.
»Hallo, Jules«, begrüßte sie ihn wie einen lang ersehnten Freund, »schön dich zu sehen. Komm rein. Madeleine steht dir in einer Viertelstunde zur Verfügung. Sie wird sich freuen. Was trinkst du?«
*
Ein bloß mittelgroßer, sehr schlanker Mann, mit braun gebranntem Gesicht und grauem Schnurrbart, trat fröhlich lächelnd und entspannt aus der Glasschiebetüre und steuerte direkt auf den ausgeschilderten Treffpunkt zu. Schon von Weitem wurde er von Chufu und Mei als Brite erkannt, wie er einerseits energisch und doch mit federnden Schritten auf sie zukam.
»Hallo Chufu, hallo Mei, ich bin Henry«, brach er vom ersten Moment an das Eis zwischen ihnen und schüttelte dann ihre Hände, fuhr jedoch mahnend fort, »ich hab gesehen, dass du die ursprüngliche Version vom Musikstück wieder hochgespielt hast. Das war zwar gut gemeint, doch auch gefährlich. Immerhin hattest du das Lied einige Zeit lang auf deinem Laptop liegen. Damit hast du Spuren zu dir hinterlassen. Du hast es doch hoffentlich in der Zwischenzeit dort gelöscht und danach die Harddisk neu formatiert?«
Mit einer solchen Begrüßung hatten Chufu und Mei nicht gerechnet. Sie blickten sich etwas betreten und gleichzeitig ertappt an. Danach gestand der Philippine ein: »Ich muss wohl noch einiges lernen. Aber ich setz den Laptop neu auf, sobald wir zurück im Hotel sind, muss mir dazu jedoch erst noch neue Software besorgen, denn die CDs hab ich ja nicht dabei.«
Huxley lächelte nachsichtig und betrachtete sich die beiden jungen Asiaten wohlwollend.
»Na, immerhin wird Jules wahrscheinlich nicht wissen, wo wir uns in diesem Moment aufhalten. Das hoffe ich wenigstens.«
»Es wäre wohl doch ein großer und recht dummer Zufall, wenn mein Vater gerade in diesen wenigen Stunden das Musikstück kontrolliert hätte, denke ich. Soweit ich weiß, habt ihr es schon lange nicht mehr benutzt?«
Henry zog die beiden etwas zur Seite, um ungestörter mit ihnen reden zu können.
»Ach, weißt du, Chufu, du kennst Jules noch nicht wirklich. Dass er dir von mir und von dieser Möglichkeit der Kommunikation erzählt hat, mag viele Gründe haben, Zufall oder Nachlässigkeit war es jedoch kaum. Jules ist zu professionell, um nicht alle Umstand im Auge zu behalten.«
»Doch wenn er heute nachschauen geht, wird er doch nichts mehr finden?«, warf Mei fragend ein, »er wird nichts von unserem Treffen hier in Kairo erfahren, oder?«
Henry lächelte sie verständnisvoll an.
»Na, zum einen hat sich das Upload-Datum des Liedes verändert. Jules weiß also, dass daran manipuliert wurde. Und da er keinen neuen Text darin findet, wird er misstrauisch werden. Zudem weißt weder du noch ich, ob Jules in seinem Kompilierprogramm keine Routine eingebaut hat, die zum Beispiel automatisch eine Kopie jedes Songs irgendwohin im Internet zusätzlich ablegt.«
Chufu und Mei sahen betroffen drein und der junge Philippine meinte etwas kleinlaut: »Ich muss wohl wirklich noch viel lernen.«
»Geheimagent wird man nicht an einem Tag«, meinte Henry beschwichtigend, »doch wie gelangen wir vom Flughafen in die Stadt?«
»Wir haben uns mit einem privaten Fahrer angefreundet. Und im Hotel haben wir bereits ein Zimmer für dich reserviert, vorerst für die nächsten fünf Tage.«
»Und wie habt ihr euer Transportmittel gefunden?«
»Als wir hier ankamen, stürmten zwei Dutzend Taxifahrer auf uns los. Achmed stand etwas abseits und hielt sich zurück. Von Jules weiß ich, dass hier in Ägypten fast alles irgendwie organisiert ist, all die Taxifahrer also unter Umständen allesamt zu einer einzigen Zentrale gehören und bloß Angestellte sind. Da hab ich mir gedacht, ein unabhängiger Privater sei vielleicht die bessere Wahl für unseren Zweck. Er spricht auch gut Englisch.«
Henry lächelte breit, als er die Verteidigungsrede des Philippinen hörte.
»Na, dann werden wir dem guten Achmed mal auf den Zahn fühlen«, und fuhr versöhnlich und auch zweideutig fort, »dein Ansatz scheint mir jedenfalls recht viel versprechend zu sein.«
Achmed Nagarin fand Anklang beim Briten, beantwortete seine Fragen offen, direkt und ehrlich. Henry verlangte allerdings die Bestätigung seiner Angaben und so fuhren sie zuerst in das el-Muski Quartier und besuchten dort die Familie ihres Fahrers. Sie gehörte zu den vielen ärmeren Sippen in Kairo, die auf dem Dach eines Wohnhauses und in selbst gebauten Hütten lebten. Achmeds Mutter Samira und zwei seiner Schwestern waren anwesend. Die übrigen Mitglieder der fünfzehnköpfigen Familie gingen ihrer Arbeit nach oder machten Besorgungen.
Die Nagarins hatten sich Wellblechhütten gebaut und lebten seit vielen Jahren recht zufrieden mit ihren Nachbarn auf den Dächern der benachbarten Wohnhäuser zusammen. Die Duldung der zahlenden Mieter der Häuser verdienten sie sich durch verschiedene Dienstleistungen, wozu das Putzen der Treppenhäuser oder Botengänge gehörten. So wusch in einem muslimischen Land eine Hand die andere. Man ließ einander leben, solange man voneinander profitierte.
Henry war nach dem Besuch auf dem Dach recht angetan, wollte von Achmed aber noch wissen, wie er sein Fahrzeug finanziert hatte.
»Meine beiden älteren Brüder konnten studieren. Damals lebte Vater noch«, meinte der junge Ägypter und wunderte sich insgeheim immer noch über die Neugierde dieses Fremden aus Europa, »sie haben für mich die Anzahlung beim Händler geleistet und ich verdiene als Fahrer genug, um ihn über ein paar Jahre hinweg abstottern zu können.«
»Du warst beim Militär«, fragte Henry weiter.
»Ja, wie jeder einigermaßen gesunde Mann. Die üblichen drei Jahre.«
»Du wolltest dort nicht bleiben? Karriere machen?«
Achmed schüttelte den Kopf.
»Um keinen Preis. Als Mitglied einer armen und unbedeutenden Familie von Dachbewohnern hätte ich als Offiziersanwärter ganz unten durchgemusst. Auf die jahrelangen Demütigungen durch die höheren Ränge wollte ich gerne verzichten. In der ägyptischen Armee braucht man gute Beziehungen, um wirklich Karriere zu machen. Das haben Assad und Mubarak zu ihrer eigenen Sicherheit so eingeführt. Familienbanden zählen mehr als echte Leistungen und gar Können und Wissen.«
»Du scheinst ein wenig verbittert zu sein?«
Henry deutete die Worte des jungen Ägypters richtig.
»Mein Kommandant hätte mich gerne behalten und wollte mich auch fördern. Doch er selbst brauchte mehr als zwanzig Jahre, um gerade mal Oberst zu werden, weil auch er damals keine Unterstützung erhielt. Das wäre wohl auch mein Weg gewesen. Bücklinge vor irgendwelchen unfähigen Idioten machen, um von ihnen als Fußabtreter geduldet zu werden.«
»Dann nimmst du aktiv an der Revolution gegen das Regime teil?«
Achmed verstummte, presste seine Lippen ablehnend zusammen. Mei und Chufu dagegen bewunderten die Verhörtechnik des Briten. Mit wenigen Fragen, beinahe beiläufig, hatte er ihren Fahrer zu einem für sie möglicherweise äußerst wichtigen Punkt gelenkt. Eine ganze Weile lang dachte Achmed angestrengt über seine Antwort nach, starrte dabei stur durch die Windschutzscheibe, vermied jeden Blickkontakt mit Henry, der neben ihm saß und weiterhin stumm abwartete.
»Muss ich darauf antworten?«
Die Stimme des Ägypters klang gepresst, fast schon ängstlich.
»Nein, natürlich nicht«, beschwichtigte ihn Henry sogleich und fügte versöhnlich an, »ich wollte nur herausfinden, wie naiv oder wie misstrauisch du bist. Es ist gut.«
Achmed machte sich nun doch zunehmende Sorgen. Was hatte dieser Engländer bloß vor? Was sollte die Fragerei nach seinen Wünschen und seiner politischen Gesinnung? In was für eine Geschichte war der Kerl und die beiden sympathischen Asiaten hier in Kairo eigentlich verwickelt, dass der Kerl ihn so verhörte und seine Familie kennenlernen wollte? Sollte er in irgendetwas Illegales hineingezogen werden? Achmed wurde noch nicht schlau aus dem Mann aus Europa, wollte aber auf der Hut bleiben.
»Wir sollten am besten miteinander etwas trinken gehen, offen miteinander reden und uns besser kennenlernen«, meinte nun Henry jovial und beinahe aufgekratzt, »fahr uns doch zu einem netten Lokal, in dem wir uns ungestört unterhalten können.«
»Ich will in nichts Gefährliches oder gar Illegales hineingezogen werden«, hatte sich Achmed entschieden, sprach die Worte hastig und mit einem Seitenblick auf den Briten. Henry begann zu schmunzeln: »Keine Sorge, mein Junge, wir gehören zu den Guten.«
*
»Oh, du Hurensohn, du verdammter«, stöhnte die mollige Blondine mit den hängenden Brüsten und dem deutlichen Bauchansatz, wand sich mehr spielerisch und voller Lust als vor Schmerzen am Andreaskreuz. Jules hielt immer noch die dicke, brennende Kerze in seiner Hand, deren Wachs er auf ihre Brüste hatte träufeln lassen. Der Anblick der blutroten Fäden über ihrem weißen Fleisch erregte ihn. Sein Glied stand hart und fest von seinen Hoden ab, deutete wie ein drohender Finger auf die Klitoris der blonden Frau. Rasch kippte er sich selbst einen kleinen Schwall Kerzenwachs auf seinen Penis, stöhnte voller Lust auf, drückte dann seine Eichel gegen die blank rasierte Scham der Frau, die sie ihm entgegenstreckte, rieb ihre äußeren Lippen, presste dann seinen Oberkörper an denjenigen seiner Sklavin Madeleine, fasste mit der linken Hand an ihre rechte Brust, knetete sie hart und für die junge Frau durchaus schmerzhaft.
»Ah, du Schwein, du elendes«, lockte die Frau mehr, als dass sie sich wehrte, »stoß mich endlich, du Hanswurst, du Versager, pack mich mal so richtig, du Schlappschwanz, oder kriegst du deinen etwa gar nicht mehr hoch?«
Als wenn ihre verächtlichen Worte ein Angriffssignal gewesen wären, stieß Jules hart zu, wuchtete sein Glied mit aller Kraft in die Scheide der jungen Frau, zwängte dabei ihre langen Schamlippen mit hinein, begann sie mit möglichst kräftigen Stößen zu quälen.
»Na, wie ist das, du verdammte Sau«, presste er zwischen seinen Lippen hervor, »gefällt dir das, du Miststück? Willst du mehr davon?«
»Jaaaaaaah, gib es mir, mein Gebieter«, schmeichelte ihm die Blonde, »beglücke deine Sklavin. Gib mir deine Lust, Herr, gib mir deinen Saft.«
Jules ergoss sich in der jungen Frau, spritze einmal, ein zweites und ein drittes Mal in sie, beziehungsweise in das übergestülpte Kondom hinein, hatte längst die Kerze fallen lassen, presste nun seinen Mund auf ihr freches Maul, hatte seine Zunge so tief wie ihm nur möglich in ihren Rachen versenkt, so dass sie nun zu würgen begann, zog ihren etwas schwammigen Körper mit beiden Händen an sich, wippte immer noch auf seinen Zehenspitzen hoch und nieder, bewegte seinen Penis in ihr drin, genoss diese weiteren Sekunden der vollkommenen Macht über dieses Fleisch gewordene, kaum achtzehn Jahre alte und doch schon so herrlich verdorbene Geschöpf.
Nur langsam beruhigte sich sein Atem. Er löste seine Hände von ihren Leib, ließ seine Zunge noch einmal um ihre kreisen, zog endlich sein Glied aus ihrem Körper und verharrte zitternd, immer noch vollgepumpt mit Adrenalin.
Madeleine schlüpfte erst mit den Handgelenken und dann auch mit den Füßen aus den viel zu weiten Fesseln am Andreaskreuz, trat dann lächelnd an Jules heran.
»Du wirst immer besser, mein Starker«, und dabei fuhr sie mit ihren Händen über seine gewölbte und angeschwollene Brustmuskulatur, »auch diesmal hast du mich bis zum Höhepunkt und darüber hinaus getrieben. Du bist einfach der Beste, Jules.«
Ihre Worte waren nicht ehrlich gemeint. Das wusste auch Jules und er gab ihr darum eine knallende Ohrfeige, die ihren Kopf auf die Seite warf und ihr die langen, blonden Haare ins Gesicht wischte.
Zwischen den Strähnen zeigte sie jedoch ein diabolisches Grinsen, eine diesmal nicht gespielte Freude über seine neuerliche Entgleisung. Beherrschte die Sklavin ihren Herrn oder war es eher umgekehrt? Jedenfalls begann sie ihn von Neuem zu locken.
»Das wagst du nicht noch mal, du Hundesohn«, spie sie ihm gespielt entgegen, worauf er ihr gleich noch eine langte und gleich danach eine rechte Gerade folgen ließ, die sie direkt auf ihre kleine Nase traf. Sie torkelte benommen zwei Schritte und blieb überrascht stehen. Blut tropfte ihr über die Lippen und dann vom Kinn auf ihre Brüste und den Bauch hinunter, lief dort weiter bis zu ihrer Scham.
»Na, komm schon, ist das etwa schon alles, was du kannst?«, forderte sie ihn aufsässig zu noch mehr Brutalität auf, »oder brauchst du noch eine weitere Viagra, um es mir noch einmal richtig zu besorgen, du alter Schlappschwanz.«
Jules rastete aus, warf sich auf die junge Frau, packte ihre Schultern, hakte seine Ferse hinter ihr rechtes Bein und stieß sie nach hinten. Sie fiel auf die bereitliegende Matratze, warf dabei ihre Beine hoch und versuchte Jules mit ihren Beinen zu stoppen, versuchte, ihm ihre Füße in den Leib zu stoßen. Der wischte sie jedoch zur Seite und warf sich auf sie, packte dann ihre Fußgelenke und zwang ihre Schenkel auseinander, ließ sich zwischen sie fallen und drückte die junge Frau mit seinem Körper zu Boden. Die wehrte sich nun mit all ihrer Kraft, versuchte, ihn von sich zu werfen oder sich unter ihm weg zu drehen. Lachend packte er sie noch grober an, umfasste mit der rechten Hand auch ihre Gurgel, drückte sogleich unbarmherzig zu. Sie stieß ein Röcheln aus, schnappte nach Luft.
Jules packte seinen Penis mit der anderen Hand, rieb an ihm und ließ ihn erstarken. Immer noch eine Hand an ihrer Kehle, stieß er seine Latte erneut grob zwischen ihre Beine, fand den Zugang zu ihrem Inneren, begann im Rhythmus seines Herzschlages sein Becken vor und zurück zu ziehen.
Die blonde Madeleine begann sich trotz ihrer Atemnot zu entspannen, hielt ihre Augenlider geschlossen, schien ihre Pein zu genießen. Der mangelnde Sauerstoff machte sich in ihrem Gehirn noch mehr bemerkbar, ließ ihre Gedanken weich und dumpf werden. Der Blutfluss aus ihrer Nase war bereits versiegt, doch sie schwoll immer noch an, würde sich bestimmt für ein paar Tage verfärben.
Jules starrte auf das Gesicht der jungen Frau, auf ihre feisten Wangen, dem runden, violett sündig geschminkten Mund, der flachen Stirn mit dem dünn gezogenen permanent Make-Up, das an Stelle der entfernten Augenbrauen über ihren Augen lag. Erneut presste er seine Lippen auf die ihren, spürte gleichzeitig ihre flach gedrückten Brustwarzen auf seiner Haut, schmeckte ihr Blut auf der Zunge.
Der süßliche Geschmack erregte ihn immer stärker und er begann, ihr Gesicht abzulecken, so als wollte er alle Blutspuren wegwischen.
Madeleine bewegte ihr Becken in seinem Rhythmus, nahm ihm einen Teil der Anstrengung ab. Nach kurzer Zeit stöhnte Jules leise auf, ergoss sich ein weiteres Mal in die Frau hinein, diesmal ohne Kondom, spürte, wie sich seine Hoden fast schmerzhaft zusammenzogen, ob der erneuten Anstrengung.
Die blonde Frau lag plötzlich ruhig unter ihm, bewegte sich nicht mehr. Sie wusste, dass die gebuchte halbe Stunde bereits überschritten war, dass Jules ihr die volle Stunde bezahlen musste, zudem einen ordentlichen Zuschlag für ihre malträtierte Nase. Und während Jules sich langsam von ihr löste und sich erhob, dabei ernüchtert wirkte, wie aus einem Traum erwacht, überlegte sich die Achtzehnjährige bereits, wie sie die angeschwollene, schmerzende Nase bei ihren nächsten Kunden am wirkungsvollsten einsetzen und zu Geld machen konnte.
Jules verließ die Folterkammer, ging hinüber zur Umkleidekabine mit den beiden Duschen. Lange stand er unter dem warmen Wasserstrahl, seifte sich gründlich ein, spülte den Schmutz der jungen Madeleine ab, immer und immer wieder, fühlte sich erst nach einer Viertelstunde so richtig rein, nachdem er auch seine Füße und die Zehen ein drittes Mal eingeseift und gründlich abgespült hatte.
Als er sich anzog, kam Madeleine hinein, hatte sich einen kurzen Morgenrock schlampig übergezogen, so dass der vorne offenstehende Stoff mehr als einen flüchtigen Blick auf ihre eher kleinen, flachen und trotz ihrer Jugend schlaff hängenden Brüste zuließ. Ihre dicken, doch aufgrund ihres Alters noch sehr strammen Schenkel, ihr deutlicher Bauchansatz mit den breiten, ausladenden und fleischig-runden Hüften, die blank rasierten Scham, deren Haare permanent entfernt waren, dem kleinen Tattoo einer Libelle genau zwischen ihrem Bauchnabel und dem Kitzler.
Jules verspürte erneut ein Kribbeln beim Anblick des Mädchens, war sich bewusst, wie falsch seine Gefühle waren, wie sehr er das Vertrauen von Alabima missbrauchte, wie stark er seiner Seele mit jedem weiteren Besuch dieses Studios schadete. Und doch war ihm ebenso klar, dass er zurückkäme, in ein paar Tagen oder einer Woche, hierher, an den Ort, wo man ihn immer noch voll und ganz respektierte, wo man vielleicht sogar ein wenig Angst vor ihm spürte, wo man ihn aber vor allem als eines ansah, nämlich als ganzen Mann.
Fast zärtlich strich er der blonden Frau über die Wange. Sie lächelte ihn an, wirkte diesmal unschuldig wie ein Lamm.
»Bitte entschuldige den Faustschlag, Madeleine«, meinte er sanft, drückte ihr einen flüchtigen Kuss auf die Lippen, »ich mach’s wieder gut.«
Wenig später bezahlte er bei der Chefin des Etablissements die vereinbarten achthundert Franken für die Stunde und ließ seine Kreditkarte mit zusätzlichen zweitausend belasten als Schmerzensgeld für die tüchtige Madeleine. Sie würde sich bestimmt freuen, ihn bald wiederzusehen.
*
Hiam Foda war tagsüber ein gewöhnlicher Physikstudent, derzeit im dritten Semester. Am Abend und in der Nacht gehörte er dagegen zu den glühenden Sympathisanten für die gerechte, palästinensische Sache. Eine Gruppe junger Muslime hatte ihn vor ein paar Monaten angeworben. Sie nannten sich die Goldene Speerspitze Palästinas. Ihre Mitglieder gingen in Tel Aviv irgendwelchen Berufen nach, waren Taxifahrer oder Maurer, pflegten alte Israelis in Heimen oder füllten Regale mit koscheren Lebensmitteln auf. Von Hiam verlangten sie nichts Geringeres, als dass er an der Universität von Jerusalem eine eigene Zelle in ihrem Sinne aufbaute, eine Verbindung von Muslimen, die zu allem entschlossen sein sollten, die auch die Ziele der Goldenen Speerspitze mit aller Konsequenz vorantrieb.
Allerdings stritt sich die Gruppe in Tel Aviv weiterhin über den Zweck und die Inhalte ihres geplanten Terrors. Wollte man Israel vernichtet sehen? Oder sollte man bloß möglichst viele Juden töten? Ging es doch eher um die Festigung des palästinensischen Staates mit einer Hauptstadt Jerusalem? Die sechs Mitglieder stritten darüber fast jede Nacht. Entsprechend wenig kam dabei heraus. Nur in einem Punkt war man sich von Anfang an einig gewesen. Man hasste den Staat Israel mit all seinen jüdischen Hunden.
Hiam Foda ging auf dem Universitäts-Campus Givat Ram sehr vorsichtig ans Werk, sprach nur wenige der palästinensischen Studenten an, versuchte sie auszuhorchen. Als er einem um ein Jahr jüngeren Palästinenser das erste Mal jedoch deutlicher wurde, verpfiff ihn dieser sogleich an Professor Singer.
Natan Singer wunderte sich zuerst, als er von Hiams Versuch hörte, an der Universität Sympathisanten für ein freies Palästina zu sammeln und eine Bewegung zu gründen, die von Anfang an auf Verschwiegenheit und Geheimnissen beruhen sollte. Er lud Hiam Foda jedoch zu einer Besprechung unter vier Augen ein. Das Drehbuch für das geplante Verhör hatte ihm allerdings Moshe Zuckerberg geschrieben und auch die beiden weiteren orthodoxen Mitglieder ihrer konservativen Vereinigung fanden sich an diesem Dienstagnachmittag im Nebenzimmer seines Büros ein. Sie wollten gemeinsam die Aussagen des Studenten mit eigenen Ohren hören. Denn sie konnten ihr Glück noch kaum fassen, möglicherweise Zugang zu einer sich im Aufbau befindlichen, palästinensischen Terrorbewegung zu erhalten und sie womöglich für ihre Zwecke zu nutzen.
»Hiam, ich darf Sie doch Hiam nennen?«
Der Student, der sich mit gesenktem Kopf auf den Stuhl vor seinem Pult hingesetzt hatte, nickte ergeben. Der erste Schritt zur Vertraulichkeit war eingeleitet.
»Dann nennen Sie mich bitte Natan.«
Das erste Mal seit seinem Eintreten nahm der junge Palästinenser Augenkontakt mit seinem Professor auf, blickte ihn sehr erstaunt an, sagte jedoch nichts. In einem forschen Ton fuhr Singer fort.
»Wissen Sie, warum ich Sie zu mir gebeten haben, Hiam?«
Verunsicherung, die zweite Stufe der Verhörpraxis, war bereits erreicht.
»Nein«, flüsterte der Student und fügte nach einer Pause unsicher hinzu, »Natan.«
Dabei irrten seine Augen auf der Pultplatte vor ihm herum, vermieden peinlichst, dem Professor ins Gesicht zu blicken.
»Sie werden eines schweren Vergehens beschuldigt, Hiam, eines sehr schweren.«
Die Stimme von Singer hatte einen drohenden Ton angenommen. Sie ließ den Palästinenser noch stärker auf seinem Stuhl zusammensinken. Hiam Foda verfluchte bereits den Tag, an dem er sich hatte anwerben lassen, verfluchte seine Absicht, eine eigene Terrorzelle hier in Jerusalem aufzubauen, verfluchte diese dumme, palästinensische Sache, die angesichts der Stärke von Israel niemals Erfolg haben konnte. Natan Singer las den Gedankengang seines Studenten fast wortwörtlich in dessen Gesicht nach.
Es wurde Zeit für die nächste Stufe des Verhörs, für die Ablenkung.
Fast wohlwollend fügte Singer an: »Sie sollen versucht haben, hier an der Universität für die palästinensische Sache zu werben, wohl auch Geld zu sammeln?«
Nun blickte Hiam doch erstaunt auf und direkt in die Augen des Professors. Seine Lippen bewegten sich, versuchten Worte zu formen, die jedoch tonlos blieben, weil sein Gehirn noch raste und keinen klaren Gedanken zuließ. Doch dann senkte sich sein Blick wieder ergeben auf die Pultplatte.
»Wissen Sie, Hiam, die palästinensische Sache genießt auch unter uns Israelis viel Sympathie«, begann Singer zu schmeicheln, »und viele von uns sind mit den Maßnahmen unserer Regierung keineswegs einverstanden.«
Der nächste Zug, die Umpolung, war eingeleitet und Hiam Foda schaute nun wieder offen, wenn auch verblüfft, in die Augen seines Professors.
»Wie meinen Sie das, Professor?«, fragte er verunsichert.
»Natan«, korrigierte ihn Singer wohlwollend, »wie ich das meine? Ganz einfach, mein Sohn. Ich kenne einige Menschen, die sehr gerne die Anliegen des palästinensischen Volkes unterstützen möchten. Ihnen und auch mir sind jedoch die Hände weitgehend gebunden. Wir stehen zu sehr in der Öffentlichkeit, können darum nicht selbst aktiv unterstützen und zum Beispiel eigene Hilfslieferungen in die palästinensischen Gebiete durchführen.«
Und nach einer kurzen Kunstpause fuhr er fort.
»Israel hat sich in den letzten Jahren zum Schlechten gewandelt. Die Regierung hat es leider verstanden, die Stimmung im Volk so sehr anzuheizen, dass mittlerweile jedes Wort gegen ihre oft unmenschlichen Entscheide von der breiten Masse der Israeli als ein Verrat an unserem Land verstanden wird.«
Und nach einer weiteren Sekunde, in der man Hiam Foda ansah, wie er merklich wuchs und sicherer wurde, fügte der Professor an: »Selbst die Presse ist nicht mehr unabhängig, wird von maßgeblichen Parlamentariern fast vollständig kontrolliert. Israel ist in einer Regierungsdiktatur gefangen, gegen die keine größere Freiheitsbewegung mehr öffentlich aufzutreten wagt.«
Der palästinensische Student hatte seine Schultern nun gestrafft, sah seinen Professor aufmerksam an, erkannte, dass dieser von ihm einige klärende Worte erwartete.
Hiam war zuvor durch ein Wechselbad der Gefühle gegangen. Zu Beginn ihres Gesprächs musste er eine Verhaftung durch die Polizei oder gar durch den Mossad befürchten. Nun aber sah es für ihn aus, als könnte er in der Person des Professors einen naiven Helfer für die gerechte, palästinensische Sache gewinnen. Diesen grundlegenden Wandel seiner Situation hatte der aufgeweckte junge Palästinenser in der Zwischenzeit verdaut.
»Es stimmt, Natan, ich habe tatsächlich versucht, unter den muslimischen Studenten ein paar Mitglieder für ein neues, palästinensisches Hilfswerk anzuwerben. Wissen Sie, ich verurteile die Haltung Israels nicht völlig. Ich sehe auch ein, dass die Hamas weit über das eigentliche Ziel der Palästinenser hinausschießen, nämlich einem friedlichen Nebeneinander unserer Staaten. Die Weigerung der Hamas, den Staat Israel als eine Tatsache zu anerkennen, ist im Grunde genommen doch lächerlich. Aber aufgrund der Repressionen gegen die palästinensische Bevölkerung und auch durch den anhaltenden Siedlungsbau wird es wohl auch auf absehbare Zeit keinen Frieden zwischen unseren Völkern geben können, ja, wir müssen sogar befürchten, dass gar niemandem etwas an einer wirklichen Verständigung zwischen Israel und Palästina liegt.«
Singer nickte immer wieder bestätigend zu den Worten seines Studenten.
»Ja, die große Politik will kein Nebeneinander. Nicht nur stehen uns die beiden Regierungen im Wege. Auch das nahe und ferne Ausland schnürt unseren nachbarlichen Konflikt, versucht, über unsere Regierungen ihre höchst eigenen Ziele auf unsere Kosten durchzusetzen.«
Professor und Student schienen sich völlig einig. Beide gaben sich als Menschenfreunde aus. Beide spielten ihr falsches Spiel.
Hiam Foda wurde noch mutiger.
»Aber wie wollen Sie denn unsere Sache unterstützen? Wissen Sie, ich habe einige Freunde in Tel Aviv. Die könnten Hilfslieferungen nach Palästina organisieren. Sie verfügen über die notwendigen Kontakte und Transportmittel. Nur das Geld fehlt uns.«
Beide Männer sahen sich offen an, der Professor blickte wohlwollend, der Student gierig.
»Kommen Sie doch morgen Mittag nach der Vorlesung wieder hier in meinem Büro vorbei. Bis dahin sollte ich ein wenig Geld aufgetrieben haben.«
Am nächsten Tag erhielt Hiam von seinem Professor 5’000 Schekel in Hunderter ausgehändigt. Dies entsprach rund tausend Euro. Die Zeit der Anfütterung hatte begonnen.