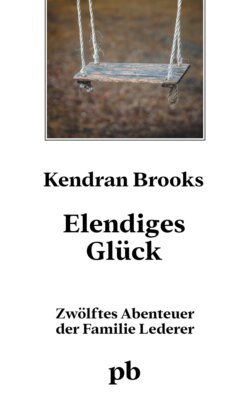Читать книгу Elendiges Glück - Kendran Brooks - Страница 4
Kapitel 1 – Der Weg
ОглавлениеIch sah in ein altes, faltiges Gesicht mit ledriger Haut und vielen Pigmenten. Altersflecke nannte man sie und manche Menschen brachten sie mit Weisheit in Verbindung.
»Hat mit Weisheit genauso viel zu tun, wie die hintersten Backenzähne. Beweisen nur, dass man immer älter wird«, sagte ich leise zu mir selbst.
»Wie bitte?«, fragte Tom irritiert zurück.
»Nichts für dich«, zischte ich den Roboter an und verstrich das leichte Make-Up über den Wangen mit den Kuppen von Zeige- und Mittelfinger, tilgte so einige der Pigmentflecken. Ich hielt inne, blickte in den Spiegel, sah mich dort als kleines Mädchen und mit meinem Vater draußen im Garten spielen. Es hatte kurz zuvor noch geregnet und der Boden war stark aufgeweicht, die Rasenhalme klitschnass. Trotzdem übten wir Fußballspielen. Mein Vater stand im behelfsmäßigen Tor, während ich Elfmeter trat. Wir beide waren längst von oben bis unten mit Dreck bespritzt, kamen aus dem Lachen kaum noch heraus. Mich schüttelte es derart heftig, dass ich den Ball mit dem Fuß verfehlte und vom Schwung meines Beins getragen ausglitt und mit dem Po mitten in einer Wasserpfütze landete. Wir kringelten uns vor Lachen und irgendwann merkte ich, dass mir beinahe zum Weinen zu Mute war. Ich wusste damals nicht warum. Es schien eine plötzliche Regung zu sein, wie ein Schatten, der unerwartet auf einen fiel. Und ich sah meinen Vater an, lachte weiter, doch Tränen standen in meinem Gesicht. Er feixte, grinste und zog mich über mein Ungeschick auf. Ich lachte mit, doch nun gezwungen und nicht mehr fröhlich, kickte den Ball erneut und nur mit wenig Schwung in Richtung Tor. Als er ihn mir wenig später wieder zuwarf, stoppte ich ihn mit dem Fuß, holte aus dem Stand weit aus, konzentrierte mich auf den richtigen Schwung und das exakte Auftreffen des Schuhs auf das Leder, trat den Ball diesmal perfekt und er segelte auf Brusthöhe an meinem Vater vorbei, der von meinem harten Schuss völlig überrascht wurde.
Der Ball hoppelte und rollte in Richtung Seeufer und mein Vater sprintete hinterher, holte ihn noch ein, kurz bevor beide im Wasser gelandet wären. Das gab mir Zeit, mich zu fassen, den plötzlichen Schmerz zu überwinden, den ich wie einen Stich verspürt hatte, als ich meinen Vater so ausgelassen und fröhlich sah.
Ich war in einer wohlhabenden Familie in einem reichen Land aufgewachsen. Geldprobleme kannten wir keine. Dafür jede Menge andere Sorgen. Das war mir damals, als Siebenjährige, noch nicht bewusst. Aber ich hatte meinen Vater schon einige Male sehr traurig erlebt, aber auch wütend und ungerecht, vor allem gegenüber meiner Maman, die ihm fast immer nachgab. Etwa stimmte nicht mit meinem Vater, das spürte ich damals wohl mehr, als ich es wusste. Und ich war beunruhigt, spürte auch eine ständige Unruhe in Maman, ihre Vorsicht im Umgang mit meinem Vater.
An die Jahre zuvor konnte ich mich allerdings kaum noch erinnern. Bilderfetzen spuckten ohne Ordnung in meinem Gehirn herum, vermischten sich mit anderem Erlebten oder bloß Eingebildetem und Geträumtem. Ein Chinese, den ich wütend anschrie und der mir gleich danach große Angst einjagte. Ein anderer Chinese, der nett zu mir und meiner Maman war. Das war in einem fernen Land gewesen und Maman machte sich große Sorgen, wollte sie mir gegenüber aber nicht zeigen. Zumindest das wusste ich noch oder vermutete es wenigstens. Ob ich das alles bloß geträumt hatte oder wirklich erlebt? Meine Eltern sprachen nie über diese Zeit, beantworteten auch meine diesbezüglichen Fragen nicht, redeten von Einbildung und Hirngespinsten. Aber irgendetwas stimmte mit meinen Erinnerungsfetzen, da war ich mir sicher. Sonst wären sie bestimmt näher darauf eingegangen und hätten nicht nur abgewiegelt.
»Üben sich Erinnerungen, die man nicht einordnen kann, auf unser Leben aus?«
Ich hatte die Frage laut ausgesprochen, merkte das erst, als mir Tom antwortete.
»Nach Ansicht führender Psychologen können alle unverarbeiteten Erinnerungen große Auswirkungen auf die betroffene Person entfalten. Das gilt in besonderem Masse für Kindheitserlebnisse«, dozierte die künstliche Intelligenz.
»Nun bist du auch noch Psychiater, Tom?«, fragte ich belustigt zurück, worauf der Roboter zweifelnd nickte: »Meine Programmierung beinhaltet auch einige psychologische Module. Doch ich empfehle Ihnen eine Fachperson hinzu zu ziehen. Soll ich Dr. Lewin informieren?«
Ich winkte ab, kehrte zurück zu meinen Gedankenbildern, zu den beiden Chinesen, zu meiner Maman, die in meiner Erinnerung eingeschüchtert und verängstigt wirkte. Und in diesem Moment sah ich andere Bilder vor mir, die sogleich kalte Schauder über meinen Rücken jagen ließen. Ich sah meine Maman vor mir, nackt und gefesselt stehend, und eine andere, wunderschöne Frau, die sie quälte. Und dann war plötzlich mein Vater bei mir, zog mich zu sich herauf, brachte mich aus dem Gebäude, übergab mich meinem Bruder Chufu und dann war alles irgendwie wieder gut. Wochen später belauschte ich aber meinen Vater im Schlaf als er träumte und vor sich hinmurmelte. Er hatte diese wunderschöne, aber böse Frau umgebracht, hatte ihr das Genick gebrochen und meine Maman von ihr befreit. Und wir waren alle wieder zusammen und es war heiß und wir lebten in einem Bungalow direkt am Meer und wir spielten viel miteinander. Es war eine schöne Zeit.
An meinen ersten Schultag konnte ich mich dagegen noch gut erinnern. Ich war so stolz über meinen Schulranzen, ein riesiges, knall-gelbes Ding mit vielen bunten Aufklebern. Alle meine Freunde waren dabei: Micky und Minnie Maus, Goofy, Pocahontas und selbstverständlich der König der Löwen Simba und seine Freundin Nala. Meine Maman fuhr mich an diesem Morgen zur Schule. Wo mein Vater war, weiß ich nicht mehr, irgendwo in der Welt unterwegs, wie so oft. Und ich ärgerte mich, weil Maman mich nicht direkt vor der Schule aus dem Wagen aussteigen ließ, sondern erst weit entfernt ein freies Parkfeld fand. So musste ich mit meinen neuen Schuhen den ganzen Weg zurücklaufen und das wunderschöne dunkelblaue, glänzende Leder war staubig, als wir endlich ankamen. So wütend war ich auf Maman, selbst, nachdem sie sich niedergekniet und den Dreck mit ihrem Taschentuch weggewischt hatte. Alle Erstklässler versammelten sich mit ihren Eltern in einem großen Saal und ein alter Mann redete und redete. Ich hörte ihm nicht zu, sah neugierig andere Kinder an, fragte mich, ob sie wohl freundlich oder gemein sein würden. Einige gefielen mir gut und wenn sie in dieselbe Klasse wie ich kämen, so wollte ich ihre Freundin sein. Im Schulzimmer suchte ich mir einen freien Platz neben einem rotblonden Jungen mit einem Gesicht voller Sommersprossen. Der starrte mich zuerst mit großen Augen an, schüttelte mir dann aber doch freundlich lächelnd die Hand. René hieß er und wurde später ein guter Klassenkamerad. Doch an diesem ersten Morgen trat sein Vater zu uns, kaum hatte ich mich gesetzt und wies René an, sich zu jemand anderen zu setzen. Ich wusste damals noch nichts über Rassismus, fühlte mich nur traurig, weil sich René tatsächlich erhob und sich woanders hinsetzte und ich danach ganz allein am Zweierpult blieb. Doch die Lehrerin, Mademoiselle Girard, war sehr nett und ich mochte sie vom ersten Augenblick an.
Weitere Lehrer sah ich nun im Spiegel vor mir auftauchen. Da war Monsieur Leroi, der uns ein paar Jahre später Englisch und Spanisch beibrachte. Ich war damals vierzehn Jahre alt und unsterblich in ihn verliebt. Er war aber auch schrecklich süß, mit seinem dunkelblonden Ziegenbärtchen und dem schmalen Gesicht, in das stets eine Haarsträhne hing, die er in jeder Stunde wohl hundertmal mit der Hand wegwischte. Wir lauerten ihm jeden zweiten Tag auf, Yvonne und Claire und ich, sahen zu, wie er das Schulgebäude verließ und zu seinem süßen kleine Wagen ging, ein uralter Deux Chevaux, ihn umständlich aufschloss, die Ledermappe auf den Beifahrersitz warf und sich schwungvoll hineinsetzte, wenig später wegfuhr, ohne uns zu beachten. Und wir stellten uns vor, wie er uns streicheln und küssen würde, wie wir ihm im Gegenzug das Paradies bescherten, uns ihm ganz schenkten und ihm so unsere unsterbliche Liebe bewiesen. Sexuelle Erfahrungen hatten wir damals noch keine. Jedenfalls nicht mit Jungs. Untereinander aber, wenn wir unbeobachtet waren, da küssten und streichelten wir uns schon. Es war einfach wunderschön, nackt beisammen zu liegen, die Körper der anderen beiden zu spüren, ihre Wärme und die weiche Haut, sich zu streicheln und zu liebkosen. Aus dem Internet wussten wir selbstverständlich schon seit ein paar Jahren, was beim Sex so ablief und was zu tun war. Und wir probierten auch einige Dinge aus, aber nie etwas, das uns hätte weh tun können. Denn wir waren Freundinnen und blieben es auch ein Leben lang.
Yvonne war unser Blondschopf und wir riefen sie nur Blondie. Als kleines Mädchen flocht sie ihr langes Haar immer zu Zöpfen und braun gebrannt wie sie stets war, sah sie für uns aus wie eine Bäuerin oder zumindest so, wie sich Claire und ich ein echtes Landei vorstellten. Wir zogen Yvonne manchmal damit auf, neckten sie mit einem »Muuh« statt einer Begrüßung, wenn wir uns frühmorgens das erste Mal in der Schule begegneten. Sie nahm es uns nie übel, spielte sogar mit, sagte manches Mal »ich treib euch eure Späße mit der Mistgabel aus« und wir drei lachten. Claire war dunkelhaarig wie ich, aber kein Mischling, sondern mit ganz heller Haut. Ihr Vater war ein Albino, erzählte sie uns, weshalb wohl auch sie sehr empfindlich auf Sonnenlicht reagierte. Wir nannten Claire meistens nur Vamp. Nicht dass sie sich besonders aufreizend angezogen hätte, im Gegenteil. Sie trug meist viel zu viele Klamotten, schützte sich vor Sonnenbrand, suchte draußen stets den Schatten. Wie ein Vampir eben. Mich nannten die beiden nur Sternchen, denn in Russland bedeutete mein Vorname Alina nun einmal Stern und das hatte ich den beiden irgendwann erzählt.
Wenn wir nackt nebeneinander lagen, so nahmen Blondie und ich die weiße Claire stets in unsere Mitte. Sie sah mit ihrer bleichen Haut so verletzlich und zart aus, dass wir beiden anderen sie ständig berühren, streicheln und küssen mussten. Irgendwann brachte dann Yvonne einen Dildo mit, einen mit Motor und Batterie und wir lernten an diesem Nachmittag den Umgang mit ihm. Das Vibrieren war so ganz anders als mit der Hand oder der Zunge, irgendwie fremdartig, falsch und doch gleichzeitig wunderbar erregend, als würde man von verbotenen Früchten naschen. Wir kannten keine Scham untereinander, beobachteten uns gegenseitig bei der Selbstbefriedigung, gaben einander Ratschläge und Anleitung.
Claire verloren wir als erste. Wir waren damals siebzehn und achtzehn Jahre alt, besuchten unterschiedliche Schulen, waren aber immer noch Freundinnen, trafen uns fast jede Woche einmal, schliefen immer noch miteinander, wenn sich die Gelegenheit bot. Wir drei waren wie eine Ehe, stellten uns dieses Leben jedenfalls so vor, wenn man miteinander ins Bett ging, nicht um etwas Neues auszuprobieren oder weil man Lust auf eine fremde Haut spürte, sondern einfach so, weil man es kannte, weil es einem gut tat, weil man immer noch Gefallen daran fand. Aber dann lernte unsere Claire ihren Pascal kennen. Der war viel älter als sie, mindestens schon dreißig. Er hatte seinen Kopf kahl rasiert, hätte sonst wahrscheinlich eine Glatze zeigen müssen. Und tätowiert war der Kerl, an den Armen und im Nacken, auch auf der Brust und sogar am Penis, wie uns Claire verriet.
»Und was für ein Bild trägt er denn auf seinem Stängel?«, hatte Yvonne lachend gefragt.
»Kein Bild, sondern ein Wort, nämlich Liberté.«
Wir dachten zu dritt nach, was dieser Pascal mit Freiheit auf seinem Penis wohl meinte, erfuhren es ein halbes Jahr später, als Claire an Aids erkrankt war. Unser Vamp hatte nicht nur all die Jahre unserer Freundschaft stets kränklich und verletzlich auf uns gewirkt, ihr Körper hielt dem Virus auch nicht lange stand. Die meisten Medikamente vertrug Claire nicht und was übrigblieb, half ihr nicht. Keine zwei Jahre später begruben wir unseren Vamp auf dem Bois-de-Vaux. Sie wurde noch nicht einmal einundzwanzig. Und dieser Pascal hatte sie längst schon verlassen, war sich keinerlei Schuld bewusst. Als wir ihn zur Rede stellten, da sagte er bloß verächtlich zu uns »Liberté« und grinste dazu dümmlich, das verdammte Arschloch.
Blondie verlor ich nur wenige Jahre später, mit 27, als ich meine Identität das erste Mal wechseln musste und darum die alte Alina Lederer für den Rest ihres Lebens starb. Yvonne war damals schon ein paar Jahre verheiratet gewesen, hatte einen kleinen Sohn geboren, war ein knappes Jahr später erneut schwanger. Ihr Ehemann trieb sich als Monteur auf Baustellen in der halben Welt herum. Er verdiente wohl gerade genug für seine Familie, denn Blondie konnte keine großen Sprünge machen. Doch sie liebte ihn und führte wahrscheinlich ein Leben, wie sie es sich immer wünschte. Wie glücklich doch stets ihre Augen blickten, wenn wir uns immer seltener trafen. Dass sich dieses Glück eher auf mich und unsere Freundschaft bezog, vielleicht auch auf ihre Rolle als Mutter, war mir damals nicht bewusst. Mir erzählte sie nie etwas von den Streitigkeiten mit ihrem Ehemann, vom Alkoholmissbrauch, von den Schlägen. Nach dem Tod von Claire schliefen Yvonne und ich auch nicht mehr miteinander. Unsere Freundin fehlte uns zu sehr und wir hätten nur an sie denken können, an ihre zarte, weiße Haut, an ihre rosa Muschi, an ihre so stürmischen Küsse, die auf uns stets wirkten, als müsste sie ihr ganzes Leben in wenige Jahre unterbringen. Womöglich schwand auch deshalb das Vertrauen zwischen Yvonne und mir, verwandelte sich unsere ewige Freundschaft immer mehr in eine gewöhnliche Bekanntschaft, deren Verlust uns kaum noch schmerzte. Wie gern hätte ich Yvonne und ihren beiden Kindern geholfen. Doch ich erfuhr viel zu spät davon.
*
Irgendwann war unsere gemeinsame Schulzeit vorbei und unsere Wege trennten sich. Blondie begann eine Lehre als Hochbauzeichnerin, schloss sie auch erfolgreich ab. Vamp und ich besuchten höhere Schulen, bereiteten uns auf ein Studium vor. Bei Claire kam es nicht mehr dazu. Ihre Erkrankung hinderte sie an jeder weiteren schulischen Entwicklung. Vielleicht auch ein Grund, warum ihr Körper so rasch aufgab, den Kampf gegen den Virus gar nie richtig aufnahm, sondern sich seinem Schicksal feige ergab. Ich dagegen studierte in Berlin Politwissenschaften, am Otto-Suhr-Institut der Freien Universität. Ich galt immer schon als hochbegabt, hatte in der Schule nie Probleme gekannt und eine Klasse übersprungen, wurde von meinen Eltern auch sehr gefördert, mit Zusatzkursen und Privatlehrern. Mit achtzehn zog ich in die Hauptstadt Deutschlands, lebte in einem 2-Zimmer-Appartement an der Spree, das jeden Monat ein Vermögen kostete, jedenfalls für normale Menschen, nicht für meine Eltern. Ich belegte die Studiengänge Internationale Beziehungen, die Politik-Wissenschaft mit dem deutsch-französischen Doppelmaster, Public Policy Management und Umweltmanagement. Mit 21 schloss ich ab mit dem Master of Sciences Po und der Spezialisierung Affaires internationales.
Mein Praktikum während des Studiums in Bruxelles öffnete mir allerdings die Augen über die dunklen Seiten der Politik. Ich arbeitete für einen EU-Abgeordneten, einen Grünen aus Irland, der in einigen wichtigen Kommissionen saß. Sein Büro glich die meiste Zeit über einem Bienenstock, so sehr schwirrten die Menschen dort ein und aus. Erst war ich nur Schreibkraft, organisierte aber aus eigenem Antrieb das chaotische Archiv neu, wurde dafür hoch gelobt und zur zweiten Assistentin befördert, durfte auch Termine für den Abgeordneten vereinbaren. Einige Bittsteller traten allerdings verdächtig arrogant auf, ließen kaum mit sich reden. Und mein Abgeordneter schien sich diesen Kerlen unterzuordnen, lehnte nie ein Gespräch oder einen Termin ab. Ich ging damals in meiner Freizeit der Sache auf den Grund, fand heraus, welche Interessen diese Leute in Bruxelles vertraten, welchen Verbänden und Unternehmen sie nahestanden. Agro-Chemie und Gen-Forschung standen ganz zuvorderst. Gegen Ende meines Praktikums blickte ich dann in die Abgründe der Politik. Zuerst traf die Zusammenfassung einer wissenschaftlichen Studie über ein neuartiges Pestizid ein. Sie sprach von besorgniserregenden Resultaten. Mein Abgeordneter ließ uns eine Kopie des Detailberichts besorgen, die ich für ihn las und ihm die wichtigsten Stellen hervorhob. Die Studie bewies, dass gewisse Pestizide derart verheerende Auswirkungen auf die Insektenwelt ausübten, dass man auf den behandelten Feldern kaum mehr von Natur sprechen durfte. Mein Abgeordneter wurde zwei Tage später wieder einmal von diesen Agrochemie-Mistkerlen zum Mittagessen eingeladen. Am nächsten Tag fand zu dieser Studie nämlich eine Anhörung im Ausschuss für Landwirtschaftsfragen statt. Und mein Abgeordneter setzte sich doch tatsächlich dafür ein, auch diese Studie als zu wenig wissenschaftlich zu bewerten und sie deshalb unbeachtet zu lassen. Ein Grüner verscherbelte die Natur für irgendwelche persönlichen Vorteile. So sah das damals für mich aus. So war es wohl auch.
Ich war nicht nur enttäuscht, sondern wütend, richtiggehend zornig und, ja, irgendwie rachsüchtig. Gegenüber diesen Dreckskerlen von der Chemie genauso, wie gegenüber meinem Abgeordneten. Vielleicht war aber auch der frühe Tod von Claire der eigentliche Auslöser gewesen, denn Yvonne und ich begruben sie nur wenige Wochen zuvor und unsere Gedanken weilten immer noch sehr oft bei ihr. Ich beendete wenige Monate später mein Studium in Berlin, hatte mich längst entschlossen, in meinem Leben etwas in der Welt zu bewegen. Nein, bewegen war ein zu schwaches, viel zu braves Wort. Ich wollte die Welt verbessern.
*
Was tat ein junger Mensch, der die Erde verändern wollte? Im Jahre 2028 war mein erster Gedanke Greenpeace. Und ich setzte ihn sogleich in die Tat um, trat als Mitglied in die Berliner Sektion ein, wühlte mich vom ersten Tag an in die Arbeit, übernahm den Posten einer Schreibkraft, recherchierte viel im Internet, konnte dank meinen Sprachkenntnissen auch Informationsquellen anzapfen, die anderen Greenpeace Mitarbeitern bislang verschlossen geblieben waren. Hier lernte ich auch Karl kennen. Er hieß Schmitt mit Doppel-T, wie er sich fast überall vorstellte. Er war einen halben Kopf größer als ich und blond, trug einen kurz geschorenen Vollbart und stammte aus einer Industriellenfamilie. Etwas schlaksig war Karl, mit seinem kaum vorhandenen Arsch und den dünnen Oberarmen. Nicht, dass ich damals etwa fett gewesen wäre, Gott bewahre. Nein, ich hatte den zarten Körperbau meiner Mutter geerbt. Doch im Gegensatz zu Karl Schmitt trainierte ich auch damals fast täglich im Gym, machte viel Krafttraining und boxte zum Spaß sogar ein wenig, aber nur gegen Männer. So waren meine Oberarme zwar immer noch schlank, doch meine Muskeln sehnig und mit viel Spannkraft. Warum diese Details wichtig waren? Nun, dazu später mehr.
Karl war auch im Bett schlaksig, wirkte auf mich stets wie ein zu groß geratenes Kleinkind, kuschelte lieber mit mir, als mich zu rammeln, sah in mir womöglich eine Art große Schwester oder Ersatz-Mutter. Wir bezogen auch nie eine gemeinsame Wohnung. Denn für diesen Karl wollte ich meine Freiheit nicht aufgeben.
Finanziell hielten mich meine Eltern weiterhin über Wasser. Sie bezahlten die Miete und jeden Monat trafen pünktlich 10'000 Euro auf meinem Konto ein. Doch mehr als die Hälfte benötigte ich nie, die zweite spendete ich jeweils meinem Arbeitgeber Greenpeace, der mir ein symbolisches Gehalt von 200 Euro pro Monat bezahlte und bei dem ich offiziell nur drei Stunden pro Woche arbeitete, statt der sechzig, die ich tatsächlich leistete. Doch damals war ich noch jung und enthusiastisch, spürte überall in der Organisation den Geist des Aufbruchs, des Widerstands, der Wahrheit und Wahrhaftigkeit. Wie naiv ich doch damals noch war, mit einundzwanzig, hatte zwar in Bruxelles bereits ein wenig hinter die Kulissen blicken können, war hier bei Greenpeace trotzdem weiterhin ohne Argwohn. Und ich machte Karriere, falls man den Aufstieg von einer Backoffice-Schreibkraft zur Projektmanagerin so nennen wollte.
Unser Berlin-Action-Dreamteam, kurz BAD, wie wir uns selbst nannten, bestand aus mir, Karl Schmitt, Sabine Reithner, eine Soziologiestudentin, Gonzales Escadrillos, ein spanischer Austauschstudenten aus Madrid, der kurz vor der Medizinprüfung stand. Wir bewarben uns Greenpeace intern um einen heiklen Auftrag. Die Grundidee bestand darin, in einem Kohlekraftwerk eine illegale, jedoch friedliche Aktion durchzuführen, um die deutsche Bundesregierung an ihr Versprechen zu erinnern, nach dem Abschalten aller Atomkraftwerke nun endlich auch mit der Reduktion des dreckigen Kohle-Stroms ernst zu machen.
Selbstverständlich waren uns alle wichtigen Zahlen bekannt und geläufig. Die Windkraft produzierte rund die Hälfte der Elektrizität. Biogasanlagen deckten dreißig Prozent ab und Solaranlagen steuerten zusammen mit der Wasserkraft weitere dreißig Prozent dazu. Das ergab zwar längst mehr als einhundert Prozent des eigentlichen Bedarfs. Doch das Problem lag weiterhin in der Stromspeicherung. An manchen Tagen im Jahr betrug die Produktionsmenge von Wind und Solar allein bereits weit mehr als was verbraucht wurde. An anderen Tagen deckten die beiden kaum zwanzig Prozent der benötigten Menge. Deshalb waren auch weiterhin die Dreckschleuder-Kohlekraftwerke fast rund um die Uhr in Betrieb und der Überschussstrom aus Deutschland flutete seit vielen Jahren den europäischen Markt mit hunderten von Milliarden Kilowattstunden. Die Differenz zwischen den Produktions- und Speicherkosten und den effektiven Marktpreisen lag mittlerweile bei über hundertdreißig Milliarden Euro im Jahr und die Subvention an die Stromwirtschaft bezahlten immer noch fast ausschließlich die im Land lebenden neunzig Millionen Privatpersonen, während Industrie und Gewerbe weitgehend verschont blieben.
Doch was war das eigentliche Ziel von Greenpeace bei der Kohlekraftwerks-Aktion? Nun, die Bundesregierung sollte endlich sämtliche Verbrennungsmotoren verbieten, ob sie nun mit Diesel, Benzin, Naturgas oder Biogas betrieben wurden. Stattdessen sollten flächendeckend Elektrofahrzeuge vorgeschrieben werden. Denn würden erst einmal statt der zwei Millionen Fahrzeuge fast vierzig Millionen auf Batterien umgerüstet sein, könnte man den Strombedarf von drei Tagen dort zwischenspeichern und so fast alle Kohlekraftwerke auf Dauer abschalten. Achtunddreißig Millionen Elektro-PKWs und LKWs würden zwar einmalige Investitionen von über siebenhundert Milliarden Euro bedeuten. Doch man hatte bereits hunderte von Milliarden ins Projekt sauberer Strom gesteckt. Da durfte man nicht auf halber Strecke anhalten.
»Wer A sagt, muss nicht B sagen. Er kann auch erkennen, dass A falsch war.«
Das sagte mir Karl Schmitt eines Morgens, nach dem gemeinsamen Aufwachen in meiner Wohnung, als er sich immer noch schläfrig-verträumt an mich kuschelte.
»Wie meinst du das?«, fragte ich zurück.
»Das war ein Spruch von Karl Valentin, ein Deutscher Satiriker aus München. Er war im 20. Jahrhundert berühmt.«
»Und was hat er damit gemeint?«
»Wer A sagt, muss nicht B sagen. Er kann auch erkennen, dass A falsch war.«
»Ja, das hab ich gehört. Doch was soll es bedeuten? Auf was bezog er sich?«
Karl zuckte mit den Schultern, wobei er mir meine rechte Brust etwas quetschte und ich ihn deshalb von mir stieß.
»Ich denke, er meinte alles damit, das ganze Leben.«
»Und du beziehst den Spruch auf…?«
Wahrscheinlich klang meine Stimme aggressiv. Oder auch nur warnend. Jedenfalls stemmte sich Karl leicht erschrocken von der Matratze hoch und sah mir ins Gesicht, schien darin nach der richtigen Antwort zu suchen.
»Nun, ich meine unsere Aktion. Bei der E-Braun in Bochum.«
»Und was genau meinst du damit…?«
Mein Tonfall blieb wohl erschreckend hart, denn Karl zuckte zusammen und wirkte irritiert.
»Ich finde die ganze Idee einfach blöd«, platzte es dann doch aus ihm heraus.
»Hast du Schiss?«, versuchte ich ihn anzustacheln. Doch er blieb ernst.
»Nein, Alina, sei doch nicht gleich eingeschnappt.«
»Eingeschnappt?«, warf ich ihm an den Kopf, »eingeschnappt? Da planen wir zu viert seit zwei Wochen die Aktion und nun kommst du mir mit so was?«
»Ich mein doch nur…«, versuchte er mich zu beruhigen, erzielte die gegenteilige Wirkung, denn nun war ich wirklich auf hundertachtzig und warf mich auf ihn, packte seine Handgelenke und zwang ihn auf den Rücken, setzte mich auf seine Hühnerbrust, sah ihn wohl wie eine Furie von oben herab ins Gesicht.
»Hör zu, du Memme, wenn du glaubst, ich akzeptiere einen Rückzieher von dir, dann…«
»Nein, nein«, wehrte er sogleich ab, der verdammte Feigling, das Muttersöhnchen, der verwöhnte Bengel aus reichem Haus, »doch eure Pläne führen in die Katastrophe. Man wird uns anklagen, verurteilen, vielleicht sogar ins Gefängnis werfen.«
Seine Bedenken ernüchterten mich, ließen meinen Zorn in wenigen Sekunden verrauchen, füllten mich stattdessen mit Abscheu. Ich stieg, nackt wie ich war, von seiner Brust und stand auf, holte mir frische Unterwäsche aus der Kommode, begann mich anzuziehen. Karl hatte sich bequem auf die Seite gelegt, stützte seinen Kopf mit der einen Hand, sah mir zu.
»Überleg doch mal, Alina. Wenn wir den Absperrzaun durchschneiden und auf das Gelände vordringen, begehen wir Sachbeschädigung und Landfriedensbruch. Aufgrund der neuen Terrorgesetze können sie uns sogar als eine nationale Gefahr einstufen und uns für Jahre hinter Gitter stecken.«
»Wenn du zu feige dazu bist?«, gab ich ihm bloß bissig zurück, schlüpfte in den Mini-Rock von gestern, zog dann meinen cremefarbenen, seidig-weichen Pullover aus Kaschmirwolle über.
»Ich hab keine Angst«, behauptete Karl, doch seine Stimme verriet mir das Gegenteil, »aber es ist sinnlos, sein Leben, seine Zukunft, für so eine Hauruck-Übung aufs Spiel zu setzen.«
»Du hast mit deinen Eltern gesprochen?«
Das war weniger eine Frage als vielmehr eine Feststellung. Seit Monaten hatte ich Karl dahingehend bearbeitet, dass er sich endlich von seiner Mutter und vor allem seinem Vater löste und sich ihrem Einfluss entzog. Aus irgendeinem Grund war ich wohl gescheitert. Entweder war Karl nicht radikal genug oder er war ein derartiger Schwächling, dass er sich für nichts und niemanden entscheiden konnte. Oder aber?
Bei diesem Gedanken stockte mein Atem und ich betrachtete den schlaksigen Kerl auf meinem Bett genauer, studierte sein Gesicht, registrierte jedes Zucken seiner Muskeln. Und da sah ich es tatsächlich, die Hinterlist, die Niedertracht, seine Falschheit, noch bevor er mir antwortete.
»So gut fickst du nicht, als dass ich dafür meine Karriere wegwerfe.«
Ich antwortete eine ganze Zeit nicht, stand nur da, sah auf ihn herab, sah sein Grinsen, seine Überheblichkeit, seine so plötzliche Sicherheit. Bestimmt hatte ihm sein Vater ins Gewissen geredet, von Familientradition und Verantwortung gesprochen, die Vorteile eines Lebens im Wohlstand geschildert, die Süße der Macht über andere Menschen, die man als Unternehmer täglich spürte. Und das niederträchtige Schwein war darauf hereingefallen und würde uns nun verraten, wenn er es nicht schon getan hatte. Ich überlegte fieberhaft. Denn unsere Pläne waren weit gediehen, sollten bereits in wenigen Tagen umgesetzt werden, am 1. Mai, wenn die Polizeikräfte durch Kundgebungen der Arbeiterschaft und ihren oft gewalttätigen Märschen beschäftigt waren und auch die Sicherheitstruppe im Kraftwerk reduzierten Dienst versah.
»Mit wem hast du gesprochen?«
Ich war kühl, ja derart ernüchtert, dass es mich innerlich fror. Und gespannt wartete ich auf seine Antwort.
»Mit niemandem«, log er mich an. Ich sah es in seinem Gesicht.
»Erzähl keinen Scheiß, Mistkerl.«
Mein Gesichtsausdruck musste ihn erneut erschreckt haben, denn er rappelte sich eilig von der Matratze hoch, suchte seine Unterhose neben dem Bett. Ich stürzte mich auf ihn, versetzte ihm einen gewaltigen Kinnhaken, der ihn besinnungslos aufs Bett zurückwarf. Meine Fingerknöchel waren aufgeplatzt und die ganze Hand tat mir weh. Doch ich achtete nicht darauf, setzte mich erneut auf seine Brust, klemmte seine Oberarme mit meinen Unterschenkeln fest, schlug ihm mit der offene Handfläche ins Gesicht, bis er aufwachte.
»Du sagst mir jetzt sofort, wann und mit wem du über unsere Pläne gesprochen hast, verdammt«, fuhr ich ihn an, als seine Augen nicht mehr glasig blickten.
»Fahr zu Hölle.«
Soviel Standhaftigkeit hätte ich dem Kerl gar nicht zugetraut. Wie hatte er mich bloß derart täuschen können? Über eine so lange Zeit? Immerhin mehrere Monate. Egal. Ich knallte ihm meine Faust gegen seine Nase, quetschte sie derart, dass sogleich Blut herausschoss.
»Schpinscht duu«, nuschelte er voller Schmerzen, wollte sich unter mir frei strampeln, warf seinen Kopf hin und her, erreichte nichts.
»Wann und mit wem?«
Ich blieb unerbittlich, hob erneut drohend meine kleine Faust und Karl zerbrach.
Ja, er hatte alles seinen Eltern gebeichtet, nachdem ihm bewusst geworden war, dass das alles kein Spiel mehr sein sollte, sondern dass es ernst galt. Der Feigling hatte bei seinem Vater um Rat gefragt und der hatte ihn mit einem Staatsanwalt zusammengebracht, dem Karl alle unsere Pläne verriet. Während er wimmernd unter mir lag und gestand, durchfuhr es mich zuerst heiß und dann eiskalt. Und ich freute mich ein erstes Mal in meinem Leben über die arg strenge Schulung und das intensive Training meines Vaters. Denn der hatte mir zumindest eines schon als Jugendliche beigebracht, nämlich in gefährlichen Situationen die Ruhe zu bewahren. Drei drängende Fragen beschäftigten mich. Welche schriftlichen Aufzeichnungen gab es über unsere Pläne? Wo befanden sich diese Unterlagen? Konnten Sabine und Gonzales einem Verhör durch Polizei und Staatsanwaltschaft standhalten?
»Bleib liegen«, befahl ich Karl und erhob mich vom Bett, suchte mein Handy, rief erst Sabine und danach Gonzales an, schilderten ihnen den Verrat und die möglichen Konsequenzen. Beide versicherten mir völlige Loyalität und Verschwiegenheit, versprachen auch, sofort alles Schriftliche zu beseitigen.
»Im Spülbecken verbrennen und die Asche mit viel Wasser runterspülen«, riet ich den beiden und unterbrach danach die Verbindung.
Karl lag immer noch genauso auf dem Bett, wie ich ihn verlassen hatte. Der Schlappschwanz war mir körperlich derart unterlegen, dass er sich nun wieder wie ein Welpe gab, der doch Schutz verdiente, der feige Schweinehund.
Sollte ich ihn nun aus meiner Wohnung werfen? Oder ihn besser gefangen setzen? Fesseln und knebeln? Doch zu welchem Zweck?
In meinem Zorn dachte ich sogar daran, ihn zu beseitigen, ihn einfach umzubringen und irgendwie aus dem Mietshaus zu schaffen. Selbstverständlich war das idiotisch. Die Forensiker hätten Millionen von DNA-Spuren von mir an seiner Leiche gefunden. So sauber konnte man keinen Toten waschen und beseitigen. Verbrennen, ja, das wäre gegangen. Doch wie und wo?
Nicht einmal erschrocken war ich über meine grässlichen Gedanken, die mir bis kurz zuvor noch völlig abwegig vorgekommen wären. Was war bloß in dieser Viertelstunde seit unserem Aufwachen mit mir passiert? Was hatte mich derart verändert?
Erst viel später fand ich die Zeit, gründlich darüber nachdenken und kam doch zu keinem eindeutigen Schluss. Bestimmt lag es am gemeinen Vertrauensbruch von Karl. Sicher auch an der Verantwortung, die ich für Greenpeace und unsere Ziele fühlte. Doch inwieweit mein Vater oder meine Kindheit und Jugend damit zu tun hatten, darüber hätte ich wohl irgendwann mit einem Psychologen reden müssen, was ich aber nie tat. Jedenfalls wurde mir an diesem frühen Morgen in Berlin klar, dass ich keinerlei Hemmungen vor dem Töten verspürte, genauso wie mein Vater. Hatte er mir mit seiner Ausbildung und seinem Training seine eigene Skrupellosigkeit eingeimpft? Oder lag das eher an einer Vererbung? Eine Art von Gen-Defekt?
»Hau einfach ab«, befahl ich Karl, ging hinüber in den Wohnraum, suchte alle Unterlagen zu unserer geplanten Aktion zusammen, ging in die Küche und verbrannte die Papier wie von mir empfohlen im Spülbecken, ließ das Wasser danach lange und kräftig rauschen. Als ich zurückkehrte, war Karl verschwunden. Ich riss alle Fenster auf und lüftete die Wohnung.
*
Wir drei wurden von der Polizei noch am selben Nachmittag abgeholt und auf ein Revier gebracht. Man befragte uns, legte auch die von Karl an die Staatsanwaltschaft abgegebenen Papiere mit unseren Plänen vor. Doch darauf waren unsere Namen selbstverständlich nicht notiert. Nur unser BAD prangte groß auf jedem Blatt.
»Müsste es nicht MAD heißen?«, fragte ich den Kommissar, der mich verhörte.
»Wieso MAD?«
»Na, wie die Satire-Zeitschrift. Denn ernst kann dieses Geschreibsel ja kaum gemeint sein.«
»Und was lesen Sie aus den Unterlagen heraus?«
»E-Braun GmbH&Co.AG. Das ist doch ein Braunkohlekraftwerk, oder?«
Er nickte zustimmend und hechelte gleichzeitig in Erwartung eines Fehlers von mir.
»Und hier steht, wie man den Zaun zum Gelände überwindet und wo man anschließend in den Gebäudekomplex eindringen kann. Und hier …«, ich beugte mich über den Tisch, so als wollte ich die Worte besser lesen können, »… stehen Informationen zum Wachpersonal.«
»Und?«
»Na, zu welchem Zweck soll jemand heimlich in ein Kohlekraftwerk steigen? Um CO2 zu stehlen?«
»Sie sind für Greenpeace tätig.«
»Ist das hier in Berlin verboten?«, gab ich frech zurück.
»Und Sie werden verdächtigt, der Kopf einer kriminellen Organisation zu sein.«
»Meinen Sie etwa dieses BAD?«, und ich deutete unschuldig auf unsere Abkürzung, »was soll das bedeuten?«
»Sagen Sie es mir.«
»Berliner Anstalt für Depressive?«
»Wie wäre es mit Berlin-Action-Dreamteam?«
Ich schaute dem Beamten ruhig ins Gesicht, zuckte dann unbestimmt mit den Schultern.
»Sie kennen Karl Schmitt?«
»Ist das eine Frage oder eine Feststellung?«
»Weichen Sie mir nicht aus, Fräulein Lederer. Wir können Sie problemlos für ein paar Tage in Gewahrsam nehmen, wenn Sie unbedingt wollen. Seien Sie kooperativ. Ein Geständnis wirkt sich sehr positiv auf die Höhe Ihrer Strafe aus.«
»Strafe? Ich habe nichts Unrechtes getan.«
»Wir wissen alles«, behauptete er weiter.
»Warum fragen Sie dann? Von Karl Schmitt habe ich mich getrennt, falls diese Papiere hier irgendetwas mit ihm zu tun haben sollten.«
»Und der Grund dafür?«
»Geht sie das etwas an? Ich denke nicht.«
Ich verbrachte den Rest des Tages und auch die Nacht in einer Arrestzelle, die wahrscheinlich für Betrunkene vorgesehen war. Denn Boden und Wände waren vollständig mit leicht zu reinigenden Kacheln bedeckt und eine mit Kunststoff überzogene dünne Matte, ein Klosett und ein Waschbecken aus Edelstahl, waren die einzigen Einrichtungsgegenstände. Mir war die ganze Nacht lang kalt, wahrscheinlich eine weitere sadistische Idee des Kommissars, um mich weich zu klopfen. Denn am nächsten Morgen, beim zweiten Verhör, blickte er mir hämisch entgegen.
»Eine gute Nacht gehabt?«, fragte er mich spöttisch.
»Auch Ihnen einen schönen Morgen«, ging ich nicht auf ihn ein, »was haben Sie heute für mich für Fragen?«
»Dieselben wie gestern«, antwortete er und packte aus seiner Ledermappe die Kopie unserer Pläne aus und verteilte sie wieder auf der Tischplatte, befahl mir, nachdem er sich selbst auf einem der beiden Stühle niedergelassen hatte, »setzen!«, was ich auch tat.
Ich blickte ihm ins Gesicht und direkt ins rechte Auge, dachte bei mir: »Dir bin ich über, du Arsch«, lächelte dazu freundlich. Auch Jules, mein Vater, war öfters von der Polizei verhaftet und verhört worden. Er sprach mit mir darüber, zählte einige der Taktiken auf, mit denen Verdächtige verwirrt wurden, um Widersprüche oder Fehler in den Aussagen zu provozieren. Ich hatte ihn nach Tricks oder Kniffen gefragt, wie man verhinderte, dass man sich verhedderte.
»Die Lösung ist relativ einfach. Doch man muss sie intensiv üben. Bist du bereit dazu?«
Ich hatte genickt und er hatte mir die Strategie erklärt: »Wenn man sehr große Zahlen auswendig lernt, unterteilt man sie in Gruppen mit jeweils drei Ziffern. Zu jeder dieser Gruppe merkt man sich ein bestimmtes Bild oder eine Handlung. Wichtig ist, dass man sich für jeden dreistelligen Code immer das Gleiche merkt, also zum Beispiel einen Sonnenaufgang für 123, einen Sonnenuntergang für 987. Und dann merkt man sich nicht mehr die große Zahl, sondern spult die einzelnen Bilder wie in einem Film ab. Eine solche selbst gestrickte Geschichte lässt sich selbstverständlich weit einfacher merken als die blanken Ziffern.«
»Und wie hilft das bei Verhören durch die Polizei?«, fragte ich ein wenig verwirrt zurück.
»Ganz einfach. Du drehst die Methode um und merkst dir zu jedem Bild deiner Geschichte, die du erzählen willst, eine fortlaufende Zahl. So bekommt beispielsweise das Einparken eine zehn, während der anschließende Einkauf die elf erhält. Auf diese Weise kannst du sicher sein, stets dasselbe in derselben Reihenfolge zu erzählen und nicht durcheinander zu geraten.«
An diesem Morgen profitierte ich von diesem Gedankentraining, durch das mich mein Vater vor Jahren und noch als Jugendliche trieb. Wir verbrachten damals mehrere Sonntagnachmittage mit dem Ausdenken von Szenarien, schrecklichen Verbrechen, bösartigen Tätern und immer war ich die Angeklagte oder die Zeugin, während mein Vater Staatsanwalt spielte und mich mit Fragen malträtierte. Locker und leicht trat ich deshalb bei diesem Kommissar in Berlin auf, so als wäre ich ein Bühnenstar, der seine tausendste Vorstellung gab. Routiniert und ohne Fehler hangelte ich mich durch das Dickicht der Querfragen, wich den gestellten Fallen aus, blieb in allen Aussagen fest und sicher, fragte mich allerdings, wie Sabine und Gonzales ein solches Verhör überstehen sollten. Doch man konnte sich in Menschen sehr leicht täuschen, wenn man sich selbst zu sicher war und insgeheim auf andere herabblickte.
Als man mich einen Tag später auf freien Fuß setzte, rief ich die beiden sogleich an und wir verabredeten uns in einem Pub am Alexanderplatz, das ständig voll von Gästen war und dessen Lärmpegel jedes Belauschen verunmöglichte. Ich hatte für uns neue Handys gekauft, übergab sie den beiden und gemeinsam transferierten wir unsere Daten auf die neuen Geräte, versprachen uns, die alten zu zerstören oder wegzuwerfen. Denn wir hätten eine Manipulation der Elektronik oder der Software durch die Behörden kaum entdecken können. Wir versicherten einander, von nun an nur noch in Ausnahmefällen wichtige Informationen übers Telefon auszutauschen. Dass man früher oder später auch unsere neuen Handys orten und uns auf diese Weise problemlos verfolgen und beschatten konnte, auch das war uns selbstverständlich bewusst. Gonzales sprach auch über seine Angst, man könnte ihm sein Stipendium streichen. Ich konnte ihn jedoch beruhigen: »Falls das tatsächlich der Fall sein sollte, wird mein Vater einspringen, versprochen.«
Sabine dagegen fühlte sich elend beim bloßen Gedanken, dass der Staatsschutz sie von nun an auf Schritt und Tritt beschatten könnte.
»Wo bleibt da die Demokratie? Wo der Persönlichkeitsschutz? Wo die Würde?«, reklamierte sie wütend.
Ich nahm sie in den Arm und drückte sie fest an mich, beruhigte sie mit meiner Wärme.
»Sie haben zwar die Aussage von Karl und die Polizei verdächtigt uns deshalb. Doch nach ein paar Tagen, spätestens nach zwei oder drei Wochen hat man uns wieder vergessen, glaub mir. Wir müssen uns nur solange bedeckt halten.«
»Du willst doch unsere Pläne nicht doch noch umsetzen?«, ereiferte sich Gonzales sogleich, »das wäre Wahnsinn«, und er schaute Sabine an, verlangte nach ihrer Unterstützung und erhielt sie auch.
»Sicher unternehmen wir nichts mehr in dieser Sache. Denn wenn wir jetzt noch in Erscheinung treten, dann haben sie uns auf sicher.«
»Du willst die Aktion abblasen?«, fragte ich erstaunt zurück, denn gerade Sabine wirkte auf mich stets wie die Radikalste von uns vier. Doch diesmal nickte sie heftig zustimmend.
»Unser Plan ist weiterhin gut und wenn etwas Gras über die Sache gewachsen ist, können wir ihn bestimmt noch umsetzen lassen. Doch wir drei sind auf jeden Fall aus der Geschichte raus, das ist klar.«
Ich musste wohl sehr enttäuscht auf die beiden gewirkt haben, denn sie zogen sich von da an von mir zurück, schufen spürbaren Abstand, errichteten eine Mauer zwischen uns, die sie behüten und beschützen sollte.
»Wir können doch nicht andere den Kopf für uns hinhalten lassen«, entrüstete ich mich, »der Plan ist auf unserem Mist gewachsen, also haben wir die verdammte Pflicht…«
»Eben nicht«, mischte sich Sabine in meine Rede ein, »Alina, denk doch nach. Der Staatsschutz verhaftet uns, sobald wir uns auch nur in die Nähe eines Kraftwerks wagen. Die fackeln bestimmt nicht lang herum. Und du weißt selbst, wie man dort mit Verdächtigen umgeht.«
Nein, das wussten wir selbstverständlich nicht. Man munkelte in der Szene zwar ständig von irgendwelchen Aktivisten, die von einem Tag zum nächsten spurlos und für immer verschwunden sein sollten. Doch wir kannten kein einziges der angeblichen Opfer persönlich, für mich ein Zeichen, dass nicht viel an den Geschichten dran sein konnte. Für Sabine und Gonzales dagegen waren die fehlenden Beweise eher eine Bestätigung.
Unsere vorgesetzte Stelle bei Greenpeace versprach uns volle Rückendeckung und juristischen Beistand bis zu den höchsten Instanzen. Wir drei winkten gelassen ab.
»Das war ein Schuss ins Blaue von den Behörden. Die dachten, sie hätten es mit drei Weicheiern zu tun, die ihre Ideale rasch vergessen und verraten würden.«
»Und Karl?«, fragte Detlef Seibert zurück.
»Den kannst du abschreiben«, antwortete ich an Stelle der beiden anderen, »dieser Feigling ist der einzige Grund, warum man uns verhaftet hat. Er machte insgeheim einen Rückzieher und verriet uns an die Bullen, das verdammte Schwein.«
Detlef war über unsere genauen Pläne nicht informiert gewesen. Das war so üblich bei Greenpeace. Denn solange die Geschäftsleitung wenig bis gar nichts über die Aktionen der einzelnen Gruppen wussten, solange konnte man sie auch nicht belangen. Erst ein paar Jahre später erkannte ich den Fehler in der Organisation dieser selbsternannten Umweltschützer. Denn wenn sich die oberste Führung wie Generäle weitab von den Schlachtfeldern im Hintergrund halten konnten, opferten sie auch leichtfertig ihr Fußvolk, warfen sie die von Idealen völlig Verblendeten den Haifischen des Staates und der Wirtschaft zum Fraß vor. In Japan machten erfolglose Generäle nach einer verlorenen Schlacht traditionsgemäß Seppuku. Bei Greenpeace gönnten sie sich lieber eine weiter Flasche Champagner und eine dicke Zigarre auf Kosten des Hauses, egal, ob nur eine Schlacht oder der ganze Krieg verloren gegangen war, denn wichtig war einzig die Publicity und damit die kostenlose Werbung für noch mehr Spendengelder. Doch das alles erkannte ich leider zu spät. Zumindest viel zu spät für mich.
*
Ich war für ein paar Wochen in mein Elternhaus zurückgekehrt, verbrachte viel Zeit mit meiner Maman und sogar noch mehr mit Jules, meinem Vater. Denn nun war ich aufgewacht und bereit, war alarmiert, vor der Staatsgewalt, vor den Wirtschaftsinteressen, vor all den politischen Verwicklungen, die kaum noch Raum für Freiheitsliebende und Verantwortungsbewusste ließ.
Bei Greenpeace hatte ich gekündigt. Sabine und Gonzales waren eh keine zwei Wochen nach unserer Freilassung ausgetreten und mieden mich seitdem, die beiden Feiglinge. Opportunismus schien für alle Welt die Losung für eine glückliche und erfolgreiche Zukunft zu sein. Und ich? Die Matrix aus dem gleichnamigen Film kam mir in den Sinn, das System, das uns Menschen einspannte und gleichzeitig aussaugte, uns das Leben, die Unschuld und die Tatkraft raubte und zu einem willfährigen Werkzeug der Mächtigen machte.
Ich war wütend, auf die Politiker, auf die Wirtschaftsführer, auf die Menschen, die nicht begreifen wollten oder konnten, die ganz einfach zu dämlich waren, um Parallelen und Entwicklungen voraus zu sehen, die zu dumm waren, um die ständig wachsende Bevormundung der Mächtigen zu stoppen. Zu keinem Zeitpunkt in meinem späteren Leben war ich derart empfindsam und aufgewühlt, politisch und engagiert. Und mein Vater nahm mich zur Seite, hörte mich ruhig an, stimmte mir manches Mal zu, wich vor allem keiner meiner Fragen aus.
»Ich versuche zwar, dich zu verstehen, Alina«, so begann er fürsorglich und einfühlsam, »doch vielleicht bin ich der Falsche. Denn ich selbst habe in meinem bisherigen Leben vor allem zu mir selbst geschaut, war meistens sehr egoistisch und im Grunde genommen nie wirklich selbstlos.«
»Aber ich denke, ich kann dich verstehen«, fuhr er fort, »kann dich fühlen und begreifen, wofür du stehen willst, was du erreichen möchtest. Doch ich muss dich warnen. Den wichtigsten Leitsatz von Epikur habe ich dir zwar schon mit sechzehn beigebracht. Ich rufe ihn dir trotzdem in Erinnerung.«
»Lebe im Verborgenen?«, antwortete ich spöttisch.
»Nein, im Gegenteil. Mache dich kundig, setze dich für das Richtige ein. Blicke weiterhin hinter die Kulissen und entwickle aufgrund deiner Beobachtungen eine erfolgversprechende Strategie. Suche dir anschließend vertrauenswürdige Mitstreiter zusammen und verschwört euch zu einer Familie, die sich beisteht, die sich nie verrät, die lieber stirbt als nachgibt.«
»Du sprichst von Moral«, meinte ich und er nickte.
»Moral ist die Bindung, die über den Tod hinausgeht. Moral ist stärker als jede Eigenliebe, mächtiger als die Folter …«
»…und gewalttätiger als jedes Verbrechen«, unterbrach ich ihn lächelnd und er stimmte mir ebenso zu.
»Ja, die wahre Macht im Universum ist die Moral. Doch man muss sie richtig einzusetzen wissen.«
»Und wie geht das? Worauf muss ich achten?«
Irgendwie spürte ich, dass mein Vater mir meine Augen weiter öffnen wollte, mich eine weitere Stufe der Erkenntnis erklimmen lassen konnte.
»Forsch immer nach der Würde in einem Menschen.«
»Würde?«, fragte ich skeptisch zurück, »was meinst du damit?«
Mein Vater sammelte sich, reflektierte vielleicht sogar noch einmal sein Wissen oder seine Vermutungen.
»Die Würde sorgt stets dafür, dass wir uns vernünftig verhalten, dass wir abwägen, dass wir auch Empathie für andere Menschen entwickeln und empfinden.«
»Und je mehr einer davon besitzt, desto moralischer handelt er?«, fragte ich verdutzt zurück.
»Nein, im Gegenteil«, widersprach mir mein Vater sogleich, »je mehr Würde jemand in sich trägt, desto ausgleichender will er wirken, desto gerechter wird er auftreten, desto mehr wird er bei seinen Entscheidungen an das Schicksal anderer Menschen denken, an ihr Wohlbefinden. Deshalb ist zu viel Würde schlecht für deine Pläne.«
»Also keine Würde«, schloss ich daraus.
»Nicht ganz, denn ohne Würde lebt die Niedertracht. Du musst dir also Gleichgesinnte suchen, die einiges an Würde aufweisen. Sonst hintergehen sie dich, booten dich aus oder verraten dich für einen Vorteil. Du brauchst Mitstreiter mit einer gewissen Menge an Würde, die zumindest ausreicht, damit sie sich einer Sache und einem Ziel völlig unterordnen können. Gleichzeitig dürfen sie nicht zu viel Würde besitzen. Sonst werden sie im entscheidenden Augenblick zögern, werden Gewissensbisse verspüren und große Bedenken entwickeln, sobald sich ein Plan zuspitzt und Gefahr für andere Menschen besteht.«
Ich schaute ihm wohl eine ganze Zeit lang ins Gesicht, forschte darin, so als sähe ich ihn das allererste Mal in meinem Leben richtig. Und dieses eine Mal hielt er meinem Blick stand, ja, er öffnete sich sogar für mich ein Stück weit und ich hatte das Gefühl, als könnte ich in ihm lesen wie in einem aufgeschlagenen Buch. Ich spürte, wie ich erschauderte, ohne dass ich im Grund wusste, warum. Doch da war das Gefühl vollkommener Kälte, die mir mein Vater zeigte und auch wenn ich ihn bis zu seinem Tod weiterhin auf meine Weise liebte, so verlor ich an diesem Nachmittag meine Achtung vor ihm. Denn ich erkannte in seinen Augen keinerlei Würde, keine Ehre, noch nicht einmal echten Stolz, dafür alle möglichen negativen Eigenschaften, Gewinnsucht, Kampflust, Niedertracht und Dünkel zum eigenen Vorteil. Mir wurde einmal mehr bewusst, auf welche Weise mein Vater für unseren Wohlstand gesorgt hatte, mit welchen verwerflichen Mitteln er in seinem Leben meist unwerte Ziele verfolgt hatte. Das war ein anderer Jules, als ich ihn mir immer als Jugendliche und junge Erwachsene eingeredet hatte. Er war in diesem Moment der Jules, den ich nie sehen und erkennen wollte.
»Bitte verzeih«, entschuldigte er sich bei mir, denn er hatte den Schrecken aus meinem Gesicht gelesen und schien ihn zu verstehen, »weißt du, Alina, für mich ist nur dein Glück wichtig. Du sollst im Leben das erreichen, was du dir wünschst. Und du sollst deine Ideale erfolgreich und zielgerichtet verfolgen und dich von niemandem über den Tisch ziehen lassen müssen. Und verdammt noch mal, wenn du die Erde und die gesamte Menschheit umkrempeln willst, dann tue es und setze dazu alle Tricks und Kniffe ein, die notwendig sind.«
»Amen«, warf ich ein, war darüber ebenso verdutzt, wie mein Vater. Wir lächelten uns an, hatten unsere Grenzen abgesteckt, würden nach diesem Nachmittag nie mehr eine Tochter-Eltern-Beziehung leben, waren von nun an für viele Jahre gleichberechtigte Individuen, die von ihren Charakter-Eigenschaften her kaum unterschiedlicher sein konnten, die sich aber weiterhin als Menschen und innerhalb der Familie achteten und liebten.
Ich sprach in diesen Tagen auch viel mit meiner Maman. Sie hatte es aufgegeben, ihren Ehemann doch noch zu ändern, ihn handzahm zu machen, wie sie es nannte. Glücklich wirkte sie nicht auf mich, sondern ernüchtert vom Leben und vielleicht sogar ein wenig erbost über ihr Schicksal. Doch sie liebte meinen Vater immer noch, wie sie mir versicherte, war ihm womöglich auf eine traurige Weise hörig, vermochte nicht mehr auszubrechen aus dieser vor so langer Zeit eingegangenen Partnerschaft, die nie wirklich gleichberechtigt funktionierte, in der sie stets mehr gab als sie erhielt.
»Jeder ist seines Glückes Schmied«, zitierte sie den römische Konsul Appius Claudius Caecus.
»Und du bist nicht glücklich?«, stellte ich mehr fest, als ich fragte. Doch meine Maman schüttelte kurz und ablehnend ihren Kopf, blickte mich traurig lächelnd an.
»Ich habe meinen Glauben gefunden, Alina.«
»Und der hilft dir?«, fragte ich skeptisch zurück, doch meine Maman nickte nun zustimmend.
»Wir kennen Gottes Pläne für unser irdisches Leben nicht, könnten sie auch nie begreifen, müssen unser Schicksal deshalb so annehmen und akzeptieren, wie es über uns kommt.«
»Du weißt, dass ich an keinen Gott glauben mag?«
Wiederum nickte sie, lächelte dazu und nicht einmal traurig, sondern zuversichtlich.
»Irgendwann wirst du zum rechten Glauben finden, Alina, da bin ich mir völlig sicher. Lass dir einfach Zeit dazu, suche ihn nicht, sondern lass ihn dich finden.«
Ich fragte mich in diesem Moment, wie mein Vater, der zeitlebens genauso gottlos dachte und lebte, wie auch ich seit vielen Jahren, wie Jules es bloß mit meiner Maman aushalten konnte. Oder war das nur eine weitere Niederträchtigkeit von ihm? War ihm schon immer bewusst gewesen, dass seine Ehefrau als gläubige Christin ein einfaches Opfer für ihn war? Denn die Macht des Glaubens konnte jeden Stolz und jede Ehre brechen. Für den Glauben warfen viele Menschen sogar ihre Würde, ja ihr Leben weg. Der Glaube vermochte die Menschen willenlos zu machen, trieb sie in die Sklaverei der Skrupellosen, so wie jede bösartige Ideologie.
Womöglich empfand ich Mitleid mit meiner Maman, auch wenn ich noch jung war und der Meinung, jeder Mensch wäre an seinem Unglück selbst schuld. Doch gleichzeitig liebte ich sie für all das, was sie für mich als Mensch verkörperte, ihre Demut, ihre Aufopferung, ihren Sanftmut, mit dem sie ihr Leben annahm und gestaltete, auch ihre Unaufgeregtheit. Wahrscheinlich hatte sie andere Zeiten gekannt, war irgendwann auch einmal jung gewesen, wollte damals dem Teufel ins Auge spucken, vor lauter Übermut und Energie. Zumindest hatte sie keiner der zahlreichen Schicksalsschläge brechen können. Denn immer noch blickte sie offen und frei in mein Gesicht, hatte nichts zu verbergen, zeigte mir weiterhin ihre schöne Seele und die riesige Würde, mit der sie ihr Leben annahm und tapfer ertrug.
»Du hast sie von mir geerbt«, meinte sie nach ein paar Sekunden Stille. Ich musste sie nicht fragen, was sie meinte.
Rückblickend waren diese drei oder vier Wochen der Dreisamkeit im Jahr 2028 wohl die Wichtigsten, die ich in meinem Elternhaus verbracht hatte.
*
Ich war nach Paris gezogen, versuchte mich dort als Künstlerin, tat ungeheuer wichtig, hatte mir eine Marke zugelegt. Die bestand zum größten Teil aus verwirrenden Kollagen, die man sich an seine Wände hängen konnte, freizügigen Outfits, die meine vollen, natürlichen Brüste nur selten vollständig verhüllten und eine künstliche Arroganz, mit der ich zu spielen lernte.
Claude war mir zu Anfang ein guter Freund und Kollege, stellte mich überall vor und führte mich bei seinen Bekannten genauso gerne ein, wie er seinen Penis in meine Vagina schob. Wir hatten uns im Invalidendom das erste Mal gesehen. Er wirkte zerstreut, aber süß, hatte ein lustiges Funkeln in seinen Augen, nachdem er mich bewusst wahrgenommen hatte.
»Allô, ma chère, wo kommst du denn her? Du musst eine der Sternschnuppen sein, die gestern Nacht auf die Erde fielen.«
Er war ein wenig verrückt, mein lieber Claude, auch etwas kleinwüchsig, so dass sein Gesicht im Stehen zwischen meine Brüste passte, auch nicht mit einem beachtlichen Penis ausgestattet, dafür aber umso leidenschaftlicher in allem was er anpackte, ob er einen Betonblock mit seinem Presslufthammer bearbeitete oder aus Kastanien und Zündhölzern kleine Männchen und irgendwelche Fantasie-Tiere zusammensetzte, sie danach in Szene zueinander stellte und Hunderte von Fotos von ihnen knipste, die er dann in GIF-Dateien zu kurzen Filmen verband und sie auf IPads speicherte, um sie mittels Bildschirme als bewegend-ergreifenden Wandschmuck zu verkaufen. »Mouvements pathétiques« nannte er seine Kunst, eine selbstgefällige Selbstüberschätzung, wie vieles in seinem Leben.
Meine Werke tat er stets als bourgeois und nihilistisch ab, wobei sich meiner Meinung nach die beiden Ausdrücke gegenseitig ausschlossen. Nicht jedoch bei Claude, der stets umso verbissener an seinen Ansichten festhielt, je verlorener seine Position war. Ja, Claude war die Leidenschaft an sich, hätte als ihr Synonym im Duden aufgeführt sein müssen, wobei er unbewusst mit seiner oft sehr gequält wirkenden Art viel mehr Leid unter seine Mitmenschen trug, als er willentlich wollte.
Wir lebten in einer riesigen Mansarde an der Rue Gabrielle, besaßen beide eigene Ateliers, die dank den großen Dachfenstern ein perfektes Licht boten, schufteten jeweils die zweite Hälfte des Tages, denn die erste verschliefen wir in der Regel, brachen abends aus unserer Wohnung aus wie wilde Löwen, die schon zu lange hungern mussten, zogen durch die Bistros und Kneipen und trafen eine endlose Reihe von Bekannten, Kollegen und Freunden, tauschten uns aus, redeten über die Welt, nahmen uns allesamt ungeheuer wichtig.
Die Kunst bewirkte nichts. Das wurde mir schon nach einem halben Jahr mit Claude bewusst. Ich konnte so viele Anklagen über die Welt herstellen, wie ich nur wollte. Aber meine Collagen verkauften sich gar nicht schlecht, so dass die monatlichen Überweisungen meiner Eltern auf meinem Konto versauerte, eigentlich immer so lange, bis Claude wieder einmal eine seiner teuren Eingebungen auslebte, ein Kunstprojekt ins Leben rief, das stets alle Dimensionen brechen musste und nicht selten in einer Anklage vor Gericht, hohen Anwaltskosten und einer Strafzahlung endete. Einmal färbte er die Seine in den französischen Nationalfarben ein, wobei sein Clou darin bestand, mindestens zehn Mal mehr Rot als Blau oder Weiß zu verwenden.
»Das Sterben der Macht«, hatte er seine Performance genannt. Und ich bezahlte wenig später nicht nur seinen Promi-Anwalt, sondern überwies auch das Bußgeld und die Gerichtskosten von über zweihunderttausend Euro an die Staatskasse. Der Kommentar von Claude: »Kunst kennt keine Regeln und wenn die Leute sie nicht verstehen, dann ist das ihre Schuld, nicht meine.«
Noch am selben Abend trennte ich mich von Claude. Zu sehr hatten mich seine Worte an einen Comic erinnert, der mir mein Vater vor vielen Jahren gezeigt hatte. Es war eine der Kurzgeschichten über Calvin & Hobbes, dem kleinen Jungen mit seinem Stofftiger, der stets zum Leben erwachte, sobald sich niemand außer Calvin in der Nähe befand. In diesem Comic-Strip führte Calvin aus: »Die Leute denken immer, Kunst würde für sie gemacht. Dabei ist echte Kunst die intime Sprache gebildeter Menschen, mit deren Hilfe sie ihre vollkommene Überlegenheit über den Rest der Welt erklären. Gerade weil meine Arbeiten völlig unverständlich bleiben, sind sie von größter Wichtigkeit und höchster Bedeutung.«
Ohne Claude als Klotz an meinem Bein wuchs auch mein Konto bei der Bank stetig an und ich hatte somit keine Probleme, ein eigenes Atelier anzumieten und einzurichten. hielten die meisten Freunde und Bekannte weiterhin zu mir, verstießen Claude zwar nicht direkt, ließen ihn jedoch deutlich spüren, wie sehr ihnen im Grunde genommen seine blasierte Überheblichkeit auf den Senkel ging.
Ein Dreivierteljahr später war jedoch endgültig Schluss für mich und meine Collagen und ich wendete mich der Literatur zu, begann Kurzgeschichten zu schreiben, fand auch Zeitungen, die sie veröffentlichten. Manche von ihnen provozierten die Leser zu Briefen und über meinen Blog tauschten sich Gegner und Befürworter meiner veröffentlichten Ansichten rege aus. Doch auch diese Arbeit befriedigte mich nicht wirklich, zeigte nämlich ebenfalls keinen Einfluss auf die Gedanken und die Werte der Menschen, schien bei einigen bloß ihre vorhandenen Vorurteile zu bestärken, bei anderen den Widerstand und die Gegnerschaft zu erhärten. Ich sah ein, dass es ein sinnloses Unterfangen war, mit Denkanstößen die Welt verändern zu wollen. Und so begann ich mich ernsthaft zu fragen, wie ich direkt an die Schalthebel der Macht gelangen konnte. Denn wenn man die Basis nicht aufrütteln und zu Veränderungen bewegen konnte, dann musste man doch im Top-Down-Verfahren seinen Einfluss auf die Entwicklung der Menschheit ausüben?
Ja, so vermessen war ich damals, Mitte zwanzig, noch. Dachte weiterhin, die Welt aus ihren Angeln heben zu müssen. Für das Wohl der Menschen zu kämpfen, ihnen das Heil zu bringen, die Erlösung. Das klang nicht nur sakral, es hatte auch sehr viel mit Glauben zu tun, ohne dass ich es damals bemerkt hätte. Vieles wäre mir wohl erspart geblieben, hätte ich es damals so empfunden wie heute. Denn jeder Glaube enthielt stets die Gefahr von Fanatismus. Und der wurde seit jeher den Menschen zum Verhängnis, den Opfern genauso, wie den Tätern.
*
Die mächtigste Organisation, wenn es um weltumspannende Dinge ging, waren damals die Vereinten Nationen, zumindest bis zum großen Krieg. Der zerschlug jede frühere Weltordnung, ließ drei weiterhin verfeindete Machtblöcke zurück und einen Haufen Länder, die sich von ihnen beeinflussen lassen mussten. China hatte sich mit seinen fast zwei Milliarden Menschen zur wirtschaftlich und militärisch stärksten Kraft emporgeschwungen, kontrollierte den gesamten pazifischen Raum inklusive Japan, Neuseeland und Australien und halb Süd-Ost-Asien. Die USA hatten ihre Vormachtstellung endgültig eingebüßt und igelten sich mit dem Rest des amerikanischen Kontinents richtiggehend ein, wachten nervös über ihre Grenzen, kontrollierten jeden Besucher akribisch, was längst schizophrene Züge angenommen hatte. Europa dagegen war eng mit Russland verbandelt und man kontrollierte wirtschaftlich und politisch den Orient und halb Afrika, war jedoch militärisch den beiden anderen Mächten hoffnungslos unterlegen.
Blockfreie Länder wie Indien, Pakistan und Afghanistan hatten sich angesichts der drohenden Ausdehnung von China und Euro-Russland verbandelt und mochten mit ihren fast drei Milliarden Menschen dem Druck der anderen Nationen und Bündnissen wohl auf Dauer standhalten. Ja, dass äußerst günstige Züchten von Organen hatte das Bevölkerungswachstum nach 2050 regelrecht explodieren lassen, trotz der beiden so leidvollen Kriege mit weit über einer Milliarde Toter. Kaum jemand starb noch vor seinem hundertsten Geburtstag und den derzeitigen Rekord hielt ein Milliardär aus Boston mit 165 Jahren, der allerdings, wie man munkelte, nur noch dank Maschinen am Leben erhalten wurde und dessen Körper eher einer künstlich geschaffenen Intelligenz glich, mit all den eingebauten und angehängten Apparaturen. Doch sein Geist war wohl immer noch wach genug, um seinen Geschäfte nachzugehen und weiterhin hohe Profite einzufahren.
Doch ich hatte vorgegriffen. Denn damals, im Jahre 2030, war die UNO eine der wichtigsten Institutionen auf Erden. Und so begann ich mich für eine Anstellung zu interessieren, sprach auch mit meinen Eltern darüber. Beide rieten mir dringend ab.
»Du wirst in einem solchen Moloch von Organisation niemals glücklich sein können«, gab mir mein Vater zu bedenken, »in einer Administration wie den Vereinten Nationen bist du nicht einmal ein Rädchen, sondern bleibst eine unbedeutende Schraube, die auf der Stelle dreht und niemals Einfluss auf den gesamten Organismus nehmen kann.«
»Du solltest aufhören, die Welt ändern zu wollen. Das hat doch noch kein einziges Mal in der Geschichte funktioniert«, meinte Maman, »und die Versuche haben eigentlich stets nur Leid und Unglück über die Menschheit gebracht.«
Selbstverständlich hörte ich nicht auf die beiden, sondern arbeitete weiter an meinem A-Better-Live Projekt, wie ich es insgeheim nannte. Doch es war mir bewusst, dass ich mich seriös auf die neue Lebensaufgabe vorbereiten musste. So ließ ich mich zuerst von einer angesehenen Agentur in Wien anstellen. Die stand für regenerative Nachhaltigkeit und ihre Arbeit hatte zum Ziel, nicht etwa einen möglichst kleinen Fußabdruck zu hinterlassen, sondern echte Mehrwerte zu schaffen. Wir berieten internationale Konzerne und auch ganze Länder bei der Ausarbeitung und Umsetzung entsprechender Strategien und Konzepte.
In den nächsten beiden Jahren baute ich mir so ein wachsendes Netzwerk auf, reaktivierte zudem meine alten Kontakte zu Professoren und Studenten in Berlin und Paris, wandte mich sogar an die Leute, die ich während meines Praktikums in Bruxelles kennengelernt hatte.
Im Internet schrieb ich an drei Blogs gleichzeitig. Der erste stand für Umweltthemen, der zweite für medizinische Forschung, der dritte für politische Veränderung. Alle drei gestaltete ich aber nicht etwa mit extremen Ansichten aus, sondern mit höchst gemäßigten. Denn niemand bei der UNO würde eine Extremistin anstellen.
Alle Vorbereitungsarbeiten liefen innerhalb meiner Pläne. Doch ohne es selbst zu bemerken, radikalisierte ich mich wohl in diesen beiden Jahren immer stärker. Denn in jedem jungen Menschen wirkte wohl die Ungeduld auf recht ähnliche Weise. Nach außen hin konnte man die Fassade der Angepasstheit zwar lange aufrecht halten. Doch in seinem Inneren brodelte es weiter, vergiftete das Herz und die Seele, vertrieb die Würde, machte immer deutlicher dem Hass Platz. Im Internet und bei der Arbeit blieb ich also eloquent und war keineswegs rechthaberisch, auch wenn ich es meistens besser wusste. Doch so manches Mal sah ich früh morgens in den Spiegel, musterte mein Gesicht, übt an meiner Mimik, die mir immer wieder entglitt und die dann meine wahren Gedanken und Gefühle zeigte.
Zumindest eines lernte ich in dieser Zeit, dass man Menschen niemals zu etwas zwingen sollte, sie aber auch kaum je zu überzeugen vermochte. Besser war, man erforschte ihre Schwächen, nutzte diese konsequent aus und begann sie so zu steuern. Die einen waren eitel, die anderen stolz, die dritten auf Ehre und Anerkennung erpicht. Ich probierte das Konzept der indirekten Beeinflussung zuerst bei einigen meiner regelmäßigen Blog-Leser aus, begann sie zu manipulieren. Später flossen meine Erfolge auch in die Arbeit bei meinen Kunden ein. Man schenkte mir mehr Beachtung, lobte mich vor meinen Vorgesetzten. So übte ich die meiste Zeit über für meinen großen Auftritt auf der Weltbühne, dem ich immer zuversichtlicher, aber auch ungeduldiger entgegenblickte.
Ach, wie enthusiastisch oder doch eher fantastisch man als junger Mensch doch dachte, handelte, lebte, wie radikal man sein Leben seinen Überzeugungen widmen konnte, selbst wenn sie ehrlich und objektiv betrachtet von Anfang an zum Scheitern verurteilt waren.