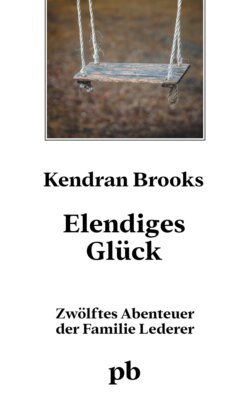Читать книгу Elendiges Glück - Kendran Brooks - Страница 5
Kapitel 2 – Das Ziel
ОглавлениеWie veränderte man die Welt nach seinen Wünschen?
Bestimmt nicht als Terrorist, denn mit Mord und Totschlag konnte man zwar neue Kapitel im Buch der Zeit aufschlagen, doch die weitere Entwicklung entglitt einem zwangsläufig.
Es nutzte aber auch nichts, sich an die Spitze eines Weltkonzerns zu setzen, denn die Mittel blieben stets bescheiden, selbst wenn sie Milliarden von Dollar betrugen. Aber auch als Präsident eines Landes oder als Chef einer Junta war einem der Erfolg verwehrt, denn zu kleinräumig und damit unbedeutend waren selbst die größten und militärisch mächtigsten Staaten. Und schon gar nicht funktionierte ein Auftritt als Prediger der Wahrheit, ob als Priester in einer Kirche oder als Wissenschaftler an Kongressen.
Und in der mächtigen, weltumspannenden Organisation, den Vereinten Nationen? Auch sie konnte höchstens als Steigbügelhalter dienen, denn zu verzettelt und mit zu vielen Stimmen und Zungen wurde dort geredet und entschieden.
Nein, die Welt veränderte man niemals in der Öffentlichkeit, sondern ausschließlich im Verborgenen. Denn weder die Religionen noch die Staaten und schon gar nicht die Kultur kamen gegen die vierte Kraft im menschlichen Universum an, gegen die Zivilgesellschaft. Sie trat in den letzten Jahrzehnten immer stärker hervor, organisierte sich neu über Soziale Medien und Diskussionsplattformen, hatte neue Formen eines kollektiven Bewusstseins und Gedächtnisses entwickelt. In früheren Jahrhunderten rotteten sich die Menschen manchmal spontan zusammen, putschten sich gegenseitig zu einem gewaltigen Zorn auf, schlugen dann blindwütig und wenig koordiniert zu, schufen so neue Voraussetzungen. Die Französische Revolution war wohl das beste und erfolgreichste Beispiel dafür. Und exakt diesen Ansatz wollte ich verfolgen, nur mit den heutigen Mitteln der Kommunikation, mit Twitter, Facebook, Instagram & Co.
Selbstverständlich war ich nicht so naiv, die staatliche Überwachung all dieser Orte außer Acht zu lassen. Mein Vater gab mir manchen Tipp, wie ich mir mit falschen Identitäten unerkannt Zutritt zu diesen Räumen verschaffen konnte. Dabei war das Verbergen der IP-Adressen noch das geringste Problem, zumindest wenn man über genügend Geld verfügte. Doch das allerwichtigste war ein subtiles Vorgehen, kein direkter Angriff auf die bestehenden Institutionen. Denn es gab einen guten Grund, warum der Degen das Schwert abgelöst hatte und der hieß Fortschritt.
Anonymous hatte es vorgemacht, eine Gruppe von Computer-Hackern, die ab und zu Krieg spielten, gegen Regierungen, gegen Unternehmen, ja sogar gegen Terror-Organisationen. Mein Vater erzählte mir von solchen Aktionen und ich lauschte begeistert seinen Ausführungen, fühlte mich wie ein Teil des Abenteuers, wie ein neuer Wilhelm Tell, ähnlich einem Freibeuter mit Kaperbrief. Womöglich hatte mein Vater damals meinen Geist das erste Mal so richtig freigesetzt, die Tür zu meinem Käfig weit aufgestoßen, der einem das Elternhaus, die Schule und der Freundeskreis schufen. Und es war weit weniger ein Wissen, sondern vielmehr ein Spüren, das Fühlen von Rebellion und Freiheit. Wenn ich mich an diese Tage zurückbesann, soweit das mit über hundert Lebensjahren noch möglich war, dann überkam mich ein freudiger Schauder und ein mächtiges Glücksgefühl, die Herz und Seele öffneten.
Vor allem, dass Anonymous damals sogar gegen die gefährliche ISIS vorging, dem Islamischen Staat im Irak und Syrien, ihnen Daten stahl und veröffentlichte, ihre Zahlungsströme störte und den westlichen Streitkräften nützliche Informationen zuspielte, beeindruckte mich sehr. Denn wenn bereits eine kleine Gruppe von Enthusiasten aus dem Verborgenen heraus nicht nur das Verbrechen bekämpfen, sondern gar Einfluss auf die Handlungen mächtiger Staaten nehmen konnte, was erst vermochte ein großes Netzwerk an Gleichgesinnten bewirken, das in unmittelbarer Nähe der Schaltstellen der Macht saß?
*
Taio Ouko hieß mein Vorgesetzter. Er war Kenianer und Vorsteher des Department of Regional Programmes and Field Representation bei der UNIDO in Wien. Ich arbeitete in der Abteilung zur Unterstützung der industriellen Entwicklung in Ostafrika und auf der arabischen Halbinsel. Neben Französisch, Englisch, Deutsch, Spanisch und Portugiesisch sprach ich selbstverständlich die Sprache meiner äthiopischen Mutter, Amharisch, hatte mir während meiner Zeit in Paris aber auch Arabisch angeeignet, um mir als Künstlerin leichteren Zugang zu den zahlungskräftigen Scheichs aus den Ölstaaten zu verschaffen. Die erste Zeit las ich vor allem die Berichte über die laufenden Projekte, analysierte sie und fasste sie für die Leitungsebene zusammen, bekam auf diese Weise rasch einen Eindruck von der schieren Zahl an Aufgaben und über die hohe Komplexität der politischen und wirtschaftlichen Verflechtungen innerhalb denen die UNO ein gewichtiges Wort mitredete. Doch es dauerte eine ganze Weile, bis ich die Tücke und die Verworfenheit meines neuen Arbeitgebers Taio Ouko erkannte.
Ich machte mich von Anfang an bei allen Leuten beliebt, war vor allem zu den weiblichen Angestellten eher unterwürfig, ließ nur immer wieder meinen Geist und mein Wissen aufblitzen, gab mich sonst aber höchst bescheiden, spielte die graue Maus, die jedermann für seine Zwecke einspannen konnte, in diesem Fall jedoch eher jede Frau. Susanne Wolke-Oberhansigger arbeitete in der Buchhaltung und mit ihr schloss ich bald einmal eine Art von Freundschaft. So verriet sie mir im Vertrauen, dass unser oberster Boss, Taio Ouko, nur erster Klasse reiste und in Präsidenten-Suiten von 5-Sterne-Hotels übernachtete. Seine monatlichen Spesenabrechnungen beliefen sich in der Regal auf über eine halbe Million Dollar, da er meistens in Begleitung einer ganzen Entourage unterwegs war, vor allem mit seinen beiden persönlichen Assistentinnen, eine hochgewachsene, hagere Finnin mit blondem, kurzgeschorenen Haar und einer ausgeprägten Nase, die ihrem Gesicht die Kühnheit eines Feldherren verlieh, sowie einer gemütlich wirkenden, drallen Rumänin, deren riesige Brüste völlig natürlich waren und die trotz wehrhaftem BH bei jedem ihrer Trippelschritte bedenklich auf und ab wogten.
»Taio schläft mit beiden«, meinte Susanne abfällig, »und Kaya soll im Ritz in Paris beim Sex so laut geschrien haben, dass die Leibwächter die Türe zur Suite aufbrachen, um nach dem Rechten zu sehen. Ich hab die Rechnung des Hotels für die Behebung des Schadens gesehen. Und Stella arbeitete früher für einen Escort-Service in Bukarest. Die dämliche Kuh kann noch nicht mal tippen.«
»Und warum wird das toleriert? Ich meine die übertriebenen Spesen und die Nutten?«
»Ach, da gibt es noch viel Schlimmere bei den Vereinten Nationen. Ich hab gehört, ein Amerikaner hätte vor drei Jahren in New York eine Party auf Kosten der UN geschmissen, die über zwanzig Millionen Dollar gekostet hat.«
Susanne klang bei diesem Vorwurf eher begeistert und keineswegs entrüstet. War sie selbst in irgendwelche Machenschaften verwickelt? Nein, dann hätte sie wohl kaum mit mir so offen darüber gesprochen. Oder bewunderte sie die Dreistigkeit dieser Spesenreiter? Auch das stimmte nicht, wie sie mich gleich anschließend belehrte.
»Der Amerikaner wurde wegen Veruntreuung angeklagt und zu drei Jahren Gefängnis verurteilt.«
Nun klang ihre Stimme zufrieden und das war sie wohl auch.
»Ist Taio Ouko denn auch sonst korrupt?«, fragte ich vorsichtig nach.
»Nicht mehr als andere, würde ich sagen. Selbstverständlich erhält jeder höhere Beamte ein paar Zuwendungen von Regierungen und Konzernen. Doch Taio übertreibt nicht, hält sich sogar eher zurück.«
»Woher weißt du das?«
Susanne schmunzelte wissend.
»Ich habe über einen guten Bekannten, der für die externe Kontrollstelle arbeitet, Zugang zu den internen Berichten. Darin findet man auch eine Korruptionsbewertung über jeden Direktor. Streng vertraulich, selbstredend.«
»Und warum tut die UNO nichts oder kaum was gegen korrupte Beamte?«
Sie zuckte mit den Schultern.
»Alles kleine Fisch, die selbst ja nur wenig bewegen können. Die Gelder für die Projekte werden über Ausschüsse gesprochen und die Kosten dafür separat überwacht und abgerechnet. Da ist nicht allzu viel Luft für Mauscheleien. Du darfst nicht vergessen, die UNO ist ein Weltkonzern und verschiebt jedes Jahr Dutzende von Milliarden Dollar. Das kann gar nicht ohne Korruption ablaufen.«
Sie sagte das so locker und leicht, als hätte sie eine Gehirnwäsche hinter sich. Die Buchhalterin war gut zehn Jahre älter als ich. Würde ich mit Mitte dreißig auch so denken? Wurde einem die Korruption, die persönliche Bereicherung auf Kosten der Allgemeinheit, irgendwann egal?
Ich war auch ein wenig enttäuscht. Denn ich hatte selbstverständlich gehofft, dass gerade in meiner Abteilung, die mit Industrie-Entwicklung zu tun hatte, die Bestechungsgelder ganz besonders reichlich flossen und darum sehr viel aufzudecken wäre. Doch Susanne Wolke war vom Gegenteil überzeugt. Trotzdem leistete sie mir gute Dienste leisten. Nur musste ich sie behutsam an ihre neue, zusätzliche Aufgabe heranführen. Denn wer jemals auf der Pirsch war, der wusste, dass man ein scheues Reh unweigerlich vertrieb, wenn man zu forsch auf das Tier zuging.
In Jahr 2032 begann die große Registrierung aller Menschen weltweit. Auch mir wurde der Chip in den Unterarm geschossen, auch meine Personalien landeten nebst einigen biometrischen Daten im Zentralcomputer der UNO, wo sie allen Nationen zur Informationsentnahme zur Verfügung standen, zumindest die Grunddaten wie Name, Geschlecht, Geburtstag, letzter bekannte Wohnort und Informationen zur Identifikation, ein Foto, die Fingerabdrücke und ein Scan der Iris. Die USA, Russland, China und einige kleinere Länder wie Kanada, Australien und Japan verweigerten sich dieser von Europa ausgehenden Aktion, bauten ihre eigenen, autonomen Datenbanken aus. Sie wollten vor allem nicht riskieren, dass ihre Bevölkerung für andere Nationen gläsern wurde. Entsprechend kompliziert gestaltetet sich daraufhin die Reisetätigkeit, vor allem für weltweit tätige Geschäftsleute und politische Funktionäre. Die mussten ihre persönlichen und biometrischen Daten spätestens bei der Einreise in die entsprechenden Länder abgeben. Bereits liefen Hunderttausende von Menschen mit mehr als einem halben Dutzend Chips im Unterarm herum. Die taten zwar nicht weh, führten auch nur selten zu Infektionen, bereitete aber den Lesegeräten immer wieder Probleme, falls sie zu dicht nebeneinandersaßen. Doch man rechnete damit, dass sich der UNO-Standard in einigen Jahren weltweit durchzusetzen vermochte und die nationalen Datenbanken mit ihren eigenen Chips irgendwann verschwinden würden. Denn da alle Länder, die sich dem UN-Konzept angeschlossen hatten, die Daten der reisenden Amerikaner, Russen, Chinesen und so weiter ebenfalls an den Zentralcomputer meldeten, war ein Abseitsstehen zumindest langfristig völliger Unsinn, weil die Daten reines Stückwerk blieben.
Auch ich hatte mittlerweile fünf Chips in meinem linken Arm. Doch sie störten und beeinträchtigten mich nicht. Und während sich autonome Gruppen lautstark und mit gewalttätigen Demonstrationen gegen die Zwangsregistrierung durch ihre Regierung wehrten, sich den Sicherheitskräften zu entziehen versuchten, manchmal sogar durch den Einsatz von Waffen, da dachte ich vor allem an die großen Vorteile für die Zukunft dieser anfänglichen Mehrfach-Registrierung mit Chips. Denn mit genügend krimineller Energie konnte man jede Vielfalt für eigene Zwecke nutzen.
Meine Analysen und Berichte kamen übrigens gut an und nicht lange, so interessierten sich höhere Führungskräfte für meine Bemühungen. Ich stieg ein paar Stufen auf der Karrieretreppe hoch, ohne dass ich auch nur mit einem der Kerle hätte schlafen müssen, ein sicheres Zeichen für die Qualität meiner Arbeit. Bald einmal leitete ich ein ganzes Analyse-Team, das sich geographisch auf Ostafrika konzentrierte. Und ich besuchte viele internationale Kongresse, knüpfte so weltweit Bekanntschaften, ging mit manchem Abgeordneten einer fremden Nation ins Bett, soweit er mir und meinen Zwecken dienen konnte und mir sympathisch war.
Ja, als Künstlerin in Paris hatte ich gelernt, wie man seine Haut zu Markte trägt und nutzbringend an den Mann oder die Frau brachte. Damals verlor ich öfters jede Hemmung, war nicht nur einmal nach einer wilden Nacht in einem ganzen Getümmel von Körpern aufgewacht, konnte mich an Einzelheiten zur jeweiligen Orgie auch später kaum mehr erinnern. Mit Meskalin versetzter Mezcal war Ende der 20er-Jahre die beliebteste Party-Droge gewesen. Er putschte nicht nur ungemein auf, er führte den Körpern unmittelbar in eine Art von Ekstase, in der man rasch den Überblick verlor, einfach abtauchte in eine Welt voller farbig visueller Halluzinationen. Und während alle anderen Sinne und selbst die Gefühle für Wärme oder Kälte gedämpft wurden, stieg das sexuelle Verlangen stark an. Dass manche Menschen bei einem Meskalin-Rausch Atemnot, Übelkeit oder Kopfschmerzen verspürten, war mir unverständlich geblieben, hatte ich selbst doch nur positive Erinnerungen daran oder ums exakt zu umschreiben, nur positive Aussetzer erlebt.
Die Staaten China, Japan und Australien hatte ich bislang noch nicht bereist, weshalb die entsprechenden Chips mit der Registrierung in meiner Unterarm-Sammlung noch fehlten. Doch diese drei Länder traten, seit dem militärischen Rückzug der USA aus dem westlichen Pazifik, derart aggressiv gegen ihre Nachbarn auf, dass man den Ausschluss von China aus dem Sicherheitsrat der UNO diskutierte. Noch zögerten die anderen Mächte. Würden sich allerdings die vielen Streitigkeiten und die bislang zum Glück noch unbedeutenden, militärischen Geplänkel um unbewohnte Inseln und um die Ausweitung der Seehoheitsgebiete weiter intensivieren, die Krise ließe sich auch bei den Vereinten Nationen kaum mehr unterm Deckel halten.
Auch die chinesischen UN-Mitarbeiter traten meistens ausgesprochen arrogant auf, waren im Grunde genommen bloß verlängerte Arme der Zentralregierung in Peking, fühlten sich dieser Rolle voll und ganz ihrem Staat und nicht der Welt verpflichtet. Auch zwei meiner Mitarbeitenden im Team stammten aus dem Reich der Mitte. Doch schienen sie loyal gegenüber den United Nations zu sein. Aber wer konnte schon wissen, was die Zeit brachte? Ich behielt beide ganz besonders im Auge, ließ auch einzelne ihrer Berichte auf eine mögliche politische Einflussnahme aus Peking von dritter Seite untersuchen. Ling Wembo und Huyn Jabba gehörten allerdings beide der ethnischen Minderheit der Uiguren an, waren von der UNO direkt angestellt worden und nicht etwa offiziell von Peking entsandt. Von den beiden lernte ich viel über das Land der großen Mauer und seine oft schmerzvolle Geschichte. Hätte ich allerdings damals gewusst, was das Schicksal Böses mit den beiden vorhatte, ich wäre wohl anders vorgegangen und hätte sie nicht in Lebensgefahr gebracht.
Mit den Toten, die man zu seinen Lebzeiten zu verantworten hatte, musste man umzugehen lernen. Oder man ging an seinen Aufgaben zugrunde.
*
Ich war in Addis Abeba an einem weiteren Entwicklungs-Kongress, besuchte selbstverständlich auch meine Verwandten in der Hauptstadt Äthiopiens. Meine Großeltern waren damals schon alle tot. Die Eltern meines Vaters Jules in der Schweiz starben bereits viele Jahre vor meiner Geburt. Die meiner Mutter in Äthiopien als ich noch ein Teenager war. Doch es gab noch einen ganzen Haufen von Tanten, Onkeln, Kusinen und Neffen zu begrüßen. Am meisten freute ich mich allerdings auf Elvira, die Tochter von Mutobo Suheli und Erina Kassahun. Sie hatte ich als Kleinkind in Hara kennengelernt, wo ihre Eltern ein Entwicklungsprojekt über mehrere Jahrzehnte führten. Und auch später besuchten meine Eltern und ich das Dorf immer wieder und Elvira und ich konnten unsere Freundschaft erneuern und vertiefen.
Sie war zu einer selbstbewussten Frau herangewachsen, hatte Architektur studiert, war bei einem angesehenen und großen Planungsunternehmen angestellt, arbeitete allerdings wenig kreativ, wie sie mir gegenüber bemängelte, wurde vor allem auf den zahlreichen Baustellen zur Überwachung der Materialanlieferungen und dem Prüfen und Abzeichnen von Arbeitsrapporten eingesetzt.
»Wenn du nicht männlich und über vierzig bist, darfst du entweder am Bildschirm das umsetzen, was alte Männer als deine Vorgesetzten sich ausgedacht haben oder du machst Laufburschen-Arbeit, so wie ich.«
»Das ist doch nicht schlimm, Elvira«, tröstete ich sie, »du musst nur das Richtige daraus machen.«
»Wie meinst du das?«
»Na, knüpfe doch engere Verbindungen zu den Baugeschäften und Zulieferern. Stell sie vor künstlich geschaffene Probleme und löse sie gemeinsam mit ihnen und zu ihrer Zufriedenheit. So machst du dich nicht nur wichtig, sondern gleichzeitig auch höchst beliebt. Ich bin mir sicher, deine Chefs werden deine Qualitäten rasch erkennen und dir wichtigere Aufgaben übertragen, zum Beispiel das Aushandeln von Offerten. So kommst du auch direkt an eure Klienten heran und kannst dich nach ein paar Jahren selbstständig machen und dein eigenes Architekturbüro aufziehen.«
»Ganz schön raffiniert«, meinte Elvira lächelnd, »doch will ich das überhaupt? Ich meine, Karriere machen oder eine eigene Firma leiten? Auch meine biologische Uhr tickt nicht ewig.«
»Ach, wir beide sind doch noch jung«, wiegelte ich ab.
»Aber ich bin fünf Jahre älter als du und bereits dreißig. Und ich habe noch nicht einmal einen festen Freund.«
»Um Kinder zu bekommen, brauchst du doch keinen Freund?«, fragte ich etwas verwirrt zurück.
»Da kennst du meine Eltern aber schlecht«, lachte sie mich aus, »wenn Mutobo erfahren sollte, dass ich unverheiratet schwanger geworden bin, redet er kein Wort mehr mit mir.«
»Mach doch eine In-vitro-Fertilisation oder erzähl wenigstens deinen Eltern, du hättest dich für eine künstliche Befruchtung entschieden, weil du Mutter sein willst. Problem gelöst.«
»Du bist wie dein Vater«, mäkelte Elvira sogleich an meinem Vorschlag herum, »immer die rasche, unkomplizierte Lösung. Das Lederer-Syndrom, so nennt es mein Vater.«
Wir lachten beide derart laut auf, dass sich uns einige Gesichter im Lokal neugierig zuwandten. Wir sprachen deshalb sehr viel leiser weiter.
»Und du? Machst du denn international Karriere bei der UNO? Wann wirst du Generalsekretärin?«
Mein Gesicht hatte wohl in diesem Moment all das widergespiegelt, was ich in meinem Innersten empfand, denn Elvira zuckte zurück, als wäre aus dem Nichts ein Gespenst vor ihr aufgetaucht.
»Hab ich einen wunden Punkt berührt? Hast du Probleme?«, fragte sie besorgt. Ich schüttelte verneinend den Kopf.
»Ach, weißt du, wir sollten nicht länger über unsere Arbeit reden. Genießen wir diesen Abend und haben eine Menge Spaß zusammen.«
»Aber für Sorgen sind doch Freundinnen da?«, begehrte die gute Elvira sogleich auf, »komm, erzähl mir mehr davon.«
Und ich schüttete ihr in den folgenden fünfzehn Minuten tatsächlich mein Herz aus, sprach von der Korruption, auf die ich bei meiner Arbeit fast ständig stieß, auf die Geldverschwendung, die mir Susanne jeweils brühwarm weitergab oder all die Misserfolge in den Projekten, die auf unfähige Mitarbeiter und Vetternwirtschaft zurückzuführen waren, manchmal auch auf direkte Sabotage durch andere UN-Abteilungen oder Regierungen oder Wirtschaftsverbände. Sie ließ sich von meinem Pessimismus anstecken, fühlte nicht nur mit mir, sondern verschwisterte sich geradezu mit mir. Wir wechselten in ein indisches Restaurant, aßen gemütlich während zweier Stunden zu Abend, machten die unmöglichsten Pläne, verfolgten die idiotischsten Strategien, hatten ganz einfach ungeheuren Spaß an den wilden Einfällen und Utopien von zwei jungen Frauen, die das Universum retten wollten. Zuerst das Bier in der Bar, danach die Flasche Wein beim Inder hatten uns zusätzlich angefeuert und so landeten wir wenig später in einer Art von Tanzlokal, das jedoch nur von Lesben besucht wurde. Elvira hatte mich dorthin gelotst, vielleicht ihre Art mir zu zeigen, weshalb sie noch keinen festen Freund hatte.
Ja, wir küssten uns im Halbdunkel der Sitzgruppe, streichelten einander, empfanden eine große Zuneigung, die über die bisherige Freundschaft hinausging. Später gingen wir zu ihr, fetzten uns die Kleider vom Leib, kaum standen wir im kleinen, dunklen Flur und hatten die Wohnungstüre ins Schloss gedrückt. Wir küssten uns wild, leckten uns gegenseitig über Gesicht, Brüste und Scham, wurden immer gieriger aufeinander, so als hätte sich in all den Jahren unserer innigen, doch kindlichen Freundschaft eine derart gewaltige Menge an Erotik angehäuft, dass sie nun unweigerlich zur Explosion kommen musste.
Wir hatten uns schon als Kinder immer körperlich nahe gefühlt, gingen oft Arm in Arm durch die Straßen von Hara, streiften uns gegenseitig die Haare aus der Stirn, lächelten uns gerne an, sahen im gegenseitigen Aufblitzen unserer Augen die völlige Übereinstimmung. Elvira stellte sich in dieser Nacht als beinahe unersättlich heraus, kam auch sehr leicht zu ihren langanhaltenden Höhepunkten, so dass ich fast neidisch auf sie wurde. Vielleicht lag das aber auch an der Häufigkeit ihres Geschlechtsverkehrs. Denn meiner war in Wien über die letzten Monate regelrecht eingeschlafen. Zu sehr bewegten mich meine Arbeit und meine wachsende Erkenntnis über den Sumpf in der UNO und in den Regierungen der Länder, die wir berieten.
Wir aßen am nächsten Morgen in einem nahen Lokal zusammen Frühstück, blickten uns glücklich wie in Kindertagen in die Augen, hatte uns nichts vorzuwerfen.
»Und du musst wirklich schon heute zurückfliegen?«, versuche sie mich noch einmal zu locken. Aber ich nickte mit Bedauern: »Ja, man erwartet mich heute Abend in Wien. Leider.«
»Und wann kommst du wieder?«, fragte sie mich offen und ehrlich, wollte an der von uns beiden ungeplant entflammten Beziehung festhalten, suchte eine Zukunft mit mir, die ich ihr nicht geben wollte und auch nicht konnte.
»Unsere beiden Leben sind zu verschieden, Elvira«, und ich sah auch schon das Erschrecken und die beginnende Traurigkeit in ihrem Gesicht, »und ich habe für mich eine Aufgabe gewählt, die keine Partnerschaften erlaubt«, versuchte ich eine Erklärung, die sie nicht verstand oder nicht begreifen wollte.
»Aber was kann denn wichtiger sein als die Liebe?«, fragte sie mich höchst erstaunt, aber ziemlich naiv zurück.
»Alles ist wichtiger als die Liebe«, gab ich wohl etwas unwirsch zurück, denn ich sah wieder ihr Zurückschrecken, als hätte ich ihr ins Gesicht geschlagen, »alles ist wichtiger, denn die Liebe ist stets auf wenige Personen beschränkt, kann nie die gesamte Menschheit umfassen. Und was sind schon zwei oder vier glückliche Seelen, wenn der Rest der Welt zum Teufel geht?«
»Du klingst nicht wie die Alina, die ich kenne. Warum wälzt du derart düstere Gedanken? Warum erfreust du dich nicht einfach des Lebens? Denn was folgt danach? Wenn wir alt geworden sind und sterben müssen? Wir wissen es nicht. Doch dieser Augenblick, hier und heute, dieser Moment gehört ganz uns beiden. Er ist real. Die einzige Wirklichkeit und Wahrheit. Alles andere sind womöglich bloß Hirngespinste.«
»Bist du nun Philosophin geworden?«, spöttelte ich übertrieben deutlich, sah die Zornfalte zwischen ihren Augenbrauen auftauchen, so wie manchmal auch in unseren Kindertagen.
»Es gibt nichts Wichtigeres als Glück. Und die Liebe ist ein großer Teil davon. Ohne sie kann man kein Glück finden.«
»Und wenn ich gar nicht das Glück suche? Wenn ich stattdessen einem anderen Götzen dienen will?«
»Du nennst das Glück einen Götzen? Das ist nicht nur abfällig, sondern geradezu blödsinnig.«
»Auch Jules meinte mal, das Glück sei das einzig Bedeutende im Leben.«
Elvira nickte heftig zustimmend.
»Aber wenn du dir sein eigenes Leben vor Augen führst, dann hat er es nicht wirklich gesucht, im Gegenteil. Er hat es sich die meiste Zeit über mit dem Glück gehörig verdorben, oder etwa nicht?«
Wir schwiegen, schauten einander in die Augen, als wollten wir uns mit den unterschiedlichen Ansichten zum Sinn im Leben gegenseitig niederringen. Dort die Frau von dreißig, die letzte Nacht glaubte, mit mir ihr Glück gefunden zu haben. Hier die Frau Mitte zwanzig, die einsah, dass selbst der beste Sex keine wahre Befriedigung im Leben brachte, wenn man für sich eine andere, wahre Bestimmung erkannt hatte.
Ein halbe Stunde später schieden wir voneinander, versprachen uns immerwährende Freundschaft und Liebe und anderes dummes Zeug. Ich sah Elvira für viele Jahre nicht mehr. Und als wir uns wieder unverhofft trafen, da war sie längst zu meiner Feindin geworden.
*
Während meine Karriere bei der UNO weiter gedieh, baute ich ebenso stetig mein Netzwerk aus. Noch bestand es aus mehr oder weniger engen und damit wenig zuverlässigen Bekannten und ein paar echten und vertrauenswürdigen Freunden. Ich sammelte jedoch bereits fleißig Beweismittel gegen meine und andere Vorgesetzten und gegen Regierungsstellen und Konzerne. Vor allem in Kenia, Somalia und dem Jemen wurde ich erschreckend rasch und vielfältig fündig und die Völker dieser Länder litten und starben deswegen. Trotzdem berührten mich die grausamen Schicksale der Menschen nicht wirklich. Denn meine Pläne durfte ich nicht aufgrund der Leiden von Einzelnen aufs Spiel setzen, in dem ich beispielsweise zu früh und darum nur ungenügende Informationen und Beweismittel den Medien zuspielte.
Da gab es Infrastrukturprogramme, die entgegen allen Gesetzen des Rechts und der Logik in manchen Ländern durchgedrückt wurden und für die ganze Dörfer geschleift werden mussten. Industrieanlagen, die nicht einmal rudimentäre Schutzbestimmungen kannten und in der Folge ganze Landstriche verseuchten, hatten ihren Weg aus China und Südostasien bis nach Afrika gefunden. Und an manchen Orten wurden die Menschen von ihrem Land einfach vertrieben, um riesige Farmen für Export-Produkte aufzubauen, während die eigene Bevölkerung hungerte. Ja, Ostafrika war zur neuen Billig-Werkbank der Welt geworden, zumindest für die ganz besonders dreckigen Dinge. Als ich jedoch auf den ersten Korruptionsfall in Äthiopien stieß und sein Ausmaß alles Bisherige sprengte, setzte ich mich unverzüglich mit meinen Eltern in Verbindung, kündete meinen Besuch fürs nächste Wochenende an.
Meine Maman hatte bereits am Telefon gespürt, wie aufgewühlt und durcheinander ich war, erwartete meine Ankunft entsprechend angespannt, hatte wohl auch meinen Vater mit diesem Virus geimpft, so besorgt die beiden mir bereits unter der Eingangstüre entgegenblickten. Wir begrüßten einander so herzlich wie immer, wobei mich Jules länger in seinen Armen hielt als sonst üblich.
»Bist du gut geflogen?«, fragte Maman, um irgendetwas zu sagen und ich nickte nur, ließ mich von den beiden hinein und ins Wohnzimmer führen. Mein Vater setzte sich in einen der Sessel, meine Mutter neben mich aufs Sofa. Beide sahen mich derart vorsichtig lauernd an, dass ich laut auflachen musste.
»Ihr solltet euch sehen. Wie zwei Katzen, die gespannt vor einem Mausloch liegen und warten und sich fragen, ob wohl ein Nagetier als nächstes herausschlüpft oder doch eine gefährliche Giftschlange.«
Sie lachten beide nicht mit, behielten ihre Sorgenfalten im Gesicht. Das erste Mal in meinem Leben spürte ich das Alter meiner Eltern in dieser Deutlichkeit. Jules ging damals schon gegen die siebzig, Alabima hatte die fünfzig ein paar Jahre zuvor überschritten. Ihr aufregendes und manchmal gefährliches Leben und die Sorgen um ihre Kinder hatten sie rascher und stärker altern lassen als andere. Vor allem Jules mit seinem schlohweißen Haar glich eher einem Methusalem als seinem früheren Ich.
»Was ist passiert? Erzähl doch endlich«, fragte mich Maman auffordernd, wollte Klarheit.
»Darf ich meine Eltern nicht ab und zu besuchen?«
Ich wusste nicht, warum ich immer noch auswich. Wahrscheinlich eine Folge der Erkenntnis über das wahre Alter meiner Eltern, die mir auf einmal so seltsam verletzlich erschienen. Wo war der draufgängerische Jules von früher geblieben? Wo die unerschütterliche Alabima? Vor und neben mir saßen zwei Menschen, die ich bislang nicht gekannt hatte oder die ich bislang mit falschen Augen sah.
»Red nicht um den heißen Brei herum«, herrschte mich mein Vater ungeduldig geworden an. Meine Maman hatte ihm wohl in den letzten Stunden gehörig große Sorgen eingeimpft.
»Geht es um etwas Privates?«, fragte er nach und wirkte für einen Moment wieder so kämpferisch wie früher, straffte sogar seinen Oberkörper, stellte sich wie ein Widder zum Kampf. Doch als ich meinen Kopf schüttelte, da sah ich, wie er merklich in sich zusammensackte. Ja, Jules war nicht mehr der alte Haudegen, hatte sich in den letzten Jahren vom Geschehen in der Welt immer weiter zurückgezogen, führte mit Alabima ein unauffälliges, ruhiges und zunehmend stilles Leben. Ob die beiden wohl glücklich waren? Einzeln und miteinander?
Diese Frage bestürzte mich in diesem Moment und ich verdrängte sie rasch wieder, konzentrierte mich auf meine Antwort.
»Ich bin da auf eine Sache gestoßen, die mich persönlich stark berührt und über die ich mich mit euch austauschen will«, begann ich meine Erklärung unnötig nebulös, »ihr wisst ja, dass mittlerweile sämtliche Berichte der UN-Außenstellen in Ostafrika und im arabischen Raum über mein Pult gehen.«
Sie nickten schweigend und im Gleichklang. Eine solche Übereinstimmung hatte ich früher nie bei den beiden beobachtet. Auch das war mir nicht nur Zeichen für ihr Alter, sondern auch für ihre mittlerweile sehr eingeschränkte Sicht auf das Geschehen in der Welt. Sie beschäftigten sich fast nur noch mit sich selbst, sperrten wohl immer mehr Bereiche aus ihrem Leben und aus ihren Gedanken. Ich bereute bereits, in die Schweiz gereist zu sein. Doch es war mir klar, dass ich nun nicht mehr kneifen konnte.
»Derzeit läuft ein Rüstungsprogramm in Äthiopien. Die jetzige Regierung kauft für über sechzig Milliarden Dollar Waffen ein.«
»Und wie steckt die UNO da drin?«, warf mein Vater dazwischen und ich fragte mich einen Moment lang, ob dies eher Ausdruck seiner früheren Ungeduld war oder doch seine beginnende Vergreisung zeigte. Denn alte Menschen bekundeten nicht nur Mühe, zwei Dinge miteinander zu verknüpfen, die auf den ersten Blick wenige Gemeinsamkeiten besaßen. Sie lehnten auch Gedankenexperimente generell ab, waren kaum noch bereit, sich mit Neuem und Unbekanntem zu befassen.
»Ich komm gleich darauf zu sprechen«, schob ich seinen Einwand vor mich her, »jedenfalls lässt sich Äthiopien wissentlich schrottreife Waffen andrehen, unbrauchbares, völlig veraltetes Kriegsgerät.«
»Kommt mir bekannt vor«, meinte Jules, wirkte plötzlich aufgeräumt und sogar gut gelaunt, so als spürte er endlich wieder sicheren Boden unter seinen Füßen, »das gab’s schon einmal in den 1990ern. Damals war wohl die amerikanische CIA in den Betrug verwickelt, machte gemeinsame Sache mit der äthiopischen Regierung. Wahrscheinlich teilten sie sich damals den riesigen Gewinn. Und darin verwickelt war auch noch ein US-Amerikaner, der später größte Bedeutung für die Schweiz erlangte. Als nämlich die US-Justiz das Bankkundengeheimnis angriff. Birkenstock oder so ähnlich hieß der Kerl. Der arbeitete in Äthiopien für die CIA, stieg später bei der Schweizer Großbank ein, um sie anschließend in die Pfanne zu hauen…«
Er verstummte. Endlich. Vielleicht, weil er die Bestürzung in meinem Gesicht erkannt hatte? Denn ich dachte nur, was zum Teufel erzählt der alte Mann da? Plappert drauf los, als hätte ich einen Schalter umgelegt. Faselt von uralten Geschichten ohne jede Bedeutung für das Hier und das Heute. Verdammt. Ich will den alten Jules zurück, nicht diesen Greis.
»Jedenfalls«, nahm ich den Faden wieder auf, »sind die Waffen und Geräte einen Bruchteil der verrechneten Kosten wert, denn es handelt sich ausschließlich um ausgemusterte Teile der Nato. Ich stieß auf diesen Betrugsfall, weil man zur Finanzierung des Deals wohl auch Gelder aus einem Entwicklungsprogramm abzweigt, nämlich aus dem Ausbau der Autobahn zwischen Addis Abeba und Dschibuti. Denn obwohl nicht einmal zwanzig Prozent der Strecke bislang fertiggestellt sind, fielen bereits mehr als siebzig Prozent der Gesamtkosten an.«
»Und was willst du von uns wissen?«
Diese banale Frage meines Vaters ließ einen Graben zwischen mir und meinen Eltern aufbrechen, der sich rasch zu einer Schlucht vertiefte, als ich den ebenso ratlosen Blick meiner Maman erkannte. Die beiden schienen mit der Welt dort draußen abgeschlossen zu haben, lebten friedlich innerhalb der Mauern ihres Grundstücks am Lac Léman, interessierten sich nicht mehr für das Geschehen außerhalb ihres kleinen Reiches. Ich kam mir wie ein Depp vor und hätte ich die beiden nicht geliebt, ich hätte unser Gespräch wohl unverzüglich beendet.
»Versteht ihr denn nicht? Tausende von Arbeitsplätzen für den Bau der Autobahn fallen diesem Betrug zum Opfer. Wir sprechen immerhin von zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts von Äthiopien, die illegal abgezweigt wurden. Ein ungeheurer Diebstahl am Volk.«
Es tat mir in der Seele weh, dieses gleichgültige Achselzucken meines Vaters.
»Das Volk, wie du es nennst, ist doch selbst schuld. Was wählen die Leute seit mehr als fünfzig Jahren immer noch dieselbe Partei? Demokratie funktioniert nur, wenn sich die Regierenden die Mehrheiten zusammensuchen müssen. Fallen sie ihnen einfach so in den Schoss, dann entsteht automatisch Vetternwirtschaft und Korruption.«
Das war wieder einmal Mein Erklärbär Jules, wie Alabima meinen Vater früher ab und zu aufgezogen hatte. In der Sache mochte er zwar Recht haben. Nur nutzte dies niemandem was.
»Du solltest vielleicht der Frage nachgehen, was denn die Äthiopier an Gegenleistungen erhalten, wenn sie die Amerikaner an ihrem Betrug teilhaben lassen. Vielleicht steckt weit mehr dahinter als bloße Korruption von ein paar Politikern?«
Dass dieses Votum von meiner Maman kam, erstaunte mich nur einen Augenblick lang. Denn es war wohl so, dass meine Eltern ihre Rollen zu vertauschen begonnen hatten. Wahrscheinlich war das eine natürliche Folge der fortschreitenden Vergreisung von Jules. Während er in den letzten Jahren immer stärker abbaute, versuchte Maman die größer werdenden Lücken auf ihre Weise zu füllen. Ich lächelte ihr voller Anteilnahme zu, für ihren rührenden Versuch, den alten Jules auf ihre ganz eigene Art noch eine Weile am Leben zu erhalten. Funktionierten alle alten Paare auf diese oder ähnliche Weise?
»Ja, dieser Frage gehen wir bereits nach. Doch mich beschäftigt etwas anderes.«
Sie blickten mich beide zwar interessiert, aber auch seltsam distanziert an, so als wenn ich in diesem Moment nicht mehr ihre Tochter gewesen wäre, sondern eine Fremde, der man zwar zuhörte, deren Probleme einen jedoch nichts angingen.
»Was geschieht mit dem unterschlagenen Geld, das beim CIA oder anderen Geheimdiensten landet? Es sind viele Milliarden, die in unbekannte Kassen fließen.«
Mein Vater zuckte mit den Schultern, das Zeichen für meine Maman, ihm den Vortritt zu überlassen.
»Die Amerikaner werden damit andere Regierungen destabilisieren, Politiker kaufen, Waffen für Rebellen besorgen, einfach all das, was sie seit Jahrzehnten tun.«
»Und wenn ich einen Weg wüsste, wie man ihnen dieses Geld wieder abnehmen kann?«
Meine Frage hing im Raum wie eine Gewitterwolke, die jederzeit Blitze schleudern und alles vernichten konnte. Vor allem das Zusammenzucken meines früher immer so überlegen wirkenden Vaters beunruhigte mich. Er schien nur noch ein Schatten seiner selbst zu sein.
Selbstverständlich wusste ich mittlerweile recht gut Bescheid über seinen Auftrag damals in Mexiko, vor mehr als zwanzig Jahren, auch über seine ersten Erfolge und das anschließende Desaster. Einiges erzählte er mir selbst, anderes mein Bruder Chufu, den Rest erfuhr ich von meiner Maman und aus alten Zeitungsberichten. Ein paar Banker aus der Schweiz hatten Jules beauftragt, den USA gehörig auf die Zehen zu treten. Zu diesem Zweck sollte er Beweise für die Zusammenarbeit der US-Geheimdienste mit Terroristen und Verbrecherorganisationen sammeln. Mein Vater war zwar erfolgreich. Doch die Banker verrieten ihn anschließend, brachten so ihn und unsere gesamte Familie in Todesgefahr. Zudem bekamen wir die mexikanische Drogenmafia auf den Hals gehetzt und Chufu und seine heutige Frau Mei wurden entführt. Jules tat wohl alles, um die beiden frei zu bekommen, ermordete vier Mexikaner auf bestialische Weise, nur um an Informationen zu gelangen, die sich hinterher als völlig nutzlos erwiesen. Nach diesen schrecklichen Erlebnissen veränderte sich mein Vater, wie Maman mir später erzählte und ich es auch als Kind spürte. Er zog sich aus dem Leben zurück, begegnete allen fremden Menschen mit Misstrauen, füllte unseren Keller mit immer mehr Waffen und Munition, so als gälte es einen weiteren Weltkrieg zu überstehen. Vielleicht war das der Beginn einer Schizophrenie, vielleicht aber auch nur die Auswirkungen seiner Angstzustände. Ich selbst erlebte als Kind mehrere Male, wie er mitten in der Nacht schreiend und schweißgebadet aufwachte und von meiner Maman kaum zu beruhigen war. Ein paar Jahre später befiel ihn ein Krebsleiden, das Jules nicht zu überleben hoffen durfte. Er schloss damals mit seinem Leben ab, hatte sich innerlich von uns, seiner Familie, gelöst und sich seinem Schicksal ergeben, erwartete nur noch seinen baldigen Tod. Doch dann rettete ihn ein experimentelles Medikament und Jules musste ins Leben zurückfinden, ein Weg, der ihm wohl sehr schwergefallen war und ihn noch mehr veränderte. Das konnte ich als Kind noch nicht nachvollziehen, als Erwachsene zumindest nachfühlen. Denn wenn jemand mit seinem Leben endgültig abgeschlossen hatte und es ihm dann doch überraschend erneuert wurde, was fing man mit dieser unverhofft geschenkten Zeit an? Was besaß nach einem solch einschneidenden Erlebnis noch Wert und Sinn genug, um sich dafür zu engagieren?
Mein Vater jedenfalls tat sich sehr schwer mit seiner Wiedergeburt und er ließ sich danach von einer Psychologin über viele Jahre begleiten und wohl recht erfolgreich therapieren. So jedenfalls berichtete es mir meine Maman später.
Und nun saß ich mit diesem gealterten Ehepaar in deren Wohnzimmer, hatte eine große Korruption geschildert und die Möglichkeit, sie öffentlich zu machen, musste nun erkennen, dass Jules genauso wie Maman ängstlich zurückzuckte, vor der Herausforderung, vor dem Unbekannten, vor der Gefahr. Ich war für einen Augenblick sehr enttäuscht, schalt mich dann aber eine Närrin. Denn wie hatte ich bloß von meinen alt gewordenen Eltern erwarten können, dass sie sich noch einmal und mit mir zusammen in ein neues Abenteuer stürzten? Mich zumindest berieten und anleiteten? Sie und mich, ihre Tochter, dadurch vielleicht in höchste Gefahr brachten?
Jules räusperte sich, wirkte auf mich verlegen und trotzig zugleich, ähnlich einem alten Dampfer, dessen Kolben längst nicht mehr rund in den Zylindern liefen, der deshalb nicht mehr auf die Befehle aus dem Steuerhaus unmittelbar reagieren konnte, sondern nur noch mit gehöriger Verzögerung oder gar nicht und deshalb wusste, dass seine Zeit im Grunde benommen längst abgelaufen war.
»Täubchen«, begann er und ich fragte mich, wann er diesen Kosenamen das letzte Mal verwendet hatte, konnte mich nicht erinnern, »warum suchst du die Gefahr? Glaub mir, ich habe gegen die CIA und andere Geheimdienste gekämpft, mein halbes Leben lang. Doch man kann sie nicht besiegen, höchstens etwas aufhalten, ihnen ein paar Stolpersteine in den Weg rollen. Doch sie überwinden jeden Angriff, weil die Mächtigen der Welt so sehr auf sie angewiesen sind. wird die Macht stets ihre Hände schützend über sie halten. Dein Kampf ist aussichtslos.«
»Ich will die Welt doch gar nicht verändern, Papa. Ich will bloß verhindern, dass ein armer Staat wie Äthiopien ausgebeutet wird und dass ein Geheimdienst sehr viel Geld in seine Hände bekommt, mit dem er ohne jede politische Kontrolle alles Mögliche anstellen kann.«
»Und wie hast du dir das gedacht?«, fragte meine Maman und zeigte sich mehr als skeptisch, lehnte alle meine Ideen ab, noch bevor ich sie beschrieben hatte, wollte ihr kleines Mädchen keiner Gefahr ausgesetzt sehen.
»Ich bin dabei, innerhalb der UNO ein Netzwerk von Gleichgesinnten aufzubauen. Mit dessen Hilfe will ich alle Informationen und Beweise für die Unterschlagungen öffentlich machen. Selbstverständlich verdeckt, so dass niemand die Spur zu mir und den anderen zurückverfolgen kann.«
»Deshalb dein Besuch? Willst du unsere Hilfe?«, fragte Jules und in seiner Stimme fand ich nur Ablehnung.
»Ja, eigentlich hatte ich gehofft, dass mich meine Eltern unterstützen würden.«
Während mein Vater seinen Kopf schüttelte, sah mich Alabima forschend an. Ich lächelte ihr um Verzeihung bitten zu: »Du verstehst mich bestimmt, Maman. Ich kann dieser Ungerechtigkeit nicht tatenlos zusehen. Auch du hast doch früher gekämpft.«
Sie nickte und blickte danach Jules auffordernd an. Und ich sah im Gesicht meines Vaters eine Veränderung. Zuerst biss er seine Kiefer fester zusammen, so dass sich die Muskeln unter seiner schlaff gewordenen Haut abzeichneten. Dann blitzte es in seinen Augen auf, so als erinnerte er sich an alte, glorreiche Tage, als käme seine Vergangenheit noch einmal zurück und lebte auf.
»Wie kann ich dich unterstützen?«
»Gib mir dein Notizbuch«, forderte ich und sah im selben Moment schon die Enttäuschung in seinem Gesicht stehen. Denn dass ich bloß an die vielen nützlichen Namen herankommen wollte, die Jules in seinem langen Leben zusammengetragen hatte, Adressen von verlässlichen Freunden und Vertrauten, auch von Kämpfern wie er selbst einer war oder Henry Huxley, sein enger Freund aus London. Das musste für ihn wie eine klatschende Ohrfeige gewesen sein. Nein, keinen Moment lang hatte ich wirklich daran gedacht, meinen alten Vater an diesem Projekt direkt teilhaben zu lassen. Denn seine Zeit war längst vorbei und er wäre bloß ein weiterer Unsicherheitsfaktor in meinem gefährlichen Spiel gewesen.
Doch dann, nach Sekunden des Schweigens und Starrens, da erwachte mein Vater wie aus einem Tagtraum, räusperte sich erneut und nickte dann, wirkte auf mich wie eine Schnecke, die vor einer Gefahr zurückzuckte und sich in ihr Haus verkroch.
»Also gut. Wenn du nur die Adressen willst?«
Das war keine Frage, sondern eine Kapitulation.
Ich blieb noch zwei Tage bei ihnen. Wir besuchten ein Konzert, gingen in der Stadt essen, spielten Familie, fast wie früher. Nur kam ich mir als die Erwachsene vor, während meine Eltern auf mich eher wie Kinder wirkten, vielleicht, weil sie auf alle meine Vorschläge und Ideen bereitwillig eingingen, mir überall den Vortritt ließen, sich auch meiner Führung anvertrauten. War auch diese Ablösung völlig normal zwischen Eltern und ihren Kindern?
*
Nach meiner Rückkehr nach Wien studierte ich Jules Notizbuch akribisch. Mein Vater hatte mir auch seinen Code beigebracht und so konnte ich die Verschlüsselung knacken und alles übersetzen. Und ich versuchte für jeden Namen aus meiner Erinnerung eine Verbindung herzustellen, schätzte so auch das ungefähre Alter der aufgeführten Menschen ab. Denn was hätten mir irgendwelche Greise wie Henry Huxley in London oder Toni Scapia in Miami genutzt oder gar längst Verstorbene? Es blieben rund zwei Dutzend Vertraute meines Vaters übrig. Allerdings kannte ich nur wenige von ihnen persönlich. Und wie viele von ihnen bereit waren, die Tochter von Jules Lederer zu unterstützen? Schon damals begann mein Spiel gegen die Mächtigen der Welt in unbekannte und kaum zu kontrollierende Bahnen zu gleiten. Doch was hätte ich anderes tun können? Mein Vorhaben aufgeben? Mit den Ungerechtigkeiten und der Korruption leben lernen? Wegschauen, so wie die Allermeisten? Nein, das kam für mich nicht in Frage. Zumindest damals nicht.
Nur zwei der Personen fand ich unter den angegebenen Adressen. Alle anderen musste ich mir aufgrund der Daten im Zentralcomputer der UNO mühsam zusammensuchen. Denn der Lebenslauf der meisten Menschen spulte sich nicht nach Schema F ab, kam nicht ohne harte Wechsel aus, erlebte einige nicht planbare Weichenstellungen. Die Europäer unter ihnen konnte ich leicht verfolgen, hatten doch die Regierungen auch ältere Registerdaten ihrer Bevölkerung in den UN-Computer einspeisen lassen, so auch jeden früheren Wohnortwechsel, solange er ordentlich gemeldet worden war. Doch das galt bei den vorhandenen Amerikanern, Asiaten und Russen keineswegs. So suchte ich über eine Woche lang nach dem Verbleib von Juri Antopow, ein russischer Atom-Wissenschaftler mit guten Verbindungen in den Kreml. Ich fand ihn in Irkutsk, einer Stadt am Baikalsee, wo er ein unbedeutendes, technisches Institut der staatlichen Universität leitete und immer noch als Professor tätig war. Man hatte ihn an diesem Ort wohl regelrecht kaltgestellt. Deshalb war fraglich, ob er mir noch nützlich sein konnte. Trotzdem rief ich ihn an, erwähnte den Namen meines Vaters, erkannte die Freude in seiner Stimme. Wir vereinbarten ein Treffen in Kiew, denn die Ukraine galt damals als eine Art von Pufferzone zwischen Europa und Asian, in der sich Leute aus dem Westen und aus dem Osten unbeschwert und in der Regel unbeobachtet treffen konnten.
Auch Juri Antopow war einiges über sechzig, wirkte jedoch noch voller Elan, wie ein Mensch, der noch Ziele in seinem Leben kannte. Wir fanden auf Anhieb einen guten Draht zueinander. Er erzählte mir, wie er meinen Vater kennenlernte, was sie zusammen erlebten. Und einmal mehr musste ich den früheren Jules ebenso bewundern, wie es Antopow immer noch tat. Wie schade, dass jedes Leben irgendwann zu Ende ging.
Juri stattete mich mit neuen Namen und Adressen von Leuten aus, die in Moskau einen gewissen Einfluss besaßen. Sogar zwei UNO-Mitarbeitende waren darunter, die mein Netzwerk ergänzen konnten. Ich weihte zwar Antopow nicht in alle Einzelheiten ein, dafür kannte ich ihn nicht gut genug. Und selbst die Empfehlung meines Vaters reichte nicht aus, mein Misstrauen gänzlich zu vertreiben. Denn was wusste man schon von Menschen und ihren wahren Schwächen?
»So wenige Spuren wie möglich hinterlassen«, war eine weitere Maxime meines Vaters, in der er mich von Kindesbeinen an schulte, »spiel deine Fähigkeiten und Möglichkeiten stets herunter«, war eine andere. Und so horchte ich Juri vor allem aus, notierte mir das, was mir wichtig erschien, war freundlich zu diesem netten, alten und etwas geschwätzigen Mann, fragte mich gleichzeitig, wo und mit wem er wohl über mich plaudern würde. Doch seine Versetzung nach Irkutsk war eigentlich Gewissheit genug für mich, dass er kaum noch überwacht wurde. Wir verabschieden uns fast schon als Freunde.
»Komm mich doch mal besuchen«, riet mir Juri, »der Baikalsee ist immer noch wunderschön, wenn man die richtigen Ecken kennt.«
Ich versprach ihm irgendetwas, hatte all das von ihm erhalten, war ich mir erhofft hatte, sah oder sprach ihn später nie mehr.
Es dauerte ein Vierteljahr, bis ich alle Kontakte hergestellt hatte. Mein Netzwerk innerhalb und außerhalb der UNO wuchs weiter an. Auch die Versuche der Beeinflussung meiner Blog-Leser schienen mir immer besser zu gelingen. Denn ich verfolgte den früheren Rat meines Vaters, bei jedem Menschen zuerst seine bestimmende Charaktereigenschaft zu erkennen und danach zu handeln. Da war der Stolz, die Suche nach Anerkennung, das Wissen/Können und die Würde. Und ich wusste, dass nur Menschen mit nicht zu ausgeprägter Würde für mein Vorhaben in Frage kamen.
Den Stolz eines Menschen konnte man leicht stärken oder auch brechen, je nachdem, was man bezweckte. Und wer nach Anerkennung strebte, für den war der mögliche Verlust der Ehre einfach unerträglich. Menschen aber, die von ihrem Wissen oder Können lebten, konnten überaus nützliche Instrumente sein. Aber sie waren derart eigenwillig, dass man sich nicht völlig auf sie verlassen durfte. Leute jedoch mit genügend Würde, konnten die Folter genauso ertragen wie Denunziantentum oder öffentliche Schmach, waren noch nicht einmal bei ihrem Wissen oder Können zu packen und zu verunsichern, weil sie sich selbst recht gut einschätzen konnten.
Doch wie erkannte man den Grad an Würde bei einem Menschen? Im Vergleich zu den anderen drei Charaktereigenschaften, die jeder besaß? Nun, ich tat es, indem ich Stolz, Ehre und Wissen/Können prüfte und die Reaktionen analysierte.
Den Stolz konnte man am leichtesten erforschen. Meistens ergab der sich bereits aus dem allgemeinen Gebaren eines Menschen, aus seinem Auftreten, seiner Stimme. Und man konnte den Stolz sehr leicht reizen und so den Grad der Würde dieses Menschen beobachten.
Um das Bedürfnis nach Anerkennung und Ehre auszuloten, musste man erst einiges Privates und Geschäftliches erfahren. Ich lenkte das Gespräch darum meist auf mögliche Mitbewerber, auf Kollegen oder auf Nachbarn. So erkannte man recht schnell, wer seinen Stolz, sein Wissen und sein Können der Anerkennung durch Dritte allzu leicht opferte.
Die Nerds jedoch, Leute die ganz aus Wissen oder Können bestanden, erkannte man sofort an ihrer fehlenden Empathie für andere Menschen. Doch ich musste zusätzlich sicherstellen, dass diese Fehlleistung nicht auf übertriebenem Stolz beruhte. Denn die Lust, sich über andere zu erheben, führte ebenso zu emotionalem Unverständnis.
Die wahren Nerds besaßen in der Regel kaum Würde oder ließen sie einfach nicht gelten, betrachteten sie sogar als eine Schwäche. Doch da sie stets rational dachten und handelten, konnte ich sie trotz fehlender Empathie recht gut in mein Netzwerk knüpfen.
Wer die ersten Prüfungen überstand, den testete ich immer auch noch direkt bezüglich der Stärke seiner Würde. Ich sprach über den Sinn des Lebens, über die Zivilgesellschaft und ihren Wandel, auch von neuen Strömungen in Politik und Wirtschaft. Menschen mit zu viel Würde für meinen Zweck redeten bei solchen Themen gerne so, als würden sich alle anderen Menschen wie Kinder aufführen. Sie waren sich selbst derart sicher, dass sie jeden anderen am liebsten anleiten wollten, ihm ihre Führung aufdrängten. Mit solchen Besserwissern konnte man kein verborgenes Netzwerk aufbauen und über lange Zeit erfolgreich betreiben. Ihre Ansprüche an die Welt waren zu rigide. Sie würden immer viel zu viel von sich selbst und allen anderen erwarten.
Im Laufe der Monate stellte ich fest, dass nur etwa jeder zwölfte Kandidat in Frage für mein Netzwerk kam. Doch als höhere Angestellte der UNO hatte ich jeden Tag mit vielen verschiedenen Menschen zu tun, stellte jede Woche bestimmt dreißig neue Kontakte her.
Als das Jahr zu Ende ging, war mein geheimes Netzwerk auf über einhundertfünfzig Personen angewachsen. Und die wenigsten von ihnen kannten einander, wussten gar nicht um die wahre Bedeutung und Größe unserer Gruppe. Denn ich hielt vor ihnen alles klein und wenig umfassend, so als wären sie und ich bloß ein kleiner Haufen von Verschwörern, die in ihrem eng begrenzten Bereich geringe Verbesserungen anstrebten. Über die eigentliche Organisation und ihre Ziele waren sie nie informiert.
Ich hatte vor wenigen Wochen meinen sechsundzwanzigsten Geburtstag im engsten Bekanntenkreis gefeiert und mein Schicksalsjahr 2033 stand vor der Tür.
*
Die Unterschlagungen rund um den Autobahnbau in Äthiopien wurden zu unserem Probestück. Wir begannen, in den unterschiedlichsten Berichten der UN-Verwaltung gewisse Hinweise einzustreuen. Wir machten auf diese Weise das recht große Projekt innerhalb der Organisation immer bekannter. Wenig später ließen wir eine Aktennotiz auftauchen, die Kopie einer fingierten E-Mail, die auf Ungereimtheiten hinwies und zusätzliche Abklärungen forderte. Sie landete über Umwegen auf den Pulten der internen Revision, wurde dort von einer Sachbearbeiterin aufgenommen. Wir sorgten dafür, das erste, naiv gestellte Fragen unbeantwortet blieben. Das förderte die Neugierde der Erbsenzähler. Und so beschäftigte sich plötzlich ein Abteilungsleiter um das Thema, forderte Aufklärung, traf diesmal auf echten Widerstand von unseren Chefs, so dass der Mann um Unterstützung durch seine Vorgesetzten bat. Nur vier Wochen später platzte die Bombe endgültig und der Fall wurde ganz groß in der Weltpresse aufgerollt, nachdem sich ein erstes Dutzend der großen Zeitungen von uns gesteuert auf die Story gestürzt hatte.
Eine Untersuchungskommission fand problemlos genügend Hinweise zu Korruption und stichhaltige Beweise für all die Veruntreuungen, die wir zuvor säuberlich an verschiedenen Stellen im immensen Archiv der UNO abgelegt hatten. Und da diese Daten von mehr als zwei Dutzend unabhängigen Abteilungen zusammengetragen worden waren, kam nicht einmal der Hauch eines Verdachts auf, dass es sich um ein gesteuertes Komplott handelte.
Die gesamte Regierung Äthiopiens trat zurück und Neuwahlen fanden statt. Die USA zahlten im Namen der CIA siebenundzwanzig Milliarden Dollar an die geschädigte Staatskasse zurück. Der Direktor und weitere Beamte mussten die CIA verlassen und eine parlamentarische Untersuchungskommission sollte wieder einmal zusätzliches Licht ins Dunkel der Geheimdiensttätigkeiten bringen, dies allerdings zugegebenermaßen ohne nennenswerten Erfolg.
Alles in Allem ein kleiner Sieg für die Menschheit, aber ein sehr großer für unser Netzwerk.
Wir wurden mutiger.
Leider.
*
Die Kommunikation untereinander war eine der Schwachstellen. Das war mir von Anfang an bewusst gewesen. Telefonate kamen aufgrund der weltumspannenden Abhörnetze eh nicht in Frage. Ebenso wenig taugte der E-Mail-Verkehr, selbst nicht mit den Standard-Verschlüsslungen, die längst von den führenden Nationen geknackt worden waren. Doch wir arbeiteten fast alle für die UNO und die besaß zwei abhörsichere Kommunikationswege. Das eine war uralt, das zweite nur wenig jünger.
Seit über hundert Jahren gehörte der Telex zu den sichersten Verbindungen, weil der Austausch von Informationen immer nur zwischen zwei Geräten erfolgt und der Verschlüsselungscode der Daten ad hoc festgelegt wurde, ohne bestimmbare Regel. Das zweite sichere Verfahren gehörte vor einem halben Jahrhundert zum Standard jedes Unternehmens, wurde in den letzten zwanzig Jahren jedoch kaum noch genutzt. Denn der Telefax war umständlich und langsam, jedoch ebenso sicher vor jeder Spionage wie der Telex.
Beide Verfahren hätte man nur mit einem riesigen Aufwand knacken können. Und das Aufspüren einer wichtigen Mitteilung wäre reines Glück gewesen. Das waren wohl auch die beiden wichtigsten Gründe gewesen, warum die Staaten diese Formen der Kommunikation so weit als möglich zurückgedrängt hatten und das Internet als Kommunikationsmittel derart populär machten. Denn im Netz hatte man es nie mit reiner ad hoc Maschinenlogik zu tun, konnte auch Unternehmen, die Verschlüsselungssysteme entwickelten, problemlos ausspionieren, einschüchtern oder gar erpressen und sich so Zugang zu allen geschützten Daten verschaffen.
Ich wusste allerdings, dass unsere Netzwerk-Kommunikation trotzdem zwei Schwachstellen aufwies. Denn Telex wie Telefax kannten Verbindungsprotokolle, weshalb man zwar nicht den Inhalt, aber die Häufigkeit unseres Austausches nachweisen konnte. Außerdem bestand auch stets die latente Gefahr, dass eine übermittelte Nachricht in die falschen Hände geriet. Und größere Informationsmengen ließen sich eh nicht über die beiden Techniken versenden, geschweige denn an mehrere Empfänger gleichzeitig. Für größeren Datenaustausch benutzten wir entweder persönliche Kontakte oder tote Briefkästen, schickten uns über Telex und Telefax bloß Treffpunkt und Zeit verschlüsselt zu oder gaben Hinweise auf frisch gefüllte Postfächer, die wir aber immer in ganz allgemein gehaltenen und völlig unverfänglichen Texten verbargen. Wir kamen uns wie gerissene Spione vor und waren es wohl auch eine Zeit lang.
Einem Beobachter mochte zwar auffallen, dass völlig unterschiedliche Departements der UNO auf einmal weit intensiver als früher zusammenarbeiteten. Doch es gab innerhalb der Weltorganisation keine Stelle, die sich solchen Besonderheiten vertieft gewidmet hätte.
Selbstverständlich benutzte die UNO auch abhörsichere Telefonverbindungen. Doch die dazu nötigen Geräte waren den höheren Funktionären vorbehalten und ihre Benutzung durch uns hätte rasch Misstrauen gesät.
Irgendwann stellte ich fest, dass sich einige unserer Mitglieder nicht lückenlos an die interne Vereinbarung zur Kommunikation hielten. War es Überheblichkeit? Naivität? Oder doch nur Faulheit? In fast jedem Korb mit Äpfeln fanden sich auch ein paar ungenießbare, so auch bei uns. Das Schlimme jedoch war, dass sie lange Zeit von mir unentdeckt geblieben waren und ich auch nicht sofort und konsequent die notwendigen Entscheidungen traf.
Im Sommer 2033 jedenfalls waren wir uns noch völlig sicher, unentdeckt im Untergrund zu operieren. Und wir waren fleißig, hatten bis dahin eine Finanzkrise in Singapur rund um einen der größten Baukonzerne der Erde ausgelöst und vier hohe UN-Funktionäre der Korruption überführt und so zu Fall gebracht.
Über meinen obersten Chef allerdings, Taio Ouko, hielt ich noch meine schützende Hand. Ihn wollte ich zusammen mit der halben arabischen Welt an den Pranger stellen und dafür fehlten uns noch etliche Beweise. Klar war bislang, dass sich die Golfstaaten aufgrund des stark gesunkenen Erdöl- und Erdgasgeschäfts schon vor Jahren aufs Offshore-Banking und andere Finanzdienstleistungen konzentriert hatten und dabei wenig zimperlich vorgingen. Sie beriefen sich zwar auf ihr moralisch einwandfreies Islamic Banking und hatten zudem eine riesige Behörde zur Einhaltung der Scharia-Bestimmungen geschaffen, die vordergründig jedes einzelne Geschäft kontrollierte und so sicherstellte, dass weder Geldwäsche noch Unterschlagung oder Korruption eine Chance bekamen. Doch wir fanden immer mehr Finanzströme aus unlauteren Geschäften, die sich im Moloch dieses staatlich-religiös kontrollierten Islamic Banking verloren. Uns schien, als ob die gesamte kriminelle Welt, ob Terroristen, Verbrecherorganisationen, Steuerbetrüger, korrupte Politiker oder bloße Geschäftemacher, freudig von der neu erschlossenen Möglichkeit des Geldversteckens und Geldwaschens Gebrauch machte. In diesen Wochen traf ich mich mit Henry Huxley. Der Brite war zwar fünfzehn Jahre älter als mein Vater, hatte die achtzig also überschritten, schien mir im Kopf aber noch weit klarer als Jules. Ich flog nach London, traf ihn und seine Frau Holly in deren Privatwohnung. Wir hatten einander viele Jahre nicht mehr gesehen und entsprechend freudig, aber auch distanziert, begrüßten wir uns.
Henry und Holly zeigten sich beide sehr interessiert an meinen Fragen. Doch es war ausschließlich der Brite, der sie beantwortete.
»Es war doch immer schon so, dass sich die Mächtigen der Wirtschaft und der Politik zusammenraufen, um sich gegenseitig Vorteile zuzuspielen. Und dabei spielt die Regierungsform keine Rolle. Es scheint mir sogar, als ob gerade in Demokratien die Politiker weit stärker auf die Verlockungen der Wirtschaft reagierten und ihre Völker ohne Bedenken hintergehen, dabei auch noch so tun, als ob sie zum Wohle der Nation handelten, wenn sie wieder ein für die Bevölkerung nachteiliges Gesetz erlassen. Dabei installieren sie nicht nur haufenweise Steuerschlupflöcher und beteiligen sich mittels Wirtschaftsförderung direkt an der Verschwendung staatlicher Mittel. Sie sichern dem schwarzen, wie dem grauen Geld dank der Beibehaltung von Offshore-Finanzplätzen stets genügend Rückzugsgebiete.«
Er schwieg für einen Moment und sammelte sich, bevor er weitersprach.
»Ich kann mich noch gut erinnern, wie die USA die kleine Schweiz vor über zwanzig Jahren in die Knie zwang und das Bankkundengeheimnis durchlöcherte. Gleichzeitig jedoch bauten Gliedstaaten wie Delaware, Nevada oder Montana ihre Gesetzgebung um, so dass jedermann sein unversteuertes Geld sicher in die USA verschieben konnte. Wenig später wurden Plätze wie Panama stillgelegt oder die Kanalinseln. Gleichzeitig blieben jedoch Orte wie Monaco, die Bahamas oder Costa Rica völlig unangetastet. Die USA zogen jedes Mal im Hintergrund die Fäden und die Welt fiel auf sie bereitwillig herein, war froh, wenigstens noch ein paar Orte für ihr illegales Geld behalten zu dürfen. Heute liegen rund Dreiviertel aller Vermögenswerte der Erde im Einflussbereich der USA. Damit hat sie ihre schwindende militärische Macht durch eine monetäre Überlegenheit mehr als kompensiert. Wenn die Amerikaner nur wollten, so verschwänden von einem Tag auf den anderen drei von vier Pfund. Die Folgen wären eine beispiellose Rezession, eine generelle Panik, die sich von den Finanzmärkten rasch über alle Unternehmen zu den Staaten und danach in jede einzelne Brieftasche auf Erden ausbreiten müsste. Eine größere Machtfülle hatte in der Geschichte der Menschheit wohl keine Nation und keine Regierung je erlangt.«
Die langatmige Rede von Henry hatte meine Fragen zwar nicht beantwortet. Trotzdem unterbrach ich ihn nicht, hörte ihm interessiert zu und ließ ihn weitersprechen.
»Aber du hast mich nach den neuen Finanzzentren in Kuwait, Saudi-Arabien, Jordanien und dem Iran gefragt. Nun, auch hinter ihnen stecken die USA. Mittlerweile leben mehr als sechzig Prozent der führenden Köpfe dieser Länder im Einflussbereich der Amerikaner, halten sich zumindest den größten Teil des Jahres dort auf. Zudem sind die großen US-Banken äußerst stark mit den arabischen Ländern verquickt. Wer hat denn diesen Ländern die Billionen von Dollar vorgestreckt, die sie zum Aufbau ihrer Finanzwirtschaft und der völlig überrissenen Infrastruktur benötigten? Die Erträge aus Erdöl und Erdgas verschwendeten diese Länder ja größtenteils für unsinnige Bauprojekte und übertriebene Sozialprogramme. Schon immer galt, dass ein Gläubiger irgendwann Macht über seinen Kreditnehmer erlangt, sobald der Schuldner auch nur den Anflug von Schwäche zeigt. Und als die Rohstoffpreise vor drei Jahren derart rasch zusammenbrachen, war es um die Selbstständigkeit dieser Länder und Regierungen geschehen. Seither sind sie nur noch der verlängerte Arm der US-Großbanken, hinter denen die US-Regierung steht.«
»Im Allgemeinen sagt man doch, Wall Street würde die Politik in Washington bestimmen?«, fragte ich etwas irritiert dazwischen. Henry schüttelte verneinend den Kopf: »Umgekehrt wird ein Schuh daraus. Schon immer hat der Staat die Wirtschaft beherrscht, wenn er es nur wollte. Denn die Wirtschaft hat zwar Geld, doch sonst keine Waffen. Die reißerischen Pamphlete zur schwindenden Macht des Staates stammen doch von der US-Regierung selbst. Sie redet sich klein und die Bankenwelt groß, streut dem Volk so Sand in die Augen, so dass jedermann der zusätzlichen Regulierung und Überwachung zustimmt, nicht wissend, dass damit die Politiker auch direkt ihre Hände an die Lebensadern der Banken legen und sie für ihre Zwecke nach Belieben einspannen können.«
Die Worte des Briten klangen angriffslustig, aber auch recht bitter. Womöglich war Henry Huxley einfach zu alt geworden, um noch Positives für die Zukunft der Welt zu erkennen, um noch Hoffnung auf Besserung zu empfinden. Oder er sah die Verhältnisse völlig realistisch und machte sich nichts mehr vor. Ich tendierte allerdings zu ersterem, vielleicht aufgrund meiner Erfahrung mit meinen Eltern. Doch Henry hatte mir wenigstens meine Zweifel genommen.
»Dann meinst du also, wenn ich mich mit dem intransparenten Islamic Banking anlege, könnten die USA verärgert sein und ihre Geheimdienste auf mich hetzen?«
»Da besteht für mich kein Zweifel. Falls du in diesem Kochtopf mit rührst, werden sie dich und alle Mitwisser aufspüren und töten.«
Der Brite wirkte trotz seiner drastischen Worte keineswegs bestürzt, sondern völlig ruhig. Auch sah mich Holly zwar forschend, aber nicht aufgewühlt an. Sie beide hielten sich seit Jahren aus allen gefährlichen Aktivitäten heraus, beobachteten ihre Umwelt jedoch weiterhin mit sehr wachen Augen, machten sich auch viele Gedanken, behielten sie jedoch meist für sich, mischten sich nirgendwo mehr wirklich ein. Sie waren zu Zuschauern geworden, die dem Theater des Lebens zwar noch Interesse und Spaß abgewinnen konnten, die jedoch keinen Anteil mehr am Schicksal der Akteure nahmen. Sollte ich sie bedauern? Oder eher beglückwünschen?
Ich war zu jung, um aufzugeben. Und so nutzten alle geäußerten Warnungen und Bedenken nichts. Mein Weg lag klar vor mir und ich würde vor keiner Gefahr zurückweichen. Denn zu viel stand meiner Meinung nach auf dem Spiel, für die Welt und für die Menschheit. Irgendjemand musste diesen Kampf einfach ausfechten. Davon war ich weiterhin überzeugt. Damals zog ich noch keine Parallelen zu anderen tragisch gescheiterten Figuren in der Geschichte. Hätte ich es getan, mir und vielen meiner Mitstreiter wäre wohl viel Ungemach erspart geblieben, manchen auch der Tod oder lebenslange Haft.
»Es irrt der Mensch, solang er strebt«, hatte Goethe in seinem Faust geschrieben. Ich erinnerte mich an eine Aufführung, die ich während meines Studiums in Berlin besucht hatte und die sich durch äußerst brutale und sexistische Szenen von der Masse der Repetitionen dieses alten Schauspiels abzuheben versuchte. Gleichzeitig überlegte ich, in welchem Zusammenhang dieser berühmte Satz im Stück eigentlich gefallen war. Mephisto wettete mit Gott um das Seelenheil von Faust. Er bat den Herrn, diesen Faust sachte auf den schlechten Weg führen zu dürfen. Und Gott antwortete Mephisto: »Solang er auf Erden lebt, solang sei’s dir nicht verboten. Es irrt der Mensch, solang er strebt.«
Und auch aus der Ballade Der Zauberlehrling war eine Passage in meinem Kopf hängen geblieben: »Herr, die Not ist groß! Die ich rief, die Geister, werd ich nun nicht los.«
Wer sich mit den Mächtigen anlegte, durfte sich nicht wundern, wenn sie mit aller Härte zurückschlugen.
*
Ich beachtete die Warnung von Henry nicht. Mochten die USA insgeheim hinter den arabischen Finanzzentren stecken oder auch nicht. Wir wichen nicht von unserer Linie ab, sammelten weiter fleißig Dokumente und Beweise, horchten unsere Vorgesetzten und die verschiedenen Projektleiter aus, begannen sogar, vor Ort für gewisse Informationen zu bezahlen. Dass dies ein großer Fehler war, hätte mir eigentlich klar sein müssen. Denn Geld hinterließ stets Spuren und führte unweigerlich zu unerfüllbaren Begehrlichkeiten. Und so zog sich schon bald hinter unserem Rücken und ohne dass wir auch nur das Geringste ahnten, langsam und doch stetig die Schlinge zusammen.
Einer meiner engsten Vertrauten, ein Schwede mit Namen Arne Jacobson, war wieder einmal nach al-Hazm gereist, der Hauptstadt von al-Dschauf, um die Fortschritte eines großen Entwicklungsprojekts in diesem ehemaligen jemenitischen Gouvernement festzuhalten. Erst vor sechs Jahren hatte sich diese nördlichste Provinz nach einem endlos langen Bürgerkrieg vom Rest des Landes abspalten können. Seither regierten dort die Schiiten, während im Rest des Landes weiterhin die Sunniten dominierten. Ein selbsternannter Emir übte eine starke Anziehungskraft auf andere Schiiten auf der arabischen Halbinsel aus und zu Zehntausenden strömten sie von überall her in ihr neu geschaffenes, gelobtes Land, überforderten die frisch aufgebaute, staatliche Verwaltung und jede Infrastruktur. Eine humanitäre Katastrophe bahnte sich an, mit unabsehbaren Folgen für die Sicherheit der gesamten Region. Die UNO hatte deshalb schon vor drei Jahren zusammen mit zwei Entwicklungsbanken und den arabischen Finanzzentren ein Infrastrukturprogramm nie gekannter Größe aufgelegt. Tausende von Kilometern an Straßen, Schienen, Wasser- und Abwasserleitungen und Hunderte öffentliche Gebäude sollten erstellt werden und der Bevölkerung gleichermaßen Arbeitsplätze und ein geregeltes Einkommen bescheren. Auf achtzehn Milliarden Dollar belief sich die bislang aufgewendete Summe, größtenteils gespendet von den westlichen Industrienationen und Teheran. Doch Satelliten-Bilder zeigten, wie wenig für das Geld tatsächlich gebaut worden war. Zudem hatte Arne herausgefunden, dass den Arbeitern der vereinbarte Mindestlohn fast nirgendwo ausbezahlt wurde, ja dass auf manchen Baustellen mehr Chinesen als Einheimische arbeiteten. Auch wurden mit dem Geld zahlreiche Gewerbeliegenschaften erstellt und anschließend illegal und unter der Hand an Firmen verkauft, jedoch weiterhin als Verwaltungsgebäude und in Staatsbesitz ausgewiesen. Die erstellten Straßen waren zudem von minderer Qualität, die Fortschritte hingen den Plänen um Jahre hinterher und kosteten das Zehnfache der ursprünglich vorgesehenen Beträge. Arne Jacobson war zum Schluss gekommen, dass weniger als fünf Prozent der Entwicklungsgelder zielgerichtet und sinnvoll verwendet wurden und die Bevölkerung entsprechend enttäuscht und mittlerweile gereizt reagierte. Wir waren in unserem Anti-Korruptions-Netzwerk zum Schluss gekommen, dass hier Betrug im ganz großen Stil betrieben wurde und dies nur möglich war, weil alle Entscheidungsträger, ob sie nun zu den Banken, zu einer der beteiligten Regierungen oder den United Nations gehörten, diese Kasse gemeinsam plünderten.
An einem Abend wollte Arne einen Kontaktmann treffen, der ihm bereits früher wertvolle Informationen verkauft hatte. Jacobson erhoffte sich von ihm entscheidende Beweise zur unrühmlichen Rolle von Taio Ouko, meinem obersten Vorgesetzten. Denn die Korruption war bei uns intern längst offensichtlich geworden und trotzdem zeigte Ouko keinerlei Interesse an gezielten Untersuchungen, hielt wohl auch die ersten beiden Berichte von Arne unter Verschluss, hatte Jacobson zudem angewiesen, in seiner nächsten Analyse über den Stand der Projekte nur Positives aufzuführen. Jacobson und ich waren der Auffassung, der richtige Zeitpunkt zum Zuschlagen stünde kurz bevor. Diesmal wollten wir auch Taio mit entsprechenden Beweisen öffentlich an den Pranger stellen und ihn zu Fall bringen. Dank ihm als möglichen Kronzeugen könnte anschließend die gesamte korrupte Organisation innerhalb der UNO auffliegen.
Dass ich den Schweden auch zwei Tage nach dem geplanten Treffen nicht erreichen konnte, beunruhigte mich noch nicht. Doch als ich ihn auch nicht für unser zweites, vorgängig abgesprochenes Telefonat erreichen konnte, begann ich mir Sorgen zu machen. Ich fragte nach, in seinem Hotel, bei der UN-Vertretung vor Ort, danach im Projektbüro. Niemand wollte Arne Jacobson in den letzten paar Tagen gesehen oder gesprochen haben.
Noch bevor ich mir weitere Schritte überlegen konnte, erhielt ich einen Anruf von einer der Assistentinnen von Taio Ouko. Ich musste mich unverzüglich im Besprechungsraum Orchidee einfinden. Man konnte sich leicht vorstellen, mit welch schlechtem Gefühl im Magen und bösen Gedanken im Kopf ich meinem obersten Vorgesetzten gegenübertrat. Der thronte mehr als das er saß am Kopfende des langen Sitzungstisches, ließ mich irgendwo Platz nehmen, sah mich finster an und kam sogleich auf den eigentlichen Punkt zu sprechen.
»Was tut Arne Jacobson in al-Hazm, Miss Lederer?«
»Ein neuer Bericht steht an. Über das Infrastrukturprojekt«, gab ich wage zurück.
»Das weiß ich selbst. Doch Ihr Mitarbeiter stellt dort unten mehr als seltsame Fragen.«
Ich antwortete noch nicht, wollte auf diese Weise zuerst mehr über den Verbleib des Schweden erfahren.
»Sind Sie Teil dieser Sache? Haben Sie ihn gegen mich aufgehetzt?«
»Ich verstehe nicht …?«, tat ich unschuldig, »…wieso gegen Sie aufgehetzt?«
Taio Ouko sah mich mit seinen fast schwarzen Augen stechend an, schien die Wahrheit in meinem Gesicht zu suchen, wollte mich womöglich auch bloß verunsichern.
»Wir spielen hier keine Spielchen, Miss Lederer. Wir sind die United Nations.«
Er schien nachzudenken, war deshalb verstummt, schaute mich jedoch unverwandt an. Erst nach einer Weile sprach er weiter.
»Jetzt verstehe ich erst. Mein Gott, ich habe eine Natter an meiner Brust genährt«, und er erschien mir auf einmal höchst aufgewühlt und verunsichert, ähnlich einem einzelnen Löwen, der unvermutet einem großen Rudel Hyänen gegenüberstand. Jedem einzelnen dieser Tiere war er weit überlegen. Doch gegen alle zusammen konnte er nicht bestehen, musste er in einem Kampf untergehen.
»Gehen Sie«, schrie er mich plötzlich an, »verlassen Sie das Gebäude. Sofort«, und er drückte auf einen der Knöpfe am Schaltkästchen vor ihm. Kaum eine Sekunde später traten bereits zwei uniformierte und bewaffnete Männer des Sicherheitsdienstes ein. Sie mussten direkt hinter der Tür gewartet haben. Taio Ouko deutete mit dem Zeigefinger auf mich und befahl den beiden: »Führt Miss Lederer aus dem Haus. Sie darf ihr Büro nicht mehr betreten. Nehmt ihr auch sämtliche Ausweise ab und durchsucht ihre Taschen, nein, am besten auch ihre Kleidung. Konfisziert alles, was den United Nations gehören könnte und bringt es in mein Büro.«
So wurde ich wenig sanft aus dem Besprechungsraum geführt, musste mich vor einer weiblichen Uniformierten nackt ausziehen. Jedes Kleidungsstück wurde penibel untersucht, sogar manche der Nähte aufgetrennt. Danach durfte ich mich wieder anziehen, musste das Gebäude unverzüglich durch einen Seitenausgang verlassen. Meine privaten Habseligkeiten in Pult und Schrank versprach man mir in den nächsten Tagen an meine Adresse in Wien zu senden.
Und ich? Nun, ich war äußerlich wohl ziemlich ruhig geblieben. Doch innerlich kroch längst die nackte Angst durch meinen Körper. Denn ich hatte die große Mordlust in den Augen von Taio Ouko gesehen.
Ich war aufgewühlt, höchst verunsichert, vom hohen Podest des Moralapostels in einem einzigen Moment tief hinabgestürzt und auf dem Boden einer gewöhnlichen Kriminellen aufgeschlagen. Vom UN-Sitz aus ging ich quer über die Straße und danach den Gehweg entlang, sah immer wieder zurück, versuchte mögliche Verfolger zu entdecken, fand zwar keine, spürte jedoch Augenpaare auf meinen Rücken starren. Ich begann zu zittern und der Klumpen in meinem Magen wurde immer größer. Mir war schlecht. Einen klaren Gedanken oder gar folgerichtige Pläne konnte ich in diesen Minuten noch keine fassen. Am liebsten wäre ich kopflos weggerannt, zu meiner Wohnung oder noch besser direkt bis in die Schweiz und zu meinen Eltern. Ja, mein Vater kam mir als erster in den Sinn. Er hatte in seinem Leben einige höchst bedrohliche Situation überlebt, war zum Profi für Gefahren geworden. Er wusste, was möglich war, was man dagegen unternehmen konnte. Dass Jules alt und verbraucht war, auch etwas wirr im Kopf, nahm ich in diesem Moment nicht bewusst wahr. Vielmehr erschien mir die Villa meiner Eltern als der einzig sichere Ort für mich.
Wieder wirbelte ich herum, suchte die Straße und die Gehwege hinter mir nach Verfolgern ab, sah noch, wie sich ein Mann wegdrehte, damit ich sein Gesicht nicht erkennen konnte. Der Kerl starrte in ein Schaufenster, sah nicht zu mir hinüber. Sollte ich zu ihm hingehen? Ihn direkt zur Rede stellen und so vielleicht vertreiben? Angst überflutete meinen Körper. Was war, wenn sie nur noch nach einer passenden Gelegenheit oder einen nützlichen Ort suchten, um mich umzubringen oder zu entführen? Im UN-Gebäude konnten sie dies schlecht tun. Sie benötigten erst Video-Aufnahmen als Beweismittel, dass ich die Zentrale gesund verlassen hatte. Doch von diesem Moment an war ich zum Freiwild geworden, konnte man mit mir machen, was man nur wollte.
Ein Verkehrsunfall? Eine schnelle Kugel aus dem schallgedämpften Lauf einer Waffe? Oder ein scharfer, schneller Stich in den Rücken, ausgeführt im Vorbeigehen und mit einem schmalen, biegsamen Stilett? Mein Vater hatte mir in meiner Jugend viel zu viel über erfolgversprechende Methoden zum Töten erzählt. Ich rannte nun doch einfach los, in heller Panik, der Hauptstraße entlang, aber nicht in Richtung meiner Wohnung. Denn zuerst musste ich mich in Sicherheit bringen, danach Geld und Ausweispapiere besorgen, um das Land schnellstmöglich zu verlassen.
Das Wachpersonal hatte auch alle meine Wertsachen konfisziert, die ich an diesem Tag auf mir trug, selbst den Schmuck und die Armbanduhr. Bestimmt wollte man mich auf diese Weise zwingen, direkt zu meiner Wohnung zu gehen, wollte mich vielleicht schon auf dem Weg dorthin oder spätestens in meinem Appartement beseitigen.
Endlich dachte ich an meine Mitstreiter im Netzwerk. Die musste ich so rasch als möglich warnen. Doch für Letzteres würden wohl meine Kolleginnen und Kollegen bei der UNO unfreiwillig sorgen, wenn sich die Nachricht über meine fristlose Entlassung und sofortige Wegweisung brühwarm und schneller als der Wind intern verbreitete. Nein, zuerst einmal musste ich für mich selbst sorgen.
Ich rannte weiter und gelangte über die Reichsbrücke in den 22. Bezirk, konnte dort ein freies Taxi ergattern, das mich an den Stadtrand brachte. Dort blickte ich mich zuerst sorgfältig um, schien mögliche Verfolger abgeschüttelt zu haben. Ich betrat wenig später die seit Jahren unbewohnte und verwahrloste Mietskaserne, in der sich einer unserer Toten Briefkästen befand, ging jedoch in eine der anderen Wohnungen, wischte in einer Ecke des Schlafzimmers den Staub und den Dreck weg, hob zwei Dielenbretter hoch und nahm das Geldbündel und den gefälschten Personalausweis heraus, dachte dankbar an meinen Vater, der mir beides schon vor Wochen aufgedrängt hatte und mir gleichzeitig riet, sie an einem sicheren Ort zu verwahren, den ich auch in höchster Not aufsuchen konnte und von dem sonst niemand etwas wusste oder ahnte.
Ich setzte mich auf den Fußboden und dachte angestrengt nach, versuchte mich in meinen Vater hinein zu versetzen, der in seinem Leben schon oft gefährliche, ja beinahe aussichtslose Situationen durchgestanden hatte. Wie würde Jules das Land möglichst rasch und unerkannt verlassen?
Taio Ouko würde wohl kaum die österreichischen Behörden einschalten. Doch ich musste gar nicht in erster Linie den UN-Funktionär fürchten, sondern ganz andere Leute, die selbst derart viel Dreck am Stecken hatten, dass es ihnen auf einen weiteren Mord nicht ankam. Die CIA gehörte zu dieser Gruppe. Deren Mitarbeitende steckten generell tief im Sumpf der UNO-Korruption, profitierten milliardenfach. Meinem Vater war vor vielen Jahren eine gütliche Regelung mit dem wohl mächtigsten Geheimdienst der Erde gelungen. Er brachte auf diese Weise sich und seine Familie aus deren Schusslinie. Doch damals verfügte Jules über ein mächtiges Druckmittel und konnte deshalb Bedingungen stellen. Wo aber stand ich? Stand mein Netzwerk?
Man hatte mich zu früh entdeckt und zu konsequent gehandelt. Auf unsere gesammelten Beweise besaß ich keinen Zugriff mehr, denn ich bewahrte sie in den endlosen Archiven der UNO auf. Dort war eine Entdeckung praktisch ausgeschlossen. Doch wie viel konnten sie von unserer Organisation schon kennen? Ich dachte an Arne Jacobson. Er hatte sich seit mehreren Tagen nicht mehr gemeldet. Hatte er mich verraten? Fast jeden Menschen konnte man in wenigen Stunden zerbrechen und ihn gefügig machen. Doch was wusste Arne über die anderen Mitglieder unserer Bewegung? Wie viele von ihnen kannte er mit Namen oder gar persönlich? Mehr als drei Dutzend, durchlief es mich heiß. Waren sie alle gefährdet so wie ich? Was konnte man ihnen nachweisen? Wie sehr würde man ihnen die Daumenschrauben anlegen?
Doch zuallererst musste ich aus Wien heraus, so rasch als möglich. Ich verließ die ehemalige Mietskaserne, ging zu Fuß Richtung Innenstadt, konnte mir nach einer Weile ein Taxi heranwinken.
»Nach Graz, wenn´s Recht ist«, teilte ich dem Fahrer mit original Wiener Akzent mit und stieg hinten ein. Der musterte mich im Rückspiegel erst erstaunt, kratzte sich dann mit dem Zeigefinger die Schläfe.
»Das wird gegen 300 Euro kosten«, warnte er mich und sah mir unverwandt in die Augen.
»Dann machen wir doch eine Pauschale von 400 Euro aus und Sie schalten den Taxameter gar nicht erst ein.«
Nun lächelte er zufrieden und setzte den Wagen in Gang, fädelte in den flüssigen Verkehr ein.
*
Ich hatte in einer Pension unter meiner falschen Identität übernachtet. Rosemarie Hilfinger hieß ich laut Personalausweis. Jules hatte mir erzählt, es existierten entsprechende Facebook und Twitter Accounts mit ein paar wenigen, undeutlichen Fotos. Die echte Rosemarie Hilfinger war zweiunddreißig und lebte seit Jahren in einer geschlossenen, psychiatrischen Anstalt in Burgdorf.
So nahe an der Wahrheit bleiben wie nur möglich, das war eine weitere Regel meines Vaters. Wozu Menschen erfinden, wenn es doch genügend echte von ihnen gab? Unwohl war mir allerdings schon, als ich den Ausweis der Wirtin vorlegte und sie die Nummer in ihren Computer tippte. Doch sie schien zufrieden.
Das Zimmer war klein und vollgestopft mit alten Möbeln. Doch mit den geblümten Vorhängen und dem gehäkelten weißen Deckchen auf dem Mahagoni-Beistelltisch, den Perser-Teppichen und der Tapete mit exotischen Vögeln recht heimelig. Zum Frühstück gab es reichlich Brot, Butter und Marmelade, große Tassen voller Milchkaffee und etwas Schinken und Käse. Ich schlug hungrig zu, hatte seit dem gestrigen Morgen nichts mehr gegessen. Die Wirtin hatte mich bei der Anmeldung etwas misstrauisch betrachtet, weil ich ohne jedes Gepäck angereist war. Ein dummer Fehler für jemanden auf der Flucht, den ich später in meinem Leben nie mehr beging.
»Tja«, hatte ich ihr am Vorabend erklärt, »mein Koffer ist auf dem Flug nach Graz abhandengekommen. Ich hoffe doch, dass ich ihn morgen früh am Airport abholen kann.«
Die gute Seele hatte mir eines ihrer Nachthemden ausgeliehen, bot mir zudem Unterwäsche an, was ich jedoch dankend ablehnte.
»Für Morgen wird die alte noch gehen. Wenn ich meinen Koffer zurückhabe, zieh ich mich sowieso gleich auf dem Flughafen um.«
Sie bestellte mir telefonisch ein Taxi zum Airport, das mich wenig später abholte. Am Flughafen kaufte ich mir einen Koffer und etwas Wäsche, auch Zahncreme, Bürste und Kamm, bestieg wenig später ein anderes Taxi und ließ mich nach Innsbruck bringen, was mich weitere fünfhundert Euro kostete. Doch Geld hatte ich mehr als reichlich zur Verfügung.
Auch in der Tiroler Hauptstadt mietete ich ein Zimmer in einer kleinen Pension etwas außerhalb, ging abends in Richtung Stadt los und aß im ersten Gasthof ein Schnitzel mit Pommes, trank einen Radler dazu, war mit mir soweit zufrieden. Am nächsten Morgen würde mich ein Taxi nach Bregenz bringen, wo ich den Koffer irgendwo stehen lassen konnte und wo ich mir einen kleinen Rucksack besorgen wollte. Mit der öffentlichen Fähre würde ich wenig später unerkannt und zusammen mit Dutzenden von Tagesausflüglern über Lindau nach Romanshorn und so in die Schweiz zurückkehren. Mein Vater wäre bestimmt stolz auf mich gewesen.
*
Selbstverständlich rechnete ich damit, dass mein Elternhaus überwacht wurde und man die Telefonleitung angezapft hatte. Doch auch in dieser Hinsicht hatte mein Vater schon vor Jahren vorgesorgt und in Blonay, dem Nachbardorf von La Tour-de-Peilz, einen Schuppen gemietet und darin ein Funkgerät installiert.
»Falls du mal eine abhörsichere Verbindung zu uns benötigst, rufst du uns von dort aus an. Denn die Behörden und die Geheimdienste mögen jede moderne Kommunikation abfangen können. An eine derart vorsintflutliche Technik denken die nie.«
Der Verfolgungswahn meines Vaters bis hin zur ausgewachsenen Paranoia war wohl doch zu was nütze. Jedenfalls reiste ich unerkannt mit der Bahn nach Vevey, spazierte der Hauptstraße entlang nach Blonay, fand den Schuppen und den hinterlegten Schlüssel, sperrte auf, ging hinein, schloss die Türe sorgfältig hinter mir zu, schob das Rollo am kleinen Fenster etwas hoch, setzte mich auf den staubigen Stuhl am uralten Pult und schaltete das Funkgerät ein, griff nach dem Mikrophone.
»Allô?«, meldete ich mich etwas verlegen, »hört mich jemand?«
Jules hatte mir versichert, die richtige Frequenz wäre voreingestellt und ich hätte am Gerät nichts einzustellen. Doch die Gegenseite blieb stumm. Aber auch auf diese Möglichkeit hatte mich Jules hingewiesen: »In der Villa ist das Funkgerät mit der Alarmanlage gekoppelt. Nur wenn die ausgeschaltet ist, wir also zu Hause sind, läuft auch die Empfangsstation. Du musst also im Fall der Fälle etwas Geduld aufbringen. Versuch es einfach jede halbe Stunde, bis jemand von uns antwortet.«
Doch was war, wenn die Behörden längst in der Villa saßen und meine Anrufversuche mithören konnten? Ich spürte, wie die kalte Furcht in meine Knochen kroch und sich in mir die Gefühle von Verlorenheit und von Panik abwechselnd hochschaukelten. Ich rief mich zur Ordnung, versuchte kühl über meine Lage nachzudenken. Nein, ich glaubte nicht daran, dass die Geheimdienste ihre Maske gegenüber meinen Eltern hatten fallen lassen. Dazu war ich derzeit wohl kaum wichtig genug. Denn das tatsächliche Ausmaß unserer Beweissammlung über Unterschlagungen, Erpressungen und Günstlingswirtschaft konnte noch gar nicht bekannt sein. An meine bisherigen Mitstreiter dachte ich allerdings nicht mehr. Jeder war sich in der Not selbst der Nächste. Und sich für andere opfern? So hatte ich noch nie in meinem Leben empfunden. Wer seine Haut riskierte, egal für welche Sache, der musste auch die Konsequenzen tragen, konnte sie nicht auf andere abwälzen, war für sich selbst verantwortlich. So war ich erzogen worden. So dachte und fühlte ich damals.
Ich versuchte an diesem späten Nachmittag gewissenhaft jede halbe Stunde Kontakt zu meinen Eltern aufzunehmen. Waren sie etwa auf Reisen? Nein, darüber hätten sie mich bestimmt informiert. So war es zumindest ausgemacht. Endlich, gegen neun Uhr abends, meldete sich meine Maman.
»Oui?«, sagte sie nur ins Mikrophon.
»Ich bin’s«, flüsterte ich glücklich zurück und spürte, wie mir Tränen über die Wangen liefen.
»Komm«, meinte meine Maman bloß, hielt sich gewissenhaft an die Regel meines Vaters, so wenig Worte wie nur möglich auszutauschen, falls keine Gefahr drohte, jedoch wie ein Wasserfall zu plappern, falls man das Gegenteil von dem meinte, was man sagte.
Ich hängte das Mikrophone zurück an den kleinen Haken und stellte das Funkgerät ab, erhob mich vom Stuhl, spürte einen leichten Schmerz in Becken und Rücken, eine Folge des langen und harten Sitzens auf dem ungepolsterten Holzbrett. Leise verließ ich den Schuppen, sperrte ihn gewissenhaft ab, legte den Schlüssel zurück ins Versteck und machte mich zu Fuß zu meinem Elternhaus auf.
Es war kühl geworden. Ein böiger Wind strich über das Wasser, kräuselte die Oberfläche, drang unangenehm und feucht durch Jacke und Bluse, ließ mich frösteln. Ich schlug die Arme um meinen Oberkörper und fluchte leise vor mich her, aufs Wetter, auf die späte Abendstunde und auf mein Versagen.
*
Meine Eltern versteckten mich die nächste Zeit in ihrer Villa. Ich ging nie aus, schlief in einem geheimen Raum im Keller, den mein Vater hinter dem begehbaren Tresor schon vor Jahren hatte einrichten lassen. Er bot mit einem schmalen Bett und einem winzigen Bad gerade genug Platz für eine Person. Ich kam mir in manchen Nächten wie eingemauert vor, als hätte man mich lebendig in einem Sarg begraben. Die Enge hätten wohl viele Menschen nicht ausgehalten. Ich kam mit ihr aber einigermaßen zurecht, denn Klaustrophobie kannte ich nicht. Schon als Kind kroch ich in niedrige Abflussrohre oder zwängte mich durch enge Spalten zwischen Bretterstapeln in der nahen Sägerei, ohne je einmal Furcht oder Angst empfunden zu haben.
Unsere Vorsichtsmaßnahmen stellten sich später als wahrscheinlich unnötig heraus, denn meine Eltern wurden nie von einer Behörde über mich befragt. Die Zeit nutzte mein Vater jedoch, um meine weitere Flucht, das heißt mein endgültiges Abtauchen und Verschwinden, zu organisieren. Ich konnte noch die Weihnachtstage und das Neujahr mit den Eltern verbringen. Und auch mein Bruder Chufu und seine Freundin Mei Ling kamen über die Festtage in die Schweiz, erfuhren erst hier von meinen Problemen und machten mir beide derart heftige Vorwürfe, dass mich meine Eltern in Schutz nahmen.
Doch eines Abends im Januar 2034, die Dämmerung hatte bereits eingesetzt, da machten sich Jules und ich auf den Weg. Ich verabschiedete mich von meiner Maman. Hätte ich damals gewusst, wie lange wir uns nicht mehr sehen würden und unter welchen Umständen wir uns erst nach vielen Jahren wieder in die Arme schließen konnten, ich hätte mich wohl gegen die Pläne meines Vaters entschieden.
Mit dem Motorboot setzten wir über den See, landeten in Lugrin, einem hübschen Dorf auf der französischen Seite. Jules ging mit mir zu einer ehemaligen Arztpraxis, die wohl schon vor längerer Zeit aufgegeben worden war, weil Monsieur Le Docteur keinen Nachfolger fand. Im Besprechungszimmer erwarteten uns zwei Männer, beide so jung wie ich, beide erwartungsvoll und gleichzeitig angespannt. Wer sie waren oder wie sie hießen, würde ich nie erfahren. Das spielte auch keine Rolle. Sie führten mich in einen fast leeren Raum, in der nur ein Operationstisch mit Scheinwerfer stand. Ich musste meinen Oberkörper frei machen, bekam ein grünes Tuch umgehängt, legte mich hin. Routiniert führte der eine die Kanüle für das Betäubungsmittel in eine der Venen meines rechten Arms ein. Ich musste von zehn bis eins runter zählen, schon bei acht entschwanden mir die Sinne.
Als ich wieder aufwachte, war draußen noch finstere Nacht. Ich lag immer noch auf dem Operationstisch, fröstelte unter der dünnen Decke, die man über mich geworfen hatte. Mein Vater lächelte mir zu.
»Hat alles wunderbar funktioniert. Du musst dir keine Sorgen mehr machen.«
Ich hob meinen linken Arm unter der Decke hervor, fühlte ein starkes, schmerzhaftes Ziehen vom Handgelenk bis unter die Achselhöhle, stöhnte leise auf.
»In ein paar Stunden sollten die Schmerzen abgeklungen sind und in zwei, drei Tagen ist die Venen-Entzündung endgültig Geschichte.«
Von den beiden jungen Männern war keiner mehr zu sehen. Sie hatten wohl nach der Operation die Arztpraxis umgehend verlassen. Ich legte mich wieder bequem hin, schob meinen Arm zurück unter die Decke, versuchte mich zu entspannen.
»Schlaf ruhig noch eine Runde, Betty Garland. Wir müssen eh die nächste Nacht abwarten, bevor wir von hier verschwinden.«
Ich hörte die Stimme meines Vaters wie durch einen Nebel, tauchte langsam ab in die Tiefe, fühlte mich wie eine Schwimmerin, die sich völlig verausgabt hatte und die nun erschöpft aber irgendwie doch glückselig sich der See hingab, keine Sorgen mehr kannte, alle Lasten abgeworfen hatte und sich darum ruhig und gelassen dem Sterben hingab. Nur ein Name hallte noch in mir nach wie eine Erinnerung. Betty Garland.