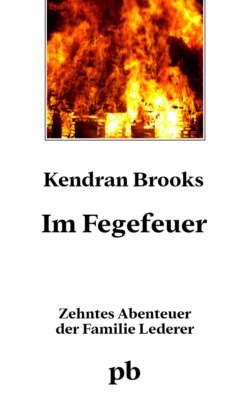Читать книгу Im Fegefeuer - Kendran Brooks - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Einzug
ОглавлениеAlabima und Alina waren an diesem Sonntagmorgen nach Lausanne gefahren, wollten der katholischen Messe in der L’église Notre-Dame du Valentin beiwohnen. Jules begleitete die beiden, wenn auch ohne jede Begeisterung und aus reinem Pflichtgefühl heraus. Alabima war zwar äthiopisch-orthodoxe Christin. Sie erzog Alina jedoch katholisch, obwohl die Afrikanerin die strickte Ausrichtung der Papsttreuen auf die Erbsünde ablehnte. Doch dafür mochte sie umso mehr deren starke Gewichtung der Bergpredigt von Jesus Christus als die grundsätzliche Auslegung der gesamten Bibel, also auch des Alten Testaments.
Die Kirche Notre-Dame du Valentin war erst 1832 erbaut worden und durfte viele Jahrzehnte lang keine Glocken in ihrem Turm läuten lassen. Denn nach der Eroberung der Waadt durch die reformierten Berner im Jahre 1536 wurde der katholische Glaube über Jahrhunderte hinweg zuerst verboten und später diskriminiert. So waren den Katholiken lange Zeit Gotteshäuser gänzlich verboten und die stolze Kathedrale, fertig gestellt und geweiht 1275 in Anwesenheit von Papst Gregor X. und König Rudolf von Habsburg, hatte man den Katholiken damals weggenommen und den Protestanten übergeben. Selbst heute noch sorgte der Staat für den teuren Unterhalt des konfiszierten Gotteshauses. In ihm fand auch weiterhin nur eine einzige katholische Messe im Jahr statt.
Im September 2013 machte die Kathedrale schweizweit Schlagzeilen, weil einer Gruppe ehemaliger Papstgardisten der Zugang zur Kirche verweigert wurde, obwohl doch in der Waadt mittlerweile wieder weit mehr Katholiken als Protestanten lebten. Der Glaube konnte Berge versetzen. So jedenfalls interpretierte man in der Bibel Hiob 9,5 und Matthäus 17,20. Doch bestimmt passierten derlei Dinge nicht in Lausanne, wo sich die 27% Protestanten in der Bevölkerung weiterhin nicht um die Befindlichkeiten der 38% Katholiken scherten.
Jules kannte alle diese Geschichten, mochte als nicht-gläubiger und nicht-praktizierender Protestant generell keine Gotteshäuser. Ganz besonders verabscheute er jedoch diese katholische Notre-Dame du Valentin, in der er an diesem Sonntagmorgen zusammen mit Alabima und Alina saß. Denn mit ihrer völlig überdimensionierten Zugangstreppe und dem übermächtigen Eingangsportal quetschte sie sich brutal zwischen die Häuser des Quartiers, ähnlich einem Walrossbullen, der sich rücksichtslos zwischen seine Weibchen drängte. Hinzu kam der achtunddreißig Meter hohe Glockenturm, der die gesamte Umgebung dominieren wollte. Papst Johannes Paul II. verlieh der Notre-Dame du Valentin 1992 gar den Rang einer Basilica minor. Der Ehrentitel drückte die starke Verbindung dieses Gotteshauses zum Vatikan aus und sollte gleichzeitig ihre alles überragende Stellung in der Romandie zementieren.
Und nun saß also Jules mit seinen Lieben und vielen Gläubigen an diesem Sonntagmorgen in dieser ungeliebten Kirche und harrte der kommenden, von ihm so verabscheuten Dinge.
Die Orgel setzte plötzlich ein, vehement, zwingend, den gesamten Raum dröhnend füllend und alle bislang noch vorhandenen guten Gefühle vertreibend. Ein Rudel Ministranten drängte sich aus einer Seitenpforte, wurde von drei Priestern verfolgt. Die blickten mit harten Augen auf ihre vorangehenden, jungen Helfer, zeigten offenen Missmut oder gar Anzeichen von Zorn. Hatte es kurz zuvor in der Sakristei etwa Zwist oder gar heftigen Streit gegeben? Waren die sechs jungen Burschen etwa beim verbotenen Naschen des köstlichen Messweins erwischt worden? Oder hatten sie schlimme Zoten gerissen, während sie sich in ihre gelb-stichigen Gewänder hüllten, um sich so in gläubige Lämmer Gottes zu verwandeln?
Alle Kirchenbesucher hatten sich von den Stühlen erhoben, selbst Jules mit seiner Skepsis, und schauten dem Einzug der heute stattfindenden Konzelebration zu, der Liturgie mit mehreren Priestern und mit dem entsprechenden Pomp. Die Geistlichen verzichteten allerdings auf den qualmenden Weihrauch, wie Jules erleichtert feststellte. Dieser alles verpestende Kübel hatte seit der Einführung von Deodorants den Nutzen zur Gänze verloren, zauberte heutzutage höchstens noch Ekel in die Gesichter der Kirchenbesucher. Wenigstens der Kelch ging an diesem Sonntagmorgen an ihm und allen anderen vorüber.
Jules blickte kurz zu Alina hinüber, die regungslos dastand und dem Einzug von Ministranten und Priestern mit großen Augen folgte, fasziniert vom Prunk der Gewänder, dem feierlichen Schreiten und der damit ausgestrahlten Würde, wohl ebenso gefangen vom Dröhnen der Orgel und den ernsten Gesichtern der meisten anderen Kirchenbesucher.
Wo war bloß Gott, wenn man ihn mal brauchte?, dachte sich Jules und sah das Bild eines zornigen Zeus vor sich, wie er seine Blitze zur Erde schleuderte, mitten hinein in diese verlogene Rotte, die sich Christen nannte und Demut heuchelte, gleichzeitig aber Flüchtlinge herzlos abwies. Er musste über seinen Gedanken einer Gottesstrafe unwillkürlich schmunzeln und erhielt prompt einen recht derben Ellbogenstoß von Alabima in die Seite. Hatte sie etwa auf seinem Gesicht mitgelesen?
Der Einzug umrundete vollständig das Geviert der Besucher und schritt danach vor den Altar, begrüßte auch diesen. Dem Kreuzzeichen des ersten Priesters folgten alle Anwesenden mit Ausnahme von Jules, der sich in diesem Moment an das Lied Habemus Papam von Konstantin Wecker erinnerte, in dem der bayrische Liedermacher den Prunk und die Verlogenheit des Vatikans anprangerte und gegen Ende sang: »... und strahlend betreten am nächsten Morgen die Ehrwürdens die Bühne, behängt und beringt und geschmückt wie die Christbäume, und sprechen das Agnus Dei. Und wenn sie ihre Hände zum Segen erheben, mach ich mich ganz klein, um auch ja nichts abzukriegen davon.«
Jules hatte seine Schultern hochgezogen, so als ginge er in Deckung.
*
Womit Henry Huxley früher sein Geld verdient hatte, war nur ihm bekannt. Denn nicht einmal sein langjähriger Freund Jules Lederer wusste viel über die Vergangenheit des Briten. Der 62-jährige wirkte auf einen Betrachter wie der kühne Major einer Spezialeinheit, der es gewohnt war, mit seinen Männern hinter feindlichen Linien gefahrvolle Aufträge zu erledigen. Hoch aufgeschossen, ausgesprochen schlank, beinahe hager, wirkte er trotz seines Alters immer noch drahtig und durchaus fit und leistungsfähig. Seine Lebenspartnerin Holly Peterson lernte er erst vor knapp zwei Jahren kennen. Die Mitte-Vierzigerin hatte bis dahin als selbstständiges Escort-Girl gearbeitet, sah immer noch blendend aus und wäre wohl von den meisten Männern auf höchstens fünfunddreißig geschätzt worden. Auch sie hatte in ihrem Beruf sehr erfolgreich agiert und war zudem umsichtig mit dem verdienten Geld umgegangen. So war sie heute finanziell ebenso unabhängig wie Henry Huxley. Die Engländerin und der Engländer lebten allerdings nicht in Saus und Braus, hätten ihr gemeinsames Leben eher als bescheidenen Wohlstand beschrieben. Denn Understatement war für die beiden Briten eine Selbstverständlichkeit.
Henry kannte das Vorleben von Holly, hatte sich keinen Moment daran gestört. Ihre frühere Tätigkeit als Tages-, Freizeit- und Ferienbegleitung, Sex inklusive, hatte sie für ihren Henry selbstverständlich aufgegeben. Im Gegenzug fühlte sie sich als Hausfrau jedoch zu wenig ausgelastet, auch wenn sie in den ersten Wochen und Monaten die Ruhe und Beständigkeit ihres neuen Zusammenlebens durchaus genossen hatte. Irgendwann jedoch kam der Punkt, an dem es sie wieder nach mehr Aufregung im Leben verlangte. Doch der Brite mochte seine neue Lebenspartnerin unter keinen Umständen in seine weiterhin laufenden Geschäfte einbeziehen, wollte sie aus jeder Gefahr heraushalten. Denn Henry Huxley liebte immer noch das Nachspüren und Auflösen von Geheimnissen, besaß in London und Umgebung ein riesiges Beziehungsnetz, kannte in der Hauptstadt Gott und die Welt und hielt ständige seine Fühler ausgestreckt, zur Unterwelt der acht Millionen Einwohner zählenden Stadt ebenso, wie zu deren Oberschicht.
»Viel zu gefährlich«, lautete sein wichtigstes Argument gegenüber den Forderungen von Holly nach mehr Einbezug in seine Tätigkeiten, »aber meistens auch sterbenslangweilig«, gestand er ihr oft, wenn er spät abends von seinen meist ergebnislosen Treffen zurückkehrte, mit denen er seine Kontakte aufrecht hielt.
Gemeinsam mit Jules Lederer erlebte Henry Huxley in den vergangenen Jahren einige aufregende, aber auch aufreibende Abenteuer. In seiner Stadt London allerdings und ganz allein auf sich gestellt, ging der Brite eher wenig Risiko ein, spürte lieber irgendwelchen Gerüchten nach, die sich manchmal dank seinem Netzwerk in Informationen und später in Beweise verwandelten, die er verkaufen konnte oder noch öfters verschenkte, um neue und in Zukunft nützliche Bekanntschaften zu knüpfen. Denn das war das Angenehme an seiner finanziellen Unabhängigkeit. Er konnte sich auch in dieser Hinsicht großzügig zeigen.
Für Holly Peterson war das syrische Flüchtlings-Mädchen Sheliza bin-Elik eine willkommene Ergänzung in ihrem Leben gewesen. Eigene Kinder besaß Holly genauso wenig wie Henry. Und so hatte die 45-jährige noch so gerne die Rolle einer älteren Freundin für die damals 14-jährige, angehende Mutter übernommen und nur sehr selten den strengen Pflegeelternteil heraushängen lassen. Mit der kleinen Fadoua aber schien sich für die Engländerin ein weiteres, aufregendes und hoffentlich auch glückliches Kapitel geöffnet zu haben.
Sheliza bin-Elik hatte erst nach der Geburt ihrer Tochter erkannte, wie sinnlos ein Leben in Syrien war. Der damals 14-jährigen wurde angesichts des Bürgerkriegs und all der Not der Menschen bewusst, dass sie ihre Fadoua unmöglich in einem Land großziehen durfte, indem andauernde Unterdrückung und hässlichste Brutalität herrschten. Als sie und ihre Tochter von Henry Huxley und Jules Lederer aus den Fängen der ISIS gerettet wurden, hatte die junge Frau innerlich bereits den Entschluss gefasst, ihre Tochter nicht nur in den Westen und damit in Sicherheit vor Willkür und Tod zu bringen, sondern auch den christlichen Glauben anzunehmen und Fadoua gewissenhaft darin zu erziehen. Denn ihre Tochter sollte aus all den Zwängen des Islams befreit aufwachsen dürfen und unter ihresgleichen in London unbeschwert und von allen Menschen akzeptiert leben können.
Die heute 15-jährige stürzte sich nach ihrer Rückkehr mit viel Elan in die selbst gestellte Aufgabe, durchforstete das Internet nach passenden Angeboten und entschloss sich nach reiflicher Überlegung für die römisch-katholische Kirche St Mary of the Angels in Bayswater als Ort ihrer Konvertierung zum Christentum. Holly und Henry waren mit ihrem Vorhaben zwar grundsätzlich einverstanden gewesen, hatten die junge Syrierin trotzdem gefragt, warum sie denn ausgerechnet zur römisch-katholischen Glaubensrichtung und nicht etwa zu ihrer eignen, der anglikanischen, konvertieren wollte.
»Ich weiß nicht«, begann die 15-jährige und schien einen Moment lang verunsichert, »ihr habt zwar den Erzbischof von Canterbury als höchste geistliche Instanz. Doch ich denke, der Papst in Rom hat weit mehr Gewicht in der Welt, ist er doch das Oberhaupt von mehr als einer Milliarde Gläubigen, während die Anglikaner bloß achtzig Millionen zählen.«
»Ich sehe, du denkst recht praktisch«, meinte Holly etwas anzüglich und neckend, » ob aber die schiere Menge in Glaubensfragen wirklich alles ist, was zählt?«
»Ich will ganz einfach sicher gehen, dass Fadoua nicht nur innerhalb einer möglichst großen Glaubensgemeinschaft aufwächst, sondern diese Kirche auch von einer obersten Instanz geleitet wird. Denn ich denke, das ist das wahre Problem des Islams. Bei ihm gibt es keine Instanz, die Terroristen und Dschihadisten aus der muslimischen Kirche werfen könnte, egal, welch schreckliche Verbrechen diese Ungeheuer auch begehen und wie viele Menschen sie umbringen oder versklaven. Dieser oberste, religiöse Führer fehlt uns ganz einfach. Alle Muslime dürfen sich gleichermaßen auf Allah und Mohammed berufen und niemand kann sie in ihrem Irrglauben stoppen, weil niemand das dafür notwendige, übergeordnete Recht besitzt. Doch bei den Katholiken ist das ganz anders. Hat der neue Papst nicht erst vor kurzer Zeit alle Mitglieder der italienischen Mafia ex-kommuniziert und seine Priester angewiesen, diese Leute in Zukunft nicht mehr als gläubige Christen zu betrachten? Ihnen die heiligen Sakramente vorzuenthalten? Das ist doch ein überaus starkes Signal gegen das Unrecht?«
Henry, Holly und Sheliza wandten sich also an die Kirche St Mary of the Angels und wurden an Monsignore Keith Barltrop verwiesen, einen Mann von wohl Mitte fünfzig, der sehr ruhig und abgeklärt auf sie wirkte und gleichzeitig einen gewissen Schalk in seinen Augen zeigte und diesen keineswegs vor ihnen zu verbergen suchte. Er versprach, die junge Muslimin in den nächsten Monaten persönlich in die römisch-katholische Lehre einzuführen und sie bis zu ihrer Taufe anzuleiten und zu begleiten. Irgendwie schien der Geistliche begeistert von der Vorstellung, eine syrische Muslimin mit ihrer Tochter zusammen in den Schoss seiner Kirche zu führen. Allerdings verschwieg die 15-jährige dem Monsignore gegenüber ihr Kalkül bezüglich der Größe der katholischen Kirche mit ihrem Papst an der Spitze, also die eigentlichen Gründe für ihren Religionswechsel. Sie gab sich ihm gegenüber als aufgeschlossen und äußerst wissbegierig aus, sparte auch nicht mit Komplimenten zu verschiedenen Aussagen in der Bibel, die sie sich im Vorfeld herausgesucht hatte. Allerdings empfand sie viele der Passagen der Heiligen Schrift als eher naiv oder zumindest weltfremd, andere als viel zu lasch. Ständig wurde an das Gute im Menschen appelliert, während im Islam doch weit klarere Forderungen und harte Bedingungen gestellt wurden, die ein schwacher Erdenbürger zu erfüllen hatte, um Ewiges Leben erlangen zu können.
Ihre Scheinheiligkeit gegenüber dem Monsignore erschien der jungen Alawitin als eine geringe Verfehlung, gemessen an all den Demütigungen, die sie immer noch täglich als Muslimin empfand, wenn sie mit Fadoua im Kinderwagen der nahen Oxford Street entlang spazierte oder durch Covent Garden schlenderte. Sex, Sex, Sex, schrie es von überall her auf sie ein, zeigte sich sogar in den Gesichtern der Passanten. Es schien nichts Wichtigeres im heutigen London zu geben, nichts Anderes zu gelten. Aus den Schaufenstern und von den Plakatwänden herunter lächelten leicht bekleidete Models, so als bestünde das Leben nur aus lauter Spaß und sexuellen Ausschweifungen. Junge Frauen zogen sich wie Huren an, boten sich den Blicken der Männer wie eine käufliche Ware an, staksten auf hochhackigen Schuhen, Miniröcken und knappen Blusen oder Shirts über die Gehsteige, freuten sich sogar über die lästerlichen Pfiffe oder zotigen Sprüche der männlichen Fleischbeschauer.
An einem Freitagabend ging Holly Peterson mit der jungen, muslimischen Mutter aus, wollte mit ihr eine der angesagten Diskotheken der Stadt besuchen. Zuvor hatte sich die Syrierin in einer Boutique mit dem entsprechenden Outfit ausstatten lassen müssen, mit engen, weißen Jeans und einer Bluse mit Ausschnitt, dazu passenden Sandalen, die ihren schlanken Fuß so wunderbar betonten, wie die Boutique-Betreiberin ihr weismachen wollte, während sich die junge Alawitin vor dem Spiegel stehend innerlich für ihr durchaus hübsches Aussehen vor Allah schämte.
Bevor die beiden jedoch am späteren Abend das Appartement verließen, musste sich Sheliza von Holly erst noch stark schminken lassen.
»Du musst wie achtzehn oder älter aussehen, sonst lassen sie uns gar nicht erst rein«, hatte die aparte Britin lächelnd gemeint und das Gesicht der jungen Muslimin anschließend um Jahre altern lassen. Als Henry Huxley die beiden wenig später verabschiedete, hatte der Engländer ein besonderes Funkeln in den Augen, aber nicht etwa ein amüsiertes, sondern eher ein angespanntes. Und er hatte Sheliza auffordernd und wohlwollend zugenickt. Denn der feinfühlige Brite wusste wohl nur zu gut, welch heftigen Kulturschock die 15-jährige Muslimin in dieser Nacht erleben würde.
Sie hatten sich noch gar nicht in die lange Schlange vor dem Tanzlokal eingereiht, als sie bereits die ersten Sprüche über sich ergehen lassen mussten, von wegen Dreier-mit-Mutter-und-Tochter und ähnlichen obszönen Einladungen, ausgesprochen von schmierigen, angetrunkenen Typen in knappen T-Shirts und hängenden Jeanshosen, oft Maurerdekolleté zeigend, wie Holly Peterson schmunzelnd Sheliza erklärte. Zum Glück wurden sie wenig später vom Türsteher entdeckt und zu sich nach vorne gewunken und auch gleich eingelassen. Holly sah aber auch entzückend aus, wie Sheliza selbst fand, trug eine enge, dunkelblaue Jeans, die ihre langen, schlanken Beine mit den schmalen Knöcheln hervorragend betonte, einen recht weiten, rosafarbenen Pullover, der mehr von ihren üppigen Brüsten erahnen als klar erkennen ließ. Die Engländerin trug nur mittelhohe Sandalen an ihren Füssen, weil sie nicht größer als die meisten der möglichen Tanzpartner sein wollte, wie sie der Muslimin erklärt hatte.
Als die Türe zum Kellerlokal aufschwang, wummerten Basstöne und schrillte Gitarrengeplärr wie ein Schwall hoch zu ihnen. Sheliza blieb unwillkürlich stehen, als wäre sie gegen eine Wand geprallt, musste von Holly mit sanftem Druck die schmutzige Betontreppe hinuntergeführt werden. Der Lärm schwoll weiter an, je tiefer sie gelangten, und Sheliza hielt sich längst ihre Ohren zu, worauf Holly in ihrer winzigen Umhängetasche kramte und zwei Pfropfen herauszog, ihrer Pflegetochter irgendetwas zuschrie und danach die gummiartigen Stöpsel in deren Gehörgänge stopfte. Dankbar nickte Sheliza der Britin zu, denn der Lärm in ihrem Kopf war endlich auf Zimmerlautstärke verringert.
Unten mussten sie an einem winzigen, aus ein paar Brettern gezimmerten Tickethäuschen zwei Eintritte lösen, bekamen einen Stempel auf ihren linken Handrücken gedrückt und einen Getränkegutschein ausgehändigt, stürzten sich daraufhin in das Getümmel des erstaunlich großen Kellergewölbes, das mit seinen Nebenräumen bestimmt mehreren hundert Besuchern Platz bot und auf dessen Bühne drei Musiker ihre Instrumente malträtierten und in Mikrophone kreischten. Holly schrie Sheliza irgendetwas zu und deutete mit dem Zeigefinger in Richtung der langen Bar. Gemeinsam kämpften sie sich durch die Masse an Menschen. Die allermeisten Besucher waren Männer, nur ein Viertel von ihnen Frauen. Dementsprechend oft wurde Sheliza von Händen und Armen und Beinen gestreift, meistens absichtlich, nur manchmal versehentlich. Strahlende Gesichter schwangen sich vor ihre Augen, grinsten und lachten, versprühten ihren Scharm und den Willen zum Sex. Abstoßend, widerlich, geradezu unmenschlich. Beinahe sehnte sich die 15-jährige in diesem Moment zurück in den Bürgerkrieg nach Syrien und in eines der Gefängnisse der ISIS, wo man sie zumindest in Ruhe gelassen hatte, sie nicht berührte, sich ihr nicht aufdrängte, sie keinen Moment lang als Sexobjekt entwürdigte, sie nur mit dem Tode bedroht hatte.
Die junge Mutter riss sich jedoch zusammen, lächelte zurück, stieß den einen oder anderen mit der flachen Hand sanft aus dem Weg, zwängte sich zwischen anderen hindurch, gelangte endlich zur Bar und stellte sich neben Holly an die Theke. Die Britin bestellte für sie beide und wenig später wurden zwei große Kelchgläser vor sie hingestellt, gefüllt mit irgendwelchen farbenfrohen Flüssigkeiten, garniert mit einem Spieß, an dem ein paar Fetzen Früchte recht dekorativ hingen.
»Alkoholfrei«, glaubte Sheliza durch die Ohrpfropfen zu vernehmen und nickte dankbar, hob ihr Glas und prostete Holly zu, die ihrerseits mit einem strahlenden Lächeln und ein paar freundlichen Handbewegungen etwas mehr Platz für sie beide an der Bar schaffte. Zwei junge Männer in schwarzen Lederjacken erhoben sich wenig später von ihren Hockern und boten sie ihnen mit den Händen fuchtelnd an. Holly nickte dankbar und führte Sheliza hinüber und sie setzten sich. Die beiden Kerle bauten sich sogleich links und rechts von ihnen auf, als wären sie nun ihre persönliche Beute, begannen schreiend mit ihnen zu quatschen. Sheliza verstand kaum ein Wort, spürte nur den Atem des einen unangenehm auf ihrem Hals und auf der Wange, roch die säuerliche Bierfahne, konnte kaum von den gelben Zähnen wegsehen, bog sich immer weiter vom ständig Nachdrängenden weg, stieß unsanft mit Holly zusammen, die sie aufmunternd und forschend ansah, ihren Oberarm mit der Hand sanft umfasste und ihr »Toilette« ins Ohr schrie. Sie nickte dankbar und wie erlöst. Holly sagte etwas zum Kerl neben ihr, bahnte anschließend für sie beiden den Weg hinüber zum mit Washroom bezeichneten Ausgang. Der Flur dahinter machte einen Knick und verzweigte danach in zwei Räume für Männer und Frauen, deren Türen mit automatischen Schließern für einigermaßen Ruhe dahinter sorgten. Zwei junge Frauen standen vor einem der vier Waschbecken, kontrollierten ihr Make-Up, trugen beide weiße, halb-durchsichtige Blusen und darunter rote BHs, hatten schwarz und dick umrandete Augen und knallgrüne Lippen, sahen verbraucht aus wie vierzig, waren wohl doch eher erst zwanzig, blickten Holly und Sheliza zuerst abschätzend und dann neidisch an, als sie den Waschraum verließen.
Eine der Kabinen war noch besetzt und das Mädchen oder die Frau hinter der Blechtür kotzte sich gerade die Seele aus dem Leib, fluchte zwischen dem heftigen Aufstoßen immer wieder laut vernehmlich. Sheliza zog endlich die Stöpsel aus ihren Gehörgängen und verstand nun, dass der Ärger der Frau in der Kabine weit weniger mit ihrem Unwohlsein zusammenhing als vielmehr mit dem vielen guten Geld, das diese bislang in ihren Freitagabend-Rausch investiert hatte und das unwiederbringlich verloren war.
»Mit Freiheiten muss man umzugehen lernen«, meinte Holly lächelnd und legte ihre rechte Hand auf Shelizas linke Schulter, »das Treiben hier muss dir wie die Hölle vorkommen, ich weiß. Doch das, was du hier siehst, hat nicht wirklich viel mit dem echten Leben zu tun. Denn spätestens am Montagmorgen sitzen alle diese jungen Leute wieder ordentlich hinter ihren Schreibtischen oder stehen an der Theke der Läden und Imbiss-Buden und gehen ihrer Arbeit nach. Das, was du hier siehst, ist nichts anderes als ein Ventil. Doch die meisten von diesen jungen Menschen arbeiten unter der Woche hart, strengen sich im Studium oder als Angestellte richtig an, verdienen sich ihren Lebensunterhalt und hoffen auf ein bisschen persönliches Glück. Bitte sei ihnen nicht böse, wenn sie den richtigen Weg für sich selbst noch nicht entdeckt haben. Denn jeder Mensch muss ihn eigenständig für sich aufspüren und kann ihm erst danach folgen. Viele dieser jungen Männer und Frauen werden in wenigen Jahren bereits Eltern sein, so wie du. Sie werden ihre Kinder großziehen, sich ein Häuschen in einem Vorort mieten und alle Wildheit von früher abgestreift und rasch vergessen haben. Denn sie sind allesamt bloß auf der Suche, genauso wie du, Sheliza.«
Die junge Syrierin nickte.
»Ich verstehe schon, was du mir mit dem Besuch hier klar zu machen versuchst. Doch ich kann es noch nicht wirklich begreifen und schon gar nicht akzeptieren oder in Ordnung finden.«
»Das kommt alles noch. Lass dir dafür Zeit. Du bist wie ein Tiger, der in einem ihm fremden Dschungel unterwegs ist. Er muss vorsichtig bleiben, spürt vielleicht sogar Angst, kennt nichts, sieht überall nur mögliche Gefahren und unbekanntes Gebiet, ist deshalb höchst misstrauisch gegen alles und erwartet jederzeit einen Überraschungsangriff. Doch so fühlen sich in einer Großstadt wie London sehr viele Menschen. Wie einsame Tiger in einem dichten Dschungel, den niemand durchschaut. Die Wildnis kommt auch ihnen jeden Tag von Neuem fremd und manchmal gefährlich vor, selbst wenn sie schon Jahre darin leben. Und trotz all der Probleme und möglichen Gefahren bleiben sie hier wohnen, stellen sich den wiederkehrenden Herausforderungen und wachsen an ihnen. So wird es auch dir ergehen. Hab nur ein wenig Geduld.«
Wiederum nickte die Syrierin tapfer.
Die Verriegelung der Kabine drehte sich und die Tür schwang auf. Eine junge Frau torkelte auf hohen Stilos heraus. Sie trug langes, gewelltes, dunkelbraunes Haar, das ihr bis zur Brust herunterhing. Sie war nur mäßig hübsch, hatte eine zu kleine Stupsnase und einen zu schmalen Mund, die ihrem Gesicht etwas Verschlagenes gaben. Leicht schwankend ging sie hinüber zu einem der Waschbecken, ohne Holly oder Sheliza auch nur anzusehen, blickte mit ihren entzündeten Augen in den Spiegel, entdeckte die hängengebliebene Kotze an einigen ihrer Haarsträhnen, fluchte erneut, aber leiser, und beugte sich tief hinunter, um sie unter dem Wasserstrahl recht unbeholfen auszuwaschen, schaute wieder hoch und betrachtete sich den verschmierten Mascara im Spiegelbild, kramte in ihrer winzigen Umhängetasche nach dem Stift, versuchte eine Korrektur, die jedoch gänzlich misslang, weil ihre fahrige Hand unkontrollierbar blieb. Sie fluchte erneut, diesmal wieder lauter, und stopfte die Mascara zurück in die Tasche, reckte sich noch einmal vor dem Spiegel zurecht und schwankte dann an Holly und Sheliza vorbei zur Türe.
»Guter Spruch«, meinte sie dann doch noch und drehte sich zu den beiden um, »ich mein, das mit dem Tiger.«
Die Tür schlug hinter ihr zu.
Holly und Sheliza blickten sich an und lächelten einander zu.
»Musst du auch?«, fragte die Britin die Syrierin und wie zwei gleichaltrige Kolleginnen setzten sie sich in zwei nebeneinanderliegende Kabinen, das heißt, sie hockten sich stehend über die schmutzigen Schüsseln ohne Deckel oder Toilettensitz. Wenig später und wieder vor den Waschbecken und den fleckigen Spiegeln, schauten sie einander stumm lächelnd an, während andere Frauen und Mädchen hereinkamen oder wieder gingen.
»Lektion gelernt«, meinte Sheliza nach einer Weile, »ich beiß mich schon durch, keine Sorge, Holly.«
»Du musst die Tigerin sein, vergiss das nie. Die Tigerin, nicht das Reh.«
*
Fu Lingpo kam an diesem Abend sehr spät von der Arbeit nach Hause, wurde von Sophie Shi ungeduldig erwartet. Sie hatten sich im Hidding einen Tisch reservieren lassen, zur Feier des Tages, nämlich dem Jahrestag ihrer Flucht aus Hongkong nach Kenia. Fu Lingpo war viele Jahre lang ein treues Mitglied der Tong Triade gewesen, hatte für das alt-eingesessene Verbrecher-Syndikat gestohlen, erpresst und auch gemordet. Doch als er ein einziges Mal Erbarmen einem Opfer gegenüber gezeigt hatte, fiel er in Ungnade und musste ausscheiden. Wenig später verliebte er sich in seine Wohnungsnachbarin Sophie Shi. Die arbeitete damals heimlich als Telefon- und Internet-Prostituierte, verkaufte ihre Zeit, ihre Stimme und den Anblick ihres Körpers an zahlungswillige Männer. Auch der Anführer der Tong Triade, Lao-tse, gehörte zu ihren treuen Kunden. Und als der von ihrer Beziehung zu Fu Lingpo erfuhr, wollte er zumindest seinen früheren Mitarbeiter töten lassen, womöglich aber auch Sophie Shi zum Schweigen bringen. Mit Hilfe von Jules Lederer konnten die beiden Chinesen allen Verfolgern entkommen, reisten auf abenteuerlichem Weg nach Afrika, gelangten unerkannt nach Nairobi, begannen sich in Kenia ein neues, gemeinsames Leben aufzubauen.
Fu Lingpo arbeitete seit einem halben Jahr als Gärtnergehilfe auf dem Campus des University College in Garissa, einer Kleinstadt nahe der Grenze nach Somalia. Die Arbeit war nicht anspruchsvoll, jedoch in der tropischen Dauerhitze des äquatornahen Landes anstrengend, wenn er beispielsweise in zwanzig Metern Höhe mittels einer Hebebühne und einer Machete abgestorbene Wedel sorgfältig von Palmen entfernen musste oder den Campus-Wegen entlang neue Hecken angelegt wurden, zu deren Bewässerung man Wasserschläuche über hunderte von Metern in den Boden vergrub. Doch dieses Mit-den-Armen-und-Händen-Arbeiten besaß auch eine ganz besondere Qualität, wie Fu von Anfang an fand. Denn man erkannte am Abend nicht nur sein Tagewerk, man konnte auch dessen Wertbeständigkeit über die Wochen und Monate hinweg weiter beobachten, wenn sich zum Beispiel der vorgängig geplante und entsprechend gesteuerte Pflanzenwuchs auch tatsächlich einstellte.
Ausgeglichenheit.
Das wäre wohl der Begriff gewesen, mit dem Fu Lingpo sein derzeitiges Wohlbefinden in einem einzigen Wort zusammengefasst hätte.
»Du kommst spät. War was?«, fragte die Chinesin etwas ungehalten, als er die Wohnungstüre aufgeschlossen hatte und in den kurzen Flur getreten war. Sophie Shi war um die fünfzig Jahre alt, schlank, aber nicht dürr, hübsch, jedoch nicht schön.
»Nein. Oder doch. Hughudu wollte mich nach der Arbeit noch sprechen, lud mich auf ein Bier ein.«
»Und?«
Die Frage klang eher abschätzig als neugierig, denn Sophie Shi hatte seit mehr als einer Stunde auf das Eintreffen von Fu gewartet. Immerhin musste er noch duschen und sich umziehen und ihr Tisch im Restaurant war schon auf halb acht reserviert und bis dahin waren es nur noch knapp vierzig Minuten.
»Er hat mir sein Herz ausgeschüttet. Hat Probleme mit seinem ältesten Sohn. Der scheint in schlechte Gesellschaft geraten zu sein, schwänzt oft die Schule, wurde vor Kurzem bei einem Ladendiebstahl erwischt. Der übliche Ärger mit Teenagern.«
»Aber warum fragt er ausgerechnet dich um Rat? Er weiß doch, dass wir keine Kinder haben?«
Fu Lingpo zuckte mit den Schultern: »Was weiß ich. Wir verstehen uns gut. Er hat Zutrauen zu mir gefasst. Vielleicht glaubt er, ich kenne den Konfuzius auswendig und wüsste ihm darum Rat.«
Er zog sein verschwitztes Hemd aus und ging hinüber ins Bad, stopfte es dort in den Kübel für die Schmutzwäsche, streifte die Hose zusammen mit dem Slip ab, ließ die Unterhose auf das Hemd fallen, legte die Hose ordentlich über einen an der Wand hängenden Kleiderbügel, wollte sie am nächsten Morgen wieder anziehen. Sophie war ihm ins Bad gefolgt, sah auf seinen breiten, muskulösen Rücken und die feste, gar nicht schlanke, aber vor Kraft strotzende Taille mit dem immer noch schmalen, festen Po darunter. Sie lächelte versonnen.
»Und was hast du ihm geraten?«
Er drehte sich zu ihr um und sie sah auf seine haarlos-glatte, mächtige Brust, darunter die straffe Bauchwölbung, die nichts mit einer Bauchkugel gemein hatte, sah auf seinen rasierten Penis mit Hodensack, die beide schlaff herunterhingen, doch auch in diesem Zustand mächtig groß wirkten, auch auf seine kräftigen Oberschenkel, die gut zu einem Gewichtheber oder einem Sumo-Ringer gepasst hätten. Sophie verspürte sogleich das ihr wohlbekannte Kribbeln in ihrem Unterleib und blickte deshalb wieder hoch und ihrem Lebenspartner ins Gesicht.
»Ich hab ihm gesagt, ich an seiner Stelle würde den Kleinen auseinandernehmen und ihn neu zusammensetzen, würde ihn jeden Tag verprügeln, bis er die heilige Mannesfurcht verspürte und alles täte, was ich von ihm verlangte, nur aus Angst vor noch mehr Schlägen.«
Sophie Shi schaute Fu Lingpo erschrocken und gleichzeitig erstaunt forschend an. Doch der grinste nun und meinte: »Nein, selbstverständlich nicht. Ich hab ihm geraten, für seinen Jungen ein paar Kerzen in der Kirche anzuzünden und für ihn zu beten.«
»Das tönt ebenso wenig nach dir«, bemängelte die Chinesin lächelnd.
Er war in die Dusche gestiegen und hatte den Kaltwasserhahn aufgedreht, genoss den eher lauen Strom aus dem Brausekopf. Richtig warmes oder gar heißes Wasser gab es in diesem Mietshaus eh nur am frühen Morgen, zumindest wenn man etwas Glück hatte. Doch diese Annehmlichkeit überließ Fu stets seiner Lebenspartnerin, hatte sich längst an das laue Kaltwasser gewöhnt, seifte sich gründlich ein, während sein Penis weiter zusammenschrumpfte, wie Sophie immer noch zuschauend feststellte.
»Ich hab ein Geschenk für dich«, rief er ihr irgendwann zu, während er sich die Haare einseifte, »zur Feier des Tages. Es steckt in meiner Hosentasche.«
Sophie Shi sah dies als Aufforderung an und nahm die Hose vom Bügel, fühlte etwas Hartes in einer der Taschen und zog es heraus. Das sechs mal sechs Zentimeter große und drei Zentimeter hohe Päckchen war in Geschenkpapier eingewickelt. Doch sein Inhalt konnte eigentlich nur in einem Schmuckstück bestehen. Vielleicht ein Ring?
»Bist du verrückt geworden?«, fragte Sophie ihren Fu mit einer Stimme, die ebenso Tadel wie auch große Freude und gespannte Erwartung enthielt.
»Warum denn?«
»Schmuck? Für mich?«
»Wie kommst du denn auf Schmuck? Ist doch bloß etwas Schokolade. Aus dem Tank Shop.«
Zum Glück konnte Fu unter der Dusche das enttäuschte Gesicht von Sophie nicht sehen, als sie nun die Verpackung abstreifte und tatsächlich eine braune Plastikbox in Händen hielt, die gemäß ihrem Etikette vier Luxus-Pralinen enthielt.
»Danke«, meinte sie laut und fest, konnte ihren leichten Ärger trotzdem nicht ganz verbergen.
»Und, wie schmecken sie dir?«, fragte er weiterhin gut gelaunt unter dem Wasserstrahl hervor.
»Soll ich sie etwa jetzt gleich probieren? Vor unserem Essen?«
»Ja, bitte.«
Sie musste zwei Klebestreifen entfernen, bevor sie den Deckel abheben konnte. Darunter kam ein Solitär-Ring mit lauter Diamanten hervor, der in einem blau-samtenen Kissen steckte.
»Du elender Lügner«, rief sie ihm lachend zu und steckte sich das Schmuckstück probeweise an die Hand, »woher kennst du denn die Größe meines Ringfingers?«
Er schob die Glastür zur Seite und stieg aus der Dusche, packte sich ein großes Badetuch vom Wandhaken und begann sich abzutrocknen.
»Herzlichen Glückwunsch zu unserem Jahrestag«, meinte er herzlich und mit einem strahlenden, breiten Grinsen. Sie kam in seine noch feuchten Arme und sie küssten sich lange. Wiederum meldete sich das Kribbeln in ihrem Unterleib und sie befreite sich darum rasch aus seinen Liebkosungen.
»Wir kommen zu spät, wenn wir erst noch…«
Sie ließ den Grund offen, lächelte spitzbübisch, blickte dann betont auf seinen Penis, der sich deutlich regte.
»Ist denn nicht noch genug Zeit?«, lockte Fu die Chinesin mit schmeichelnder Stimme.
»Nein«, entschied sie spielerisch abschließend, »denn etwas Strafe nach deiner Lügerei muss einfach sein, Mister Lingpo. Ziehen Sie sich endlich an und führen Sie mich aus.«
Auf dem Weg zum Restaurant kamen sie an der Kreuzung vorbei. Hier konnte Sophie Shi kürzlich ein Verkaufslokal anmieten, das derzeit von einem örtlichen Schreiner ausgebaut wurde. Die umtriebige Frau wollte hier in wenigen Tagen eine traditionelle, chinesische Apotheke eröffnen. Denn in Garissa lebten mehrere hundert ihrer Landsleute, die bislang auf die von Zuhause gewohnte Medizin hatten verzichten müssen. Und auch die Einheimischen würde man bestimmt für die zumeist sanften, fernöstlichen Heilpraktiken interessieren können.
Konkurrenzlos.
Das wäre wohl der Begriff gewesen, mit dem Sophie Shi ihre Geschäftsidee in einem Wort beschrieben hätte.
*
Es hatte sich über die letzten Jahre abgezeichnet und so kam der Entschluss von Zenweih Ling, aus der ehelichen Villa auszuziehen und ein luxuriöses Appartement in der Innenstadt zu mieten weder für Mei Ling noch für Chufu Lederer wirklich überraschend. Denn seine Gattin Sihena gab sich weiterhin unnahbar, war in letzter Zeit sogar noch abweisender und kälter gegenüber ihrem Ehemann und auch gegenüber ihren Kindern geworden. Seit dem zweiten Verschwinden ihrer jüngsten Tochter Shamee war die Frau oft unausstehlich, zu den Hausangestellten etwas weniger als zum eigenen Ehemann. Dass ihre ständige Verärgerung etwas mit den zahlreichen außerehelichen Affären von Zenweih Ling der letzten Jahre zu tun hatte, mochten die beiden Studenten der Psychologie allerdings nicht glauben. Seine Eskapaden waren Sihena schon viel zu lange bekannt gewesen und still geduldet worden, hätten viel früher zum Bruch führen müssen. Nein, die zunehmende Gefühlskälte der Mutter von Mei und ihr gleichzeitig gesteigerter Stolz hingen höchstwahrscheinlich doch mit Shamee und ihrem abermaligen Verschwinden zusammen. Dies jedenfalls vermutete zumindest Chufu, während Mei skeptisch blieb und die Gründe eher im zunehmenden Alter ihrer Mutter vermutete.
Doch wohin war die jüngste Tochter der Lings erneut derart fluchtartig verschwunden? Und aus welchem Anlass? An denselben Ort, wie vor einem halben Jahr? Und nur aus Ärger über den Streit mit ihrer Mutter?
Zumindest die zuerst von Mei und Chufu vermutete Drogensucht hatte sich als Fehlanzeige erwiesen. Denn niemand in der Szene wollte die 17-jährige kennen. Das hatten sie durch eine Handvoll Privatdetektive umfassend abklären lassen. Und der einzige Hinweis zu ihrem früheren Verbleib bestand weiterhin in einem Porno-Film von wenigen Minuten Länge, in der eine junge, chinesisch-stämmige Frau als Postbotin verkleidet sich von einem heißblütigen Südländer gründlich vernaschen ließ. Die Darstellerin glich Shamee eigentlich aufs Haar. Ob es sich beim Möchtegern-Pornosternchen tatsächlich um die 17-jährige Shamee Ling handelte und wo und vor allem von wem der Film gedreht worden war, das alles hatten Mei und Chufu immer noch nicht herausfinden können. Und die jüngere Schwester hatte nach ihrer Rückkehr alle diesbezüglichen Fragen offengelassen.
Das Psychologie-Studium war für Chufu und Mei abgeschlossen und die beiden hatten vor einigen Tagen ihre Abschlussarbeiten eingereicht, harrten nun deren Prüfung durch das Gremium und einer hoffentlich positiven Beurteilung. Darum hatten die beiden Noch-Studenten in diesen Tagen wenig zu tun, genossen die gemeinsame Muse, spazierten oft den Strand entlang, auch wenn die Witterung im winterlichen August der Südhalbkugel an manchen Tagen mit kaum 19° unangenehm kühl blieb. Immer wieder sprachen die beiden über das erneute Verschwinden der jüngeren Schwester von Mei, stellten Mutmaßungen über den Anlass des Streits mit Sihena an, spekulierten über die Gründe für ihre erste, wie für ihre zweite Flucht aus dem Elternhaus und über den derzeitigen Aufenthaltsort. Beide waren voller Sorgen und mehr als einmal schlug Chufu vor, doch seinen Adoptivvater Jules endlich einzuschalten, der mit all seiner Erfahrung und seinen Kontakten wohl am ehesten in der Lage sein müsste, die jüngste Tochter der Lings aufzuspüren. Doch Mei war strikte dagegen.
»Du weißt ganz genau, was damals in Kairo mit Malika geschah«, meinte die Chinesin kühl und Chufu musste trocken schlucken, erinnerte sich höchst ungern an das grausame Schicksal der jungen Gomaa, an die Bilder ihres so sinnlosen Todes, die sich für immer in seinem Gehirn und in seiner Seele eingebrannt hatten, die er verdrängen, aber nicht vergessen konnte.
»Doch bei Shamee liegt der Fall doch ganz anders. Sie ist Atheistin und glaubt an nichts und niemanden«, warf Chufu in ihre Diskussion ein, wurde von Mei jedoch ebenso energisch abgewiesen: »Du vergisst, auf welche Art und Weise dein Vater vorzugehen pflegt. Bitte versteh mich richtig. Ich mag Jules zwar als Mensch gut leiden, auch wenn er mir manchmal unheimlich ist. Auf jeden Fall geht er mir aber zu verbissen und vor allem zu rücksichtslos vor, gegen sich selbst, wie auch gegen andere. Ein paar Mal erschien er mir richtiggehend bösartig, beinahe tollwütig. Nein, Schatz, tut mir leid, aber das Leben meiner Schwester möchte ich niemals in den Händen deines Vaters sehen.«
Chufu gab selbstverständlich nach, hatte keine Argumente gegen die Anschuldigungen seiner Freundin, stellte sich jedoch genauso vehement der Idee von Mei entgegen, erneut Henry Huxley um Unterstützung zu bitten.
»Henry hat doch genug eigene Probleme, ich meine mit Sheliza. Wir dürfen ihn nicht auch noch mit unseren Sorgen belasten. Das wäre nicht in Ordnung, auch nicht gegenüber Holly. Und wenn du ehrlich bist, mit Henry zusammen hatten wir damals in Kairo wenig bis gar nichts erreicht, oder?«
Das stimmte zwar auch, klang jedoch aus dem Mund des jungen Philippinen ziemlich abfällig und Mei zog darum eine unwillige Schnute.
»Ja, ich weiß«, beteuerte er deshalb rasch, »du bist ein großer Fan von Henry«, und er umarmte seine Freundin und küsste sie zärtlich.
Sihena Ling empfing an diesem Morgen neue Bewerber für den Posten des Majordomus für ihren Haushalt. Ihr langjähriger Angestellter, Aílton Santoro, war vor einigen Monaten von Unbekannten in seinem Zuhause ermordet worden und den jungen Carlos Forano, der sich danach um die Organisation des Haushalts der Lings gekümmert hatte, war von Sihena gleich nach ihrem heftigen Streit mit Shamee fristlos entlassen worden, entweder aus guten Gründen oder aber aus einer ihrer Launen heraus. Doch auch darüber schwieg sich die Chinesin aus. So bildeten derzeit die langjährige Köchin Marta Gonzales-Vinerva und das Zimmermädchen Naara Huaterdo die stark geschrumpfte Dienerschaft des Hauses, neben den Torwächtern und den unvermeidlichen Bodyguards. Doch auch das hielt Sihena nicht davon ab, weiterhin als verbiesterte Tyrannin aufzutreten und Köchin wie Dienstmagd immer wieder zu schikanieren, sie geradezu zu quälen. Es schien, als müsste sich die Herrin des Hauses mit den beiden Hausangestellten fast täglich reiben, um den ständig steigenden Dampfdruck auf dem Feuer ihrer inneren Wut auf Tochter Shamee oder andere Menschen wenigstens über dieses Ventil immer wieder abzubauen.
»Die braucht endlich wieder mal einen guten Fick«, meinte Naara despektierlich. Sie saß unten in der Küche am Mitarbeitertisch und war einmal mehr den Tränen nahe, »sie wird mit jedem Tag unausstehlicher, gereizter und gemeiner. Wie ein eingesperrter Tiger, der sich jeden Moment aus lauter Wut und Hass selbst zerfleischen wird, zuvor jedoch noch alles in seinem Käfig zerschlagen und zerreißen muss.«
»Sei still, böses Kind«, wurde sie von Marta Gonzales-Vinerva zurechtgewiesen, »hier verdienst du doch gutes Geld? Dort draußen aber«, und sie meinte die Großstadt Rio de Janeiro, »gehst du rasch vor die Hunde. Vor allem mit deinem nichtsnutzigen Freund.«
Damit meinte sie Antonio Vivaldo, ein blendend aussehender junger Brasilianer, der leider in den meisten praktischen Dingen des Lebens ein kläglicher Versager war, ob es sich um eine feste Anstellung, ausreichendem Verdienst und auch nur um regelmäßig bezahlte Arbeit handelte. Dass Naara weiterhin zu ihm hielt und ihm oft genug mit ihrem knappen Einkommen aushalf, das konnte Köchin Marta allerdings gut und gleichzeitig schmerzlich verstehen, hatte sie sich bislang doch auch nicht von ihrem Ehemann Marinos getrennt, der in seinem Leben endgültig gescheitert war und sie stockbetrunken manchmal sogar schlug, wenn sie ihm kein Geld geben wollte oder konnte. Doch die Bürde, die einem der Liebe Gott im Leben auferlegte, die hatte man klaglos zu tragen. Amen.
Trotz ihres eigenen, demütigen Verhaltens gegenüber ihrem oft betrunkenen Marinos redete die Köchin immer wieder eindringlich auf die junge Naara ein, doch nicht denselben Fehler wie sie zu machen und sich und ihr Leben nicht noch länger für einen Nichtsnutz wegzuwerfen.
»Aber wenn mein Antonio auch nur ein einziges Mal mit einer seiner Ideen Erfolg hat?«, führte das Zimmermädchen einmal mehr dagegen an.
»Glaub mir, Naara, wenn mich das Leben eines gelernt hat, dann das: Nur Leute, die an einer Sache dranbleiben, die fest an diese eine Chance glauben und sich auch durch Rückschläge nicht beirren lassen, es immer wieder versuchen und bei jedem Scheitern dazulernen, es das nächste Mal besser machen, nur solche Leute haben irgendwann Erfolg. Wer jedoch wie dein Antonio oder auch mein Marinos stets von einer halb ausgegorenen Idee zur nächsten springt, sobald die ersten Schwierigkeiten auftauchen, der ist viel zu schwach, um jemals erfolgreich zu sein.«
Die Köchin stemmte die Fäuste in ihre Hüften, sah voller Bitterkeit auf die junge Frau am Küchentisch, erkannte in deren Gesicht dieselbe Demut vor dem Herrn, die sie selbst empfand, dieselbe Ergebenheit vor dem eigenen Schicksal. Unfähig und unwillig, das Leben in die eigenen Hände zu nehmen, stattdessen stets bereit, dem Fluss der Dinge einfach zu folgen oder sich von ihm treiben zu lassen, auch wenn der Wasserfall längst nicht mehr zu überhören und die Klippen bereits zu sehen waren.
Es klingelte an der Haustür oben und Naara zuckte zusammen.
»Der nächste eingebildete Idiot«, meinte sie und erhob sich seufzend vom Stuhl, wirkte müde und abgespannt.
»Vielleicht mal ein hübscher?«, mutmaßte die Köchin über den nächsten Kandidaten für den Posten des Major Domus, »einmal muss das Glück doch auch uns beide treffen?«
Zenweih Ling blickte in seiner Stadtwohnung erstaunt auf, als der mächtig dröhnende Gong der Haustüre anschlug. Entweder der Wohnungseigentümer oder der Vormieter hatte seiner Vorliebe für Dramatik nachgegeben und sich den Klang von Londons Big Ben installieren lassen. Melodisch zwar, aber viel zu wuchtig, raumfüllend und erschlagend.
Der Chinese erhob sich mit einem unbewussten, leisen Ächzen vom Sofa und schleppte sich mehr, als dass er ging, hinüber zur Sprechanlage.
»Ja?«, fragte er, den Knopf gedrückt haltend.
»Senhor Ling?«, tönte es elektronisch hässlich verzerrt und doch erkennbar männlich-jugendlich aus dem Lautsprecher. Die überaus schlechte Qualität der Sprechanlage entsprach der Bastelarbeit eines überforderten Hobby-Installateurs, dem wahrscheinlich auch noch die richtigen Bauteile gefehlt hatten.
»Ja.«
Die Stimme von Zenweih verriet einen grollenden Ärger, entweder ob der schlechten Sprechverbindung oder über die Störung seiner Mußestunde an diesem Abend.
»Ich bin es, Carlos Forano.«
Viel Hoffnung war aus der Stimme des jungen Brasilianers heraus zu hören, drang überaus deutlich an die Ohren des chinesischen Restaurantbesitzers, der das Bild seines früheren Hausdieners sogleich vor Augen hatte.
»Komm herauf«, antwortete Zenweih nach kurzem Zögern und drückte den Türöffner zum Haupteingang.
Sein Luxus-Appartement lag in der obersten Etage des zwölfstöckigen Gebäudes. Neben einer separaten, für Besucher unzugänglichen Feuertreppe, gab es nur den Privatlift, der mittels Schlüssel unten oder elektronisch vom Appartement aus geöffnet werden musste. Zenweih blickte auf seine Armbanduhr und begann, die Zeit zu messen. Dabei schürzten sich seine Lippen zu einem grimmigen Lächeln, während er den Sekunden zuschauten, wie sie zäh und doch stetig zerrannen, sanft und doch so unerbittlich. Wie lange würde der junge Brasilianer wohl benötigen, bis er herausgefunden hatte, dass er die neue Wohnung seines früheren Arbeitgebers weder über den öffentlichen Aufzug noch über das Treppenhaus erreichen konnte, sondern nur über den abgesonderten, privaten Aufzug, beim dem er sich über die Sprechtaste erneut anmelden musste? Eine Minute war bereits verstrichen und Zenweih vermutete, Carlos Forano würde noch mindestens drei weitere brauchen. Doch dann summte die Sprechanlage erneut und zeigte mit dem entsprechenden Blinklicht an, dass jemand vor dem Privatlift unten stand.
»Ja?«, meldete sich Zenweih so unverbindlich wie zuvor.
»Ich steh vor dem Aufzug zum Penthouse, Senhor Ling. Können Sie mir bitte öffnen?«
Der Chinese ärgerte sich, dass der stets vorwitzige Carlos so rasch die Lösung des Problems erkannt hatte. Deshalb drückte er nur widerwillig den Öffner zur Lifttür und wenig später den Knopf zum Heraufholen der Kabine.
Carlos trat freudestrahlend und blühend wie das junge Leben heraus, beugte artig den Kopf vor seinem früheren Arbeitgeber, schritt auf ihn zu, streckte seine Hand weit aus. Zenweih griff nach ihr, ohne Höflichkeit, sondern herablassend, denn der kaum zwanzig Jahre alte Kerl erinnerte ihn in diesem Moment zu sehr an sich selbst in seinen Jugendjahren, als er ebenso zuversichtlich und kraftstrotzend durchs Leben geschritten war, als er die ganze Welt hätte umarmen können, als es für ihn stets nur ein Vorwärts und niemals ein Stehenbleiben oder gar ein Zurückweichen gab. Wehmut überkam den Chinesen, während er immer noch in Gedanken versunken die Hand von Carlos in der seinen hielt.
»Weshalb kommst du zu mir?«
»Ich suche eine Anstellung«, gab der junge Brasilianer offenherzig zu.
»Bei mir?«
»Wo sonst, Senhor Ling«, bekannte Carlos ehrlich und ein wenig unterwürfig. Doch noch bevor sich Zenweih zu einer abschlägigen Antwort durchringen konnte, ergänzte Forano einnehmend lächelnd, »ein wichtiger Mann wie Sie, Senhor, kann doch nicht ohne Hausdiener leben? Wer kümmert sich denn um Ihre Wäsche, um den Haushalt, um Ihr Wohlbefinden?«
Das alles war selbstverständlich hinlänglich über den Vermieter geregelt, war in der recht hohen, monatlichen Pauschale bereits enthalten. Doch davon konnte ein dummer Bengel wie dieser Carlos selbstverständlich nichts wissen, hatte nie das Leben in den obersten Etagen der Gesellschaft kennengelernt, verstand den Spruch »Time is Money« noch nicht richtig, nämlich dass man sich als Wohlhabender mit seinem Geld problemlos Zeit erkaufen konnte. Und trotzdem. Die pure Lebenslust und die unerschütterliche Zuversicht im Gesicht von Carlos Forano, die der junge Brasilianer selbst im Moment seines demütigen Bittens ausstrahlte, auch das offene Lachen im Augenblick der persönlichen Erniedrigung, all das berührte Zenweih und machte ihn neugierig. Denn der Chinese fühlte sich durch die ganze Art des jungen Brasilianers wie verletzt oder verwundet. Hier der alternde Geschäftsmann, gut situiert, wenn nicht sattsam reich, dort der recht unverschämte und unbeschwert auftretende, stets positiv denkende kleine Angestellte, der das Leben annahm, wie es kam und daraus das Beste machte. Fast gegen seinen Willen und ganz bestimmt gegen seine Vernunft meinte Zenweih deshalb: »Ja, warum nicht? Dasselbe Gehalt wie früher?«
Carlos nickte glücklich lachend: »Gerne Senhor. Wann soll ich anfangen?«
»Komm morgen früh gegen sieben Uhr wieder her. Und besorge dir bis dahin angemessene Kleidung.«
Er holte seine Brieftasche heraus und entnahm ihr ein paar Hunderter, streckte sie Carlos vor, der sie freudestrahlend entgegennahm. Seine Zukunft schien dem jungen Brasilianer gesichert, zumindest für den Moment. Und wer dachte in seinem Alter schon über den Augenblick hinaus?