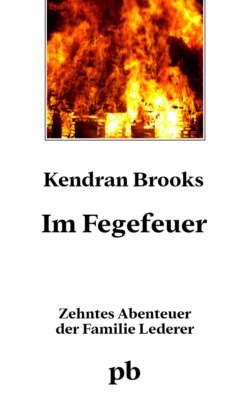Читать книгу Im Fegefeuer - Kendran Brooks - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Schuldbekenntnis
Оглавление»Ich bekenne Gott, dem Allmächtigen,
und allen Brüdern und Schwestern,
dass ich Gutes unterlassen und Böses getan habe.
Ich habe gesündigt in Gedanken, Worten und Werken,
durch meine Schuld, durch meine Schuld,
durch meine große Schuld.
Darum bitte ich die selige Jungfrau Maria,
alle Engel und Heiligen,
und Euch, Brüder und Schwestern,
für mich zu beten, bei Gott, unserem Herrn.«
Die Gläubigen antworteten mit: »Herr, erbarme dich unser! Christus erbarme dich unser! Herr, erbarme dich unser!«
Warum wohl nur der Herr und Jesus Christus von den Gläubigen angerufen wurde, nicht aber der Heilige Geist des Dreigestirns? Jules wusste es nicht, hatte sich bislang auch nie mit dieser Frage geplagt. Doch an diesem Sonntagmorgen in der katholischen Messe in Lausanne fiel ihm diese Lücke auf.
Der Herr und auch Jesus Christus sollten sich der Gläubigen erbarmen, doch das Wohlwollen und die Unterstützung des Heiligen Geistes benötigten sie nicht? Wofür stand so ein Heiliger Geist? Er war zwar Teil der Trinität und damit Gott selbst, besaß jedoch im Gegensatz zu den anderen beiden keinerlei Körperlichkeit. War das vielleicht der Grund für das fehlende Flehen zu ihm? Dass der Geist keine Substanz besaß? War das womöglich auch das Übel der Menschheit? Dass sie gefangen war in der Körperlichkeit und deshalb Geist und Logik keinen allzu hohen Stellenwert besitzen konnten, zumindest wenn es wirklich darauf ankam?
Jules war weder bibelfest, noch hatte er sich jemals besonders stark für Religionen ganz allgemein oder das Christentum im Besonderen interessiert. Er wusste nur, dass die Jungfrau Maria ihren Sohn Jesus durch den Heiligen Geist empfangen hatte. Und in die Köpfe der Apostel war er nach der Auferstehung Jesus gefahren, auf dass sie sich aufmachten, um die Menschen zu missionieren, was ihnen im Rückblick betrachtet mit weltweit fast zwei Milliarden Christen doch ganz gut gelang.
Völlig ohne Macht war dieser substanzlose Heilige Geist also doch nicht, konnte zumindest Frauen schwängern und Apostel überzeugen. Doch er kam nur dann über einen, wenn man fest an den gekreuzigten Jesus glaubte, niemals jedoch nur aufgrund von guten Taten. So hatte man es ihm zumindest damals als Knabe im Religionsunterricht eingetrichtert. Auch das war mehr als seltsam, dass der Heilige Geist dem reinen, naiven Glauben den Vorzug gab, während gottgefälliges Verhalten eher wenig zählten. Zumindest ließen sich aus diesem Umstand viele Fehlentwicklungen in der Menschheitsgeschichte erklären, wenn man sich ein wenig Mühe gab.
Alabima und Alina saßen ganz ruhig auf ihren Stühlen, blickten wachsam zum Priester am Rednerpult hinüber, der nun zum gemeinsamen Vaterunser aufrief.
»...und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern...«
Dieser Satz hatte Jules schon als kleiner Junge nie behagt, hatte ihn immer als falsch und heuchlerisch empfunden. Denn wenn man die Nachrichten im Fernsehen, Radio oder den Zeitungen verfolgte, so fand man haufenweise schlechte Menschen, die sich mit riesiger Schuld beladen hatten. Warum jedoch auch er, als meistens völlig unschuldiges Kind, stets um dieselbe Vergebung bitten musste, das hatte in ihm damals schon einen großen Widerwillen gegen diesen allmächtigen Gott erzeugt.
Als Erwachsener hatte er dann den Trick mit der Erbsünde selbstverständlich erkannt und billigte der römisch-katholischen und auch der protestantischen Kirche durchaus ein großes Geschick bei der Entfaltung weltlicher Macht über ihre Gläubigen zu. Doch viel mehr als den Machtanspruch der Priester hatte er nie hinter diesen Worten gesehen, hatte sich deshalb umso mehr gewundert, als ihm Alabima nach der Geburt von Alina eröffnete, ihre Tochter im römisch-katholischen Glauben erziehen zu wollen und nicht etwa in ihrem eigenen, äthiopisch-orthodoxen, der ohne jede Erbsünde auskam und darum den Menschen weit freier in seinen Entscheidungen beließ.
»Amen.«
*
Sheliza fuhr auch an diesem Nachmittag zur Kirche St Mary of the Angels in Bayswater, war auf fünfzehn Uhr mit Monsignore Barltrop verabredet. Sie war direkt vor ihrer Schule in den Bus gestiegen und hatte mit den Augen einen freien Sitzplatz gesucht, blieb dabei unvermittelt an der Niqab einer Frau hängen, die sie erst anstarrte und dann das Tuch kurz lüftete und ihr Gesicht für eine Sekunde zeigte. Es war Afifa Mosul und sie blickte Sheliza bin-Elik immer noch verblüfft und zunehmend konsterniert an.
»Was machst du denn in London?«, fragte die Sunnitin und schien hinter Sheliza nach weiteren Bekannten zu spähen. Afifa Mosul überredete vor etwas über einem halben Jahr die junge Syrierin, ebenso wie sie selbst die alawitische Kirche zu verlassen und sich der sunnitischen Glaubensrichtung des Islams anzuschließen. Sheliza hatte dem Drängen von Afifa nachgegeben, als sie die Chance erkannt hatte, mit Unterstützung des Imams in ihr Heimatland zurückkehren zu können, um dort nach ihren Eltern und Geschwistern zu suchen. Für Afifa hingegen war allein die überragende Persönlichkeit von Imam Chalid al-Muzaffar, einem Salafisten aus Ägypten, entscheidend für den Wunsch von Sheliza nach Konvertierung. Höchst zufrieden hatte die Muslimin wenig später von der Abreise Shelizas nach Syrien erfahren, glaubte an eine zusätzliche Mitstreiterin für die gerechte Sache der sunnitischen Dschihadisten in ihrem Heimatland, die wenige Wochen später ihr Kalifat ISIS ausriefen. Umso mehr wunderte sich Afifa Mosul nun, die junge Muslimin so unvermittelt wieder in London anzutreffen.
»Setz dich doch«, verlangte Afifa von Sheliza und deutete auf den freien Platz neben sich, »wann bist du denn zurückgekehrt? Warst du gar nicht in Syrien? Wie war es denn dort?«, und plötzlich misstrauisch geworden fügte sie hinzu, »warum trägst du keine Niqab? Nicht mal ein Kopftuch?«
Als sich Sheliza neben sie hingesetzt hatte, kamen weitere zu erwartende Fragen: »Ach, ich seh erst jetzt, du bist ja gar nicht mehr schwanger? Hast du dein Kind geboren? Ist es gesund? Was ist es denn? Knabe oder Mädchen? Wo lebst du? Wieder bei diesem Huxley und seiner Hure?«
Sheliza antwortete immer noch nicht, überlegte fieberhaft, wie sie aus dieser ihr so peinlichen Situation entkommen konnte. Da war die glühende Sunnitin, deren Denken verzerrt war und die es sich zur heiligen Aufgabe gemacht hatte, möglichst viele Alawitinnen zum sunnitischen Glauben zu führen, mit Hilfe dieses extremen Predigers aus Alexandria. Und da war sie selbst, eine aus eigennützigen Gründen nur scheinbar konvertierte Alawitin, die nun sogar das Christentum annehmen wollte. Das musste für Afifa wie eine schallende Ohrfeige sein. Gerne hätte Sheliza die Frau nie mehr in ihrem Leben getroffen, wollte nichts mehr mit ihr zu tun haben. Doch nun saß sie neben ihr im Bus und suchte nach Antworten und Auswegen.
»Ich war in Syrien«, begann die 15-jährige tapfer, »und es war schrecklich dort, ganz anders, als uns Imam al-Muzaffar erzählt hatte.«
Sie erntete von Afifa Mosul nur ein kurzes, ungläubiges Kopfschütteln.
»Die ISIS Kämpfer sind nichts anderes als gefühllose Mörder«, ergänzte die junge Mutter nun trotz des deutlich aufblitzenden Zorns in den Augen der Sunnitin, »und ihr Kalifat ist ein reines Terror-Regime, hat rein gar nichts mit dem Koran, Allah oder Mohammed zu tun. Ich konnte mit meiner Tochter dieser Hölle zum Glück entkommen. Und ja, ich wohne wieder bei Henry und Holly«, schloss sie ihre heftige Rede wie mit einer Entschuldigung ab, die sie dem zufälligen Zusammentreffen geschuldet glaubte.
»Aber…«, wollte Afifa irgendetwas der 15-jährigen entgegnen, doch die schnitt ihr das Worte sogleich ab: »Kein Aber, Afifa. Ich bin fertig mit dem Islam, restlos fertig. Das, was ich in Syrien erlebt und gesehen habe, hat mich für alle Zeiten kuriert. All dieses Geschwätz von Ehre und Kampf im Namen von Allah ist eine Lüge. Ich habe sie gesehen, die sogenannten Gotteskrieger. Fast alle sind jung, naiv und ungebildet. Sie rauben, plündern, morden und vergewaltigen. Weißt du, was mir passiert ist? Obwohl ich doch Sunnitin geworden bin, hat man mich verhaftet, ins Gefängnis geworfen und als Sklavin verkauft. Als Sklavin! Und später wollte man mich sogar töten oder gegen ein hohes Lösegeld verkaufen. Ist das etwa Allahs Wille? Hat Mohammed so etwas gewollt? Dass Sunniten andere Sunniten versklaven, umbringen oder mit ihnen Geld erpressen? Alles, was Chalid al-Muzaffar uns erzählt hat ist Lüge, Lüge, Lüge. Aber vielleicht weiß es der alte Mann es einfach nicht besser«, schloss sie erneut mit einer Beinahe-Entschuldigung.
Afifa Mosul blieb nun stumm, starrte die junge Mutter aus weit geöffneten Augen immer noch ungläubig und gleichzeitig zornig an, versuchte das Gehörte in ihr bisheriges Bild des Kalifats einzuordnen. Ihre erste Konsternation wurde alsbald von Misstrauen abgelöst, die sich rasch in Wut wandelte.
»Ich weiß nicht, wovon du sprichst, Sheliza. Doch Saif ad-Dín erzählt uns ganz bestimmt keine Lügen, denn er ist von Allah beseelt. Das hast du doch selbst einmal gesagt? Und Allah ist die einzige Hoffnung, Allah zeigt uns den Weg. Wahrscheinlich bist du gar nicht von den Kämpfern des großherzigen Kalifen gefangen genommen und verkauft worden, sondern von diesen kurdischen Hunden. Ja, so wird es gewesen sein«, redete sich die glühende Sunnitin aus dem zuvor Gehörten heraus. Sheliza schüttelte mitleidig ihren Kopf.
»Fahr selbst nach Syrien und sieh es dir an, wenn du mir nicht glaubst«, meinte sie verächtlich zur fast dreimal so alten Frau. Die schwieg einen Moment lang immer noch aufgewühlt und zornig. Doch dann fiel ihr etwas anderes aus der Rede der 15-jährigen wieder ein.
»Was hast du mit für alle Zeiten kuriert gemeint?«, fragte sie ahnungsvoll.
»Den Islam, selbstverständlich. Ich bin fertig mit ihm, endgültig. Er ist keine richtige Religion. Er ist bloß Unterdrückung und Terror. Und ich will nicht, dass meine Tochter unter der Fuchtel des Korans aufwachsen muss, der durch jeden verblendeten Idioten für seine Zwecke missbraucht werden kann«, und nur noch flüsternd fuhr die 15-jährige fort, »weißt du eigentlich, was ich in Deir ez-Zor alles erlebt habe? Um mit meiner Tochter diesem Terror zu entkommen, musste ich sogar eine Spionin der ISIS umbringen. Ich hab die Frau in höchster Not am Hals gepackt und habe sie erwürgt«, und Sheliza hob ihre Arme und zeigte der Muslimin ihre offenen Hände, deren Finger leicht zitterten.
Afifa Mosul schwieg betroffen. Doch in ihren Augen zeigte sich Unruhe und eine ansteigende Anspannung. Einen Moment lang wirkte die gläubige Muslimin wie ein Frettchen, das in der Falle saß und fieberhaft nach einem Loch suchte, durch das sie den Vorwürfen von Sheliza entschlüpfen konnte.
»Du willst deine Tochter ohne Allah aufziehen? Das geht doch gar nicht. Sie ist ihm doch bestimmt längst geweiht worden, gleich nach ihrer Geburt?«
Sheliza lächelte das erste Mal, zynisch und triumphierend.
»Nein. Niemand hat meiner Fadoua nach der Geburt den Gebetsruf in ihr Ohr geflüstert. Wenigstens das konnte ich verhindern. Fadoua ist immer noch rein und sie gehört weder Allah noch Mohammed und schon gar nicht dem Islam.«
Sie hatten Bayswater erreicht und Sheliza überlegte, an welcher Haltestelle sie aussteigen sollte. Die zur Kirche nächst gelegene kam für sie nicht in Frage. Denn sie wollte Afifa Mosul nichts von ihrer eigenen, in wenigen Wochen bevorstehenden Konvertierung zum Christentum erzählen. Deshalb entschied sich die 15-jährige, schon beim nächsten Halt auszusteigen und den Rest der Strecke zu Fuß zu gehen. Besser den Monsignore ein paar Minuten warten lassen und dafür Afifa Mosul abschütteln.
»Ich muss hier raus«, verkündete sie deshalb, als der Bus das nächste Mal stoppte. Rasch erhob sie sich und eilte zum Ausgang, stürzte sich förmlich auf den Gehsteig, drehte sich sogleich um und warf einen Blick zurück, registrierte befriedigt, dass die Sunnitin sitzengeblieben und ihr nicht gefolgt war. Zum Abschied hob Sheliza leicht ihre Hand, winkte jedoch nicht. Afifa saß nur da und starrte Sheliza zornig brütend an, während sich der Bus mit ihr entfernte.
Monsignore Barltrop erwähnte ihre um fünf Minuten verspätete Ankunft mit keinem Wort, vermutete vielleicht einen ausgefallenen Bus, fragte stattdessen sogleich nach den Hausaufgaben, die er ihr beim letzten Treffen vor drei Tagen aufgetragen hatte, nickte zufrieden, als er ihren kurzen Aufsatz über die Güte im Christentum überflog.
»Du hast auf jeden Fall verstanden, auf was es wirklich ankommt. Sehr gut, Sheliza, ich bin mit deiner Einstellung und deinem Eifer äußerst zufrieden. Wie läuft es in der Schule?«
Die Leistungen von Sheliza hatten nach ihrer heimlichen Konvertierung zu den Sunniten merklich nachgelassen. Holly Peterson musste sich als Erziehungsberechtigte sogar von der Schulpsychologin happige Vorwürfe anhören, die darin gipfelten, dass Sheliza bei anderen Pflegeeltern untergebracht werden sollte. Doch noch bevor es dazu kam, floh die damals 14-jährige aus London nach Syrien. Henry und Holly setzten unverzüglich einen Anwalt ein, der die Rechte der Muslimin während ihrer Abwesenheit vertrat und nach ihrer Rückkehr fand sich dank der Unterstützung von Monsignore Barltrop eine gütige Einigung mit der Schulleitung. Sheliza musste das letzte Schuljahr zwar wiederholen, durfte dafür aber bei Henry und Holly wohnen bleiben, zumindest, solange sie sich mit entsprechend guten Leistungen bewährte.
»Die Schule ist anstrengend. Doch vieles ist für mich eine Wiederholung und fällt mir entsprechend leicht«, bekannte die 15-jährige, während draußen und gegenüber dem Verwaltungsgebäude der Kirche St Mary of the Angels die glühende Sunnitin Afifa Mosul auf dem Gehsteig hin und her tigerte, immer wieder wütende Blicke zur anderen Straßenseite warf und leise murmelte: »Warte nur, du gottlose Verräterin, warte nur.«
*
Als Gärtnergehilfe war man Teil des Campus, gehörte zu ihm, wie die gepflasterten Plätze oder die Gebäude, war eher Gegenstand als Lebewesen, fand bei den Studierenden längst keine Beachtung mehr. Fu Lingpo fegte abgestorbene Blätter und Zweige auf einen der Gehwege zusammen, hielt den dicken Stiel des langen Reisigbesens fest in seinen Händen, hatte ein Ölfass auf Rädern neben sich stehen, in das er die zusammengefegten Laubhaufen immer wieder hinein schaufelte, bevor er mit seinem Karren ein Stück weiterging. Fu kam gut voran, spürte keine schleichende Müdigkeit, würde diese Arbeit trotz der herrschenden Hitze ohne Pause bestimmt bis zum Mittagessen durchhalten. Er liebte solche recht stupiden Tätigkeiten. Sie ging einem monoton und automatisch von der Hand, ließen Zeit zum Nachdenken und trotzdem sah man den Fortschritt der eigenen Bemühungen, musste sich dazu nur umdrehen.
Meter um Meter drang er vor, steuerte auf einen Platz mit steinernen Bänken zu, sah kaum einmal auf und die Studierenden an, wenn sie an ihm vorbeieilten, schaute selbst den meist hochaufgeschossenen, schlanken, jungen Dingern nicht nach, die auch auf einem Laufsteg gute Figur gemacht hätten. Grazil wie eine Antilope, selbstbewusst wie eine Löwin und stolz schreitend wie ein Strauß. Oder war es eher staksig wie eine Antilope, träge wie eine Löwin und doof in die Welt blickend wie ein Strauß?
Der Gehweg führte an der steinernen Sitzgruppe vorbei, auf der ein halbes Dutzend Studenten saßen und miteinander diskutierten. Fu Lingpo achtete nicht auf die jungen Männer und die sahen kaum zu ihm hinüber, sprachen lebhaft miteinander und gestikulierten gegeneinander in einer Sprache, die Fu Lingpo nicht kannte, die für ihn jedoch abgehackt und kehlig wie Arabisch klang. Nur wenige Brocken hörte er deutlich heraus, konnte sie klar vom Rest unterscheiden. Darunter tauchten die Namen »Mohamud Kuno« und wenig später auch noch »Dulyadin« auf.
Fu war bei der Nennung des zweiten Namens erschrocken zusammengezuckt und hätte beinahe mit dem Zusammenfegen des Laubs eingehalten, erkannte im selben Moment und aus den Augenwinkeln heraus jedoch die rasche Kopfbewegung zweier Studenten zu ihm hinüber, riss sich zusammen und fuhr mit seiner Arbeit fort, als hätte er nichts gehört oder verstanden. Die misstrauischen Augenpaare schwenkten bald einmal wieder von ihm weg und nahmen erneut an der Diskussion der andern jungen Männer teil, während Fu seine Ohren noch mehr spitzte und versuchte, weitere Worte oder Begriffe zu verstehen oder zu erraten oder sich wenigsten zu merken. Denn der Chinese war auf das Höchste alarmiert und innerlich aufgewühlt. Dulyadin war ein bekannter Anführer der verbrecherischen al-Shabaab Miliz in Somalia. Vor mehr als zehn Jahren jedoch war Mohamud Kuno noch Lehrer in Garissa gewesen und für kurze Zeit sogar Rektor an der Madrasa Schule für islamische Wissenschaften. Nun gehörte er zu den meistgesuchten Terroristen im Nachbarstaat.
Bevor Fu Lingpo die Stelle in Garissa angenommen hatte und mit Sophie Shi hierhergezogen war, erkundigten sie sich eingehend über die somalisch-islamische al-Shabaab-Miliz. Denn immerhin lag Garissa nur zweihundert Kilometer von der Grenze entfernt. Doch eine echte Gefahr schien von den islamistischen Mördern keine auszugehen. Zu unbedeutend war die Universitätsstadt. Doch die Nennung des Namens eines wichtigen Anführers der religiösen Fanatiker aus dem Mund von Studenten war für den Chinesen ein Schock und beängstigend.
Leider bekam Fu nichts mehr von der weiteren Unterhaltung mit, denn die sechs redeten nur noch leise miteinander. Als sie sich wenig später voneinander trennten, entschloss sich der Chinese, dem offensichtlichen Wortführer mit gehörigem Abstand zu folgen und ihn weiter zu beobachten, ohne dass der Kerl etwas davon bemerken sollte. Der Student war bestimmt schon gegen Ende zwanzig und eins neunzig groß, mit magerer Brust und hagerem Körper. Er strebte direkt dem Ausgangstor des Campus zu, blickte sich nicht ein einziges Mal um, überquerte draußen den Platz und stieg in den Fonds einer weißen Limousine, deren Motor lief, wahrscheinlich, um die Klimaanlage im Innern ausreichend mit Energie zu versorgen. Vorne saßen zwei Männer in sehr dunkeln, wahrscheinlich schwarzen Anzügen und mit Sonnenbrillen. Sie starrten beide hinüber zu Fu Lingpo, erkannten in ihm aufgrund seines grünen Anoraks einen der untergeordneten Angestellten der Universität, beachteten ihn nicht weiter, als Fu sich eine Zigarette aus der Brusttasche holte, sie ansteckte und genüsslich an ihr zog. Auf der Rückbank der Limousine war ein älterer Mann gesessen, in einem teuer wirkenden, dunklen Anzug, der so gar nicht zum einsteigenden Studenten in seinen schlabbrigen Jeans, dem aus der Hose hängenden, bunten Hemd und den Nikes an den Füssen passen wollte. Womöglich der reiche Vater, der seinen Zögling vom Campus abholte? Fu notierte sich in Gedanken das Nummernschild, als der Wagen anfuhr und sich in den Verkehr einfädelte.
Bereits auf dem Rückweg zu seiner Arbeit machte sich der Chinese die ersten Vorwürfe. Was sah er bloß für Gespenster? Beziehungsweise hörte von ihnen? Da saßen ein paar Studenten zusammen und redeten über Somalia und deshalb auch über die islamistische al-Shabaab Miliz. Vielleicht waren sie angehende Politwissenschaftler und diskutierten über den Vortrag eines ihrer Professoren? Und Arabisch oder etwas Ähnliches redeten sie womöglich nur, um diese Sprache untereinander zu üben und sich in ihr zu verbessern? Alles harmlos. Oder doch nicht?
Zumindest den Besitzer der weißen Limousine würde Fu herausfinden. Irgendein Vorwand ließ sich bestimmt finden, um sich bei der Polizei über den Namen des Halters zu erkundigen, ein unbedeutender Parkschaden vielleicht, den man am Fahrzeug angerichtet hatte und für den man aufkommen wollte. Und danach? Fu Lingpo dachte nicht weiter. Zumindest vorerst nicht.
*
Als Mei und Chufu das nächste Mal Zenweih in seinem Appartement besuchten, staunten sie nicht schlecht, als sie mit dem Aufzug im obersten Stockwerk angelangt waren, sich die Lifttür öffnete und ein eifriger Carlos möglichst smart lächelnd und doch innerlich strahlend vor ihnen stand.
»Guten Abend Senhora Ling. Guten Abend Senhor Lederer«, begrüßte er sie wie früher in der Villa der Lings und konnte nun ein freudiges Grinsen über die erstaunten Gesichter der beiden Ankömmlinge nicht länger unterdrücken.
»Du arbeitest für meinen Vater?«, fragte Mei neugierig und amüsiert zugleich und erhielt ein stummes, dankbares Nicken: »Ja, Senhor Ling war so freundlich, mich einzustellen.«
»Klasse«, meinte Chufu und klopfte dem jungen Brasilianer anerkennend auf die Schultern.
Zenweih saß auf dem Sofa und las in irgendwelchen Geschäftspapieren, hatte jedoch neugierig ihrer gegenseitigen Begrüßung zugeschaut.
»Hallo ihr beiden. Ihr kommt etwas früh. Das Abendessen wurde noch nicht geliefert.«
»Ja, Papai«, meinte Mei ganz und gar nicht schuldbewusst, »ich weiß, dass wir erst in einer halben Stunde verabredet waren. Doch wichtige Gründe ließen uns jeden Anstand vergessen und zu dir eilen. Schau…«, und damit streckte sie ihre rechte Hand vor, an dessen Ringfinger ein Brillant funkelte.
Zenweih lächelte nachsichtig, während Mei den plötzlich verunsichert blickenden Chufu in Richtung ihres Vaters drängte.
»Äh, Senhor Ling«, begann der Philippine viel zu förmlich, denn er war mit Zenweih schon seit langem per Du, erkannte das belustigte Lächeln des Chinesen und spürte, wie sein Gesicht rot anlief, was ihn ärgerte und ihn trotzig und damit selbstbewusster machte, »ich habe heute deine Tochter Mei gefragt, ob wir nicht heiraten sollten.«
»Und? Was hat sie dir zur Antwort gegeben?«, fragte der Vater spöttisch zurück.
»Äh, selbstverständlich Ja.«
»Dann soll das etwa ein Verlobungsring sein?«, fragte der Chinese nun mit strenger Stimme und mit gerunzelter Stirn, deutete mit dem Zeigefinger in Richtung Mei.
»Ja, ein Verlobungsring.«
»In chinesischen Familien ist es üblich, zuerst die Eltern um ihr Einverständnis zu bitten und erst danach die Tochter zu fragen«, verlangte der Restaurantbesitzer nach Einhaltung der Tradition und fügte tadelnd hinzu, »und ich nehme an, das ist in deiner Heimat, den Philippinen, nicht viel anders?«
»Durch Adoption bin ich Schweizer geworden«, warf Chufu gereizt ein, durch den verbalen und ziemlich herablassenden Tonfall des Chinesen tatsächlich mit einer innerlich weiter ansteigenden Wut kämpfend. Er spürte nun, wie Mei seinen rechten Oberarm umfasste und sich an seine Seite schmiegte, achtete jedoch nicht darauf, wollte sie im ersten Moment mit einer unwillkürlichen Bewegung wie ein lästiges Insekt abschütteln, sah dann aber doch das amüsierte Aufblitzen in den Augen von Zenweih und schalt sich einen Narren.
»Ihr Beiden erlaubt euch wohl einen Scherz auf meine Kosten?«, brauste er auf, doch nicht wirklich verärgert und darum auch nicht echt.
»SMS«, meinte Mei lakonisch neben ihm, »als du noch auf dem Klo saßt, kurz bevor wir von Zuhause wegfuhren.«
Der junge Philippine verdrehte seine Augen, warf auch einen raschen Blick über seine rechte Schulter zurück auf Carlos, der zwar unverschämt grinste, aber so unschuldig tat, als hätte er nichts gehört oder verstanden. Und auch Zenweih strahlte nun glücklich über sein flaches und rundes Pfannkuchengesicht.
»Herzlich willkommen in unserer Familie, lieber Chufu.«
Warmherzig schüttelten sich die beiden Männer die Hände, während Mei glücklich lächelnd danebenstand und Carlos aus der Küche den kalt gestellten Champagner mit vier Gläsern brachte. Geschickt öffnete der junge Brasilianer die Flasche mit einem leisen Plopp, schenkte ein und zu viert stießen sie auf das Wohl des Paares an. Dass Zenweih seinen Hausdiener in ihre private Feier einbezog, war für brasilianische, wie für chinesische Verhältnisse mehr als ungewöhnlich, ließ Mei und Chufu erahnen, wie einsam sich der vielfache Millionär in seinem neuen Appartement fühlte.
Big Ben erschallte und durchdrang dröhnend die weite Zimmerflucht der Penthouse-Wohnung. Carlos entschuldigte sich bei ihnen und ging strammen Schrittes hinüber zur Sprechanlage, fragte hinein, erhielt Antwort und drückte dann den Türöffner, wenig später die Knöpfe zum Aufzug. Zwei Köche aus einem der Chinarestaurants der Lings traten ein, trugen Warmhaltekisten mit sich, steuerten gewohnt und direkt den Esstisch mit den acht Stühlen an, begannen zügig auszupacken und aufzudecken, hatten die beiden Lings und Chufu weder begrüßt noch mit neugierigen Blicken bedacht, versuchten sich in der Kunst unsichtbarer Helfer. Doch als sie mit Aufdecken fertig waren und gehen wollten, rief Zenweih sie zu ihnen herüber und hieß Carlos, zwei zusätzliche Gläser aus der Küche zu holen, informierte seine beiden Köche über die Verlobung seiner Tochter mit dem Philippinen und gemeinsam stießen sie ein weiteres Mal auf das junge Glück an. Auch diese neue Leutseligkeit registrierten die beiden Studenten der Psychologie zwar ohne äußere Reaktion, jedoch mit vielen inneren Gedanken und ersten Mutmaßungen über den seelischen Zustand des chinesischen Millionärs.
Die beiden Köche wurden wenig später verabschiedet und die drei setzten sich an den Tisch, während Carlos die Gläser und den Eiskübel abräumte und sich diskret in die Küche zurückzog. Niemand hätte noch vor einem Jahr darauf gewettet, dass sich aus dem ungehobelten und oft genug recht unverfroren auftretenden Brasilianer ein echter Major Domus entwickeln würde, der feinfühlig spürte, wann seine Anwesenheit erwünscht war und wann er sich zurückzuziehen hatte.
Zenweih, Mei und Chufu plauderten miteinander, während sie sich aus den dampfenden Schüsseln bedienten und mit großem Appetit aßen. Zwischendurch kam Carlos aus der Küche und reichte Grüntee oder räumte leeres Geschirr ab, betreute die drei wie ein wachsamer, aber zurückhaltender guter Geist.
Währenddessen saß Sihena Ling allein an der langen Tafel in ihrer Villa, wurde von Naara recht ungeschickt bedient, zog ein griesgrämiges Gesicht, während sie von ihrem Teller eher naschte als aß. Das Essen allerdings schmeckte ausgezeichnet und Köchin Marta hatte sich mit der italienischen Pasta nero di seppia con frutti di mare diesmal selbst übertroffen. Doch der Appetit schien der Chinesin heute zu fehlen. Womöglich lag es an diesem Briefumschlag, der neben ihrer rechten Hand ungeöffneten lag. Ein eigentlicher Absender fehlte, wie Naara wusste, adressiert war er an Zenweih und Sihena Ling und auf seiner Rückseite standen die Worte Von Ihrer Tochter. Das wusste die Haushaltshilfe, weil sie ihn am frühen Morgen persönlich vom Postboten erhalten und der Hausherrin nach dem Frühstück übergeben hatte.
Naara beobachtete Sihena Ling unauffällig. Doch immerzu schweiften ihre Augen hinüber und auf den Umschlag, über den sie mit Marta nicht nur gesprochen, sondern auch in alle möglichen Richtungen spekuliert hatte. Dass er immer noch verschlossen da lag, war bestimmt Ausdruck des harten Bruches zwischen der Mutter und ihrer jüngsten Tochter. Denn dass dieser Brief nur von Shamee Ling stammen konnte, war für die Köchin wie für das Dienstmädchen von Anfang an klar gewesen.
Was aber mochte in Sihena Ling vorgehen? In dieser so stolzen Frau, die von ihrem Mann schmählich verlassen worden war und von ihren Söhnen und den beiden älteren Töchtern nur noch selten besucht wurde, sich mit der jüngsten verkracht hatte? In dieser alternden Chinesin, die angeblich zahlreiche brasilianische Freundinnen besaß, die sie jedoch nie in ihr Haus einlud und von denen sie auch nie spontan besucht wurde? Eine zunehmend einsame Frau, deren Lebensjahre vorüber strichen und sie verwelken ließen, während sich ein eigentlicher Lebenssinn, ob im Beruf oder in der Familie, immer mehr verflüchtigte.
Naara fühlte, wie sich die Härchen auf ihren Unterarmen aufrichteten, als sie erneut auf den unberührten Umschlag blickte. Was mochte im Brief stehen? Welche menschlichen Abgründe und Tragödien darin zu erfahren sein?
Keiner der Hausangestellten hatte Shamee gemocht, solange sie hier wohnte. Zu hochnäsig und unnahbar, zu unverfroren und gemein war die 17-jährige stets zu allen gewesen. Ihr erstes Verschwinden vor einigen Monaten hatte den Haushalt der Lings zudem gehörig durcheinandergeschüttelt, ebenso ihr plötzliches Auftauchen und ihre erneute Flucht nach dem heftigen Streit mit ihrer Mutter. Und dann war auch noch Senhor Ling ausgezogen, von einem Tag auf den anderen, ohne ein Warnsignal, zumindest ohne erkennbares für Köchin Marta und Dienstmädchen Naara.
Seither trat Sihena Ling noch ungerechter und herrischer auf, tadelte und nörgelte den halben Tag über, ließ kein gutes Haar an ihnen beiden. Das allerdings hätten die zwei Frauen noch problemlos aushalten können. Weit schlimmer war die große Stille, die sich seit dem Auszug des Hausherrn immer weiter in der Villa auszudehnen schien, von einem Raum zum nächsten, angefangen im Zimmer von Shamee im Obergeschoss, hinüber zum Schlafraum des oft schnarchenden Zenweih, hinunter in die Bibliothek und immer mehr auch ins Wohnzimmer hinein und nun sogar bereits hier spürbar, im großen und täglich benutzten Esszimmer.
Naara schauderte innerlich, vor der Kälte, die sie auf einmal körperlich zu spüren vermochte, diese Abwesenheit von guten Gefühlen in den meisten Räumen der Villa.
Sihena legte die Gabel auf dem noch zu Zweidritteln gefüllten Teller, nahm mit der Linken den Brief auf und steckte entschlossen die Spitze der mit etwas Soße und winzigen Stücken Nudeln verdreckten Klinge in die eine Ecke des Umschlags, zog sie ratschend durchs Papier, legte das Messer weg und entnahm dem Kuvert ein einzelnes weißes Blatt, faltete es auf und begann zu lesen.
Noch so gerne wäre Naara hinter ihre Dienstherrin getreten, um wenigstens einen raschen Blick auf die Worte von Shamee zu werfen. Standen happige Vorwürfe oder demütige Entschuldigungen darin? Bat sie womöglich um Geld? Oder um Rückkehr in die elterliche Villa? War sie in Schwierigkeiten oder gar in Gefahr? Doch die Hausangestellte wagte sich nicht zu rühren, beobachtet das zuckende Gesicht von Sihena, sah, wie sich ihre linke Faust um den leeren Briefumschlag krampfte und ihn zerknüllte, wie sich gleichzeitig ihre Kinnlade verhärtete, ihre Mundwinkel erstarrten und die Kiefermuskeln hervortraten, wie ihre schwarzen Augen stechend auf das Papier stierten, als wollten sie es mit ihrem Blick in Brand stecken, wie ihre Pupillen noch einmal ganz nach oben wanderten, den wohl eher kurzen Text erneut überflogen, wie sie endlich den Umschlag los ließ und dieser zerknittert neben dem Teller auf das Tischtuch fiel.
Sihena sagte kein Wort, faltete den Brief zusammen und steckte ihn in die Außentasche des niedlichen, eng geschnittenen Oberteils des Chanel-Kostüms, das sie an diesem Abend trug, stand vom Tisch auf und verließ das Esszimmer ohne Anweisung oder Gruß.
Naara begann das Geschirr und das immer noch unberührte Glas mit dem stillem Mineralwasser abzuräumen, stellte alles auf ein Tablett, ließ nur den zerknüllten Briefumschlag liegen, beachtete ihn nicht, wagte kaum, ihn mit einem Blick zu streifen, so als wäre er etwas Verbotenes oder gar Unheilbringendes.
Doch dann musste sie das weiße und immer noch unbefleckte Tischtuch aus Damast mit seinen fein-gewobenen Rosenblüten, die man nur bei schrägem Lichteinfall erkennen konnte, abziehen und durch ein gleichartiges ersetzen. Denn bei den Lings wurde an jedem Tag der Woche nach dem Abendessen frisch aufgedeckt.
Sollte sie den Umschlag einfach auf den Boden fallen lassen? Und danach? Ihn beim Kehren morgen früh aufnehmen und wie anderen Unrat entsorgen? Oder ihn stattdessen an sich nehmen und aufbewahren?
Immer noch stand das Zimmermädchen neben der langen Tafel und stierte auf das Briefkuvert. Sie hatte bereits bei seinem Eintreffen am Morgen ohne Erfolg versucht, den Posttempel zu entziffern, konnte jedoch die Briefmarke als eine aus den USA identifizieren. Lebte Shamee nun dort? In Florida mit seinem schicken Miami? Oder im aufregenden Los Angeles mit seinem Hollywood? Lag den ganzen Tag faul am Strand von Malibu und ließ sich von sonnengebräunten Schönlingen umgarnen? Baute sich ein neues Leben auf? Fernab von Brasilien und all seinen Zwängen? Im reichen Norden? Oder war sie nur auf der Durchreise gewesen, hatte für sich noch keinen neuen Platz zum Leben gefunden?
Naara nahm den Umschlag endlich zur Hand und glättete ihn auf dem Damast Tuch, strich immer und immer wieder mit der flachen Hand über die Runzeln, faltete ihn dann sorgfältig einmal in der Mitte und schob ihn in die Tasche ihrer Schürze.
Warm hatte er sich angefühlt, samtig und weich und irgendwie sonnig. Ja, Shamee war bestimmt in Malibu, dachte sich Naara und träumte von einem besseren Leben voller Aufregung und Vergnügungen.