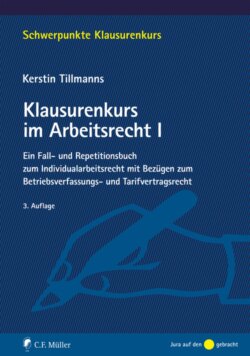Оглавление
Kerstin Tillmanns. Klausurenkurs im Arbeitsrecht I
Klausurenkurs im Arbeitsrecht I
Impressum
Vorwort
Inhaltsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Literaturverzeichnis
1. Teil Allgemeiner Teil
I. Hinweise zur Klausurtechnik
1. Hinweise zur Form. a) Überschreiben Sie die Lösung mit Rechtsgutachten! Schreiben Sie am Ende „Ende der Bearbeitung“!
b) Nummerieren Sie die Seiten und schreiben Sie Ihren Namen auf jede Seite!
c) Schreiben Sie gut leserlich! Gönnen Sie Ihrem Handgelenk und dem Korrektor ein gutes Schreibgerät!
d) Zitieren Sie das Gesetz richtig! Vergessen Sie nicht die Paragraphenzeichen!
e) Zitieren Sie eine Norm niemals ohne Gesetzesangabe!
2. Hinweise zur inhaltlichen Abfassung. a) Jede Klausurlösung beginnt mit einem Obersatz!
b) Beantworten Sie nur die Fallfrage!
c) Verwenden Sie weder „da“ noch „weil“! Bleiben Sie im Gutachtenstil!
d) Der Jurist lässt die Sache sprechen!
e) Verweisen Sie innerhalb Ihrer Klausur auf genaue Gliederungspunkte oder Seiten!
f) Verwenden Sie Abkürzungen allenfalls in echter Zeitnot am Klausurende!
g) Verweisen Sie in Ihrer Lösung nicht auf den Sachverhalt („Laut Sachverhalt …“)!
h) Lassen Sie den bestimmten Artikel vor Personenbezeichnungen grundsätzlich weg!
i) Lassen Sie vermeintlich „bekräftigende“ Ausdrücke weg!
j) Lassen Sie auch „relativierende“ Ausdrücke weg!
3. Beispiel
II. Besonderheiten der Klausur im individuellen und kollektiven Arbeitsrecht
Fall 1 Mehr Schein als Sein
Vorüberlegungen
Gliederung
Lösung[1] Frage 1: Klage der A auf Lohnzahlung
A. Rechtsweg zu den Arbeitsgerichten/Sachliche Zuständigkeit. I. Arbeitnehmereigenschaft als sog. doppelrelevante Tatsache?
II. Arbeitnehmereigenschaft oder § 5 III ArbGG?
B. Sonstige Zulässigkeitsvoraussetzungen
C. Ergebnis
Frage 2: Klage der A auf Urlaubsentgelt
A. Zulässigkeit
B. Begründetheit
I. Voraussetzungen aus § 1 BUrlG
II. Entgeltfortzahlung
C. Ergebnis
Frage 3: Klage der A auf Entgeltfortzahlung für die Woche krankheitsbedingter Nichtarbeit
A. Zulässigkeit
B. Begründetheit
I. Arbeitnehmerbegriff. 1. Abgrenzungskriterien
2. Bedeutung des Vertrags und der tatsächlichen Vertragsdurchführung
3. Gesamtwürdigung der Umstände
II. Unzulässige Rechtsausübung
III. Rechtsfolge
C. Ergebnis
Anmerkungen
Repetitorium. I. Dualismus von Arbeitsnehmer- und Selbstständigeneigenschaft
II. Prüfung der Zulässigkeit durch die Arbeitsgerichte im Urteilsverfahren
III. Zum Urlaubsanspruch. 1
2
IV. Zur krankheitsbedingten Arbeitsunfähigkeit
1
2
3
4
Fall 2 Oldies and Goldies
Vorüberlegungen
Gliederung
Lösung. Frage 1: Ablehnung des A bei seiner ersten Bewerbung. A. Anspruch des A auf Einstellung
I. Anspruch des A auf Einstellung gem. §§ 280 I, 278 BGB i. V. m. §§ 241 II, 311 II Nr. 1 BGB
II. Anspruch des A auf Einstellung gem. § 831 BGB
B. Anspruch des A auf Entschädigung in Geld. I. Anspruch des A auf Entschädigung i. H. v. 6000,– € gem. § 15 II 1 AGG
1
2
3
4
a)
b)
c)
5. Ausschlussfrist
6. Ergebnis
II. Anspruch des A auf Ersatz der 15,– € für die Fahrt zum Vorstellungsgespräch gem. § 15 I AGG
III. Weitere mögliche Anspruchsgrundlagen aus dem BGB. 1. Entschädigung i. H. v. 6000,– €
2. Ersatz der Aufwendungen i. H. v. 15,– €
Frage 2: Antrag auf Rückgängigmachung der Einstellung
A. Antrag des B gem. § 101 S. 1 BetrVG
I. Zulässigkeit. 1. Rechtsweg zu den Arbeitsgerichten/Sachliche Zuständigkeit
2. Sonstige Zulässigkeitsvoraussetzungen
3. Ergebnis
II. Begründetheit
1. Zustimmungserfordernis
2. Nichtvorliegen der Zustimmung
3. Ergebnis
B. Hilfsantrag der D-GmbH
C. Hilfsgutachten
I
II
1
2
a)
b)
aa)
bb)
cc)
c)
3
4
III. Ergebnis
Anmerkungen
Repetitorium. I. Fallgruppen der Diskriminierung
1. Geschlecht
2. Behinderung
3. Rasse/ethnische Herkunft
4. Religion/Weltanschauung
5. Alter/sexuelle Identität
6. Staatsangehörigkeit
7. Gewerkschaftszugehörigkeit
II. Unmittelbare und mittelbare Diskriminierung
III. Mitbestimmung bei personellen Einzelmaßnahmen gem. §§ 99 ff. BetrVG
Anmerkungen
Fall 3 Gehaltsgalopp
Vorüberlegungen
Gliederung
Lösung. Frage 1: Anspruch des R auf Zahlung der monatlichen Zulage i. H. v. 600,– €
A. Widerrufserklärung
B. Widerrufsrecht
I
1
2
a)
b)
aa)
bb)
c)
3
a)
b)
c)
II
C. Ergebnis
Frage 2: Anspruch des R auf Zahlung von Weihnachtsgeld i. H. v. 1000,– €
A. Anspruch aus betrieblicher Übung
B. Erlöschen des Anspruchs
I
II
1
2
a)
b)
c)
aa)
bb)
d)
3
III
C. Ergebnis
Anmerkungen
Repetitorium. I. Anspruchsgrundlagen im Arbeitsrecht
II. Prüfungsschema AGB-Kontrolle
Fall 4 Dumm gelaufen
Vorüberlegungen
Gliederung
Lösung. Frage 1: Schadensersatzansprüche des B gegen A
A. Schuldverhältnis
B. Pflichtverletzung
C. Schaden
D. Verschulden
I. Grundsätzliche Haftung
II. Haftungsmilderung. 1. Bezugspunkt des Verschuldens
2. Arbeitnehmerstatus
3. Betrieblich veranlasstes Handeln
4. Abstufung der Haftung
III. Ergebnis
Frage 2: Rechtliche Lage zwischen G und Y. A. Frage 2a: Schadensersatzansprüche der G gegen Y
B. Frage 2b: Möglichkeiten des Y
I
II
Frage 3: Anspruch des A gegen Y
A. Beschäftigter gem. § 2 I Nr. 1 SGB VII
B. Versicherungsfall der gesetzlichen Unfallversicherung
C. Betriebliche Tätigkeit
D. Kausalität
E. Angehörige desselben Betriebs
F. Kein Vorsatz
G. Ergebnis
Anmerkungen
Repetitorium. I. Haftung des Arbeitgebers bei Arbeitsunfällen
II. Mankohaftung
1
2
Anmerkungen
Fall 5 Des Menschen Wille
Vorüberlegungen
Gliederung
Lösung
A. Zulässigkeit. I. Internationale Zuständigkeit der deutschen Arbeitsgerichte
II. Sachliche Zuständigkeit des Arbeitsgerichts/Rechtsweg zu den Arbeitsgerichten
III. Örtliche Zuständigkeit des Arbeitsgerichts
IV. Sonstige Zulässigkeitsvoraussetzungen
V. Klageart/Rechtsschutzinteresse
VI. Zwischenergebnis
B. Begründetheit
I. Anwendbares Recht
II. Beendigung durch Kündigung
III. Beendigung durch Aufhebungsvertrag
1. Form
2. Anfechtbarkeit wegen Inhaltsirrtums
3. Anfechtbarkeit wegen Täuschung
4. Anfechtbarkeit wegen Drohung
a)
aa)
bb)
cc)
dd)
b)
c)
5. Widerruf gem. §§ 312g, 312b, 355 BGB
a)
b)
c)
d)
6. Unwirksamkeit gem. § 307 BGB
7. Sittenwidrigkeit gem. § 138 I BGB
8. Unwirksamkeit des Vertrags wegen Verstoß gegen das Gebot des fairen Verhandelns
IV. Ergebnis zu B
C. Ergebnis
Anmerkungen
Repetitorium. I. Aufhebungsvertrag und Ausgleichsquittung. 1. Allgemeines
2. Rechtsfolgen des Aufhebungsvertrags
II. Wiedereinstellungsanspruch
Anmerkungen
Fall 6 Erin in Cologne
Vorüberlegungen
Gliederung
Lösung. Frage 1: Kündigungsschutzklage der E
A. Zulässigkeit. I. Rechtswegeröffnung und sachliche Zuständigkeit
II. Örtliche Zuständigkeit
III. Klageantrag und Feststellungsinteresse
IV. Sonstige Zulässigkeitsvoraussetzungen
V. Ergebnis zu A
B. Begründetheit
I. Arbeitsvertrag
II. Kündigung
1. Form
2. Präklusion
3. Anhörung des Betriebsrats
4. Außerordentliche Kündigung
5. Umdeutung in ordentliche Kündigung
6. Ordentliche Kündigung
a) Anwendbarkeit des KSchG
aa)
bb)
b) Rechtfertigung der Kündigung
aa) Verhaltensbedingter Kündigungsgrund
(1) Pflichtverletzung durch die Strafanzeige
(2) Pflichtverletzung durch das Lesen der Akte
bb) Prognoseprinzip
cc) Ultima-ratio-Grundsatz
dd) Interessenabwägung
c) Ergebnis zu 6
C. Ergebnis
Frage 2: Lohnanspruch i. H. v. 60,– €
A. Entstehen des Vergütungsanspruchs
B. Erlöschen des Vergütungsanspruchs
I. Erlöschen des Vergütungsanspruchs gem. § 326 I 1, 2. Halbs. BGB
1. Erlöschen der Leistungspflicht gem. § 275 BGB
a) Erlöschen gem. § 275 I BGB
b) Erlöschen gem. § 275 III BGB
c) Verhältnis von § 275 I und III BGB
2. Schicksal der Gegenleistungspflicht nach § 326 II BGB
3. Ergebnis zu I
II. Erhalt des Vergütungsanspruchs gem. § 616 BGB
1. Erlöschen der Leistungspflicht gem. § 616 BGB
2. Schicksal der Gegenleistungspflicht gem. § 616 BGB
III. Verhältnis des § 616 BGB zu § 45 III SGB V
IV. Ergebnis zu B
C. Ergebnis
Anmerkungen
Repetitorium. I. Prüfungsschema Kündigung – die wichtigsten Punkte. 1. Jede Kündigung
2. Außerordentliche (= fristlose) Kündigung gem. § 626 BGB
3. Ordentliche Kündigung
II. Arbeitsvertragliches Synallagma. 1. Übersicht
2. Arbeitsvertragliches Synallagma – Einzelfälle: a) Annahmeverzug des Arbeitgebers
b) Betriebs- und Wirtschaftsrisiko
c) Krankheitsbedingte Arbeitsunfähigkeit
d) Erholungsurlaub
Anmerkungen
Fall 7 Endless Groove
Anmerkungen
Vorüberlegungen
Gliederung
Lösung
1. Teil: Entfristungsklage des R
A. Zulässigkeit. I. Rechtswegeröffnung und sachliche Zuständigkeit
II. Örtliche Zuständigkeit
III. Klageantrag und Feststellungsinteresse
IV. Partei- und Prozessfähigkeit
V. Sonstige Zulässigkeitsvoraussetzungen
VI. Ergebnis zu A
B. Begründetheit
I. Ausschluss des Klagerechts
II. Schriftform der Befristung
1. Nachträgliche Schriftform
a) Bestätigung gem. § 141 BGB
b) Analogie
2. Nachträgliche Befristung
3. Berufung auf Unwirksamkeit gem. § 242 BGB
a) Verwirkung
b) Venire contra factum proprium
4. Ergebnis zu II
III. Ergebnis zu B
C. Ergebnis
2. Teil: Entfristungsklage des S
A. Zulässigkeit
B. Begründetheit
I. Ausschluss des Klagerechts
II. Schriftform
III. Zulässigkeit der Befristung
1. Befristung mit Sachgrund § 14 I TzBfG
2. Befristung ohne Sachgrund
a) Befristung gem. § 14 II 1 TzBfG
aa) Tätigkeit als Leiharbeitnehmer
bb) Tätigkeit als teilzeitbeschäftigter Techniker im Jahre 2013
cc) Ergebnis zu a)
b) Befristung gem. § 14 III TzBfG
aa) Verstoß gegen EU-Richtlinie 2000/78
bb) Verstoß gegen das Verbot der Altersdiskriminierung als allgemeiner Grundsatz des Unionsrechts
cc) Ergebnis zu b)
c) Ergebnis zu 2
3. Ergebnis zu III
IV. Ergebnis zu B
C. Ergebnis
Anmerkungen
Repetitorium. I. Befristete Arbeitsverhältnisse. 1. Allgemeines
2. Übersicht. a) Sachgrundlose Befristung, § 14 II, III TzBfG
b) Befristung mit Sachgrund, § 14 I TzBfG
II. Unionsrecht und nationales Recht. 1. Übersicht: Geltung/Anwendbarkeit des EU-Rechts. a) Primärrecht (EU-Vertrag/EG-Vertrag)
b) Sekundärrecht – Verordnungen
c) Sekundärrecht – Richtlinien
2. Übersicht: Verhältnis von nationalem und europäischem Recht in der Fallprüfung
Anmerkungen
Fall 8 Qual der Wahl
Vorüberlegungen
Gliederung
Lösung. Frage 1: Kündigungsschutzklagen von G2 und G6
A. Zulässigkeit der Kündigungsschutzklagen. I. Zuständigkeit
II. Klageantrag und Feststellungsinteresse
III. Sonstige Zulässigkeitsvoraussetzungen
IV. Ergebnis zu A
B. Begründetheit der Kündigungsschutzklagen
I. Form
II. Mögliche Präklusion
III. Anhörung des Betriebsrats
1. Anhörung vor Kündigung
2. Informationspflicht
3. Ergebnis zu III
IV. Besonderer Kündigungsschutz
V. Wirksamkeit der Kündigungen nach § 1 KSchG
1. Anwendbarkeit des KSchG
a) Persönlicher Anwendungsbereich
b) Betrieblicher Anwendungsbereich
2. Soziale Rechtfertigung der Kündigungen
a) Betriebsbedingte Kündigungen
b) Sozialauswahl
aa) Vergleichbare Arbeitnehmer des Betriebs
bb) Durchführung der Sozialauswahl
cc) Ergebnis zu b)
3. Ergebnis zu V
VI. Kündigungsfrist
VII. Ergebnis zu B
C. Ergebnis
Frage 2: Rechtsmittel gegen die Kündigung von G6 (Abwandlung)
A. Zulässigkeit der Kündigungsschutzklage. I. Zuständigkeit
II. Klageantrag und Feststellungsinteresse
III. Sonstige Zulässigkeitsvoraussetzungen
IV. Ergebnis zu A
B. Begründetheit
I. Form
II. Präklusion. 1. Ablauf der Präklusionsfrist
2. Antrag gem. § 5 KSchG
a) Zulässigkeit des Antrags
b) Begründetheit des Antrags
c) Ergebnis zu 2
3. Ergebnis zu II
III. Ergebnis zu B
C. Ergebnis
Anmerkungen
Repetitorium. I. Anwendungsbereich des KSchG. 1. Persönlicher Anwendungsbereich
2. Betrieblicher Anwendungsbereich. a)
b)
II. Übersicht: Anhörungsverfahren gem. §§ 102, 103 BetrVG
Fall 9 Vive la différence!
Anmerkungen
Vorüberlegungen
Gliederung
Lösung[1]
A. Zulässigkeit. I. Rechtswegeröffnung und sachliche Zuständigkeit
II. Örtliche Zuständigkeit
III. Klageantrag
IV. Feststellungsinteresse
V. Sonstige Zulässigkeitsvoraussetzungen
VI. Ergebnis zu A
B. Begründetheit
I. Arbeitsvertrag
II. Anfechtung
1. Anfechtung wegen Eigenschaftsirrtums. a)
b)
c)
2. Anfechtung wegen arglistiger Täuschung
3. Ergebnis zu II
III. Kündigung
1. Kündigungserklärung und Form
2. Präklusion
3. Außerordentliche Kündigung
4. Ordentliche Kündigung
a) Kündigungsfrist
b) Soziale Rechtfertigung der Kündigung
aa) Anwendbarkeit des KSchG
bb) Rechtfertigung der Kündigung
(1)
(2)
cc) Ergebnis zu 4
c) Ergebnis zu III
IV. Ergebnis zu B
C. Ergebnis
Anmerkungen
Repetitorium. I. Aufklärungsrechte und -pflichten in der Bewerbungssituation/Anfechtung des Arbeitsvertrags. 1
2
II. Unionsrechtskonforme Auslegung
Anmerkungen
Fall 10 Saubermänner
Vorüberlegungen
Gliederung
Lösung
A. Arbeitsverhältnis
I. Vertragsschluss
II. Kündigung
1. Form
2. Mögliche Präklusion
3. Anhörung des Betriebsrats
a) Anhörungszeitpunkt und Unterrichtungspflicht
b) Fehler im Anhörungsverfahren
aa) Fehlerhaftes Anhörungsverfahren
bb) Rechtsfolge der Fehlerhaftigkeit
c) Ergebnis zu 3
4. Wirksamkeit der Kündigung nach § 1 KSchG bzw. nach § 613a IV BGB
a) Mögliche Unwirksamkeit nach § 1 KSchG
b) Mögliche Unwirksamkeit nach § 613a IV 1 BGB
aa) Übergang eines Betriebs
bb) Fortführung des Betriebs
cc) Übergang durch Rechtsgeschäft
dd) Übergang auf einen anderen Inhaber
ee) Kündigung wegen des Betriebsübergangs
c) Ergebnis zu 4
5. Ergebnis zu II
III. Übergang des Arbeitsverhältnisses auf R
1. Betriebsübergang
2. Arbeitsverhältnis
3. Kein Widerspruch
4. Ergebnis zu III
B. Lohnhöhe
I. Transformation
II. Ablösung durch neuen Tarifvertrag
III. Ergebnis zu B
C. Erlöschen des Anspruchs
D. Ergebnis
Anmerkungen
Repetitorium. I. Betriebsübergang (§ 613a BGB, ähnlich: § 324 UmwG)
1. Prüfungsschema
2. Rechtsfolgen des Betriebsübergangs. a)
b)
c)
d)
e)
Anmerkungen
Sachverzeichnis
Register der Gesetzesverweise
AEUV. Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union
AGG. Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG) [1]
Anmerkungen
AktG. Aktiengesetz
ArbGG. Arbeitsgerichtsgesetz (ArbGG)
AÜG. Gesetz zur Regelung der Arbeitnehmerüberlassung (Arbeitnehmerüberlassungsgesetz – AÜG)
BGB. Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) [2]
Anmerkungen
BUrlG. Mindesturlaubsgesetz für Arbeitnehmer (Bundesurlaubsgesetz – BUrlG)
BetrVG. Betriebsverfassungsgesetz
Anmerkungen
EFZG. Gesetz über die Zahlung des Arbeitsentgelts an Feiertagen und im Krankheitsfall (Entgeltfortzahlungsgesetz) [7]
Anmerkungen
EGBGB. Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche
EUV. Vertrag über die Europäische Union
GG. Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland
GewO. Gewerbeordnung
GmbHG. Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG)
HGB. Handelsgesetzbuch (HGB)
JArbSchG. Gesetz zum Schutze der arbeitenden Jugend (Jugendarbeitsschutzgesetz – JArbSchG)
KSchG. Kündigungsschutzgesetz (KSchG)
MuSchG. Gesetz zum Schutze der erwerbstätigen Mutter (Mutterschutzgesetz – MuSchG) [8]
Anmerkungen
PflZG. Gesetz über die Pflegezeit (Pflegezeitgesetz – PflegeZG) [9]
Anmerkungen
RL 2000/78. Richtlinie 2000/78/EG des Rates zur Festlegung eines allgemeinen Rahmens für die Verwirklichung der Gleichbehandlung in Beschäftigung und Beruf
RL 2006/54. Richtlinie 2006/54/EG des Europäischen Parlaments und des Rates zur Verwirklichung des Grundsatzes der Chancengleichheit und Gleichbehandlung von Männern und Frauen in Arbeits- und Beschäftigungsfragen (Neufassung)
RL 76/207. Richtlinie des Rates. zur Verwirklichung des Grundsatzes der Gleichbehandlung von Männern und Frauen hinsichtlich des Zugangs zur Beschäftigung, zur Berufsbildung und zum beruflichen Aufstieg sowie in Bezug auf die Arbeitsbedingungen (76/207/EWG)[10]
Anmerkungen
SGB II. Sozialgesetzbuch (SGB) Zweites Buch (II) – Grundsicherung für Arbeitsuchende –
SGB III. Sozialgesetzbuch (SGB) Drittes Buch (III) – Arbeitsförderung – [13]
Anmerkungen
SGB IX. Sozialgesetzbuch Neuntes Buch – Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen (Neuntes Buch Sozialgesetzbuch – SGB IX) [16]
Anmerkungen
Sozialgesetzbuch (SGB) – Fünftes Buch (V) – Gesetzliche Krankenversicherung [17]
Anmerkungen
SGB VII. Siebtes Buch Sozialgesetzbuch. Gesetzliche Unfallversicherung [18]
Anmerkungen
SGB XI. Sozialgesetzbuch (SGB) – Elftes Buch (XI) – Soziale Pflegeversicherung
TSG. Gesetz über die Änderung der Vornamen und die Feststellung der Geschlechtszugehörigkeit in besonderen Fällen (Transsexuellengesetz – TSG)
Anmerkungen
TVG. Tarifvertragsgesetz (TVG)
TzBfG. Gesetz über Teilzeitarbeit und befristete Arbeitsverträge (Teilzeit- und Befristungsgesetz – TzBfG) [20][21]
Anmerkungen
WpHG. Gesetz über den Wertpapierhandel (Wertpapierhandelsgesetz – WpHG)
ZPO. Zivilprozessordnung (ZPO)