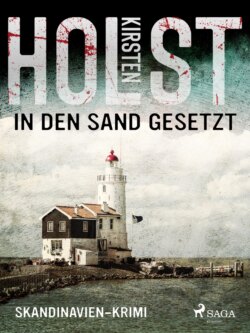Читать книгу In den Sand gesetzt - Skandinavien-Krimi - Kirsten Holst - Страница 4
1. Kapitel
ОглавлениеEs war Sonntag. Der letzte Tag der Schulferien. Die Wettergötter hatten offenbar beschlossen, ihr Bestes zu tun, um den Tag zu einem Erfolg werden zu lassen. Eine heiße Augustsonne brannte von einem völlig wolkenlosen Himmel, beschien die flachen Wellenkämme und wurde in scharfen Blitzen von den Hunderten von sonntagsblanken Autos reflektiert, die ein Stück weiter am Strand außerhalb des autofreien Paradieses geparkt hatten, das direkt unterhalb der Stadt lag. Die Luft flirrte über dem Sand vor Wärme. Man konnte die Hitzewellen nahezu sehen wie Wasser, das über eine schmutzige Fensterscheibe lief. Das klare Licht verzerrte die Abstände und Dimensionen, ließ Nahes fern und Fernes nah erscheinen. Selbst die Geräusche waren anders als sonst.
Unten am Wasser lachten und schrien ein paar Kinder mit hohen, durchdringenden und trotzdem so leisen Stimmen, als riefen sie in einem schalldichten Raum und die Schreie der Möwen blieben melancholisch in der Luft hängen, wenn die Vögel plötzlich aus ihrem Höhenflug auf die glitzernden Wogen herabstießen. Der ganze Strand schien wie ein Vakuum, herausgehoben aus Zeit und Raum. Alle Bewegungen erfolgten in einer Art zäh fließendem Zeitlupentempo. Irgendwo unterhalb der Dünen spielten vier ausdauernde Touristen – vermutlich Deutsche – Federball. Der leichte Federball löste sich fast widerwillig von dem Schläger, segelte in einem trägen Bogen durch die Luft und traf den anderen Schläger mit einem schwachen, kaum hörbaren Knall. Hin und zurück, hin und zurück. Wie ein Perpetuum mobile. Über den Dünenspitzen, weiter Richtung Stadt, stieg ein kleines, blaurotes ferngesteuertes Modellflugzeug in großen, weichen Kreisen höher und höher in den Himmel, bis man es nur noch als dunklen Fleck in all dem Blau ahnen konnte. Ein Ikarus auf dem Weg zur Sonne.
Hin und wieder ließ ein schwacher Windstoß vom Meer den ganzen Strand tief durchatmen und der Strandhafer neigte seine langen, spitzen Halme zum Sand hin und zeichnete kleine, präzise Kreise um sich herum, als wollte er sein Territorium markieren.
Ein Käfer, der offensichtlich noch kein Vertrauen in seine Fähigkeit hatte, auf seinen sechs Beinen zu gehen, arbeitete sich beschwerlich an der Seite einer Dünenmulde hoch. Er glich einem VW auf dem Weg durch eine endlose Wüstenlandschaft; fast konnte man den schnurrenden Motor hören und sehen, wie er immer wieder den Gang wechselte.
Unten in der Mulde lag ein Mann und nahm ein Sonnenbad. Ein gut gekleideter Mann. Oder besser ein gut ausgezogener Mann, denn er trug nur eine Badehose. Trotzdem machte er auf die eine oder andere Weise einen gut gekleideten Eindruck. Die blaue Badehose war aus einem glänzenden, elastischen Stoff und saß wie angegossen, das blaue Handtuch, das Kopf und Schultern bedeckte, passte farblich genau zu der Hose, er war braun genug, um nicht nackt zu wirken, und er lag hübsch und ordentlich auf dem Bauch, die Arme fest an die Seiten gepresst. Fast in Habachtstellung.
Endlich hatte der Käfer den Rand der Mulde erreicht, doch hier stieß er auf eine der Miniatursandburgen, die sich um den Strandhafer bildeten, und – bevor er seine Beine zur Zusammenarbeit sortiert hatte – verlor er das Gleichgewicht und fiel zum wer weiß wievielten Mal an diesem Nachmittag wieder auf den Grund der Mulde und landete auf dem Rücken des gut gekleideten Mannes. Der Sisyphusmythos im Miniformat. Sisyphus und der Stein – verkörpert in ein und demselben Wesen. Einen Augenblick focht er mit seinen sechs widerspenstigen Beinen in der Luft, dann rappelte er sich auf, erholte sich einen Moment, wippte mit den Fühlhörnern in alle Richtungen, um die Lage abzuschätzen, und begann wieder von vorn. Schnell krabbelte er über den gebräunten Rücken, fiel Hals über Kopf in den Sand, kam wieder auf die Beine und begann seine beschwerliche Wanderung aufwärts.
Der Mann in der blauen Badehose hatte sich nicht bewegt. Keinen Versuch unternommen, den Käfer abzuschütteln. Offensichtlich hatte er ihn nicht einmal bemerkt.
Er rührte sich auch nicht, als die Luft plötzlich in einem donnernden Knall explodierte. Ein paar Düsenjäger brachen durch die Schallmauer und verschwanden mit zwei leuchtenden Streifen hinter sich über dem Meer, während der Knall noch über dem Strand hing. Die Sonntagsträgheit war gebrochen. Die Leute waren aus ihrer Apathie, aus der Monotonie gerissen. Sie stützten sich auf die Ellenbogen, sahen sich mit blinzelnden Augen um, kamen überein, dass sie ebenso gut ins Wasser gehen, Eis kaufen, Bier trinken, Ball spielen oder sich die andere Seite mit Sonnencreme einreiben – sich jedenfalls etwas vornehmen – konnten. Nur der gut gekleidete Mann rührte sich nicht.
Er muss stocktaub sein, dachte Bo, der gerade an ihm vorbeikam und dessen Blick den Mann im Vorbeilaufen streifte. Entweder das oder er konzentriert sich darauf, braun zu werden. Manche waren so. Sie legten sich an den Strand oder in die Dünen und schienen ihren gan– zen Willen und ihre ganze Energie auf dieses eine Ziel zu konzentrieren: braun zu werden. Als wäre es eine Arbeit, die getan werden musste, und zwar so gut und so effektiv wie möglich. Der Kerl da war bestimmt einer von ihnen.
Damals ahnte Bo nicht, wie sehr er sich irrte, und ebenso wenig ahnte er, wie sehr er sich einmal wünschen würde, den Mann in der blauen Badehose nie gesehen zu haben.
Ein Stück weiter den Weg hinunter verlangsamte er das Tempo und wich in einem Bogen aus, um eine Familie vorbeizulassen. Er nickte ihnen zu, als sie auf gleicher Höhe waren. Er kannte sie vom Sehen. Familie Larsen. Sie hatten die letzten vierzehn Tage im Sommerhaus des Zimmermanns gewohnt. Vater und Mutter, ein Mädchen von etwa zehn und ein ziemlich ungenießbarer Junge um die sieben.
»Wer war das noch mal?«, fragte Alice Larsen ihren Mann, sobald sie außer Hörweite waren.
»Hast du ihn nicht erkannt?«, fragte ihr Mann. »Das war doch der junge Mann, der uns gegenüber wohnt. Der Sohn von Sanders. Der Kunstmaler.«
»Ja, richtig«, rief sie. »Der mit den wunderschönen Meerbildern, nicht? Wie hält er es bloß aus, bei der Hitze zu laufen?«
»Er läuft immer«, erklärte die elfjährige Lene.
»Nicht, wenn er malt«, sagte ihr kleiner Bruder triumphierend. Sie warf ihm einen Was-bist-du-doch-dumm-Blick zu, den er nicht sah, da er vor ihnen herlief. Plötzlich blieb er abrupt stehen, dann drehte er sich um und kam mit einem Gesichtsausdruck zurückgelaufen, als hätte man ihm die Butter vom Brot geklaut.
»Er hat uns wieder die Mulde weggeschnappt!«, rief er anklagend.
»Pssst«, sagte seine Mutter.
»Aber das hat er doch.«
»Er ist bestimmt Deutscher«, sagte Lene in einem Ton, als würde allein das ein schlechtes Licht auf ihn werfen.
»Wir suchen uns einfach eine andere Mulde«, sagte Larsen. »Es gibt doch genug.«
»Warum hat er dann unsere genommen?«, fragte der Junge mit unerbittlicher Logik.
»Das ist nicht unsere. Wer zuerst kommt, mahlt zuerst. Hättest du nicht unbedingt Minigolf spielen wollen, hätten wir sie vielleicht bekommen. Jetzt hat er sie.«
»Er hat sie uns auch gestern weggeschnappt«, sagte der Junge beleidigt. »Sie gehört uns viel mehr, weil wir auch an den anderen Tagen da gelegen haben.«
»Das hat doch damit nichts zu tun«, sagte seine Mutter müde. Der Drang, zu besitzen, war offenbar angeboren. Kinder konnten schwer zwei zusammenhängende Worte sagen, ohne dass eins davon ein Possessivpronomen war. Meine Mutter, mein Vater, mein Schnuller. Und wehe dem, der ihr Eigentumsrecht anfocht.
»Er sieht auch richtig widerwärtig aus«, sagte der Junge finster. »Er ist alt.«
»Er ist bestimmt Deutscher«, wiederholte Lene. Als würde das alles erklären.
Nahe der Stadt kamen drei, vier redende, kichernde und Eis essende Mädchen von zwölf, dreizehn Jahren die schmale Treppe hinauf, die vom öffentlichen Parkplatz hoch in die Dünen führte. Eine von ihnen lief rückwärts, ein wenig vor den anderen her, während sie rief: »Kommt! Was seid ihr langsam! Habt ihr überhaupt keine Kondition?«
Sie erreichte die oberste Treppenstufe, und als ihr Fuß plötzlich auf nichts als leeren Raum traf, verlor sie das Gleichgewicht, machte ein paar stolpernde Schritte rückwärts und prallte gegen den Bauch eines großen Mannes, der gerade aus dem Weg auftauchte, der zwischen den Hagebuttensträuchern entlangführte. Er verlor die Plastiktüte, die er bei sich trug, warf ihr einen wütenden Blick zu und zischte böse: »Kannst du nicht aufpassen, Mädchen!«, während er eilig die Tüte und ihren Inhalt wieder aufsammelte.
Das Mädchen warf ihm einen erschrockenen Blick zu, murmelte schnell eine Entschuldigung und lief eilig ein paar Schritte den Weg entlang, indem sie sich die Hand vor den Mund hielt, um ein unbezwingbares Lachen zu verbergen. Sie wusste selbst nicht, ob sie vor Schreck kicherte oder weil der Mann in seiner Wut so komisch ausgesehen hatte.
Die anderen holten sie ein.
»Typisch Pia«, sagte eine von ihnen. »Den Leuten genau in den Bauch zu rennen.«
»Hysterischer Kerl!«, sagte Pia. »Das war genauso seine Schuld. Schließlich habe ich hinten keine Augen im Kopf.«
»Männer sind hysterisch«, bemerkte eine der anderen tiefsinnig und die Freundinnen nickten altklug.
»Oh Mann, das sah wirklich komisch aus«, sagte eine und die Mädchen krümmten sich vor Lachen. Sie kicherten noch immer, als sie ein Stück weiter Bo trafen. »Hey Bo!«, rief Pia schon von weitem. »Läufst du bei dem Wetter? Du bist ja verrückt!«
Bo erreichte sie. »Heute sind bestimmt mehrere Tausend Menschen hier am Strand. Könnt ihr mir sagen, warum ich dauernd jemanden treffe, den ich kenne? Und könnt ihr mir zuerst einmal sagen, warum ich jemanden wie euch treffe?«
»Sind da draußen auch so viele?«, fragte Pia und nickte mit dem Kopf Richtung Weg.
»Nein, natürlich nicht. Sobald man hundert Meter weiter geht, ist fast niemand mehr da. Die Leute gehen nicht gerne. Warum auch! Wollt ihr nackt baden?«
Die Mädchen kicherten. »Nur sonnenbaden«, sagte Pia. »Spendierst du uns ein Eis?«
»Ein Eis? Euch? Ihr müsst verrückt sein, wenn ihr das glaubt!«
»Ach Bo, bitte!« Die Mädchen sahen ihn flehend an und lächelten einschmeichelnd.
»Okay«, sagte Bo, zog ein Bündel Scheine aus der Hemdtasche und gab Pia einen. »Aber nur unter der Bedingung, dass ihr nicht jetzt da runtergeht und Eis kauft. Ich will nicht so einen Haufen Papageien im Schlepptau haben. Die Leute könnten ja denken, ich sei euer Vater.«
Ihr Vater! Die Mädchen krümmten sich vor Lachen. Bo war 25 und sie waren alle ein bisschen in ihn verliebt. Sie gingen kichernd weiter. Bo blieb einen Moment stehen und sah ihnen kopfschüttelnd nach. Er konnte sich nicht erinnern, dass er und seine Freunde jemals so gewesen waren. Über alles und nichts gelacht hatten. Hatten Mädchen es wirklich so viel lustiger? Dann ging er in normalem Tempo Richtung Treppe.
Als er gerade hinuntergehen wollte, sprang ihm etwas ins Auge, das in den Hagebuttensträuchern lag. Ein Schuh. Ein Herrenschuh.
Sein erster Gedanke war, ihn liegen zu lassen. Er war bereits ein paar Stufen hinuntergegangen, als er plötzlich eine Idee hatte. Er ging zurück zu dem Hagebuttenstrauch, beugte sich hinunter und fischte den Schuh heraus, während er halblaut murmelte: »Hallihallo, hier komme ich! Guck mal, was ich gefunden habe.« Er sprang die Stufen hinunter, während der helle Sommerschuh an seinem Zeigefinger hing und hin- und herbaumelte.
Weltschmerz, dachte Kriminalkommissar Høyer. Das war das richtige Wort. Ein Anfall von Weltschmerz. Depression klang zu hart, zu klinisch. Auch wenn es genau das war. Eine Postferiendepression.
Er war im Bad gewesen, hatte sich umgezogen und stand jetzt auf dem Schlafzimmerbalkon, die Hände auf die Brüstung gestützt, und sah in den Garten hinunter, während er versuchte, seine Gefühle zu analysieren. Vor weniger als acht Stunden hatte er genauso auf einem anderen Balkon gestanden, mehrere tausend Kilometer entfernt, mit Aussicht auf Meer, Strand, Ferienhotels und exotische Pflanzen. Aber in Gedanken war er bereits hier gewesen. Es kam vor, dass die Seele nicht sofort folgen konnte, wenn man eine Reise antrat, dafür aber bereits vor einem selbst wieder nach Hause zurückkehrte. Es lag nicht daran, dass die Ferien kein Erfolg gewesen waren. Er hatte sie in weit höherem Ausmaß genossen, als er erwartet hatte. Vierzehn Tage in einem Touristenparadies – das hatte nicht wie sein Traum von Ferien geklungen, er war kein Sonnen- und Strandanbeter. Aber Mallorca hatte weit mehr als Strand und billigen Alkohol zu bieten gehabt. Trotzdem war da plötzlich das Gefühl aufgetaucht, dass es reichte. Er war fast erleichtert gewesen, als er dort auf dem Balkon gestanden und gedacht hatte, dass er bald wieder zu Hause sein würde. Und plötzlich hatte es ihm nicht schnell genug gehen können. Ein überwältigendes Gefühl von Heimweh hatte ihn gepackt. Und er hatte den Eindruck gehabt, dass er weinen würde wie ein Kind, das sich verlaufen hatte, wenn die Heimreise sich aus irgendei– nem Grund plötzlich verzögern würde. Er lächelte ein wenig über sich selbst. Und jetzt war er zu Hause und trotzdem stimmte etwas nicht. Es war nicht die übliche leichte Depression, die er immer hatte, wenn er mitten am Tag Alkohol trank – auch wenn er im Flugzeug vielleicht nichts hätte trinken sollen –, es war eher Enttäuschung. Das Haus hatte so fremd gewirkt, fast feindlich, als sie es betreten hatten. Die Zimmer hatten im Halbdunkel hinter heruntergelassenen Jalousien gelegen und es hatte merkwürdig gerochen, fast unbewohnt. Und der Garten! Høyer seufzte leicht. Er hatte unbestreitbar wenig Ähnlichkeit mit dem Bild, dass er am Morgen auf dem fernen Balkon vor sich gesehen hatte. Der Rasen sah gelb und ungepflegt aus, Rosen und Dahlien hatten überall welke Blüten, einige Stauden waren umgeknickt und lagen auf dem Boden, alles wirkte unordentlich und vernachlässigt.
Høyer schämte sich ein wenig über sich selbst. Es war eine kindische Enttäuschung, die er empfand. Er hatte davon geträumt, in ein Haus zurückzukommen, das aussah, als hätten sie es nie verlassen. So, wie er in der Kindheit nach den Ferien nach Hause gekommen war.
»Bist du fertig?«, rief seine Frau von unten.
»Ja.« Høyer strich sich übers Kinn. Trotz allem hatte es geholfen, sich zu rasieren und ein Bad zu nehmen.
»Der Kaffee ist fertig. Aber vielleicht willst du lieber ein Bier?«
»Nein, um Himmels willen! Ich glaube, Kaffee ist genau das, was ich jetzt brauche.«
Es roch nach Kaffee, als er die Treppe hinunterkam. Und er begann, sich besser zu fühlen. Ein heimeliger Duft. Unten konnte er die eiligen Schritte seiner Frau hören. Das Haus begann, wieder lebendig und vertraut zu werden.
Er warf einen Blick in den Spiegel, als er durch die Diele ging. Die Sonne hatte ihn etwas verbrannt, die Nase schälte sich, die neue Haut sah hellrot und unfertig aus. Bisher hatte er sich keine Gedanken darüber gemacht, dort unten sahen viele so aus. Jetzt kam es ihm plötzlich fast unanständig vor.
Mein Gesicht sieht aus wie ein Affenhintern, dachte er.
Er ging durchs Wohnzimmer. Die Türen zur Terrasse standen offen. Die Gardinen waren zur Seite gezogen, Rigmor hatte bereits die Blumen auf die Fensterbänke zurückgestellt und auf dem Tisch stand eine flache Schale mit Rosen.
Er rieb sich die Hände, als er hinausging und sich an den Gartentisch setzte. Er blickte über den Garten.
»Ich glaube, nach dem Kaffeetrinken mähe ich den Rasen«, sagte er.
Seine Frau warf ihm einen schnellen Blick zu.
»Bist du endlich zu Hause angekommen?« Sie lächelte ihn an.
Høyer lehnte sich im Stuhl zurück.
»Ja, ich glaube, jetzt habe ich meine Seele eingeholt.«
Bo schlenderte mit seiner am Zeigefinger baumelnden Trophäe langsam durch die Stadt. Zwischendurch wechselte er die Hand. Er sah auf seine Uhr. Es war nicht einmal drei. Er setzte sich in ein Straßenrestaurant und bestellte ein Bier. Er war der einzige Gast. Die Stadt machte einen ausgestorbenen Eindruck, alle schienen unten am Strand zu liegen. Nur die Geschäftsleute standen vor ihren Läden oder saßen auf den Treppenstufen und schlürften Sonnenschein in sich hinein, während sie auf bessere Zeiten warteten. Bo sah sich um. Es war merkwürdig, die Stadt so zu sehen. Mit Sonnenschein, offenen Geschäften, Warenstativen, Sonnenschirmen und Cafétischen, aber ohne Menschen. Oder jedenfalls ohne viele Menschen. Es kam ihm vor wie eine Bühne, auf der eine Riesenhand alle Akteure entfernt hatte, sodass nur noch die Kulisse da war. Es war eine seltsame Stadt. Nicht wie andere Städte, die er kannte; manchmal verabscheute er sie und trotzdem dachte er nicht im Traum daran, seine Ferien anderswo zu verbringen. Er gehörte trotz allem hierher. Das lag natürlich nicht nur an der Stadt. Das lag auch an seinem Onkel Lars und Tante Bella, doch selbst wenn es sie nicht gegeben hätte, würde er zurückkommen, dachte er und wusste, dass das nicht stimmte, denn wenn es sie nicht gegeben hätte, hätte es auch die Stadt nicht gegeben. Jedenfalls nicht für ihn. Als sein Vater und seine Mutter geschieden wurden, hatte er ein langes, furchtbares Jahr auf dem Internat verbracht. Kein Elternteil schien in seinen Träumen von einem neuen Leben Platz für einen schlaksigen, schwierigen Jungen von dreizehn Jahren zu haben. Er hatte sich schrecklich gefühlt, verraten, ausgemustert und irgendwie schuldig. Als er Lars und Bella in den Sommerferien besucht hatte, war der Onkel entsetzt gewesen über die Veränderung, die mit ihm passiert war, und er hatte die Sache sofort in die Hand genommen. Bos Eltern hatten fast erleichtert gewirkt, als er ihnen vorgeschlagen hatte, dass Bella und er Bo in Pflege nehmen wollten. Das befreite sie von einer Verantwortung, die zu übernehmen sie keine Lust hatten, und vielleicht auch von einem leichten Schuldgefühl. Seit Bo hier ein Zuhause gefunden hatte, hatte er sie nicht oft gesehen und häufig hatte er sich bei dem Wunsch ertappt, dass Lars und Bella seine richtigen Eltern wären. Der ruhige, gelassene Lars, mit dem man über alles reden konnte, und die warme, lebensfrohe Bella, die ihr lustiges, gebrochenes Dänisch mit französischen Wendungen würzte, wenn sie sich über etwas aufregte. Niemand wusste genau, wo Onkel Lars sie getroffen hatte. Bo konnte sich schwach erinnern, dass sie plötzlich da gewesen war und dass das eins der Dinge war, über die die Familie mit gedämpfter Stimme und warnenden Seitenblicken sprach, wenn er in der Nähe war. Er wusste auch, dass in der Stadt Gerüchte über sie umgingen. Vielleicht war es Lars selbst, der ihm vor vielen Jahren davon erzählt hatte, damit er vorbereitet war, wenn er von anderen etwas hörte. Aber Bo erinnerte sich nicht, dass das je passiert war, jedenfalls hatte er es nie mitbekommen. Nicht bis zum letzten Mal, als er zu Hause gewesen war. In den Weihnachtsferien. Es war eine absolut alberne Geschichte gewesen. Er war in eine Kneipe gegangen und hatte sich mit ein paar alten Schulkameraden unterhalten. Mit ein paar jungen Männern, mit denen er vor vielen Jahren zusammen in die Schule gegangen war. Ein Bier hatte das andere abgelöst und irgendwann war offenbar Bellas Name in der Unterhaltung gefallen. Bo wusste nicht mehr, was eigentlich passiert war, er konnte sich nur erinnern gesagt zu haben, dass es schade sei, dass sie nie selbst Kinder gehabt hatte, sie wäre eine fantastische Mutter gewesen. Worauf einer der anderen ein schäbiges Gelächter angeschlagen und gesagt hatte: »Ja, verdammt, auf verbrannter Erde wächst nun mal nichts mehr.«
Bo schüttelte sich leicht bei der Erinnerung an das dumme, leere Gesicht des anderen mit seinem gehässigen, wissenden Gelächter und wie er plötzlich geglotzt hatte, als Bos Faust vorgeschossen war und mit einer perfekten Rechten seinen Kiefer getroffen hatte. Bo war fast ebenso überrascht gewesen, er hatte nicht gewusst, dass er schlagen konnte.
Es war eine dumme Geschichte gewesen und das Schlimmste war, dass er es hinterher weder erklären noch sich verteidigen konnte. Er konnte weder der Polizei und erst recht nicht Lars und Bella erzählen, was ihn plötzlich zum Schläger hatte werden lassen. Manchmal hatte er das Gefühl, dass Lars ahnte, was dahinter steckte, aber das war eins der wenigen Dinge, über die sie nicht sprechen konnten. Natürlich hätte er nicht Zuschlagen dürfen, er hätte es einfach überhören sollen, aber im Innersten hatte er es nicht bereut, nicht einmal als er wegen Gewalt gegen Unschuldige zu zwanzig Tagessätzen zu je sechzig Kronen verurteilt worden war. Unschuldige! Hoffentlich geriet die ganze Geschichte bald in Vergessenheit, er war um eine Erfahrung reicher und musste sich damit abfinden, dass man ihn zumindest eine Zeit lang für einen Schläger hielt.
Er spülte den letzen Schluck Bier hinunter und schnitt eine Grimasse. Es war schon lauwarm. Er stand auf, nahm den Schuh vom Stuhl neben sich und ging zu Jes– pers Grill. Schon von weitem schlug ihm der fettige Geruch der Fritteuse entgegen, der Geruch von Pommes frites, Grillhähnchen, Zwiebeln und Ketchup, der immer hier in der Luft hing.
Er setzte sich auf einen der draußen stehenden Stühle. Das große, dunkle Mädchen, das gerade ein junges Paar bediente, lächelte ihn kurz an, dann konzentrierte sie sich wieder auf ihre Hotdogs.
Er saß da und betrachtete sie. Sie war schön. Ohne Zweifel. Aber nicht schöner als so viele andere Mädchen. Warum hatte er sich so rettungslos in sie verliebt? Maja, Maja, Maja, ihr Name ging ihm die ganze Zeit nicht aus dem Kopf und er benutzte jede Gelegenheit, hierher zu kommen und mit ihr zu reden. Noch nie in seinem Leben hatte er so viele Hotdogs, Pommes frites und Hamburger gegessen wie in diesem Sommer. Bella machte sich richtig Sorgen um seinen mangelnden Appetit. »Du musst verliebt sein«, sagte sie und irgendwie hatte sie ja Recht.
Maja war fertig, legte die Arme auf die Theke und beugte sich zu ihm vor.
»Habe ich Ketchup auf der Nase?«, fragte sie.
»Was?«, sagte er. »Nein, warum?«
»Du starrst mich so an.«
»Tu ich das?« Er stand auf und ging zur Theke. »Schau mal, was ich dir mitgebracht habe.« Er stellte den Schuh auf die Theke.
Sie sah ihn an und lachte. »Du spinnst ja! Was soll ich denn mit einem Schuh?«
»Du weißt ja nicht, was in ihm drinsteckt«, lachte er. Er steckte die Hand suchend in den Schuh, guckte verblüfft und zog eine graublaue Socke heraus. »Wie wäre es mit eine Socke?«
»Kein Bedarf«, sagte sie. »Und du solltest den Schuh besser von der Theke nehmen. Wenn Jesper das sieht, bekommt er einen hysterischen Anfall. Er ist fest davon überzeugt, dass die Hälfte unserer Kunden Spione vom Gesundheitsamt sind, die darauf achten sollen, ob wir uns die Finger ablecken oder in der Nase bohren oder Schuhe auf die Theke stellen.«
»Äußerst beruhigend«, sagte Bo. »Das hält euch bei der Stange.«
»Ja, und ob. Ist das dein Schuh?«
»Meiner? Bist du verrückt. Das ist nicht gerade mein Stil. Siehst du nicht, dass das ein teurer Schuh ist?«
»Ich hab keine Ahnung von Herrenschuhen. Wie teuer ist er?«
»Tja, ein einzelner Schuh ist natürlich nicht viel wert, eigentlich gar nichts. Das könnte ich jetzt natürlich noch weiterspinnen, es ist ja irgendwie symbolisch, nicht? Aber ich werde dich damit verschonen. Kurz gesagt, ich würde wetten, dass ein Paar davon – wenn man ein Paar hätte – ungefähr ...« Einen Moment sah er sich den leichten, hellen Sommerschuh mit dem geflochtenen Oberleder an. »Sechs– bis siebenhundert Kronen kostet.«
»Sechs– bis siebenhundert! Das ist doch Wahnsinn!«
»Er ist schick. Italienisch. Markenware.«
»Wem gehört er?«
»Keine Ahnung. Ich habe ihn gefunden.« Er schwang den Schuh hin und her und etwas fiel auf die Theke. »Zum Teufel, da ist auch noch eine Uhr. Mensch, die hätte ich leicht verlieren können.«
»Die Socke hat sie festgehalten«, sagte Maja.
Bo zog die Uhr an.
»Schön. Ich habe mir immer zwei Uhren gewünscht. Eine an jedem Arm. Das sieht nach Geld aus, nicht? Als hätte man die Dinge im Griff. Es ist auch symmetrischer.«
»Du solltest das zur Polizei bringen.«
»Ja, das sollte ich wohl. Mir tut der Kerl Leid, der jetzt auf einem Bein herumhumpelt und nicht weiß, wie spät es ist. Ich kann mir vorstellen, wie ihm zumute ist, ich bin ein empfindsamer Mensch. Aber dass ich mit einem Schuh zu Jønsson gehe, das kann ich mir nicht vorstellen.«
»Er wird heute auch geschlossen haben.«
»Ich hatte gedacht, die Polizei hätte an jedem Finger ein Auge, aber Jønsson hat eher einen Finger auf jedem Auge. Meinst du nicht, dass ich deine charmante kleine Schwester dazu überreden kann, morgen mit dem Strandgut zu ihm zu gehen?«
»Pia? Bestimmt. Wenn sie Prozente vom Finderlohn bekommt. Umsonst macht sie nichts.«
»Das ist ein vernünftiges Prinzip. Sie wird es einmal zu etwas bringen. In unserer Zeit sind Leute, die etwas umsonst tun, äußerst suspekt. Deine Arbeit wird nach dem Preis beurteilt, den du dafür verlangst. Bitte, frag sie.«
Maja holte eine Plastiktüte und steckte die Sachen hinein. »Das werde ich. Ich kann das mit nach Hause nehmen und ihr heute Abend geben.«
»Und sag ihr, dass sie den Finderlohn behalten kann. Wenn es welchen gibt. Ich käme mir wie ein Idiot vor, wenn ich einen Fünfzigkronenschein dafür bekäme, dass ich einen Schuh gefunden habe.«
»Du bist verrückt.«
»Ja, aber ich liebe dich trotzdem.«
»Willst du ein Hotdog?«
»Musst du meinen Bekenntnissen so niedrige Motive unterstellen? Ich liebe dich mit oder ohne Hotdog. Außerdem gehen wir heute Abend essen.«
»Wir?«
»Ja, du und ich. Ich habe einen Mäzen gefunden. Das müssen wir feiern. Suppe, Steak und Kuchen. Verschiedene Weine. Alles, was tu willst.«
»Einen Mäzen. Einen, der deine Horrorkunst unterstützt? Unmöglich.«
»Horrorkunst! So schlecht sind die Bilder nun auch wieder nicht.«
»Doch, das sind sie. Und das weißt du selbst. Dünen bei Sonnenuntergang. Fischerboote bei Sonnenuntergang. Das Meer bei Sonnenuntergang. Sie sind geradezu peinlich.«
»Harte Worte im August.«
»Bist du beleidigt?«
»Nein, auch wenn mir der Ausdruck Horrorkunst nicht gerade gefällt. Aber es ist nun mal so, dass dieser Kunsthändler alle Bilder kauft, die ich male, und 200 Kronen pro Stück bezahlt. Ich lebe von meiner Horrorkunst. Verdammt noch mal.«
»Ja, und er verkauft sie für 500 oder mehr. Das ist Diebstahl!«
»Das weiß ich, ich fühle mich auch wie ein Hehler.«
»Das habe ich nicht gemeint.«
»Okay, aber das war keins von den Horrorbildern. Sondern ein richtiges. Ich habe 1000 Kronen dafür bekommen. Hard cash. Ich erzähle es dir heute Abend. Das ist wie gefundenes Geld, also können wir es auch ausgeben.«
»Holst du mich heute Abend ab?«
»Hast du nicht um vier Uhr frei? Ich hatte gedacht, dass wir zuerst baden gehen. Wenn das Wetter schon mal so ist, wie es ist.«
»Ist es aber nicht«, sagte Maja mit einem kleinen Lächeln. »Guck mal!«
Bo sah sich um. Dann blickte er zum Himmel. Die Sonne war mit einer bleichen, milchigen Haut überzogen.
»Verdammt! Und das am schönsten Tag des Sommers. Seenebel.«
Larsen und die Kinder kamen vom Wasser, Alice konnte ihre Stimmen schon von weitem hören. Sie stand auf und schüttelte sich. Plötzlich hatte sie das Gefühl, dass es kälter geworden war. Vielleicht hatte sie zu lange in der Sonne gelegen.
»Du kannst anfangen, zusammenzupacken«, sagte ihr Mann, als er zu ihr heraufkam.
»Aber es ist doch erst halb vier.« Sie sah ihn verblüfft an.
»Es gibt Seenebel«, sagte er und zeigte zum Himmel. »Guck mal!«
Der Horizont war verschwunden. Ein grauer Teppich war zwischen Himmel und Meer hinuntergezogen worden. Man konnte sehen, wie sich der dichte Nebel schnell der Küste näherte.
»Sieh mal, die Sonne!«, rief der Junge. »Sie sieht aus wie ein Spiegelei mit etwas Weißem über dem Eigelb.«
Unten am Strand waren die Menschen im Aufbruch. Alle zogen sich an, ließen die Luft aus den Luftmatratzen, packten zusammen und flüchteten, als gelte es, einer todbringenden Pest zu entkommen, einem radioaktiven Niederschlag oder einer anderen drohenden Katastrophe. Hunderte von Autos wurden angelassen, fuhren den Strand entlang und blockierten die Zufahrtswege.
Dann erreichte der Seenebel den Strand und legte sich mit eisiger Nässe über alles und selbst die Begriffsstutzigsten kapierten, dass es jetzt keinen Sinn mehr hatte, hier zu bleiben.
»Das war schon fantastisch«, sagte Alice zähneklappernd, als sie gingen. »Fast von einem Augenblick auf den anderen.«
»Dann haben wir das auch erlebt«, sagte ihr Mann.
»Der Deutsche liegt noch immer da«, stellte Lene fest, als sie an ihrer Mulde vorbeikamen. »Er hat sich bestimmt einen Sonnenbrand an den Beinen geholt.«
Alice schielte kurz zu ihm hinunter. Sie schaffte es nicht, Leute direkt anzusehen, die am Strand lagen und ein Sonnenbad nahmen. Es war ein bisschen so, wie in die Fenster anderer Leute zu gucken. Eine Art Eingriff in das Privatleben. Aber hier in den Dünen ließ es sich nur schwer vermeiden. Eigentlich war es schon merkwürdig, dass er bei der Kälte einfach liegen blieb. Ob er eingeschlafen war? Oder krank geworden war? Vielleicht sollte man ... Aber vielleicht wäre er verärgert. Es ging sie ja auch nichts an.
»Mutter«, rief Jens und hielt eine 2–Liter–Weinflasche hoch. »Kann ich die haben? Das ist eine von denen, auf die es Pfand gibt.«
»Nein, komm jetzt. Und wirf die Flasche weg. Sie ist schmutzig und eklig.«
»Bekomme ich dann von dir das Geld?«, fragte Jens.
»Ja, lieber das«, sagte seine Mutter und der Junge warf die Flasche widerstrebend wieder weg – nur ein paar Schritte von der Stelle entfernt, wo er sie gefunden hatte.
Der Strand war jetzt völlig verlassen, eingehüllt in Seenebel. Nur der Mann mit der blauen Badehose lag noch immer in derselben Stellung in seiner Mulde. Unter seinem Kopf war der Sand braunrot gefärbt. Eine Schmeißfliege krabbelte heran und flog wieder auf und fast gleichzeitig wehte ein kleiner Windstoß einen Zipfel des Handtuchs beiseite. Aber der Mann rührte sich nicht.