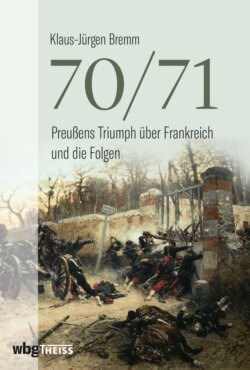Читать книгу 70/71 - Klaus-Jürgen Bremm - Страница 13
Der Weg nach Sedan – Das Preußische Heer und das Militär des Norddeutschen Bundes im Zeitalter von Heeresreorganisation und Einigungskriegen
Оглавление»Man muss mit der Deutschen Armee rechnen. Sie hat zwei Feldzüge erfolgreich beendet und damit ihr Selbstvertrauen erheblich gestärkt. Ihre Soldaten sind von solider Qualität. Sie besitzen zwar nicht den individuellen Kampfgeist unserer Truppen, aber sie sind diszipliniert, leidensfähig und ihren Offizieren absolut gehorsam. Auch diese Qualitäten ergeben eine gute Armee.«
Marschall Patrice MacMahon, Herzog von Magenta, Befehlshaber des französischen I. Armee-Korps und Generalgouverneur von Algerien im Juli 1870117
Die Streitmacht, die 1866 auf den böhmischen Schlachtfeldern das Kaiserreich Österreich so überraschend in die Knie gezwungen hatte und die sich nun anschickte, über den Rhein gegen Frankreich zu ziehen, war ein Kind der großen preußischen Heeresreform von 1859/60. Seit der Revolution von 1848/50 und der politischen Demütigung Preußens durch Österreich in den Olmützer Verhandlungen waren Prinzregent Wilhelm, der spätere König, seine Generale und selbst die meisten Mitglieder des Abgeordnetenhauses im Grundsatz einig gewesen, dass eine tief greifende Reorganisation des Heeres nicht länger aufgeschoben werden könne. Nach dem Feldzug von 1815 hatte die preußische Armee an keinem großen Staatenkrieg mehr teilgenommen. Es fehlte ihr in einer Epoche raschen Wandels der Militärtechnologie die militärische Praxis. Zwar hatte sie die Revolutionskämpfe in Schleswig und Baden erfolgreich bestanden, doch ihre Gegner waren damals nur zweitklassige Streitkräfte oder bewaffnete Bürgerhorden gewesen. Vor allem die preußische Landwehr war seit der Revolution in die Kritik geraten. Ihr Ruhm aus den Befreiungskriegen hatte nach einem halben Jahrhundert längst nicht mehr ihre gravierenden Mängel in den jüngsten Einsätzen überdecken können. Der französische Militärattaché in Berlin, Oberst Eugène Georges Baron von Stoffel, sprach mit Blick auf die Mobilisierung von 1859 von »fürchterlichsten Szenen« und sogar von »Akten formellster Befehlsverweigerung«.118 Doch selbst die preußischen Linientruppen fanden im Ausland nur wenig Anerkennung. Anlässlich einer großen Feldübung kurz nach dem Regierungsantritt König Wilhelms I. sprach der französische General Maximilian Forey sogar verächtlich von einer »Kompromittierung des ganzen Berufsstandes«.119 Kaum freundlicher klang drei Jahre später der Kommentar eines französischen Offiziers im Moniteur: Preußen befehlige nur eine Armee aus »Automaten, welche Wunder der Regelmäßigkeit bewirken, doch alles entbehren, was ein Korps solider Truppen ausmache.«120 Die Fähigkeit der Franzosen, notfalls zu improvisieren, ginge den preußischen Soldaten demnach völlig ab. Moltke persönlich bestätigte unabsichtlich diese kritische Einschätzung, als er 1867 in einer Rede vor dem Norddeutschen Bundestag erwähnte, wie sehr im Krieg von 1866 die Truppe in unübersichtlichen Lagen auf ihre Vorgesetzten und deren Befehle fixiert gewesen sei. Überall habe man dann den Ruf gehört: »Wo ist der Hauptmann?«121 Schon während des dänischen Feldzuges 1864 hatten die preußischen Regimenter im Vergleich zu ihren österreichischen Alliierten anfangs zögerlich und ohne Schwung agiert. Voller Ironie gab Erzherzog Albrecht damals dem österreichischen Befehlshaber in Schleswig-Holstein, Feldmarschallleutnant Ludwig von Gablenz, den ungewöhnlichen Rat, den Preußen aus politischen Gründen doch auch endlich einen kleinen Erfolg zu gönnen.122
Von allen europäischen Großmächten mit Ausnahme Großbritanniens schien Preußen zu Beginn der 1860er-Jahre die am wenigsten beeindruckende Streitmacht unter Waffen zu haben. Die Londoner Times spottete in ihrer Ausgabe vom 23. Oktober 1860 darüber, dass das Königreich der Hohenzollern sich nicht danach dränge, auf den Schlachtfeldern Europas zu erscheinen, sondern sich lieber auf Konferenzen vertreten lasse. Preußen habe zwar eine große Armee, aber eine, die bekannt dafür ist, nicht kampfbereit zu sein.123 Eine ernste Begegnung mit der französischen Armee würde unweigerlich zu einem zweiten »Jena« führen, hieß es wiederum vier Jahre später im selben Blatt, als dessen Redakteure anlässlich des erneut eskalierten Konflikts um Schleswig-Holstein zu einer britischen Intervention an der Seite Frankreichs und Dänemarks drängten. Wie 1806 würden, so die »Strategen« in den Büros der Londoner Fleet Street, die Franzosen ohne Schwierigkeiten über die preußische Armee hinweg nach Berlin marschieren.124
Preußens noch aus der Zeit der Befreiungskriege stammende allgemeine Wehrpflicht schien von der Zeit überholt. Die vergleichsweise kurze Dienstzeit von nur drei Jahren ließ nach Ansicht der militärischen Fachleute keine gründliche Ausbildung der Soldaten zu. Auch die von Wilhelm noch in seiner Zeit als Prinzregent verfügte Ausstattung der Linieninfanterie mit dem Dreyse’schen Zündnadelgewehr, einem revolutionären Hinterladermodell, fand in Europa vor 1866 keine Nachahmer. Vor allem oberflächlich gedrillte Soldaten würde, so die Kritik der ausländischen Militärs, die schnelle Schussfolge der neuen Waffe dazu verleiten, ihre Munition zu verschwenden und ängstlich in der Deckung zu verharren, anstatt entschlossen mit dem gefällten Bajonett gegen den Feind vorzurücken.
Die Reorganisation des Preußischen Heeres hatte schließlich im Sommer 1859 begonnen. Noch während die französische Armee mit den verbündeten Piemontesen gegen die Österreicher in Oberitalien kämpfte, hatte Preußen einen Teil seiner Regimenter auf volle Kriegsstärke gebracht, um sie als Drohkulisse am Rhein aufmarschieren zu lassen. Der überraschende Waffenstillstand zwischen Napoleon III. und Franz Joseph I. verhinderte jedoch das Abgehen der bereits organisierten Truppentransporte. Bei der folgenden Demobilisierung behielt das preußische Kriegsministerium von 45 Regimentern der zuvor mobilisierten Landwehr und Reserve den jüngsten Reservejahrgang unter den Fahnen und ergänzte deren Führerkorps durch Abstellungen aus der aktiven Truppe. So entstanden insgesamt 36 neue Infanterie- sowie zehn zusätzliche Kavallerieregimenter.125 Aus den neun bisherigen Reserveregimentern bildete das Kriegsministerium durch Zuweisung je eines dritten Bataillons neue Füsilierregimenter. Dadurch konnte der Friedensumfang des preußischen Heeres schon bis zum Januar 1860 auf 200.000 Mann erhöht werden. Die größere Zahl aktiver Regimenter erlaubte es, zukünftig je Jahrgang 63.000 taugliche Rekruten statt wie bisher nur 40.000 zum Dienst einzuziehen. Das neue Konzept sah zudem vor, dass die einberufenen Wehrpflichtigen wie bisher zunächst drei Dienstjahre in der aktiven Truppe absolvierten. Danach sollten sie für weitere fünf Jahre der Reserve angehören. War diese Zeit abgeleistet, kam der Wehrpflichtige schließlich für die nächsten elf Jahre zur Landwehr, deren Regimenter im Mobilisierungs- oder Kriegsfall den aktiven preußischen Divisionen unterstellt werden sollten. Von der alten Landwehr, die am Nachmittag von »Waterloo« der berühmten Garde Napoleons in Placenoit getrotzt hatte, blieb somit praktisch nur noch der Name.
Für die liberale Opposition im preußischen Landtag war die beabsichtigte Demontage der von vielen Bürgern noch in hohen Ehren gehaltenen Parallelarmee nur schwer zu akzeptieren. Freilich verbesserte die nunmehr höhere Zahl an aktiven Regimentern bei einer seit 1815 um 50 Prozent gestiegenen Bevölkerungszahl fühlbar die Wehrgerechtigkeit in Preußen. Kein liberaler Politiker konnte bestreiten, dass es in den Gemeinden bisher viel böses Blut erzeugt hatte, wenn dienstpflichtige Familienväter im Mobilmachungsfall zur Armee eingezogen wurden, während zahlreiche ungediente junge Männer zuhause bleiben durften.
Die deutliche Verstärkung der preußischen Armee stand trotz der damit verknüpften höheren Steuerbelastung durchaus nicht den Interessen der Fortschrittspartei entgegen. Schon während der Revolution von 1848/49 waren namhafte Vertreter des Paulskirchenparlaments durchaus bereit gewesen, für die von ihnen erstrebte nationale Einheit notfalls auch einen Krieg gegen die konservativen Mächte Österreich und Russland in Kauf zu nehmen. So etwa konzedierte der liberale Abgeordnete und Historiker Max Duncker gegenüber seinem Karlsruher Kollegen Hermann Baumgarten, dass die deutsche Frage eine Machtfrage sei und ohne eine Machtentfaltung Preußens nie gelöst werde.126
Anlässlich der Olmützdebatte im preußischen Abgeordnetenhaus hatte wiederum am 3. Dezember 1850 der liberale Abgeordnete, Historiker und Eisenbahndirektor Adolf Riedel Minister Otto von Manteuffels politische »Kapitulation« vor den Österreichern in Olmütz scharf kritisiert und schließlich unter dem Beifall der Abgeordneten prophezeit, dass zukünftig »die Sprache der preußischen Kanonen keinem Volke in Europa unvernehmbar bleiben« werde.127 Nicht eine starke Armee war für die Liberalen in Preußen das Problem, sondern eine starke preußische Streitmacht allein in den Händen des Königs. Langfristig verfolgten sie das Ziel, über das Budgetrecht auch die letzte Bastion königlicher Macht in Preußen zu schleifen. Zum entscheidenden Streitpunkt erhoben sie daher die beabsichtigte Beibehaltung der dreijährigen Wehrpflicht. Nicht zu Unrecht vermutete die Opposition hinter der erst 1856 um ein Jahr verlängerten Dienstzeit den Versuch der Krone, die ihr dienenden Soldaten im konservativen Sinne zu prägen. Sachlich ließ sich das dritte Dienstjahr vielleicht noch dadurch rechtfertigen, dass anders die Ausrückstärke von 1000 Mann je aktivem Bataillon nicht mehr erreicht werden könne. Nach diesem Konzept stellte jeder der drei aktiven Jahrgänge pro Bataillon 200 Mann, von den fünf Reservejahrgängen sollten im Mobilisierungsfall die übrigen 400 Soldaten kommen. Dass auch Bataillone mit nur 800 Mann dank der erhöhten Feuerkraft des neuen Zündnadelgewehrs ihre alte Schlagkraft behalten würden, kümmerte König Wilhelm wenig. Von Kind an Soldat und seither mit den verschiedensten militärischen Kommandos betraut, fühlte er sich nicht ohne Berechtigung als Experte und hatte die dreijährige Dienstzeit zu einer Prinzipienfrage erhoben. Damit hatte er Preußen direkt in die große Staatskrise geführt, die seine ersten Regierungsjahre überschattete. Angesichts der Fundamentalopposition der Liberalen wäre freilich der Konflikt langfristig ohnehin kaum vermeidbar gewesen. Die Alternative für den Monarchen war schließlich die Abdankung zugunsten seines Sohnes, dem auch wegen seiner britischen Gattin eine liberale Neigung nachgesagt wurde, oder das Weiterregieren ohne genehmigtes Militärbudget, also der offene Verfassungsbruch.
Der König wählte die zweite Option und ernannte den politischen Außenseiter Otto von Bismarck, den Kandidaten der Armee, im September 1862 zum preußischen Ministerpräsidenten. Seine Entscheidung rettete Wilhelm den Thron für immerhin ein Vierteljahrhundert. Der neue Mann an der Spitze der preußischen Politik war noch 15 Jahre zuvor eine verkrachte Existenz gewesen, ein trinkfester Landjunker mit seltsamen kulinarischen Gelüsten, der die politischen Ambitionen seiner Jugend unter einem pommerschen Misthaufen begraben zu haben schien. Erst dank der Revolution von 1848/49 war der einfache Landtagsabgeordnete völlig überraschend zum Gesandten Berlins am erneuerten Frankfurter Bundestag aufgestiegen, dem begehrtesten Posten der preußischen Diplomatie. Anfangs hatte Bismarck noch als strammer Parteimann der Konservativen gegolten, tatsächlich aber erwies er sich bald als wenig ideologisch und schreckte zum Entsetzen seiner alten Mentoren nicht einmal vor einem Paktieren mit Frankreich zurück.
Der Frage der dreijährigen Dienstzeit maß der neue Mann an Preußens Spitze keine große Bedeutung zu. Gleichwohl war es ihm im Babelsberger Schlosspark geglückt, den skeptischen Monarchen davon zu überzeugen, dass sich sein leitender Minister jederzeit für ihn in die Bresche werfen würde. Bismarcks erster Versuch, die Liberalen in der Budgetkommission des Landtages für den wehrpolitischen Kurs der Regierung zu gewinnen, geriet allerdings zu einem Fiasko. Seine provozierende Metapher von »Blut und Eisen« war zwar nur eine fast wortgleiche Anspielung auf die martialischen Reden der Liberalen während der Revolutionszeit, als etwa ihr damaliger Wortführer im preußischen Abgeordnetenhaus, Adolf Riedel, erklärt hatte, dass das Räderwerk der Entwicklung politischer Ereignisse, einmal den Waffen anvertraut, nur durch »Blut und Tränenströme fortgetrieben werden« müsse. Jetzt aber löste Bismarck damit unter den politischen »Professoren« ein scheinheiliges Geschrei aus. Der abgeblitzte Ministerpräsident schaltete auf stur. Fortan ignorierte Bismarck die liberale Opposition und regierte unter Berufung auf die umstrittene Lückentheorie einfach weiter. Bei fehlender Einigung zwischen Krone, Abgeordneten- und Herrenhaus sei der König berechtigt, so argumentierte Bismarck, mit seinen Ministern bis auf Weiteres geschäftsführend weiterzuregieren. Kritische Zeitungen setzte er unter Druck, andere Blätter kaufte er heimlich auf.128
Als im Winter 1863/64 der alte Konflikt mit Dänemark um die beiden umstrittenen Herzogtümer Schleswig und Holstein erneut ausbrach, nahm er sogar eine dezidiert antinationale Position ein. Zum Entsetzen aller Nationalliberalen stellte sich der preußische Ministerpräsident hinter das Londoner Protokoll, das 1852 den ungeliebten Status quo festgeschrieben hatte. Unter Bismarcks Führung gewann Preußen zwei Kriege mit einer staatsrechtlich illegalen Armee und bestritt die erhöhten Kosten am Parlament vorbei durch den Verkauf von Eisenbahnaktien aus dem Staatsbesitz. Schließlich konnte er das, was nach den Wahlen vom 3. Juli 1866, dem Tag der siegreichen Schlacht von Königgrätz, von der liberalen Fraktion im preußischen Abgeordnetenhaus noch übrig geblieben war, durch sein Indemnitätsgesetz vom August 1866 in zwei Fraktionen spalten. Mit diesem Coup war die große Verfassungskrise nach sechs Jahren offiziell beigelegt. Der politische Preis für die Armee von Königgrätz war allerdings so groß gewesen, dass Bismarck selbst zu nur geringfügigen Abstrichen an ihrer Stärke nicht mehr bereit war. Als im Frühjahr 1870 Großbritannien zu einer im Grunde unbedeutenden Reduktion aller europäischen Armeen drängte, trat er dem britischen Außenminister mit undiplomatischer Schärfe entgegen. Der misstrauische Kanzler vermutete hinter den unerbetenen Vorschlägen aus London vor allem eine französische Intrige. Dass Lord Clarendon auch aus ideellen Gründen eine europäische Abrüstung anstrebte, war für den politischen Pragmatiker in der Berliner Wilhelmstraße unvorstellbar.129
Tatsächlich war die vormals von der Londoner Times verhöhnte Hohenzollernarmee nach dem Sieg von 1866 noch weiter gewachsen. Zu ihren ursprünglichen acht Armeekorps sowie dem Potsdamer Gardekorps waren nach dem Prager Frieden und der Annektierung Schleswig-Holsteins, Hannovers, Kurhessens und Nassaus drei weitere Armeekorps mit den Nummern IX, X und XI neu formiert worden. Die Infanterieregimenter der durch Militärkonvention mit Preußen verbundenen Herzogtümer Mecklenburg, Braunschweig und Oldenburg, seit 1867 auch Mitgliedsstaaten des Norddeutschen Bundes, erhielten neue Nummern und wurden in die alten oder neuen preußischen Armeekorps eingefügt. So entstanden aus den Truppen der Thüringischen Staaten drei neue Infanterieregimenter, die dem IV. sowie XI. Armee-Korps zugewiesen wurden. Insgesamt traten aus den 1866 aufgelösten oder angeschlossenen Aufgeboten 1200 Offiziere in die preußische Armee ein.130 Preußens Heer wuchs insgesamt um 2140 Offiziere und 47.000 Mannschaften. Jedes seiner nunmehr zwölf Armeekorps war in vier Infanteriebrigaden zu je zwei Regimentern gegliedert und verfügte außerdem über ein Jägerbataillon. Dazu kamen zwei Kavalleriebrigaden zu je 1800 Reitern, ein Artillerieregiment mit 90 Geschützen sowie ein Pionierbataillon zu vier Kompanien. Die volle Kriegsstärke eines Armeekorps betrug gewöhnlich rund 30.000 Mann, das in Potsdam beheimatete Garde-Korps war um vier zusätzliche Infanteriebataillone stärker.
Das Königreich Sachsen, das 1866 noch aufseiten der Österreicher gekämpft hatte, durfte zwar im Prager Frieden seine Unabhängigkeit behalten, war jedoch mit seinen Streitkräften praktisch unter die preußischen Fahnen geraten und stellte im Krieg gegen Frankreich das von Kronprinz Albert geführte Armee-Korps mit der Nummer XII. Das hohe soldatische Niveau seiner Truppe erregte auch die Bewunderung ausländischer Beobachter. Der Dichter Fjodor Dostojewski, der sich im Juli 1870 in Dresden aufhielt, geriet beim Vorbeimarsch der sächsischen Truppen sogar ins Schwärmen. Man käme nicht umhin, notierte er in sein Tagebuch, die wunderbare militärische Haltung, die strenge, gleichmäßige Ausrichtung und zugleich die ungewöhnliche Freiheit zu bewundern, wie er sie noch nie an Soldaten wahrgenommen habe.131
Mit den Kontingenten der Mitgliedsstaaten des Norddeutschen Bundes gebot Preußen seit 1867 über ein Friedensheer von 310.000 Mann, was etwa ein Prozent der damaligen Gesamtbevölkerung nördlich des Mains ausmachte. Im Mobilisierungs- oder Kriegsfall konnte das neue Bundesheer auf 433.000 Soldaten und 1284 Geschütze gebracht werden, einschließlich der Besatzungs- und Ersatztruppen stieg die Zahl der bewaffneten Kräfte unter preußischem Oberbefehl sogar auf 990.000 Mann.132 Die Infanterie des Bundesheeres blieb mit dem noch 1866 so bewährten Zündnadelgewehr ausgestattet, obwohl der preußische Generalstab nach der vollständigen Bewaffnung der französischen Armee mit dem überlegenen Chassepot-Gewehr erhebliche Zweifel an der bestehenden Lösung hegte. Grundsätzlich strebte das Ministerium allerdings die Entwicklung einer neuen Infanteriewaffe an und verwarf daher aus Kostengründen die Anschaffung des französischen Modells als die sich aufdrängende Zwischenlösung. Gegenüber ihrem Monarchen bagatellisierten die Offiziere das Problem und der junge Graf Alfred von Waldersee klagte über Versuche des Kriegsministeriums, sämtliche kritischen Stellungnahmen zum Zündnadelmodell zu unterdrücken.133 Schlimmer noch stand es freilich um die Bewaffnung der bayerischen Soldaten. Sie mussten mit dem veralteten Podewils-Gewehr in den Kampf ziehen, einem ursprünglichen Perkussions-Vorderlader, den man zur Hinterladung umgerüstet hatte. Lediglich die vier bayerischen Jägerbataillone führten bereits das neue Werder-Gewehr, das sogar dem französischen »Chassepot« überlegen war.134 Die deutschen Soldaten wussten sich allerdings, je länger der Krieg dauerte, in ihrer Not zu helfen. Wo immer möglich, bewaffneten sich Reiter wie Infanteristen mit erbeuteten Feindgewehren. Allein durch die Kapitulation der Chalons-Armee bei Sedan sollten 66.000 Chassepot-Gewehre in die Hände der Sieger fallen.135
Die Kavallerie des Bundesheeres war dagegen hauptsächlich mit Hiebwaffen ausgestattet und führte sogar noch die alte Vorderladerpistole mit Perkussionszünder. Nur ein Teil der Regimenter war mit dem Zündnadelkarabiner, einer verkürzten Version des Infanteriegewehrs, ausgestattet.136 Die Reiterei gliederte sich in insgesamt 64 Regimenter zu je fünf Eskadronen, jedes zu 120 Kavalleristen. Kürassiere und Dragoner galten als schwere Schlachtenkavallerie während Ulanen und Husare als leichte Reiterei im feindlichen Hinterland aufklären sollten. Die von starken Traditionen geprägte Truppengattung tat sich allerdings schwer, sich mit dieser wichtigen und zukunftsweisenden Aufgabe zu identifizieren. Ausschließlich auf die große Attacke fixiert, wie sie 1866 bei Königgrätz tatsächlich noch einmal zur Ausführung gelangt war, ignorierten ihre Offiziere zum Erstaunen des als Kriegsbeobachter angereisten Philip Sheridan vollkommen die glänzenden Erfolge der zahllosen Kavallerieraids beider Seiten im Amerikanischen Bürgerkrieg.137
Starke Veränderungen traten nach dem Sieg über die Österreicher besonders bei der preußischen Artillerie ein. Noch 1866 hatte sie sich den Österreichern nicht in jeder Lage gewachsen gezeigt. Etliche Geschütze aus Gussstahl waren sogar im Gefechtseinsatz gesprungen. Gleichwohl hielten König Wilhelm und Kriegsminister Albrecht von Roon an dem einmal eingeschlagenen Kurs fest und ersetzten nach dem Krieg von 1866 auch die letzten glattläufigen Zwölfpfünder-Geschütze aus Bronze durch neue Modelle aus Gussstahl mit gezogenen Läufen. Anstelle der seit der Renaissance benutzten Vollkugeln verschossen sie konische Geschosse mit einem Kaliber von neun Zentimetern. Ihr weicher Bleimantel erlaubte ein geringfügiges Überkaliber, was die Führung der Geschosse durch die Züge und Felder im Inneren des Rohres weiter verbesserte und die Reichweite bis auf fünf Kilometer erhöhte. Mit empfindlichen Perkussionszündern ausgestattet, zerplatzten die neuen Granaten beim Aufschlag und zerlegten sich in bis zu 40 Splitter, die bei ihren Opfern entsetzliche Verletzungen verursachten. Der dagegen noch mit Vorderladern ausgestatteten französischen Artillerie sollte die preußische Artillerie im kommenden Krieg somit in Reichweite, Zielgenauigkeit und Wirkung haushoch überlegen sein.
Im Frieden war die Artillerie jedes Armeekorps in Regimenter zu je 15 Batterien gegliedert, um im Feld bis auf eine kleine Reserve den einzelnen Verbänden des Korps unterstellt zu werden. Jedes Infanterieregiment zu 3000 Mann hatte somit im Gefecht eine Batterie mit sechs Geschützen zu seiner unmittelbaren Unterstützung. Auch jede der beiden Kavalleriebrigaden konnte nun zwei berittene Batterien leichter Feldgeschütze einsetzen.
Anders als im Krieg gegen Österreich, als die Artillerie noch weit hinten in den Marschkolonnen eingegliedert war, gelang es während des Feldzuges in Frankreich, rasch gewaltige Geschützfronten aufzubauen, in deren Feuer die Angriffe des Gegners regelmäßig zusammenbrachen. Auch die numerisch überlegenen Armeen der französischen Republik konnten damit in der zweiten Kriegshälfte stets auf Distanz gehalten werden. Die Artillerie half vor allem, die Unterlegenheit des noch 1866 als Garant des preußischen Sieges gefeierten Zündnadelgewehrs gegenüber dem französischen Chassepot-Modell auszugleichen. Ihre Offiziere scheuten sich jetzt auch nicht mehr, mit ihren Geschützen in vorderster Front aufzufahren, und ein Geschütz im Einsatz zu verlieren, galt plötzlich nicht mehr in jedem Fall als ehrenrührig.138
Im Krieg von 1870/71 siegte die preußisch-deutsche Armee in mehr als 25 größeren Schlachten und kaum ein militärischer Fachmann in Europa zweifelte noch daran, dass die allgemeine Dienstpflicht das Wehrmodell der Zukunft sei. Die außergewöhnlichen Marschleistungen der deutschen Armeen fanden selbst die Bewunderung der Franzosen. Ein Mann wie Ernest Renan, Professor an der Sorbonne und Verfasser eines revolutionären Buches über das Leben Jesu, sprach unter dem frischen Eindruck der Kapitulation von Sedan sogar neidvoll von der »Überlegenheit der deutschen Rasse.«139
Die ehedem in ganz Europa verlachten Preußen galten plötzlich als militärische Magier und selbst den Briten schien ihre Spottlust vergangen. Kaum war am 10. Mai 1871 in Frankfurt der Frieden zwischen dem neuen Reich und der Dritten Republik geschlossen worden, erschien in der Maiausgabe des Blackwood’s Edenbourgh Magazine eine anonym veröffentlichte Kurzgeschichte mit dem Titel »Die Schlacht von Dorking«. Darin wurde einer erschaudernden Leserschaft geschildert, wie eine Armee teutonischer Hünen in dunkelblauen Uniformen und Pickelhauben in naher Zukunft in Südengland landete und das britische Berufsheer in einer Schlacht nahe dem idyllischen Örtchen Dorking völlig aufrieb. In der Folge schrumpfte Großbritannien zur zweitrangigen Macht, ein Wirtschaftskollaps vernichtete seinen Wohlstand und ganz Kanada ging an die Vereinigten Staaten verloren. Die düstere Geschichte aus der Feder des späteren Generals Sir George Tomkyns Chesney wurde innerhalb zweier Monate mehr als 100.000 Mal verkauft und in zahlreiche Sprachen übersetzt. Die öffentliche Resonanz im Königreich war so gewaltig, dass sich Premierminister William Gladstone sogar genötigt sah, in einer Rede vor dem Unterhaus ausgerechnet am ersten Jahrestag der Schlacht von Sedan den Abgeordneten zu versichern, dass das Dorking-Szenario niemals Realität werden könne.140 Die Geschichte fand jedoch im Inselreich noch etliche literarische Nachahmer, und als 1898 der Novellist Herbert George Wells seinen überaus erfolgreichen Fantasieroman »Krieg der Welten« veröffentlichte, waren die Pickelhauben tragenden Preußen bereits zu unförmigen Marsianern mutiert.