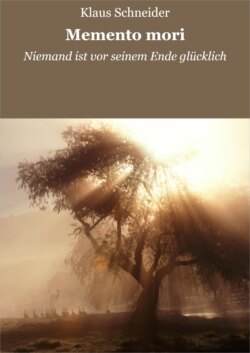Читать книгу Memento mori - Klaus Schneider Erich - Страница 3
1
ОглавлениеSpüren sie manches Mal auch die Kluft zwischen Anspruch und Wirklichkeit, zwischen dem, wie sie sich selbst sehen, dem, wie andere sie sehen und dem, wie sie gerne wären? Dieser Zwiespalt zeigt sich meist nur sporadisch, oft in denkbar unpassenden Momenten, und auch wenn er nicht immer offensichtlich präsent ist, spaltet er die schon subjektive Realität in weitere, gegensätzliche Fragmente. Was bleibt, ist eine unglückliche Existenz in Raum und Zeit, verloren zwischen Anspruch und Wirklichkeit.
Diese Diskrepanz steht ihm, seit er sich ihrer bewusst wurde, treu zur Seite, ein Umstand, der hinter alles Denken, alles Handeln, ein großes Fragezeichen setzt. Er, das sollten sie noch wissen, bin ich, Ende fünfzig, männlichen Geschlechts, verstrickt in einer ziemlich allumfassenden Sinnkrise. In Zeiten solch verdrießlicher Stimmungen, rede ich mich, um etwas Abstand zu mir selbst zu wahren, vorwiegend in der dritten Person an. Damit ist er ich, und ich bin er. Die so konstruierte Dualität meiner Person stellt einen gewissen imaginären Schutz vor Erkenntnissen, mehr oder weniger unangenehmer Art her, die das schon arg lädierte Selbstverständnis vollends ruinieren könnte. Diese Peinlichkeiten sind bei einem ausgelagerten „Ich“ besser aufgehoben. Ihm kann ich die Konfrontation mit sich selbst ohne größere Bedenken zumuten. Ohne eigenes Selbst ist er eine ideale Deponie für den Müll meiner Existenz.
Er reflektiert seine Gedanken, bringt sie mit pseudo- intellektuellem Schwachsinn in Verbindung, was dann in dessen Konsequenz eine objektive Auseinandersetzung mit sich, oder mit der Person, die er glaubt zu sein, noch mehr erschweren würde. Davor fürchtet er sich, denn die Vergangenheit präsentiert sich abweisend und düster wie ein dunkler See, dessen unergründliche Tiefe einem Betrachter Unbehagen bereitet. Sie scheint nicht willens, sich auf leichte Weise zu offenbaren. Dazu beschränkt ein zeitweise lähmender Phlegmatismus sein Denken, sein Handeln, und erschwert geistige Aktivitäten nicht nur, er blockiert sie. Kennen Sie das auch? Jeder Gedanke ist eine mühevolle Einzelaktion, ohne Zusammenhang, ohne zeitlich logisch, zwingende Verknüpfungen, ein Abklatsch der existenziellen Situation. Keine Bewegung, weder Zu- noch Abfluss, weder Leben noch Sterben; nichts als lähmender Stillstand.
Er versucht krampfhaft einen Fluss in seine Gedanken zu bringen. Mit Hilfe von brachialer, geistiger Gewalt, müsste doch in diesen dunklen See von Erinnerungen, ein Abfluss zu schaffen sein! Weit gefehlt, jede gedankliche Anstrengung verdüstert diesen Tümpel noch mehr, wie wenn sich in ihm das bedrohliche Licht heranziehender Gewitterwolken widerspiegeln würde. Er fühlt sich in solchen Augenblicken dem Sterben näher als dem Leben. Diese morbiden Gefühle stehen in eklatantem Widerspruch zu dem Vorhaben, seinem gesamten Lebensinhalt eine neue Richtung, einen neuen Fluss zu geben. Fluss, Zufluss, Abfluss, diese trägen Substantive zerren an seiner Geduld. Leblose Begriffe, der lähmenden, konkret existierenden Starre, in ihrer Auswirkung nicht unähnlich. Grammatikalisch wäre dieses Dilemma einfach zu lösen, wenn man diese ruhenden Begriffe verbalisieren könnte. Der Fluss könnte wieder fliesen, könnte...
Wenn seine Gedanken nur wieder fließen würden, das würde Bewegung bedeuten. Bewegung, die vermisste er am meisten, seit er sich entschloss sein Leben grundsätzlich zu ändern. Es fehlte ihm zunehmend ein Teil dessen, weswegen er die Veränderung wollte. Bewegung, Lebendigkeit, wenn auch nicht in der hektisch belastenden Form der Vergangenheit, aber wenigstens einen Hauch davon möchte er wieder spüren. Er vermisste nicht so sehr die gewohnte Arbeit, nach vierzig Jahren konnte er sich gut mit dem Gedanken anfreunden, nicht mehr so wie früher zu arbeiten. Wenn nur dieser verfluchte, alles abstumpfende Stillstand, nicht so erdrückend wäre.
Zudem wusste er im Moment einfach nicht mehr, wie er seine Existenz finanzieren sollte. Das Auto war weg, die Bezahlung der Wohnung stand jeden Monat auf dünnen Beinen, keine Krankenversicherung, ein Leben auf Pump und Spenden... welch unerfreuliche Perspektive einer besseren Zukunft! Die reflektierende Betrachtung der Genese dieser Situation bereitete ihm Unbehagen. Mehrere aufdrängende Ansätze blockte er schon erfolgreich ab, führt auch zu nichts, außer zu destruktiven Selbstzweifeln! Die Vergangenheit ist unwiederbringlich vorbei. Die Möglichkeiten der Zukunft, ihre tägliche Erneuerung und das alles tragende Prinzip der Hoffnung, forderte seine uneingeschränkte Aufmerksamkeit.
Ein tröstlicher, doch auch ein unbehaglicher Gedanke. Für einen Moment streckt sich sein Körper, seine Stimmung hellt sich auf, um gleich darauf wieder auf das gewohnte Niveau abzusinken. Aus dem Radiogerät tönen noch immer die schmeichelnden Klänge der Ohrwürmer aus vergangener Zeit. Vergangenes drängt sich nun zögerlich, ohne verständlichen Zusammenhang, in sein Bewusstsein, sinnloses, wirres Zeug. Seine Haltung wirkt angespannt, ablehnend. Unschlüssig seines zaghaften Verlangens nach Erinnerung, legt sich nun wieder diese Zögerlichkeit über das Vorhaben. Welcher Teufel hat ihn da überhaupt geritten, in diesem Müllhaufen zu stochern?
Die ersten, unterschwellig auftauchenden Bruchstücke der Vergangenheit, scheinen nicht geeignet, seine Stimmung aufzuhellen. Vor allem der Anfang, der Beginn seines Lebens, liegt wie stickige, abgestandene Luft über seiner Psyche. Versuche, dies zu ändern, brach er in der Vergangenheit, stets nach mäßigem Erfolg, immer wieder resignierend ab. Führte zu keinem verständlichen Ergebnis, brachte keine verwertbare Erkenntnis, nichts außer weiteren Fragen. Schublade zu lassen, den Schlüssel herumdrehen und wegwerfen, ging bis vor kurzem ganz gut, bis vor kurzem...
Wo sollte seine Erinnerung auch beginnen, wo begann die Entwicklung dessen, was ihn heute ausmacht? Sicher schon damals, als Embryo, und unterstellt man dieser frühen Lebensform eine Ahnung, in was für einer Umgebung es bald leben würde, müsste es bereits ein Grausen vor den kommenden Jahren verspürt haben. Es ist schon eine gewagte Annahme, keine Erinnerung, doch denkbar. Bei solch unerfreulichen Gedanken hört er doch lieber, zum wiederholten Mal, einem Beitrag aus dem Radio über Marder, und die, meist untauglicher Ratschläge, diese Tiere vom Auto fernzuhalten, an.
Solch banale Themen interessierten früher auch ihn , es war einmal… Fahrräder sind nun mal weniger anfällig gegen Marderbiss, als ein Auto. Manchen Dingen kann man mit einer Portion Ironie durchaus positive Seiten abringen. Er überlegt, wie lange er ein Auto besaß, es waren 39 Jahre, ohne Unterbrechung und bis vor kurzem noch eine undenkbare Vorstellung, kein Auto zu besitzen, nicht mobil zu sein. Nun, sie brachten ihm die Denk- und Lebbarkeit dieser Möglichkeit nahe und nahmen ihm sein Automobil weg. Sachlich eine richtige, vertretbare Entscheidung der finanzierenden Bank, ohne Moos nichts los! Menschlich gesehen aber doch eine sehr verwerfliche, herzlose Untat. Und das, gerade jetzt in seiner Lage, wo er auf eine Veränderung, eine neue Chance hofft, nur stolzer Besitzer eines Fahrrades zu sein, keine sehr motivierende Perspektive. Doch was soll das Lamentieren, es ist wie es ist!
Bilder aus der Vergangenheit klopfen an, verhalten, unaufdringlich, doch sich ihrer Wirkung bewusst. Aus einer Mischung von Neugier und Frust öffnet er die Türe einen Spalt weit, einen Moment abgelenkt durch die Klänge einer Operettenmelodie, er liebt diese Musik. Er öffnet die Türe weiter, denn wer A sagt… Verschwommen sieht er im Türrahmen einen jungen Mann stehen, optimistisch, voller Neugier, etwas unsicher, er mag so achtzehn Jahre alt sein. Der schaut ihn an, fragend, mit hellen, offenen Augen voll trotzigem Optimismus. Wortlos dreht er sich um und öffnet die Tür der Erinnerung. Er und er verschmelzen zu einer Person, der Symbiose aus Vergangenheit und Gegenwart.
Die Prüfungsfahrt, der praktische Teil der Fahrprüfung, lief eigentlich ganz gut, er war überzeugt, oder besser, er hoffte, alles richtig gemacht zu haben. Selbstvertrauen lag nicht mit in seiner Wiege, auch zeigte sich sein bisheriger Lebensweg wenig geeignet, diesen Charakterzug zu formen. doch dieses Mal machte er alles richtig, fast alles, er wollte die Prüfungsfahrt nur zu schnell hinter sich bringen. Etwas zu schnell, bemerkte der schräg hinter ihm sitzende, ältere, Prüfer. Er sei ja ganz gut gefahren, nur viel zu schnell. Es überraschte ihn nur kurz, sein bisheriges Leben lehrte ihn, mit derartigen Widrigkeiten klarzukommen. Widrigkeiten, Schwierigkeiten, Probleme, Pleiten, Pech und Pannen. Treue Begleiter, verlässlich und immer zur Stelle, wenn prägnante, entscheidende Ereignisse anstanden.
Wieder einmal hatte er versagt! Nein, so wollte er es doch nicht sehen, und so auch nicht weiter erzählen. Die unabänderliche Tatsache, dass er durchgefallen war, verpackte er gekonnt mit dem Umstand, dass er ja zu schnell fuhr. Das zumindest stellt, bei einer gewissen Altersgruppe, fast schon eine heldenhafte Tat dar und danach sehnte er sich doch, etwas Großes zu tun, etwas Besonderes zu sein. So durch die Stadt rasen, das hat doch etwas Herausragendes an sich, oder nicht? Seinen Gedanken wuchsen Flügel, sie trugen ihn in die höchsten Sphären seiner Sehnsüchte. Zügellos, jeden Bezug zur Realität verlierend, baute er so immer wieder neue Luftschlösser auf die Trümmer implodierter Illusionen. Er, der Gewinner, mutig, selbstsicher, souverän, erfolgreich. Diesmal war der Anlass für solche Spinnereien eben eine versaute Prüfung.
Die Erinnerung beginnt unangenehme Züge anzunehmen, die Endlosschleife alter Melodien aus dem Rundfunkgerät führen ihn schnurstracks in eine Zeit, die ihn, wenn er sie nur gedanklich streift, frösteln lässt. Sein Gefühl warnt ihn, berechtigt, hat er diese Lebensphase doch abgeschlossen. Abgeschlossen? Mühevoll überwunden beschriebe es besser. Wie lange brauchte er, seine zahlreichen Komplexe, das Resultat einer verkorksten Kindheit, zu verdrängen! Zu lange, wenn er sie denn überhaupt schon alle verdrängt hat.
Die Kindheit, auf diese Erfahrung hätte er liebend gern verzichtet. Er spürt, irgendwo, tief in ihm liegen Erinnerungen, zu denen er nur schwer einen Zugang finden wird. Der lächelnde junge Mann, der ihn auf seinen ersten Schritten in die Vergangenheit begleitete, ist verschwunden. Existiert eine Dualität der Person nur in seiner Phantasie, dieses er und ich? Doch sie ist ihm gut vertraut, im Laufe seines Lebens entwickelte er eine Genialität, die es ihm ermöglichte in allerlei Rollen zu schlüpfen, sie gedanklich zu leben, sie für sein diffuses Ego auszusaugen. Oft lebte er dabei mehr im „er“ als im „ich“. Kein Interesse an einer Psychographie! Sie kreiert doch nur ein unnützes, peinliches Psychogramm seiner Person. Eine objektive Bewertung wäre vielleicht nützlich, doch wenn es so etwas überhaupt gibt, ist das etwas für Menschen, die sie ertragen und in dieser Situation befand er sich überhaupt nicht.
Wo ist der junge Mann geblieben? Der Gedanke lähmt ihn, drückt ihn auf seinen, etwas wackeligen Stuhl. Er zündet sich eine Pfeife an, Ablenkung für einige Minuten, er lauscht auf die Stimmen im Radio, das er inzwischen zu leise stellte. Es strengt ihn an, die Worte oder gar den Sinn zu verstehen. Aus der Pfeife steigt dichter Qualm, er fächert ihn mit der Hand beiseite und starrt zum Fenster hinaus. Der Wald sieht dunkel aus, es wird wohl regnen. Teilnahmslos fixiert er die Wolken Formation, erkennt in ihnen keine Gestalten oder Gesichter, wie sonst immer, wenn er das Spiel der Wolken betrachtet. Mehr als triviale Eindrücke kann er nicht aufnehmen, nichts außer einem dumpfen Trübsinn findet Zugang in sein Bewusstsein.
Was für ein Scheiß Leben musste er doch führen! Drohende Erinnerungen, machtvoll und ohne die Möglichkeit, sich derer zu verweigern, ziehen ihn in ihren Bann. Wie weit geht die Reise, funktioniert der unbewusste Schutz seiner Psyche noch? Ist doch egal, wer nichts riskiert, kann nichts gewinnen. Eigentlich verabscheut er so dümmliche Weisheiten, wenn sie von anderen zum Besten gegeben werden, bei sich macht er gern einmal eine Ausnahme. Er ist nicht wie die anderen, er ist etwas Besonderes, das fühlt er. Glücklich war er nicht immer darüber. Die widrige Seite dieses Andersseins stand, zumindest in der Kindheit, immer düster im Vordergrund. Kindheit, die Bilder der Erinnerung nehmen Konturen an, zuerst nur verschwommen und schemenhaft. Zögernd, etwas widerwillig, öffnet er sich, lässt die Bilder in ihrer Deutlichkeit zu und flüchtet sich dann rasch in die Dualität seiner Person. Er, der Akteur und er, sein Betrachter.
Ein kleiner Junge steht verloren, etwas hilflos in einem Zimmer. Er ist nicht allein. Unheimliche Gestalten, Frauen mit ungepflegten, schütteren Haaren, strähnig, fettig, meist ergraut, bis zur Schulter reichend, bewegen sich gespenstisch leise in dem unangenehm riechenden Raum. Einem aus seiner Perspektive sehr hohen Raum. Die Kleidung der Frauen besteht aus langen, bis fast auf den Fußboden reichenden weiß- grauen Gewändern, einfach geschnitten, wie Säcke. Ihre Füße stecken, teilweise nackt, in schwarzen, klobigen Schuhen. Er fühlt sich unbehaglich. Ein natürliches Gefühl für Ästhetik lässt in ihm ein starkes Gefühl von Abscheu und Ekel aufkommen. Vor ein paar Minuten sah er sie noch in respektabler Kleidung, die Nonnen, Schwestern, ehrwürdig, barmherzig oder mit welchen Attributen sie sich immer aufwerten.
Damals, als er noch ein kleiner Junge war, leiteten und betreuten diese Frauen meist die Kindergärten, und in einem solchen muss er sich gerade befinden. Doch was hatte er allein, ohne die anderen Kinder, in diesem Raum zu suchen, was wollten diese Frauen von ihm? Die Erinnerung verblasst. Nur noch Bruchstücke, zusammenhanglos, sind sichtbar. Eine ältere, stämmige, resolute Schwester, sie schien seine Bezugsperson zu sein, eine etwas dickliche, behäbige und zwei jüngere Frauen, hielten sich zeitweise ebenfalls in dem Raum auf. Der muffige Geruch, der merklich von den halbbekleideten Nonnen ausging, raubte ihm beinahe die Luft zum Atmen. Körperausdünstungen jeglicher Form ekeln ihn an, er spürt dabei nahezu körperlichen Schmerz.
Was wollten sie von ihm? Es gab doch zahlreiche andere Kinder; sicher er war ein zarter, hübscher Junge. Warum kann er sich an nichts mehr erinnern, als an diese eine Szene, warum erinnert er sich überhaupt daran? Ist es einfach nur eine Momentaufnahme, ein Bild, ohne weitere Bedeutung, ohne Geschichte? So recht kann er diese Deutung nicht glauben, irgendwas in ihm wehrt sich dagegen. Diese Begebenheit, Jahrzehnte später Thema einer Therapiestunde, veranlasste den Therapeuten das Wort „Missbrauch“ in den Raum zu stellen, „weitläufig definiert“, wie er noch ergänzend anmerkte.
Es macht ihn nachdenklich, er versucht die Eigendynamik seiner Reise zu unterbrechen und zu verweilen, vielleicht gibt es ein paar redseligere Eindrücke, überdrüssig ihres Statistendaseins und gewillt, die Szene zu beleben. Stille, keiner traut sich, keine Souffleuse gibt ein Stichwort. Resignierend lehnt er sich zurück. Was soll diese Reflektion auf sein bisheriges Leben bringen, wenn sich nur die Fragen manifestieren? Er spürt jedoch einen Drang, eine Unruhe, so schnell will er noch nicht aufgeben. Er fühlt es, irgendeine prägende Begebenheit, unguter Natur, verbirgt sich hinter dieser Mauer des Vergessens. Seine Lethargie, zu Beginn seines Nachdenkens noch dominierend, weicht einer leichten Euphorie. Im weiten Spektrum seiner Gedanken und Gefühle tauchen verschüttet geglaubte Begriffe auf, wie „ ich habe ein Ziel, ich will das unbedingt“. Erregende und auch gleichzeitig besorgniserregende Gedanken!
Kann etwas Aufregendes oder anregendes denn Besorgnis auslösen? Es kann, wenn das Ziel nicht klar, der Erfolg nicht messbar und der Aufwand unkalkulierbar ist. Vor geraumer Zeit handelte er weitaus pragmatischer: Schublade auf, Vergangenheit rein, zu sperren und den Schlüssel wegwerfen. Ein plausibles Verhalten, nur wenig nützlich, wenn diese Schublade, das Archiv der Seele und des Unterbewussten, vollgestopft und überquellend mit Ereignismüll, im Besitz eines Ersatzschlüssel ist und sich öfters Platz schafft.
Seltsam, dass er sich an dieses Ereignis erinnert. An seine Eltern ist kaum eine Erinnerung aus dieser Zeit vorhanden. Vage glaubt er die Stimme der Mutter zu hören, die so etwas wie Stolz ausdrückt, dass ihr Sohn von den Schwestern bevorzugt wird. Für sie persönlich scheint dies eine Ehrung, eine Aufwertung ihrer Person, gewesen zu sein.
Was um alles in der Welt war in seinen ersten Lebensjahren los? Irgendwas im Leben dieses Knaben ist in irgendeiner Form abnorm verlaufen. Die Bemerkung eines Arztes fällt ihm ein, der sich auf Grund einer körperlichen Anomalie erkundigte, ob er als Kleinkind, eine nicht behandelte Rachitis hatte. Die Nachfrage bei der Mutter und seiner Oma löste bei beiden eine heftige, empörte Verneinung aus. Etwas zu heftig, zu emotional für seinen Geschmack, und mit der unausgesprochenen und doch unüberhörbaren Aufforderung „Frag nie wieder“! Ein seltsames Verhalten, oder nicht?
Seine Mutter – eine Zumutung für ein Kind! Eine lapidare Aussage, die ihm dennoch so treffend vorkommt. Es ist sicher eine diskreditierende Bemerkung, doch gedacht ohne Reue und entschuldigenden Nachsatz. Die Struktur ihrer Psyche wies Vergleiche mit der eines Geröllfeldes auf, nur mit Mühe und Risiko begehbar, ein Straucheln immer möglich und kaum zu verhindern. Eine unerschöpfliche Fundgrube für jeden Psychologen, Lebenswerk inklusive seiner Habilitation. Wäre der Begriff „widersprüchlich“ nicht schon im Sprachgebrauch verankert, für sie müsste er eingeführt werden. Er spürt eine leichte Müdigkeit. Nein, das ist keine Müdigkeit, es ist purer Frust. Die Erinnerung an diese Frau zehrt an den Eingeweiden seiner Seele. Er fühlt sich wie ein kurz vor dem Bersten stehender Dampfkessel. Seine ganze Erregung und Unruhe windet sich um diese Person. Ein Wesen, für ihn unbegreiflich, unbekannt, nur aus unerfreulichen Erinnerungsfetzen bestehend.
Es kann doch nicht sein, dass eine Mutter, die in der allgemeinen Begriffsdefinition des Wortes, etwas mit Liebe, Geduld, Fürsorge und Verständnis zu tun hat, keine positive Gefühlsregung, weder spontan noch zeitlich versetzt, auslöst. Er unterbricht seine Gedanken, unfähig sich zu konzentrieren, und starrt wieder zum Fenster hinaus. Die Schatten der Wolken treiben mit dem Wind über die Kornfelder. Ein Spiel der Natur, beruhigend, einnehmend. Seine Gedanken legen sich in die wogenden Pflanzen wie in eine Wiege, die sich sanft bewegt. Könnte er diesen Augenblick anhalten, er würde es ohne Zögern tun und alle Zeit beenden. Aussteigen, umsteigen, ein Teil der Natur sein, eingebettet in diesen Kernbegriff allen Seins, losgelöst von einer erbärmlichen Existenz mit ihren banalen und doch so existenziellen Problemen.
Weglaufen, er fragt sich, warum er als Kind nie weggelaufen ist, was hat ihn abgehalten? Stärke oder Schwäche? Kam ihn nie der Gedanke, es zu tun? Gründe waren zu Hauff vorhanden, täglich präsent. Die langsame, unmerkliche Gewöhnung ist wohl die Basis allen Erduldens. Er musste sie lange erdulden, diese Mutter. Viele Jahre war sie gegenwärtig, eine unüberwindliche, festgeschriebene Tatsache. Die Abhängigkeit von ihr, in ihrer Intensität nach dem Lebensalter zwar abgestuft, war die Basis seines Lebens, seines Überlebens. Zurückblickend stellt sich die Frage, ob er das Leben so wollte?
Damals, als Kind, stellte sich die Frage etwas anders. Wollte er leben? Ja, das wollte er wohl, wie die anderen Kinder auch. Er wollte wie andere Kinder eine Mutter haben, sicher ohne die Kenntnis, wie andere Mütter waren, doch er fühlte, dass ihm etwas fehlte. Was ihm fehlte, konnte er nur ahnen. Die passenden Begriffe sind einem Kind noch nicht geläufig, es kennt die Worte nicht, um seine Gefühle zu beschreiben. Ähnlich einem Erwachsenen, der über seinen begrifflichen Horizont hinaus zu denken versucht und sein Denken, seine Vorstellungen in Worte fassen möchte, Worte die er nicht kennt, ein unverständliches Gestammel.
Die ersten schemenhaften Erinnerungen an die Mutter beginnen mit der Geburt seiner Schwester, eine Hausgeburt, im Schlafzimmer der Eltern. Im Wohnzimmer eines alten, maroden Bauernhauses, wartete er mit seinem Vater auf etwas. Er kann sich weder an seinen Vater noch an ein Gefühl erinnern, es bewegte ihn nicht sonderlich, seine sechs vergangenen Lebensjahre bescherten ihm anscheinend wenig emotionale Reife.
Nach einiger Zeit des Wartens, sein Vater ging schon früher ins hintere Zimmer, riefen sie auch ihn. So, nun freue dich, du hast jetzt ein Schwesterchen! So oder so ähnlich lautete ihr Verlangen bei der Vorstellung dieses runzligen, hässlichen Wesens, das da bei der Mutter lag. Die glücklich strahlenden Gesichter von Vater und Mutter und einer älteren Frau, einer Hebamme, wirkten auf ihn hämisch und abstoßend. Alles wegen diesem Ding da? Er verstand überhaupt nichts. Nicht, dass er den Zuwachs ablehnte, er war ihm einfach gleichgültig.
Diese Begebenheit hätte jetzt bei weitem nicht so eine Bedeutung, wenn er nicht ab dieser Zeit in den Genuss der unerschöpflichen Vielfalt menschlicher Unzulänglichkeiten und Abgründe gekommen wäre. Mutter und Tochter, Vater und Sohn. Nein, das ginge ja noch, doch es stellte sich anders dar: Mutter und Tochter, ein Vater und ein Sohn. Sein Dilemma: Er war allein. Die Mutter verfuhr nun nach dem einfachen Prinzip: Klappt es mit dem alten Kind nicht, leg es beiseite und versuche es mit etwas Neuem. Somit hatte er ausgespielt, er war nun ein Kind zweiter Wahl. Der Vater, in sich zurückgezogen, depressiv, kaum zu einer stabilen Gefühlsregung fähig, schien keine rechte Hilfe für ihn und schon gar kein Gegenpol zu dem weiblichen“ Duo Infernale, “ Mutter und Tochter.
Nun, die Welt drehte sich in der Hauptsache fortan um die Tochter der Familie. Zielstrebig trieb die Mutter seine Demontage voran, hatte sie jetzt doch Ersatz für ihn... und zwei Kinder waren für sie eines zu viel. Keine Zuneigung zu erhalten und nicht zu wissen, was das ist, Zuneigung, ist mit einer Portion angeborener Ignoranz sicher lebbar, auch für ein Kind. Zu sehen, was das ist, Zuneigung, und sie dann nicht zu erhalten, das ist bitter für ein Kind.
Die Entfremdung wuchs, unterschwellige, beidseitige Abneigung belastete zusehends die Mutter – Sohn Verbindung. Den Machtverhältnissen entsprechend gab es einen klaren Verlierer, ihn. Dies markierte den Beginn einer Zeit, die man keinem wünschen sollte. Die Psyche des Jungen zeigte sich dieser Belastung nicht gewachsen, sie reagierte, sie reagierte mit ihren Möglichkeiten, sie rief um Hilfe. Dummerweise wählte sie die falsche Sprache; sie ließ ihn stottern. In Ermangelung gewisser intellektueller Grundlagen, verstand das niemand in seinem familiären Umfeld. „Helft mir, ich komm nicht zurecht“, mehr wollte sie nicht sagen. Der Schuss ging gründlich nach hinten los. Nun war dieser Sohn nicht nur lästig, er war auch noch peinlich.
Peinlich, da sich das Leben der Frau Mutter zu einem Teil öffentlich abspielte. Sie war aktives Mitglied in einem örtlichen Verein und dadurch fest eingebunden in den Tratsch und Klatsch des Dorfgeschehens. Ein enormer Ehrgeizig trieb sie an, ihre gesellschaftliche Stellung in der „High Society“ des Dorfes aufzuwerten, da sie doch eine „Zugezogene“ aus der Stadt war. Aus dem Dorf, wo sie lebten, stammte nur der Vaters. Und jetzt diese Blamage! Ein erstgeborener Sohn, der Stolz jeder Familie, der Kronprinz, zumindest nach außen, fängt an zu stottern. Das feine Stadtkind, wie manche ältere Frau ihn schon nannte, stottert, er ist behindert. Ein Kronprinz stottert nicht!
Ein Debakel, eine Katastrophe, berücksichtigt man die, noch sicherlich präsenten, Merkmale eines richtigen, deutschen Jungen. Fünfzehn Jahre staatlich verordnete Verleugnung liebgewonnener Ideologien, löschen keine tief verwurzelten Überzeugungen gänzlich aus. Man redet lediglich nicht mehr offen darüber, wie ein wertvoller deutscher Mustermensch zu sein hat. Groß, blond, hager, stolz, mutig und blöd genug, sich vor den Karren jeglicher dümmlichen Ideologie spannen zu lassen. Man redet auch nicht mehr offen über die Begeisterung, mit der man sich im Bund deutscher Mädchen engagierte, nicht darüber, dass der Bruder in der Waffen SS war, er hat ja nichts gemacht, sie haben ja alle nichts gemacht. Man schweigt, wiegelt ab.
Diese verdammte Generation spielt in ihrer Mehrheit die Rolle der Unschuldigen, oder Geschädigten, ganz Dreiste bezeichnen sich gar als Opfer. Nur in ihrem Inneren sind sie immer noch das, was sie immer waren, wozu sie erzogen wurden; überzeugte Anhänger der abartigen Ideologie ihres ehemaligen Führers. Kein Gedanke, dass sie mit ihrer Feigheit, ihrer Dummheit, den Tod von Millionen von Menschen mit zu verantworten haben. Ehemalige Widerstandskämpfer und Menschen, die emigrierten, weil sie dem Unrecht nicht dienen wollten, wurden noch offen als Vaterlandsverräter bezeichnet und geächtet. Dieses Volk erwartet kollektive Dummheit, kein verantwortungsvolles Handeln und sei es ethisch noch so geboten. Nicht aus der Reihe tanzen, dem Ideal so gut wie nur irgendwie möglich entsprechen, diese Prämissen werden als unbedingte Voraussetzung für die Anerkennung in der Gesellschaft gesehen und gelebt, früher, heute und wenn nicht die Sonne einmal im Westen aufgeht, auch morgen.
Aus diesem Sumpf von Dummheit und Ignoranz konnte er wohl wenig Verständnis erwarten, vielleicht etwas Mitleid. Das wird er noch schmerzlich spüren, nur gut, dass er dies damals noch nicht wusste. Damals plagten ihn andere Sorgen, er wollte sprechen. Von schierer Verzweiflung getrieben, versuchte er Wörter, vor allem diejenigen, die mit einem Vokal beginnen, auszusprechen. Aussprechen wäre zu viel gesagt; er presste sie aus seinem Mund, um anschließend die folgenden Silben abgehackt auszuspucken. Ein Zuhörer musste schon etwas Zeit mitbringen, sich die Worte merken, um nach einer gefühlten Ewigkeit, den Zusammenhang noch zu erkennen. Und vor allem sollte er sich das Lachen verkneifen.
Der Junge bemerkte dies bald, sah die Ungeduld, das Mitleid, den Spott in den Gesichtern, versuchte trotzdem zu sprechen. Später nahm dann seine Neugier zu. Er wollte mehr wissen, wollte Fragen stellen, wenn er es nur gekonnt hätte. Das „W“ gesellte sich zu den Vokalen, damit waren die Fragewörter auch problematisch geworden. „Rede langsam, was bist du denn so aufgeregt!“ so lauteten die dümmlichen Anmerkungen seiner Mutter. Mit solch hilfreicher Unterstützung, liebevollem Lächeln und einer unendlichen Geduld, war sie ihm eine stets eine wertvolle Hilfe. Oh ja, sie bemühte sich schon, beziehungsweise sie ließ andere sich bemühen. Zuerst konsultiert sie mit ihm den Hausarzt, er sollte den Makel wohl operativ entfernen. Später zog sie noch einen Professor zu Rate, allerdings nur ein einziges Mal. Diese Koryphäe war für sie etwas umständlich zu erreichen, er praktizierte weit ab von regelmäßig verkehrenden, öffentlichen Verkehrsmittel, und die Familie besaß kein Auto. Mit diesem Professor ging sie lange in ihrem Umfeld hausieren, so lange jedenfalls, bis sie die verdiente, umfassende und allseitige Anerkennung für ihr Bemühen erhielt. Damit schloss sie das Kapitel ab, mehr konnte man nicht tun und jeder wusste nun, sie hatte ja alles versucht.
Er hält inne, fragt sich, ob er sie nicht zu hart beurteilt oder gar verurteilt. Nein, das tut er nicht. Sein Zögern ist lediglich das alte Problem der geprügelten Hunde und deren Herren, der Scheidungskinder, der misshandelten Frauen und Kinder, die die Schuld bei sich suchen. Verdammt noch mal, er ist doch nicht mehr abhängig von dieser Frau, außerdem ist sie schon tot. Was soll dieser Anflug von schlechtem Gewissen und Schuldgefühlen, er ist doch das Opfer. Die Zweifel sind ihm zuwider, er weiß, es ist Unsinn und doch kann er diesen Unsinn nicht ganz ausblenden. Ist er doch ungerecht? Gibt es nicht Erklärungen für ihr Verhalten? Erklärt ihre Kindheit und Jugend, die sozialen und gesellschaftspolitischen Zwänge dieser Zeit, ihre Art?
Geht man von neueren neurologischen Erkenntnissen aus, so steuert sich unser Verhalten nicht immer bewusst mit dem Intellekt, sondern es wird aus einem unbewussten Bereich, dort wo die Struktur unserer Persönlichkeit determiniert ist, bestimmt. Soll er nun gedanklich umschwenken und sie erklären, sie rechtfertigen? Nein! In drei Teufels Namen, nein, das will er nicht! Er hat nicht mehr die geringste Lust, nur gut und edel zu sein, das hat ihm in seinem Leben zu viele Blessuren eingebracht. Diese Frau stand in der Verantwortung und hat versagt, nicht er.
War es zu viel verlangt, ihn, das Kind, zu trösten, wenn er aus der Schule heimkam, deprimiert, verzweifelt? Stundenlang saß er in einem Klassenzimmer, ängstlich, da der Lehrer ihm jeden Moment eine Frage stellen konnte. Gab es dann auf die Frage eine Antwort, dessen erstes Wort er aussprechen konnte? Er kann diese Angst heute noch spüren. Damals kroch sie ihm vom Bauch in die Beine, in den Kopf, ließ das Blut erstarren, sie schnürte ihn ein, unfähig zu jeder Reaktion, er wusste die Antworten, jedoch ohne die Möglichkeit, sich zu artikulieren. Getuschel der Mitschüler, unzählige Augenpaare auf sich gerichtet, Gelächter, für die anderen Kinder eine willkommene Unterbrechung, für ihn ein Desaster. Mobbing in der Pause und auf dem Heimweg. Kinder können grausam sein. „Bitte, bitte fragen sie mich nicht,“ ununterbrochenes stilles Flehen an die Lehrer, sobald der Unterrichtsstoff die Mitarbeit der Schüler forderte. Er hatte bald ein untrügliches Gefühl dafür; ein paar Sätze noch, dann kommt sie, die eine Frage an ihn. Jede Schulstunde die gleiche Angst, Tag für Tag, Jahr für Jahr.
Rückblickend fragt er sich, wie das eigentlich auszuhalten war. Was hat ihm die Kraft gegeben, acht lange Jahre? Die Mutter war es jedenfalls nicht. Nach einem oft fluchtartigen Heimweg erwartete sie ihn, meist in unterkühlter, frostiger Stimmung.“ Wo kommst du jetzt her“? Die Standartfrage, nicht im Kontext zur Uhrzeit zu sehen, eher willkürlich, aus ihrer miserablen Laune heraus gestellt . Sicherlich kam er manchmal etwas später nach Hause, doch nie ohne Grund, welcher sie aber nicht ernstlich zu interessieren schien. Öfters musste er einen Umweg gehen um den Gehässigkeiten und Angriffen der Mitschüler zu entkommen. Und der Umweg konnte in einem kleinen, übersichtlichen Dorf sehr weit sein. Die Verfolger im Rücken, den Terror zu Hause vor Augen, es waren traumhafte Perspektiven.
„Was war heute wieder los, kannst du nicht pünktlich heimkommen, koche ich denn umsonst“? Ihr zutiefst frostiger Blick, ihre mürrische Stimme genügten ihm, er verzichtete dann meistens auf die Schilderung seiner Erlebnisse. Sie gab ihm ja immer wieder zu verstehen, wo die Schuld eigentlich zu suchen sei, bei ihm selbst. Das prägte sich ein, ließ ihn verstummen. Trost oder gar Verständnis konnte er von der nicht erwarten. Dieser Erkenntnis musste er sich wohl oder übel beugen. So zimmerte er sich in seiner Seele eine große Kiste, in der er seinen Kummer verstaute. Kummer rein, Deckel zu. Der Deckel blieb aber meist offen, da der Nachschub nie versiegte.
Liebevolle Zuwendung war nicht im Fundus ihrer möglichen Gefühlsregungen zu finden, wenigstens nicht für ihn. Bei ihrer dicken Tochter sah das schon etwas anders aus. Die Kleine machte das auch etwas cleverer als er. Ein Wonneproppen, schleimend, lieb, treuherzig und doof, welches Mutterherz schmilzt da nicht wie Eis in der Sonne? Er fand seine Schwester zusehends unsympathischer. Sie nahm ihm zwar nichts weg, aber sie hatte etwas, was er nicht hatte, eine Mutter. Als er auch noch unter Zwang in die Betreuung des Sonnenscheins eingebunden wurde, war das Verhältnis zu der Schwester vollends zerrüttet. Sein „Loser-Leben“ dehnte sich nun auch auf den Nachmittag aus. Kinderwagen schieben vor den Augen einfach urteilender Dorfkinder, schlimmer ging es wirklich nicht mehr.
Es fällt ihm immer schwerer, sich auf seine Gedanken zu konzentrieren. Er fühlt sich müde, leer, ausgebrannt. Was hält ihn davon ab, sich hinzulegen und zu schlafen, sehr lange zu schlafen, schlafen bis sich etwas verändert, etwas, was das Leben wieder lebenswert macht? Warum muss er für alles kämpfen, kämpfen für Minimales, nicht für die großen Dinge. Verfolgt ihn diese verfluchte Kindheit ein Leben lang?
Sicher gab es auch angenehmere Erlebnisse. Diese sollte er nicht vergessen, auch wenn sie, im Vergleich zum Alltag, höchstens wie einige sonnige Stunden in einem verregneten Frühling zu spüren waren. Er erinnert sich vage an einen Freund und an ein Mädchen, die sich aus irgendeinem Grund, sei es Mitleid, er weiß es nicht, mit ihm abgaben. Nach Jahren wurden es derer mehrere, so entspannte sich seine Situation außer Hause etwas. Zum Ende der Schulzeit fühlte er sich dann soweit integriert, dass es sich leben ließ, was bedeutete, dass er sich im Dauerregen mit einem Schirm schützen konnte, zwar einem kleinen, aber er wurde nicht mehr gänzlich nass.
Seine Seele war krank, krank vor Angst. Angst vor dem Versagen, Angst vor der Beachtung, Angst vor der Nichtbeachtung, Angst vor dem Reden. Er zitterte inzwischen wie ein Alkoholiker, er zitterte beim Essen, Trinken und Schreiben. Ein zitternder Stotterer, Hauptschüler. Der Besuch weiterführender Schulen lehnte seine Mutter ab, Stotterer schaffen das sowieso nicht!
Doch spürte er nur eine geringe Resignation. Er wollte doch leben und wenn auch nur auf bescheidenem Niveau, kleine Siege, kleine Erfolge und schon war er glücklich. Einmal beim Vorlesen nicht zu stottern, oder einmal eine Rauferei als Sieger zu beenden, welch seltenes, kostbares Kleinod! Bei einem solch seltenen Ereignis drohte ihm ein, den Streit beendender Erwachsener, er werde auch noch seinen Meister finden; dümmer ginge es wirklich nimmer.
Kleine Höhepunkte machten hin und wieder auch sein Leben lebenswert. Mit zunehmender Akzeptanz seiner Person in seinem äußeren Umfeld, widersetzte er sich nun der Tristesse seines Zuhauses, seinem emotional abwesenden Vater, seiner lieblosen Mutter und der sich zur Made entwickelnden Schwester. Seine Stellung innerhalb der Jugend war sicher nicht sonderlich hoch, aber wenn kein anderer da war, kein anderer seinen Platz beanspruchte, wurde er doch akzeptiert. Diese Stellung ertrotzte er sich gegen alle Widrigkeiten.
Und dennoch, er fühlte sich meist allein. Nachträglich herzlichen Dank der Frau, die er Mutter nannte, für ihre Hilfe! Danke für all das Verständnis, die Liebe und die tröstenden Worte, wenn die Verzweiflung kaum mehr zu ertragen war, danke für die zitternden Hände, das Stottern, die Ängste! Er weiß, er wiederholt sich.
Diese Frau klebt wie eine Klette an ihm. Er fühlt, er wird keinen Frieden finden, wenn er sich dieser posthumen Auseinandersetzung nicht stellt. Bei allem, was er denkt und fühlt, spürt er ihren kalten Atem. Steigt sie jetzt aus dem Sumpf seiner Gedanken in die Freiheit einer spirituellen Existenz auf? Eine seltsame Vorstellung, doch denkbar, er glaubt an das Ewige der geistigen Existenz. Nur wo sich all die geistige Energie aufhalten soll, ist ihm ein Rätsel, das auch das Studium gängiger philosophischer Ansichten noch nicht lösen konnte. Es bleibt ihm nur die Überlegung, wie er diese Auseinandersetzung führen soll. Es streiten sich in altbekannter Manier die Fraktionen Ablehnung und Verständnis. Sollen sie streiten, es eilt nicht, die Mutter stört noch Jahrzehnte sein Leben, er blendet sie erst einmal aus.
Es klingelt, ein älterer Herr steht an dem breiten Tor, dem straßenseitigen Zugang zu dem Innenhof des großen bäuerlichen Anwesens, das sie vor zwei Jahren mieteten. Durch die Terrassen Tür beobachtet er, wie seine Frau, begleitet von ihrem Hund, auf den wartenden Mann zugeht. Es kommen nicht viele Besucher, doch deren Anliegen sind meist die gleichen, sie präsentieren irgendwelche Verbindlichkeiten, Zahlungsaufforderungen und fordern deren Begleichung. Er kann sich nicht beklagen, alle sind freundlich, nett, sympathisch und entgegenkommend. Er versteht die vielen negativen Vorbehalte gegen diese Berufsgruppe nicht, sie können doch kaum für die missliche Lage ihrer „Kundschaft“ die Schuld tragen. Sie sind nur das letzte Glied in einer Kette von Fehlentscheidungen, Schicksalsschlägen, Dummheiten, und Pleiten ihrer Klientel. Ob Selbst- oder Fremdverschulden, die Ursache spielt letztendlich keine Rolle. Es bleibt das Problem des Schuldners, seine Verbindlichkeiten zu bezahlen. Unter diesem Aspekt beurteilte und behandelte er die Menschen, die sich mit ihm und seiner misslichen finanziellen Lage auseinandersetzten müssen. Es war in der Regel nie zu seinem Nachteil.
Seine Situation war eigentlich schon etwas sonderlich, man könnte sie als pervers bezeichnen, denn so wollte er sie. Zwar nicht ganz so, wie sie sich mit einer unkontrollierbaren Eigendynamik entwickelte, vom Prinzip her aber schon. Nun musste er damit leben, und mit seinen Besuchern. Eins hatte er erreicht, es konnte nur noch besser werden und die Erfahrung lehrte ihn, dass dies mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auch geschehen würde. Er musste immer wieder in seinem Leben ganz von unten neu beginnen, und verfolgte dabei die, in jeder menschlichen Existenz eingebundene Wellenbewegung, von Erfolg und Misserfolg. Er hoffte zwar immer, dass die Welle des Erfolgs ihn an die Oberfläche spülte und er dort verweilen könnte, doch entweder war die Welle des zeitweiligen Erfolges zu schwach, oder er konnte oder wollte sich da oben nicht festhalten.
Nicht alles ist Gold, was glänzt. Manche Erfolge verlieren bei rückblickender Betrachtung schnell ihren Glanz, oder man schätzte oder achtete die Erfolge nicht, sei es willentlich oder unwissend. Bei ihm war es ein Konglomerat aus all diesen Möglichkeiten. Er kostet es fast genüsslich aus, das Auf und Ab des Lebens. Nun wollte er diese, für ihn logisch richtigen Gesetzmäßigkeiten der Wechselwirkung von Misserfolg und Erfolg, für sich in Anspruch nehmen und in Konsequenz der Gegebenheiten den Erfolg einfordern. Brechen mit all dem, was ihn ein Leben lang belastete, angefangen mit seinem Beruf, den er nie liebte, höchstens akzeptierte. Mit allem neu beginnen. Darin sah er die einzige Möglichkeit, und sei sie noch so riskant, auf eine gute, lebenswerte Zukunft.