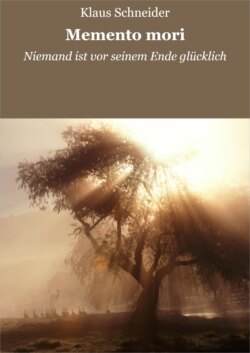Читать книгу Memento mori - Klaus Schneider Erich - Страница 4
2
Оглавление„Können sie sich vorstellen, dass ihnen ihre Mutter oder ihr Vater den Beruf aussucht?“ Seine Mutter tat es, sie griff regulierend ein, um ihre Vorstellungen, was für den Sohn gut zu sein hat, umzusetzen. Sein Wunsch, den Beruf eines Feinmechaniker oder Uhrmacher zu erlernen, eliminierte sie in einer gemeinsamen Aktion mit einem „Berufsberater“. Sie fand nicht gut, was er wollte, warum auch immer, und der Berater vom Amt stellte sich hinter sie, es war wohl einfacher für ihn. Der kleine Stotterer hatte in diesem Büroraum der Berufsberatung nie eine Chance sich durchzusetzen. Die Gegenseite verfügte über die besseren Argumente, er dagegen über fast gar keine, woher auch, er wollte es ja nur, eine unreife Spinnerei eben. Dagegen war das Ausbildungsangebot bei einer staatlichen Behörde, das der Berufsberater präsentierte, krisensicher, auch für kleine Stotterer und analog potentielle Versager.
Keiner sprach es laut aus, doch irgendwie spürte er, was sie dachten. Weitere drei Jahre Berufsfachschule für einen Beruf, bei dem ein Zitterer nach deren Meinung fehl am Platz war, das musste nicht sein. Dass der Beruf des Uhrmachers oder Feinmechanikers mit dem Beruf eines Bauzeichners gar nichts gemein hatte, fand in ihren Überlegungen keine Beachtung. So wurde binnen einer halben Stunde der kleine Loser umprogrammiert und fertig.
Etwas perplex und mit der Adresse der Behörde, wo er sich vorstellen sollte, ein paar guten Rat- schlägen für eine erfolgreiche Bewerbung und Vorstellung, sowie einer zufriedenen Mutter, trollte er sich. Was da eben passiert war, begriff er in der Kürze der Zeit nicht so recht, er musste wohl akzeptieren, dass er doch am allerwenigsten zu wissen schien, was gut für ihn sei. Sie hatten ihn einfach überfahren, ihm wie Staubsaugervertreter ihre Vorstellungen von seiner Zukunft verkauft.
Damals war die Berufswahl noch etwas fürs ganze Leben, eine schwer revidierbare Entscheidung. Gesellschaftlich toleriert wurden nur berufliche Aufstiege oder krankheitsbedingte Umschulungen, ansonsten blieb man in der Regel seinem Beruf von der Wiege bis zur Bahre treu. Eine vage Hoffnung, dass er seine Wünsche vielleicht nochmals ins Spiel bringen könnte, blieb ihm noch. Die, bei denen er sich bewerben sollte, könnten ihn ja nicht wollen. Diese Illusion erfüllte sich nicht. Bewerbung, Vorstellungsgespräch, Lehrvertrag, problemloser könnte es wirklich nicht laufen. Hatte die Mutter einen Vertrag mit dem Teufel? Er fügte sich, was blieb ihm schon übrig?
Der einhellige Tenor, verwandter oder bekannter Mitmenschen war, was für ein Glück er doch hätte. Er konnte sich nicht erinnern, dass ihn jemand fragte, was mit seinen Wünschen, die er in seinem überschaubaren, intimen Umfeld schon andeutete, geschehen war. So ganz unwohl fühlte er sich in Folge dann doch nicht, die permanente, lauwarme Berieselung mit den Vorzügen „seiner Berufswahl“, zeigte Wirkung. Er drehte sich in den Wind und ließ sich treiben. Es war nun keine richtige Niederlage mehr, er wandelte all das, was geschehen war, gedanklich einfach zu einem Erfolg um. Das machte in der unabänderlichen Situation mehr Sinn. Er hatte ja eine Stellung, um die man ihn beneidete.
Nun blendete er einfach alles aus, was dieses Gefühl des Erfolgs schmälern würde. Unbewusst begriff er, dass alles eine Frage der Sichtweise ist. Vogelscheiße kann ja auch ein wertvoller Dünger sein, der tausende von Kilometer transportiert wird, um mit der richtigen Darstellung seiner Vorzüge teuer verkauft zu werden. Die Tatsache, dass Scheiße Scheiße bleibt, kann man getrost vernachlässigen, wenn der Nutzen überwiegt. Er erfuhr nun eine gewisse Anerkennung, eine angenehme Erfahrung. Es spielte nun letztendlich keine Rolle mehr, ob der Umstand willentlich herbeigeführt wurde oder nicht.
Er hatte keine konkrete Vorstellung von dem, was er lernen sollte, was er da zu tun hatte, bei dieser Behörde. Technisches Zeichnen, Vermessen, sie hatten ihm einiges erklärt, er sagte brav „ja“ und begriff wenig. Fragen wollte er nicht viel, es dauerte immer noch sehr lange, bis er eine passende, aussprechbare Frage formulieren konnte. So wurde das Meiste, ohne es verstanden zu haben, abgenickt. Wahrscheinlich dachten die, was für ein verständiger, kluger Junge er doch sei.
Er fühlte sich in einer Aufbruchsstimmung, das Ende der Kindheit deutete sich an. Weg aus der stickigen Atmosphäre dieses dreitausend Seelen Dorfes, in das Leben der acht Kilometer entfernten Kreisstadt. Das war für ihn Zukunft, Hoffnung. Gefühle, überschwänglich, faszinierend neu, aufregend, ja fast euphorisch verdrängten die Resignation in seinen Empfindungen. Seine Fantasie trat über sämtliche Ufer der Realität. Was würde er alles erreichen können? Er sah sich schon auf höchsten Gipfeln gesellschaftlicher Stellung.
Träumen war doch so schön und behaglich. Gleichzeitig ruhte und agierte er in seinen Träumen, unwillig, sie grundlos zu verlassen. Das reale Leben, unterkühlt, konsequent in seinem Ablauf, verlangte nach diesem Gegenpol. Das frostig kalte Leben ängstigte ihn, hatte er doch in der Vergangenheit nicht viel Gelegenheit, diese Realität unbeschwert zu leben. Sie hat ihn höchstens gelehrt, Niederlagen zu akzeptieren und zu verarbeiten. Darin hatte er ein gewisses Talent entwickelt, aber sonst? In seinen Träumen dagegen konnte er die Wirklichkeit so formen, dass sie seinen Wünschen entsprach. Gott, war das schön!
Dummer Weise formte sich so ein Teil seiner Persönlichkeit in seiner Fantasie. Definiert er nun Persönlichkeit mit der Befähigung, das Leben auf Grund eigener Einsicht und Entscheidungen selbstständig zu bewältigen, so wird ihm das Absurde dieser Entwicklung erst richtig bewusst. Eine Persönlichkeit in der irrealen Welt von Himmelskuckucksheim geformt, soll im realen Leben bestehen? Wie um alles in der Welt hat er es bis hier und heute geschafft? Es drängt ihn nicht weiter darüber nachzudenken. Die Dimension dieser Aufgabe würde ein ernsthaftes Interesse und konsequentes Suchen nach einer Antwort voraussetzen. Zu mühevoll und zu riskant überlegt er und außerdem sollte man nur Fragen stellen, deren Beantwortung zu keinem ideellen Eklat führen, was hier kaum auszuschließen war.
Er sitzt auf seinem Stuhl, seinen Oberkörper wiegend, den Kopf gesenkt, und fragt sich, ob er die Geister, die er rief, auch beherrsche, oder ob ihm das Schicksal des Zauberlehrlings drohe? Nur, dessen gutes Ende bedurfte eines Meisters, den er in seiner Abgeschiedenheit kaum finden wird. Etwas missmutig blickt er durch das verschlossene Fenster. Herrliches Wetter, ein paar silbergraue Wolken in langsamer Bewegung, blendender Sonnenschein, kurze Schatten der türkisgrünen Pflanztröge legen sich auf die Terrasse, es ist die Zeit inmitten des Sommers. Die Sonne zog sich kurz zurück, um nach wenigen Minuten mit neuer Energie die Luft wieder zu erhitzen. Das Wolkenspiel zeigt das Bild einer riesigen Gans mit prägnantem Kopf, der sich kurz, nachdem das Bild zu erfassen war, wieder auflöst, um mit einem neun Bild die Fantasie des Betrachters anzuregen. Die Wolken ziehen doch etwas zu eilig auf ihrem Weg, als dass er ihr schnell wechselndes Formenspiel auskosten kann.
Sein Blick fällt auf ein kleines, rotes, achtlos abgelegtes Buch: Erster Teil: Lautlehre, §1 Schrift und Aussprache. Das griechische Alphabet besteht aus folgenden 24 Buchstaben. Er überlegt kurz. Was hat ihn eigentlich dazu bewogen, sich dieses Buch anzutun? Wohl seinem erklärten Vorhaben folgend, auch Dinge zu tun, die keinen praktischen Nutzen haben, sie nur zu tun, weil sie ihn interessieren. Eine andere Möglichkeit der Erklärung gibt es wohl nicht.
Ob seine Handlungen in der Zeit vorher alle zielstrebig und folgerichtig waren, würde er rückblickend stark bezweifeln. Was heißt überhaupt folgerichtig? Gibt es einen allgemein gültigen Maßstab für folgerichtig oder ist das immer individuell zu betrachten? Folgerichtig, das heißt dass sich eine Aktion, gleich welcher Art, in der Folge als richtig erweist oder wenigstens in einem pragmatischen Sinn sinnvoll war. Lässt man jedoch die Folge, die Abfolge des Lebens offen, so ist jede Handlung für sich richtig. Sie gibt dem Leben einer individuellen Existenz eine Abfolge vor. Reduziert man den Sinn einer individuellen Existenz auf die angenehme Gestaltung, Wohlstand und Gesundheit seines Verweilens hier, so gibt es natürlich Dinge, die folgerichtig und zielstrebig auf die Verwirklichung dieser Annehmlichkeiten ausgerichtet werden sollten.
Kann man solch profane Wünsche mit höheren ethischen Idealen gedanklich verbinden, oder gar leben? Der unserem direkten Einfluss entzogene Lebensablauf, manipuliert durch menschliche Begehrlichkeiten, Eitelkeiten und Dummheiten, in widersprüchlicher Gemeinschaft mit objektiven Wahrheiten, ist das vorstellbar? Es ist nicht nur vorstellbar, es ist wohl die gelebte Realität. Hat er sich nicht oft selbst aus Begehrlichkeit in Situationen gebracht, die er moralisch ablehnte, jedoch wegen eines persönlichen Nutzens billigte? Entscheidungen, die in ihrer Auswirkung seinen Lebenslauf entscheidend verändert hatten.
Gibt es überhaupt einen zielgerichteten Lebensfluss? Ist er nicht vielmehr eine zufällige, gar wirre Abfolge von guten, sowie schlechten Ereignissen? Sein neuer hoffnungsvoller Lebensabschnitt, schön gedacht, wirr verlaufend, war das Bestimmung oder selbst fabrizierter Unsinn? Bestimmung wäre schön, das könnte allem, was daraus entstehen würde, etwas Entschuldigendes verleihen, er könnte mit den Schultern zucken, die Mundwinkel ironisch verziehen und sich gelangweilt abwenden.
Von solch destruktiven Überlegungen war er zu Beginn seiner Ausbildungszeit noch fast unbelastet. Er fühlte sich eigenartig beschwingt, sicher etwas ängstlich, an diesem ersten August auf dem Weg zur Bahnstation, um mit dem Zug zur Arbeit zu fahren. Es fuhren nicht viele Menschen in Richtung dieser Stadt, in der vor allem Schulen und Behörden ihren Sitz hatten. Alle seine Mitschüler, auch der größte Teil der Bevölkerung des Ortes, arbeiteten in einer entgegengesetzt liegenden Stadt mit vielen Fabriken. Den direkten Weg über eine offene Tür neben dem Bahnhofgebäude, der direkt zu den Bahnsteigen führte, mied er und betrat das Bahnhofsgebäude durch den Haupteingang, ging durch die leere, dunkle Wartehalle und trat auf den Bahnsteig. Er war viel zu früh da, so hoffte er, der Erste zu sein, keine Aufmerksamkeit zu erregen, keine neugierigen Blicken zu spüren, allein zu sein, allein mit seinen Vorstellungen und Träumen. Die Hoffnung trog.
Erstaunt, fast gar erschrocken, sah er zu seinem Missfallen ein Mädchen auf einem der schmutzig grauen Holzbänke sitzen, die entlang zu den Gleisen an der Wand des Bahnhofgebäudes standen. Ihr Gesicht, über ein Buch gebeugt, verbarg sich hinter einer üppigen Haarfülle von langen, braun gelockten Haaren. Er wollte sich gerade abwenden, in die Wartehalle gehen und der unerwarteten Situation den Rücken kehren, da hob das Mädchen den Kopf und sah ihn an.
Ein vertrautes Gesicht, in das er blickte, eine der wenigen Erinnerungen, die keine bedrückenden Gefühle aufwühlten. Eine der er ersten und wenigen Begegnungen aus der Kindheit, deren er sich ohne düstere Empfindungen erinnern konnte. Doch im Moment wusste er jedoch nicht recht, wie er mit der Situation umgehen sollte. Sie schauten sich verlegen an, mehr als ein „Hallo“ brachten sie zuerst nicht über die Lippen.
Ganz vorsichtig, er war über alle Maßen unsicher, traute er sich dann, in ihre großen braunen Augen zu schauen. Sie kannten sich schon so lange, soweit seine Erinnerung reichte. Doch als sie vor Jahren die Schule wechselte und das Gymnasium besuchte, verloren sie sich aus den Augen, nicht abrupt, es ergab sich so mit der Zeit. Er schaute sie an, ihr Lächeln berührte ihn, sie war wunderschön, so sah er sie noch nie. Einen, eine kleine Ewigkeit dauernden Augenblick, blieb er noch stumm. Er spürte Schmetterlinge in seinem Bauch, die Beine wollten zu zittern beginnen, eine unerwartete, wenig vertraute Regung.
Unbeholfen taumelnd, im Wirrwarr dieses seltsamen Gefühls, verstand er aber nicht recht, was da mit ihm passierte. Er, dessen höchstes Glück bisher darin bestand, nicht unglücklich zu sein, verspürte ein mächtiges Gefühl, das ihm das Herz sprengen wollte. Solche Gefühle passten doch überhaupt nicht in seinen imaginären Tagesplan und auch nicht zu ihm. Er stemmte sich mit aller Macht gegen diese Eruption seltsamer Emotionen. Wie dumm er damals war! Dieses Verhalten würde er nach Jahren noch bitter bereuen. Doch, das war an diesem Tag in weiter Ferne.
Die beiden fanden ihre Sprache wieder und redeten dann allerlei belangloses Zeug. Alsbald drängten sich bei ihm wieder die Gedanken, die schon Wochen um diesen Tag kreisten, in den Vordergrund. Er begann heute seine Ausbildung und er wusste bei Gott nicht, was ihn da erwartete. Das Mädchen verunsicherte ihn, auch sie erinnerte ihn an die Zeit, die er am liebsten vergessen, aber sicher heute beenden wollte. Der Zug kam, sie stiegen ein und fuhren in die Stadt. Kurz bevor er mit mulmigem Gefühl vor dem Gebäude dieser Behörde stand und sich bewusst wurde, dass er da jetzt hinein gehen musste, trennten sie sich.
Ein schmuckloser moderner Bau, einfachster zweckmäßiger Architektur, mit einem enorm großen Treppenhaus und langen, dunklen Fluren. Er fand sich kurz darauf etwas verloren und unsicher, in dem direkt neben dem Aufzug liegenden Geschäftszimmer wieder. Neugierig und abschätzend von zwei Damen des Sekretariats begrüßt, wartete er nun auf die Dinge, die da kommen würden. Die Euphorie der vergangenen Tage wich zusehends einer bangen Unsicherheit. Ob er da wohl bestehen konnte?
Die Türe ging auf und ein respekteinflößender Mann, groß und wohlbeleibt, mit Halbglatze und fester Stimme stand vor ihm. Er erschrak, duckte sich innerlich und schrumpfte nun ganz auf das Normalmaß eines Lehrlings zusammen. Träume ade! Recht unsanft schlug er in der Realität als unwissender, unbedeutender kleiner Azubi auf.
Sein Ausbilder erwies sich in der folgenden Zeit als Segen und Fluch zugleich. Unter seinen Fittichen befand er sich im Gefüge dieser Behörde an einem sicheren Ort. Er war nun sein Lehrling und dieser Mann wurde allseits respektiert. Korrekt vom Scheitel bis zur Sohle, ein ehemaliger Offizier der Wehrmacht, der keine Schwächen und Blößen erkennen ließ, und auch nicht sehr viel Verständnis für die Schwächen anderer aufbrachte. Der Junge verstand schnell, er war durch die jahrelange Sprachlosigkeit ein guter Zuhörer und Beobachter geworden, analysierte seine Lage und passte sich an.
Es war ja nicht von Nachteil für ihn, was ihm deutlich bewusst wurde, als zwei ältere Auszubildende ihn zum Einkaufen für ihre Mittagspause schicken wollten. Der Alte, der zufällig dazukam, kürzte sie binnen ein paar Augenblicken auf eine übersehbare Größe. Nie wieder hat sich jemand erdreistet, ohne ausdrückliche Erlaubnis seines Ausbilders, ihn mit irgendeiner Aufgabe zu betrauen. Verglichen mit seiner Schulzeit fühlte er sich hier wie in einem Schutzgebiet für noch nicht gänzlich lebenstüchtige Heranwachsende.
Die ersten Wochen verliefen angenehm ruhig und waren doch aufregend und interessant. Keine Gedanken mehr, dass er einmal, in vergangener Zeit, diesen Beruf gar nicht wollte. Er ging in der Gleichmäßigkeit der Tage auf, er genoss sie. Keine Hänseleien, kein Spott. Nur die tägliche Anspannung, jeglichen Fehler zu vermeiden, lastete noch auf seiner Seele. Welch ein Unterschied, diese Befreiung von den meisten Dingen, die ihm bisher so viel Kummer bereiteten; ganz langsam aber stetig wurde ihm leichter ums Herz.
Dann fiel ihm etwas Unglaubliches an sich auf. Er konnte öfter sprechen ohne zu stottern, sicher nicht in jeder Situation, aber doch wenigstens in manchem Einzelgespräch. Unfassbar, nach einer Ewigkeit der gefühlten Sprachlosigkeit endlich sprechen zu können. Er konnte sich einbringen, sich bemerkbar machen, oder wenigstens ohne diese lähmende Furcht eine Frage beantworten. Diese Annahmen bewahrheiteten sich im Laufe der Zeit leider nur teilweise. Ja, er konnte Fragen beantworten, wenn er nicht aufgeregt war, ja, er konnte sich unterhalten, doch war es am besten, wenn er mit seinem Gegenüber alleine war. Er konnte sich aber nur schwer an Gesprächen beteiligen, an denen noch andere mitwirkten, das hatte er nie gelernt.
Hier zeigte sich wieder seine Angst, unangenehm aufzufallen, sei es durch Unwissen, durch stottern, oder einfach durch die Unfähigkeit, zwanglos zu plaudern. Doch es genügte ihm fürs Erste. Wieder ein Schritt die Treppe hoch und seien es vorerst nur die Stufen der Kellertreppe. Es bewegte sich etwas. Die Statik seiner unseligen Kindheit geriet aus dem Gleichgewicht, seine Entwicklung machte einen Schritt nach vorne. Ein Gefühl von realem, praktischem Selbstvertrauen regte sich in ihm. Das aus Träumen und Phantasien konstruierte Selbstverständnis bekam ein etwas stützendes Gerüst, wenn auch das Fundament noch auf keinen tragfähigen Grund stand.
Hatte ihn etwa dieser ehemalige Wehrmachtsoffizier, sein Ausbilder, korrekt, gradlinig, etwas egozentrisch, auf diesen Weg gebracht? Wenn diese Entwicklung von menschlicher Hand beeinflusst wurde, dann von ihm, der Bezugsperson in dieser Zeit. Er respektierte diesen Mann, er achtete ihn, seine Persönlichkeit, sein Auftreten, er war ein Vorbild an dem er sich orientieren konnte.
Ob das Vorbild in all seinen Facetten seinem Ideal entsprach, war zu Beginn dieser Beziehung nicht von großer Bedeutung. Viele lebende Vorbilder und Ideale hatte er noch nicht kennen gelernt. Irgendwie tat er ihm gut, dieses Prachtbild eines Beamten, der immer pünktlich auf die Minute den Dienst antrat und beendete, ohne dienstliche Erfordernisse keine unnötigen privaten Plauderstündchen im Amt einlegte, irgendwie war er aus einer anderen Zeit übrig geblieben.
Er bildete ihn gut aus und lehrte ihn alles, was zur Ausübung des Berufs nötig war. Auch vergaß er nie, sein besonderes Können, seine beruflichen Glanzpunkte zu erwähnen. Hier war er eine Primadonna, eitel und süchtig nach Anerkennung und Applaus. Es musste kein erlesenes Publikum sein, das ihn hochleben ließ, auch einfache Messgehilfen oder Stammtischbrüder jeglicher Art waren ihm genehm und natürlich auch die Bewunderung seines Lehrlings.
Während die Demonstration seiner intellektuellen und fachlichen Überlegenheit teils bewundernd aufgenommen wurde, führte die Präsentation des felderprobten Soldaten manches Mal zu schmerzhaften Erfahrung des Lehrlings. Die in der freien Natur zu erledigenden Arbeiten wurden in der Regel in den Wintermonaten ausgeführt. Vermessen von landwirtschaftlichen Wegen und Wasserläufen. Schöne Arbeiten in reizvoller Landschaft könnte man meinen, wenn in dieser Jahreszeit die Temperaturen nicht so weit außerhalb eines gewissen Wohlfühlbereiches liegen würden. Kommt dann noch romantischer Schneefall und kalter Wind hinzu, ist das klimatische Horrorszenario perfekt.
Bei normal gearteten Beamten, dem Rest der Belegschaft, waren Witterungsbedingungen dieser Art ein willkommener Grund, entweder früher nach Hause zu fahren oder den Tag gemütlich in irgendeiner abgelegenen Gaststätte zu verbringen. Von solchem Verhalten war der Vorzeigebeamte weit entfernt, es war für ihn gar verachtungswürdig. So eine Schwäche würde er nie zeigen und sein Lehrling durfte, natürlich ungefragt, an dieser Einstellung teilhaben.
Er, der fünfzehnjährige Hungerhaken, ein Strich in der Landschaft, eingehüllt in einen zu großen Bundeswehrparka, musste an solchen Tagen die gesamten acht Arbeitsstunden im Freien verbringen. Nach zwei, drei Stunden fühlten sich die Füße so kalt an, dass sie wie leblose, abgestorbene Glieder in den Schuhen steckten und so unwirklich fühlte sich dann auch jeder Schritt an. Ein Körper, der sich an den eigenen, ununterbrochenen Zitterbewegungen erlebte. Hände so kalt und schmerzend, dass sie das Schreibgerät kaum halten konnten. Eigenartig unempfindlich gegen derartige Widernisse, stand sein Chef mit geschwellter Brust den ganzen Tag neben ihm, und überwachte mit Argusaugen seine Arbeit.
Seine Verzweiflung nahm manches Mal Dimensionen an, die nahe bei Suizidgedanken lagen. Stunden können lang sein, wenn man die Minuten zählt und diese noch in gezählte Sekunden gliedert. Sehr lang, wenn einem die Kälte jede Minute, ja jede Sekunde, körperliche Schmerzen bereitet. Die Art der Tätigkeit ließ nur gelegentliche Bewegung zu, zu wenig, um sich zu erwärmen und diese Ikone von einem wetterharten, strammen Soldaten stand wie sein eigenes Denkmal an seiner Seite, unerbittlich in dem Vorhaben, die vorgenommene Arbeit zu Ende zu bringen. Seit diesen prägenden Erlebnissen pflegt er ein gestörtes Verhältnis zu der Jahreszeit, die ihn in diese Bredouille brachte. Doch seltsamer Weise war er damals stolz nach getaner Arbeit, nach überwundenem Leiden, er hatte seinen Mann gestanden. Ein paar anerkennende Worte und alles Leiden war vergessen.
Was war er doch für ein Kerl, verglichen mit seinen, in den warmen Fabriken und Büros arbeitenden, ehemaligen Mitschülern. Sein Ego dankte ihm jede Aufwertung, jede sich bietende, wenn noch so kleine, aufwertende Besonderheit. Sie richtete ihn innerlich wieder ein Stückchen mehr auf. Er meinte, sich dem gedachten Ideal zu nähern, der Person, die er sein wollte, stark, erfolgreich, gut und edel. Er, eben ein Träumer mit fließenden Grenzen zum realen Leben.
Eine der Besonderheiten einer Lehre bei einer technischen Behörde war die, dass die schulische Ausbildung der Lehrlinge des ganzen Landes zusammengefasst war. Die Bildungsstätte, in der dies stattfand, lag jedoch nicht in unmittelbarer Nähe, sondern in der einhundert Kilometer entfernten Landeshauptstadt. Ein ideeller Quantensprung, diese Möglichkeit, dazu noch zwingend vorgegeben, in dieser Stadt wochenweise zu leben und zu wohnen. Weg von zu Hause, weg aus dem Zwang der sich täglich wiederholenden Rituale zu Hause, denen er sich nicht gänzlich entziehen konnte. Zu dieser Zeit wuchs sein Verlangen immens, die Vergangenheit aus seinem neuen Leben zu drängen. Sie war ihm lästig, doch klebte sie wie eine Klette an ihm, ein Gefühl, das er insbesondere zu Hause empfand.
Diese Vergangenheit störte die neue Konstruktion, das neue Bild, das er von sich kreiert hatte. Eine gewisse Arroganz kam auf. Seine Unsicherheit, so ganz glaubte er noch nicht an sich, überspielte er mit einem introvertierten Verhalten. Eine Distanz zu seiner Umgebung zu schaffen war dabei nicht seine Absicht, er wollte nur den schützenden Effekt eines solchen Verhaltens für sich in Anspruch nehmen. Es drängte ihn, sich auf irgendeine Art neu zu positionieren oder vielleicht auch sich, seine Legende, neu zu erschaffen und dazu brauchte er die Freiheit einer neuen Umgebung, neue Menschen, einen Neubeginn ohne die Altlasten der Vergangenheit. Die Umstände meinten es nun gut mit ihm, sie zwangen ihn geradezu, das zu tun, was er aus eigenem Antrieb zu dieser Zeit wohl nicht getan hätte, wegzugehen.
An einem Morgen, kurz nach seinem sechzehnten Geburtstag, zog er dann für mehrere Wochen in die Großstadt. Untergebracht in einem Lehrlingsheim, einer karitativen Organisation christlicher Prägung, stand er da in der großen Stadt. Vor ihm türmte sich ein Berg von zwar eher kleinen Problemen auf. Die Sorge, wie er diese lösen könnte, war dagegen umso größer. Welche Straßenbahnlinie verbindet das Heim mit der Schule? Was kostet das? Wie bekomme ich eine Fahrkarte? Wann muss ich losfahren, um nicht zu spät zu kommen? Wie würde er ankommen bei den Mitschülern und den neuen Lehrern?
Sein Denken erinnerte sich an das Empfinden der Kindheit. Unangenehme, verdrängte Erinnerungen zerrten an seinem, noch sehr labilem, Selbstverständnis. Kurzerhand verwehrte er ihnen jedoch den Zutritt in die Illusionen seiner mühsam aufgebauten, subjektiven, doch leidlich lebbaren Welt. Es gab sowieso keine Möglichkeit eines Rückzuges mehr, auch wenn er ihn in einem Anflug von aufkommender Panik, kurz konkret andachte.
Eine unerträgliche Anspannung lähmte ihn fast, als er den Hof der Schule betrat. In diesem Augenblick glaubte er, die Kontrolle über sein Denken und Handeln zu verlieren. Wie eine riesige Welle schwappte mühsam Verdrängtes wieder hoch und begrub sein neues Selbstverständnis unter sich. Weg war die Aufbruchsstimmung, die Euphorie, sein neues Lebensgefühl der letzten Monate. Er fühlte sich wieder als der kleine, abgelehnte Stotterer, der er einmal war.
Unsicher blickte er um sich. Standen vielleicht schon Mitschüler da, die ihn kritisch beobachteten und ihm seine Schwächen ansahen? Seine Beine drohten ihm den Dienst zu versagen, die Heftigkeit dieser Gefühle war niederschmetternd. Er wollte raus aus dieser Situation, doch wie? Er konnte nur davonlaufen. Nur wohin sollte er laufen, wie sollte er sich dann erklären, zu Hause, im Amt? Da musste er wohl weiter gehen, wenn seine Zukunft nicht abrupt enden sollte. Er weiß nicht mehr, wie die nächsten Minuten vergingen, wie er das Klassenzimmer fand, auf einem der hinteren Bänke Platz nahm und mit düsteren Gedanken der Dinge harrte, die nun kommen würden.
Ein Lehrer betrat den, seinen Gedanken ähnlich, düster wirkenden Raum, schaute sogleich auf die in den hinteren Bänken sitzenden Schüler. „Meine Damen, meine Herren, setzen sie sich doch etwas vor, besetzen sie bitte auch die ersten Reihen“. Er fühlte sich nicht angesprochen, so wenig wie die anderen Hinterbänkler auch. Folglich wurden sie alle in die erste Reihe zwangsversetzt. Eine Situation, die er eigentlich unbedingt vermeiden wollte, die aber in der Gemeinschaft der anderen doch ganz erträglich schien. Vor allem war er dadurch, ohne eigenes Zutun, mit einer Gruppe verbunden, was seine Stimmung sehr anhob. So sehr, dass er sich danach recht lässig in der ersten Bank lümmelte und mit ansteigender Zuversicht gelangweilt den Ausführungen des Lehrers lauschte.
Es ging alles gut. Aufatmend, erleichtert verließ er das Schulgebäude. Für den Augenblick bekam alles seine gewohnte Zuordnung wieder. Er konnte durchatmen und es schien so, dass er sogar in der realen Gegenwart eine Nische finden könnte.
Zwei Mitschüler wohnten im gleichen Heim wie er und damit war er ein Teil dieser Zweckgemeinschaft. Sie bot ihm eine gewisse Sicherheit in dieser neuen Umgebung, ohne dass er einer eingefahrenen Hierarchie, bei der er meist am unteren Ende seinen Platz fand, unterworfen war. Sie beschlossen, einmal aufs Geratewohl in die Stadt zu fahren, man würde dann schon sehen. Markanter Punkt, oder das Herz fast einer jeden Stadt, ist ihr Bahnhof, meist zentral in der Mitte gelegen. Es lässt sich kaum vermeiden, sich früher oder später dort einzufinden, da, wo Tausende von Menschen ihre Reise, ihre Fahrt beenden oder beginnen.
Das Gebäude war groß und mindestens so hässlich, graubraun, mit gewaltig hohen Hallen. Verzerrte Stimmen aus den Lautsprechern durchdrangen nur undeutlich das Stimmengewirr der Masse von Menschen. Dieser Ort lebte, faszinierte die Buben. Einmal die Hallen durchlaufen, betont lässig, sichtlich uninteressiert am Geschehen... ein Höhepunkt für die Neuen aus der Provinz.
Das Knurren des Magens, das sich nach ein paar Stunden ohne Nahrung bemerkbar machte, stillten sie mit einer Currywurst aus einer dieser schmuddeligen Imbissstände, die sich entlang der Ein- und Ausgänge wie Perlen aufreihten. Er meint heute noch, dass er nie wieder eine Bessere gegessen habe. So standen sie da, aßen und redeten miteinander. Eigentlich waren sie grundverschieden, doch das war nicht von Bedeutung, es belastete sie keine gemeinsame Vergangenheit. Es lief wieder gut für ihn. Die Panik des Vormittags war vergessen, es war so, als hätte es sie nie gegeben.
Einer von den beiden anderen, vertraut mit dem aktuellen Geschehen der Gegenwart, zeigte ihm dann im Laufe der Zeit eine ihm völlig unbekannte Welt, aus einer Sichtweise, die ihm fremd war. Er begann sich dann für das Weltgeschehen zu interessieren, bildete sich nach und nach eine kritische Meinung, sicher nicht ganz unbeeinflusst von den liberalen, gar anarchistischen Idealen seines Schulfreundes.
Das Amerika Bild seiner Kindheit, der Wilde Westen, die rauen, harten Kerle mit ihren rauchenden Colts, verlor seine Unschuld und zeigte sich in einer hässlichen Parodie. Der Vietnamkrieg, in den Artikeln der ihm bisher täglich zugänglichen, lokalen Presse, immer einseitig pro amerikanisch dargestellt, gar idealisiert als Kampf der freien Welt gegen den Kommunismus, präsentierte sich ihm in seiner ganzen Hässlichkeit. Eine zunehmend kritische Berichterstattung einer liberalen Presse, Bilder von fliehenden, nackten, um ihr Leben rennenden Kindern, oder die Erschießung eines Gefangenen, wirkten schockierend auf ihn. Er fühlte sich diesen schwachen, leidenden Menschen nahe, sie waren ja irgendwie wie er.
Er stellte dann noch grundsätzlich Autoritäten in Frage. Ihre Macht respektierte er dennoch, offene Auflehnung war noch nicht sein Ding. Doch er begann sich seit diesen Tagen den personifizierten Autoritäten des Staates und der Gesellschaft, die er zusehends als eine Bande von Ignoranten und Dummköpfen hielt, zu verweigern. Die Proteste der Studenten, zugegeben er wusste nicht so ganz genau, was die wollten, waren bewundernswert, ein Quell der Hoffnung gegen ein scheinbar allmächtiges System.
Welche heimliche Freude löste der Brandanschlag auf ein Frankfurter Kaufhaus aus. Wie hasste er diesen Staat und seine Repräsentanten nach den Osterunruhen, wegen ihrer aktiven und verbalen Reaktionen, wegen ihrer Ignoranz gegenüber den Protesten, der kaum zu überbietenden Dummheit und des Dilettantismus beim Einsatz so genannter staatlicher Gewalt bei Demonstrationen.
Wie Hohn klangen die Worte des scheinbar zu einem Demokraten konvertierten ehemaligen NSDAP Mitgliedes und jetzigen Bundeskanzlers, der von einer Gefahr von Minderheiten für die freiheitlich- demokratische Ordnung sprach. Das einzige, was der glaubhaft aussprechen konnte war das Wort „Ordnung“. Das war doch ein altes, vertrautes Wort für ihn und seinesgleichen. Freiheitlich und demokratisch, solche idealistische Begriffe klangen sarkastisch aus dessen Mund.
Wie sein Denken auf diese Schiene geriet, was diese Auflehnung verursachte, war es nur eine längst überfällige, pubertäre Auflehnung oder eine tiefe innere Überzeugung? Er weiß es nicht, aber wie es auch immer begann, es hat bis heute Bestand. Damals hinterfrage er seine Ansichten nicht explizit, er erlebte sich in ihnen.
Er genoss die Zeit in der großen Stadt, die Freiheit, das unbekümmerte Leben. Die zeitweise Wiederkehr alter Probleme beim Unterricht trübte manchmal diese Glückseligkeit. Immer wieder einmal bekam er Probleme beim Sprechen, nicht so bedrückend, wie er sie als Kind verspürte, doch noch genug, um ihn zu ängstigen.
Diesmal setzte er aber eine wirksame Strategie dagegen, die, in dem er Prioritäten setzte. Vorrangig räumte er seinem Ansehen bei seinen Mitschülern die höchste Priorität ein, er wollte keine Blamage mehr erleben! Es war einfacher, die Unterrichtsbeteiligung zu verweigern, sich unwissend zu geben, als sein Ansehen zu demontieren. Die Frage einer Lehrkraft scheinbar desinteressiert zu ignorieren, sich teilweise massiver Kritik derselben auszusetzen, ist allemal leichter zu ertragen, als die Häme der Mitschüler.
Diese zusammen gezimmerte Strategie, auf der einen Seite erfolgreich, hatte als Konsequenz aus der Verweigerung der schulischen Mitarbeit auch merkliche Nachteile für ihn. Er war so damit beschäftigt, diese vermeintlichen hinterhältigen und facettenreichen Angriffe der Lehrkräfte auf seine Person abzuwehren, dass er etwas die Orientierung im Unterricht verlor. Seine schriftlichen Leistungsnachweise waren nicht schlecht, aber auch weit weg davon, sie als gut einzustufen, hervorragend geeignet, um seine Rolle glaubhaft vorzutragen, völlig ungeeignet für die eigenen Ansprüche. Ein Dilemma aus dem er keinen Ausweg fand und mit Blick auf seine gesetzte Priorität, es auch keinen Ausweg gab.
Nachmittags, nach dem Unterricht, war alles wieder vergessen. Die Stadt, ihr pulsierendes Leben, ihre Hektik, gaben ihm die Anonymität und Sicherheit, in der er sich wohlfühlte. Er konnte sie betrachten, die Menschen, ihr Verhalten, ohne sich der Gefahr auszusetzen, selbst beachtet zu werden und unvermittelt im Focus des Interesses zu stehen. Ein pures Wohlgefühl zwischen Currywürsten, stinkenden Autos und stillosen Zweckbauten einer an sich seelenlosen Stadt.
Umgarnt von all den neuen Erfahrungen und Möglichkeiten, kam nie Langeweile auf. Sie hatten daher auch keine Zeit für persönliche Streitereien oder gar zeitraubende Schulaufgaben. Unbeschwerte Tage und Wochen folgten, etwas eingetrübt von dem ewigen Problem leerer Kassen und der Hausordnung des Wohnheims, wegen des nächtlichen Torschlusses für Minderjährige, die sie nun mal waren.
Diese Widernisse konnten ihr Lebensgefühl nicht ins Wanken bringen. Kindlich unbekümmert, ohne belastende Verantwortung und drückende Verpflichtung, das würde die größten Vorzüge der drei am besten beschreiben. Eine einmalige Zeit im Leben eines jungen Menschen. Keine drückende Verantwortung lastet auf den Schultern, die Freiheit träumend zwischen Realität und Fantasie mit fließenden Grenzen zu leben, die Tage einfach verrinnen zu lassen, sich der realen, nüchternen Welt entziehen. Frei von jeder Kontrolle einer mürrischen Mutter oder eines penetrant korrekten Ausbilders, keine ständige Erinnerung an die beschissene, traumatische Kindheit, was für ein herrliches Gefühl!
Diese Sache musste ja einen Haken haben, hatte sie auch, den, dass diese Glückseligkeit nach sechs Wochen endete und sie sich erst nach Ablauf eines Jahres wiederholen würde. Das Prinzip Hoffnung könnte die Zeit schon verkürzen, er vertraute darauf, doch es war einer der ersten wehmütigen Abschiede, die er erlebte, nur vergleichbar mit solchen, wenn er als Kind nach den Ferien, die er öfters bei seine Oma verbringen durfte, wieder in seine persönliche Hölle, nach Hause musste.
Seine Oma, er überlegt, wer sie war, es fällt ihm schwer, in seinen Gedanken eine Vorstellung von ihr zu projizieren. Er fühlt dabei nichts Besonderes, das ist verwunderlich, da er doch so gerne die Ferien bei ihr verbrachte. Gut, sie ist schon zwanzig Jahre tot, aber da müsste doch noch etwas sein, eine gefühlte Erinnerung, ein Bild von ihr. Unklare, verschwommene Erinnerungsfetzen, das ist alles, was von ihr geblieben ist.
Was an Erinnerung jedoch nie verlöschen wird, ist ihre Kochkunst, legendär und unerreicht. Sie konnte einfach kochen! Maultaschen, Dampfnudeln, ein Gedicht, eine Offenbarung für jede schwäbische Seele. Dampfnudeln mit krossem Boden, der Hefeteig hoch und prall aufgegangen, locker und leicht. Der markante Duft dieses Teiges, harmonisch vermischt mit dem einer warmen Vanillesauce, himmlisch!
Es gab aber noch eine Steigerung: ihre Maultaschen. Die Nachkommen versuchten sie oft zu kopieren, ein unnützes Bemühen, nie wieder hat irgendjemand sie so gut zubereitet. Wer es auch immer versuchte, es wurde nur ein mehr oder weniger guter Abklatsch ihrer Kochkunst. Eine aufwändige Rezeptur, stundenlange Vorbereitung für ein zwanzig minütiges Essen, wenn es denn lange dauerte. Gieriges Schlingen, der Ehrgeiz, sich möglichst viel dieser Götterspeise einzuverleiben.
Wer behauptet denn, dass man beim Schlingen keinen Genuss empfinden kann? Ein Geschmackserlebnis empfindet man nicht nur beim genüsslichen Kauen, auch das permanente Nachstopfen solch delikater Maultaschen in die Futterluke ermöglicht eine intensive Gaumenfreude, solange nur der Nachschub gesichert ist. Dies führt dann zu einem weiteren, wenn auch nicht sehr edlen Empfinden, dem Futterneid. Langsames, betont genussvolles Essen würde doch dazu führen, dass anwesende Mitesser von dieser Marotte profitierten. Dies galt es, wenn solche vorhanden waren, zu verhindern.
Nach einem Gelage von zwei Enkeln gleichen Gedankengutes, einer davon war er, ließ sich die Oma zu der Bemerkung hinreißen, „Ihr esst nicht mehr, ihr fresst wie die Sauen“. Keine Ahnung, was sie störte, es waren doch nur neunzig Stück, von diesen so zehn mal zehn Zentimeter großen Maultaschen, und das zu zweit. Sie hat ja auch fünf davon gegessen. Später wollten wohl noch andere Enkel und Kinder zum Essen kommen, später, eben zu spät. Fleischbrühe war noch übrig, dazu hat sie dann noch Suppennudeln abgekocht. Seiner Meinung nach war das gut genug für die bucklige Verwandtschaft.
Die Oma zog sieben Kinder groß, darunter auch seine Mutter, es war immer Leben in ihrem kleinen Siedlerhäuschen. Der Opa starb schon früh, er kannte ihn kaum. Es gab immer nur die Oma, ein Pol um den sich alles scharte, ihre noch zu Hause lebenden, jüngeren Kinder und in den Schulferien die zahlreichen Enkel. Vor seiner Schulzeit muss er auch längere Zeit dort verbracht haben, er weiß es, kann sich aber nicht mehr daran erinnern. Die Erinnerung an die Oma beginnt mit seiner Schulzeit, und den Ferien, die er dann teilweise bei ihr verbringen durfte.
Dieses kleine, verwinkelte Siedlerhäuschen war vollgestopft, gar überladen mit allerlei Hinterlassenschaften der großen Familie. Stundenlang konnte er in den leeren Zimmern stöbern, vom Dachboden bis in den Keller, fand immer wieder neue interessante Dinge. Ein Luftgewehr, Werkzeuge, Romanhefte, Comics, Briefmarken, Bilder. Verstaubt, in Schränke gepresst schlummerten sie dort, um von ihm entdeckt zu werden.
Er schlich sich oft in diese Refugien, leise, um ungestört seiner Neugier zu frönen. Den Geruch dieser Räume kann er heute noch herholen, muffig, ein Sammelsurium aus eigenartigen Aromen der vielen, jahrzehntelang abgelegten und vergessenen Gegenstände. Damals war es bei der Oma wie im Paradies schön, er fühlte sich dort wohl und hoffte manches Mal, seine Eltern würden ihn nie wieder abholen und nach Hause bringen.
So fühlte er auch, als die Schule endete, und er wieder zurück musste. Die menschliche Empfindung ist schon eine eigenwillige Konstruktion. Vor Monaten war die Lehrstelle noch der Quell eines neuen Lebensgefühls, doch schon nach dem kurzen, beeindruckenden Aufenthalt in der Stadt, empfand er die Existenz in der gewohnten Umgebung als deprimierende Tristesse. Nur unterteilt in die Zeit der Arbeit, die sich durch ständige Anforderung etwas kurzweiliger gestaltete, und die langweilige, öde Freizeit zu Hause.
Einerseits eingezwängt zwischen der ständig nörgelnden Mutter, dem oft nur körperlich anwesenden Vater, dem nervigen, verzogenen Balg von Schwester und andererseits den einseitigen, öden Vergnügungen eines dreitausend Seelen Dorfes mit Sportverein, ein paar Gaststätten und ehemaligen Mitschülern, mit denen ihn nicht viel verband. Er fühlte sich in dieser Umgebung ausgeschlossen von dem, was draußen geschah und es geschah viel in dieser Zeit. Sicher, er war auch in der Stadt nicht aktiv daran beteiligt gewesen, doch er hat sich dort weitaus näher am Puls der Ereignisse gefühlt, wie in diesem Dorf.
Die meisten Menschen, die da wohnten, jedenfalls die, die er kannte, kümmerte es nicht groß, was außerhalb des Dorflebens geschah. Irgendwie waren sie wie fröhliche, naive Kinder, was sie auch so belassen wollten. Probleme außerhalb ihrer Person und direkten Umgebung, existierten nur schemenhaft oder abstrakt. Sie lehnten sich an die politische und gesellschaftliche Ideologie ihrer Vorfahren und Väter an, die in der letzten Konsequenz immer die Obrigkeit achtete und alles Störende ablehnte, war ja auch viel einfacher so..
Auch die Jugend beschäftigte sich überwiegend nur mit dem Mikrokosmos ihres direkten Umfeldes. Musik, Saufen, Mädchen, Frauen, Dorfklatsch, in austauschbarer Reihenfolge, so, wie es der Zufall gerade vorgab. Erfolge in diesen Disziplinen brachten kurzzeitig Ruhm und Ehre, wobei das Saufen als Schlachtfeld der Ehre, einen ungefährdeten Spitzenplatz einnahm. Mit den Mädchen war es etwas komplizierter, da gehörten dummerweise zwei dazu, was die Sache enorm erschwerte. Die Erfolgsmeldungen fielen da etwas spärlich aus, objektiv bewertet, fast nicht erwähnenswert.
Blieb noch die Musik. Blechmusik, im Kollektiv gespielt, in untrennbarer Verbindung mit dem Genuss größerer Mengen Alkohol, was nach einigen Stunden alko- blechmusischer Mühen das Problem mit den Mädchen nicht unbedingt vereinfachte.
Das Antrinken von Mut, führte unter Nichtbeachtung einer fließenden Verträglichkeitsgrenze des Genussmittels zum Vollrausch, in dessen Folge dann zum Gegenteil dessen, weshalb sich die Künstler den Mut antranken. In Ermangelung einer weiblichen Begleitung, die sich die Blamage einer volltrunkenen Begleitung ersparen wollte, wurde der Heimweg dann wieder in der Gemeinschaft spät pubertierender Schwachköpfe angetreten, so, wie sie gekommen waren.
Das war nicht seine Welt. Die Musik vergällte ihm einmal gründlich der Leiter des Schulchors. Dieser Dorf-Karajan und Rektor der Schule, identifizierte aus zwanzig Schülern gerade ihn als denjenigen, der durch seine falschen Töne den Wohlklang von zwanzig pubertierenden Stimmen störte. Er durfte sich nach dieser Bloßstellung in eine Bank setzen und malen. Die Deppen sterben nie aus!
Als nun offiziell ausgewiesener Nichtmusiker, war ihm dann auch der Zugang zum Musikverein erschwert. Er versuchte es erst gar nicht. Dumm war danach nur, dass er später auf diesen Veranstaltungen musikalischer Offenbarung nur zweite Wahl war, kein umjubelter Auftritt im Scheinwerferlicht mit einem blitzenden Instrument in der Hand! Ihm blieb nur die Rolle des Zuschauers und als Trost noch der Konsum von Alkohol, was unter Berücksichtigung der vorab erwähnten Probleme, keine rechte Begeisterung aufkommen ließ.
Die Mädchen, ausgenommen die, deren Anblick man durch Alkohol in ein gefälligeres Licht rücken musste, gefielen ihm schon gut. Sein Problem war nur, dass sie ihn alle gut kannten, ihn, den Stotterer. Die Jahre der Schulzeit ließen sich nicht vergessen machen. In diesen Kreisen war er chancenlos, das glaubte er wenigstens.
Vielleicht begeisterte er sich auch nur für die falschen Mädchen, genau für die, die ihn ignorierten, ihn allenfalls peinlich fanden. Für die anderen Mädchen hatte er kaum einen Blick übrig. Es mussten schon die allseits bekannten Dorfschönheiten sein, die anderen stellten ja auch ein Zumutung dar, fand er und musste vorerst mit den Konsequenzen dieser Ansichten leben.
Der Hoffnungslosigkeit seiner Situation bewusst, zog er sich so nach und nach, ziemlich frustriert, aus dem Dorfleben zurück. Sein neues Selbstverständnis, sein Selbstvertrauen, entstanden aus dem Neuen, das er kennen lernte, konnte nicht in die Mentalität der Dorfjugend eindringen. Die Entfremdung zu dieser Gemeinschaft war spürbar, zwar war er ohnehin nie innig mit ihr verbunden, doch es war bisher ein Teil seines Lebens.
Was sollte er tun? Das hier waren doch seine Wurzeln! Paralysiert wie ein Kaninchen, das den Biss der der Schlange erwartet, ließ er die Dinge auf sich zukommen. Gab es eine Lösung, einen Platz für ihn, auf dem er eine Rolle im Scheinwerferlicht spielen konnte? Er fühlte sich wieder einmal hilflos, machtlos, dem ihm anscheinend nicht sehr wohlgesonnenen Schicksal ausgeliefert. Die Glanzpunkte der vergangenen Monate relativierten sich angesichts der Realität der Gegenwart. Hier konnte er nicht bleiben, wo auch immer sein Platz war, hier war er bestimmt nicht.
Das Ausschlussverfahren zur Problemlösung, unter Berücksichtigung der Gegebenheiten, gestaltete sich einfach. Vergangenheit und Gegenwart waren als Grundlage des weiteren Lebens höchst ungeeignet, was blieb war die Zukunft, die Bewegung in die Zukunft. Nicht festhalten an Gegenwärtigem! Die Begriffe Heimat, Herkunft verloren für ihn ihre ideelle Bedeutung. Er wollte in die Welt zurück, in die Welt des gesellschaftlichen und politischen Lebens und deren Lebendigkeit und Veränderung.
So einfältig diese Vorstellungen auch sein mögen, sie zeigten ein Ziel auf und brachten damit eine gewisse Zuversicht in seine Zukunft zurück, aber auch die Erkenntnis, dass er seine persönliche Identität an anderer Stelle suchen musste. Wo das sein sollte, da hatte er keine konkreten Vorstellungen. Er wollte nur irgendwo, irgendwie seinen Platz finden. Dieser gedanklichen Konstruktion lag im Bereich seiner physischen Mobilität ein grundsätzlicher Denkfehler zugrunde, er war sechzehn Jahre alt, und in diesem Alter ist man etwas immobil.
Bewegen kann man sich auch geistig, es ist zwar lange nicht so aufregend, doch es ist besser als nichts zu tun. Aktualität über die Medien erlebt, vermittelt auch ein Gefühl des Dabeiseins. Es war damals alles in Bewegung, in Aufruhr. Die starre Gesellschaft der ewig Gestrigen wehrte sich mit Händen und Füßen gegen die längst überfällige Erneuerung ihrer Strukturen. Diese Forderung passte nicht in ihr naiv dümmliches Bild von einem starken Staat samt allmächtiger Obrigkeit und allgegenwärtiger, verlogener Moral.
Die Antipathie gegen solches Denken konnte er auf keine konkrete Erfahrung zurückführen. Es entstand aus dem Resümee seines bewussten Erlebens und dessen Bewertung bis dahin und dem ersichtlichen Unrecht der Mächtigen von gestern und heute an den Menschen. Die Unfähigkeit dieser Institutionen, human zu agieren und letztendlich aber auch das gedankenlose Abnicken jeglicher, denkbarer Inkompetenz durch das Volk, entsetzten ihn.
Inmitten des kalten Krieges, der Auseinandersetzung zweier verblendeter Ideologien, fand er keine politische Heimat, seine gefühlte Sympathie war jedoch stark linkslastig. Nicht, dass er mit den roten Machtblöcken dieser Welt sympathisiert hätte, diese diskreditierten sich schon durch die Unterdrückung ihrer eigenen Bevölkerung, nein, er fand die Ideen der Erneuerung, der Befreiung im eigenen Land beachtenswert und die entstammten nun mal dem linken Lager. Und diese Ideen, so wirr und so konträr, dass sie sich teilweise selbst im Weg standen, beeinflussten seine politische Meinung nachhaltig.
Die Protestbewegung mit all ihren Aktionen, ob nun sinnvoll oder moralisch richtig, was immer in der Sicht des Betrachters liegt, war ein Kampf einer wachen Gesellschaftsschicht gegen einen starren, übermächtigen Staatsapparat. Die Institutionen von Politik und Verwaltung verfügten nur über ein Mittel dagegen, Gewalt, wie sie es von jeher gewohnt waren, ausgeführt von meist begeistert prügelnden Polizisten, die so ihre Abneigung gegen langhaarige Intellektuelle ausdrucksstark zur Geltung brachten. Sie begriffen nicht, dass diese Menschen und deren Anliegen ihnen doch näher stehen sollten, als die Gesinnung ihrer Auftraggeber. Diese geprügelten, subversiven Elemente konnten seiner ungeteilten Sympathie sicher sein. Das Bemühen der Presse, die Proteste so zu positionieren, dass sie einen staats-, gar gesellschaftsfeindlichen Touch bekamen, beeindruckte ihn nicht weiter.
Eine erste Weiche in seinem neuen Leben war gestellt, die Solidarität zu allem und jenem, was dem Gutdünken einer Übermacht ausgesetzt war. Übermacht, Macht nährt sich aus der Ohnmacht der Machtlosen, sie dient nur sich selbst und ihrer Erhaltung. Diese Erkenntnisse waren zwar bewegend, doch das Einerlei seines Lebens schien sich davon wenig beeindrucken zu lassen.
Die eintönige Abfolge von Arbeit, trister Freizeit, trostlosen, trüben Sonntagen, war und blieb die Regel im Ablauf dieser Zeit. Unterbrochen von zwei, drei Urlaubsreisen mit verbliebenen Schulfreunden, in denen sie trampend mit Zelt und Schlafsack die nahe Schweiz bereisten, um dann meist bereits nach einer Woche, verdreckt, übel riechend und völlig pleite zurückzukehren. Es waren aber immer ganz unbeschwerte, schöne Tage.
Er fühlte sich immer unbeschreiblich wohl im Fluss des Reisens, der Bewegung, eingetrübt nur durch die absehbare, unvermeidliche Rückkehr. Dies fühlte er auch auf seinen früheren Ferienreisen so, die er in Obhut der katholischen Jugend in den Bergen verbrachte. Begeistert bei der Anreise, den Wanderungen, sogar an tristen, verregneten Tagen, die im Ferienheim verbracht werden mussten. Die Rückfahrt, die Rückkehr nach Hause, empfand er damals schon fast als körperlichen Schmerz.
Alles, was den Alltag auflockerte, nahm er dankbar an. Ein Praktikum bei einer Baufirma, ein Teil seiner Ausbildung, stand nun an. Eine geeignete Stelle im Straßenbau fand er in Zeiten der Hochkonjunktur schnell. Begeistert, in enger Verbindung mit Unsicherheit und Angst, wie immer, wenn sich etwas Neues auftat, stand er an einem Montagmorgen um 4:30 Uhr bei einem vereinbarten Treffpunkt, wo ihn ein Firmenbus abholen würde.
Früh aufstehen war er gewohnt, doch dieser Zeitpunkt verlangte schon einige Überwindung. Der Bus kam, er stieg ein und das Wort Überwindung bekam eine völlig neue Bedeutung. Als Begrüßung hörte er ein undeutliches mürrisches „ Morgen“, deutlich überlagert von einer nicht eindeutig definierbaren Duftwolke, die ihm aus dem Innern des Busses entgegen schlug,. In dem voll besetzt Bus rückten die Arbeiter etwas widerwillig zusammen, er zwängte sich dazwischen, der Bus fuhr weiter, noch ehe er saß.
Er wusste nicht, was er zuerst beachten sollte, das Sammelsurium an beeindruckenden Charakterköpfen oder den bestialischen Gestank, der den dazugehörenden Körpern entwich. Übelkeit stieg in ihm hoch. Vor einigen Minuten erfrischte ihn noch die kühle, reine Luft eines Sommermorgens, und dann das! Unbeschreiblich, diese Mischung aus anal und oral entweichenden, akustisch unterstrichenen Gerüchen. Die wegen der kühlen Morgenluft geschlossenen Fenster im Bus sorgten für einen unverfälschten Genuss.
Die übrigen Insassen schien das alles nicht übermäßig zu stören. Einzig der Fahrer kommentierte allzu laute Geräusche mit einem deftigen „alte Drecksau“, was anscheinend dem üblichen Umgangston entsprach. Er traute sich nicht auch nur einen Ton zu sagen. Fast ängstlich hoffte er, dass sie ihn nicht beachteten würden, und er hatte Glück. Außer der Frage nach seinem Namen, schien seine Person nicht von Interesse zu sein.
Die spärliche Unterhaltung der Insassen ergoss sich in knappen, rustikalen, ordinären Feststellungen, die keine Antwort verlangten. Er überstand die Fahrt ohne zu kotzen. Was für eine Wohltat, als die Baustelle erreicht war. Der Fahrer, als solcher eine Autorität innerhalb der Fahrgemeinschaft, übergab ihn mit unverständlichem Gemurmel an den Vorarbeiter der Baustelle.
Gottfroh, diesem Inferno unbeschadet entgangen zu sein, musste er erst einmal tief durchatmen. Der Vorarbeiter, beschäftigt mit der Einteilung der Arbeit, beachtete ihn kaum, so blieb ihm Zeit, sich umzuschauen. Imponierend, was er sah, riesige Maschinen, die sich unter ohrenbetäubendem Lärm in Bewegung setzten, ein prägnanter Geruch von Abgas und Diesel lag in der Luft. Der Boden vibrierte unter den sich in Bewegung setzenden, gigantischen Baumaschinen. Die Eindrücke waren überwältigend.
Etwas entrückt stand er lange da und überlegte, etwas resignierend, was er hier auf dieser riesigen Baustelle wohl arbeiten könnte. Es war ein Straßen Neubau mit enormen Erdbewegungen, tiefen Einschnitten und hohen Auffüllungen im Gelände. Was konnte er hier tun, sollte er den ganzen Tag den Vorarbeiter begleiten, der ihn seit geraumer Zeit nicht mehr wahr zu nehmen schien?
Als der Lagerplatz sich leerte, fiel seine Anwesenheit auf. Wo konnte man dieses überflüssige Subjekt, am wenigsten störend, abstellen? Mit Schaufel und Pickel ausgestattet, fuhren sie ihn dann an einem entfernten Ort, ganz am Rande der Baustelle. Dort arbeitete ein kleinerer Bagger und hob einen Graben aus. Die Arbeit war einfach. Nacharbeiten, was die grobe Baggerschaufel nicht bewerkstelligen konnte, und immer darauf zu achten, von eben dieser Baggerschaufel nicht beschädigt zu werden.
Es gab viel zu staunen an diesem Tag, einem langen Arbeitstag, der von 4:30 Uhr bis um 19: 30 Uhr dauerte. Drei Pausen unterbrachen die Arbeit, die in der eigens dafür vorgesehenen Kantine, einem Bretterbau, ausgestattet mit Bierbänken und Tischen, großen Kühlschränken und einigen Kochplatten, verbracht wurden. Ein älterer Mann, oder sah er nur so alt aus, mit kleinen, angeschwollenen Augen, welker Gesichtshaut und zitternden Händen, hatte hier die ungemein wichtige Aufgabe, die Getränke, in der Regel Bier, kühl zu halten und zu verkaufen.
Unmengen von Bier. Der Praktikant staunte, konnte es nicht fassen, welche Mengen da durch die durstigen Kehlen, in die sichtlich nach vorn erweiterten Auffangbehälter der Arbeiter flossen. Zwei bis vier Flaschen Bier zum Vesper, um neun Uhr morgens, egal, welcher Beschäftigung die Konsumenten nachgingen, Fahrer von überdimensionale Muldenkippern, Bagger- oder Raupenfahrer, sie alle zeigten da keine Schwäche. Der alte Mann hatte viel zu laufen. Rüde Bestellungen ungeduldiger Männer, er hatte alle Hände voll zu tun, um den Anforderungen gerecht zu werden. Sein Kopf wurde rot, Schweißperlen zeigten sich auf seiner Stirn, die Hände zitterten so, dass er Mühe hatte, die Flaschen zu öffnen.
Nach dem Abflauen der Bestellungen saß er erschöpft und müde auf einem Stuhl. In diesen Minuten der Ruhe frönte er seiner Leidenschaft, Schnupftabak in größeren Häufchen, geräuschvoll von der Öffnung seiner Nüstern in Richtung Großhirn zu ziehen um dann nach einiger Zeit diesen Vorgang in umgekehrter Richtung zu wiederholen. Mit Geschick und in einigermaßen nüchternen Zustand schaffte er es, die zurückfließende braune Brühe in ein Stoff Taschentuch zu leiten. Er war ein Faktotum mit geringem Ansehen, ein lebendes Inventar der Firma, geduldet, und doch an einer Schlüsselposition, der Getränkeausgabe.
Für ihn, den Praktikanten war das, was er da sah, faszinierend. Derb, grob, rau und er mittendrin. Die Tage liefen dann auf ihre Art gleichmäßig ab. Verbale Streitereien wechselten sich mit Handgreiflichkeiten oder einträchtigem Saufen ab, je nach dem, mit welchem Fuß die Männer morgens aufgestanden waren. Die Tage waren heiß in diesem Sommer, der Durst groß, die Aggressionen, wenn sie zu Tage traten, entsprechend heftig.
Es ließ sich gut und ohne Probleme auf dieser Baustelle arbeiten. Die Arbeiter akzeptierten ihn, entweder aus Geringschätzung oder aus der Befürchtung, er könnte irgendwann als Ingenieur zurückkehren und es ihnen heimzahlen. Er gewöhnte sich an den Gestank im Bus, es würgte ihn wenigstens nicht mehr, an das ordinäre, teils saudumme Gerede, sowie an den auf der Rückfahrt regelmäßig angetrunkenen Fahrer. Dessen Konstitution musste er irgendwie bewundern, er hätte mit dieser Menge Alkohol im Blut wohl die Besinnung verloren.
Eine ausgefüllte und ruhige Zeit. Nach täglich vierzehn Stunden Arbeit brachte ihn nichts mehr aus der Fassung. Keine Mutter, keine Schwester, keine langweiligen Wochenenden belasteten ihn, er fühlte sich nur müde, erschöpft und zufrieden. Gott und die Welt interessierten ihn nicht mehr sonderlich.
In dieser fast archaisch anmutenden Welt fand er Geborgenheit und Ruhe. Es gab eine einfache Erklärung dafür; da er in gewisser Weise keiner Hierarchie unterworfen war, musste er sich außer der körperlichen Arbeit, mit keinem psychischen Stress, keinen Ängsten vor Versagen, vor Fehlern, vor Angriffen auf seine Person plagen. Dann waren auch die Tage ereignisreich und kurzweilig, keiner verging ohne irgendeine Aufregung. Baumaschinen fielen aus und legten für Stunden den Betrieb lahm, kleinere und größere Unfälle, Proteste von aggressiven, nicht mehr ganz nüchternen Arbeitern gegen die Schinderei der langen, heißen Arbeitstage und er mitten drin, er gehörte dazu.
Hätte er die Zeit anhalten können, er würde wahrscheinlich heute noch träumend auf diesen staubigen Baustraßen auf und ab gehen und eine dieser Melodien aus Liedern, die von Freiheit und Abenteuer handeln, summen. Die so erlebte Realität und diese ergänzenden Illusion weckten da erstmals seinen Wunsch nach einem Leben in der Fremde, nach Abenteuer und Freiheit, ein Traum, getragen von seiner Phantasie und dem grauen Alltag.
Jede schöne Zeit geht einmal zu Ende und so fand er sich nach ein paar Wochen hinter seinem Schreibtisch in Amt wieder. Die Begeisterung darüber hielt sich in den ersten Tagen sehr in Grenzen. Die gedämpfte Atmosphäre in den Büros, versteckte Intrigen und Animositäten, beherrschte, fast emotionslose Kollegen, das kam ihm schon nach der kurzen Zeit seiner Abwesenheit etwas fremd vor. Auch vermisste er die Ausnahmestellung als Praktikant. In dieser Welt war sein Platz klar definiert: er war der Lehrling, der Geringste der Geringen.
Seine Stellung war weder gut noch schlecht, doch seine Meinung, falls er sich traute, sie zu äußern, wurde allenfalls wohlwollend ignoriert. Nur stand er sich jetzt einen höheren Wert zu als früher und begann sich gegen die Dienstgrad bedingte Dominanz der Kollegen aufzulehnen. Natürlich vorerst still für sich, so ganz sicher war er sich doch nicht, ob er da wirklich dagegenhalten konnte. Intellektuell fühlte er sich durchaus zum Mitreden berufen, doch das Stottern meldete sich immer wieder zurück, was dann manchmal zu peinlichen Situationen führte.
Seine Meinung nicht artikulieren zu können, eine bekannte, wenig erfreuliche Situation. Instinktiv vermied er die Situationen, die ihn in Gefahr bringen konnten. Er blieb der kritische Zuhörer und Beobachter, vermied Äußerungen in der Gruppe, zog den Dialog mit einzelnen Personen vor. Zuhören und beobachten brachten ihm aber unschätzbare Erkenntnisse über seine Mitmenschen, ihre intellektuellen Fähigkeiten und ihre oft selbstgefällige Moral.
Profiliersüchtige Egoisten mit allerlei Halbwahrheiten ausgestattet, diese fatale Kombination führte oft eine Diskussion ins Absurde. Dann boten sie ein Bild des Jammers, diese biederen Lichtgestalten der Mittelschicht, alles und doch nichts wissend, Treibgut im Strom von angepassten Meinungen und politischen Mehrheiten. Einige Ausnahmen, sehr dünn gesät, aber doch vorhanden, blühten meist im Verborgenen. Das Bedürfnis, der kollektiven Dummheit zu widersprechen lag vielleicht nicht in ihrem Interesse, oder es fehlte ihnen der Mut, sie gaben ihre Gedanken, ihr Wissen selten preis.
In dieser Zeit geriet seine Duldung von Autoritäten in eine noch tiefere Krise. Bis dahin akzeptierte er sie, seien es Eltern, Lehrer, Pfarrer oder Chefs, er duldete diese Menschen mit einer Leitfunk-tion. Er sah die Autorität als Sache im Konsens von Leiten, Ordnen zum Ablauf aller lebensnotwendigen Vorgänge, als erforderlich an. Dies stellte er auch weiterhin nicht in Frage, jedoch die Personen, die diese Autorität verkörperten wurden zur Zielscheibe seiner Kritik.
Die wohlwollendste Definition von Autorität wäre die: Personen mit einer starken Persönlichkeit, einem hohem Ansehen und hervorragenden fachlichen Kenntnissen. Das stellt so etwas wie ein charakterlicher oder fachlicher Selbstläufer dar, ein gedachtes Ideal. Dass diese märchenhafte Auslegung ein Wunschtraum ist, liegt in der Natur des Menschen, der selten in der Lage ist, solche Ideale zu beleben.
So muss man diese Definition der Realität anpassen und feststellen: Autorität wird von autoritären Personen verkörpert, die die Welt und ihre Mitmenschen aus einem rigiden machtorientierten Blickwinkel betrachten. Sie verhalten sich meist rücksichtslos gegenüber Untergebenen, ihr Verhalten gegenüber Höhergestellten ist devot, unterwürfig, was sie in gleicher Reihenfolge von ihren Untergebenen erwarten. Ein bewährtes System, seit Menschengedenken auf Herz und Nieren getestet und für gut befunden.
Auch sein bis dahin zwangs- geachteter Ausbilder, der stramme Ex-Offizier, fiel bei akribischer Beobachtung seines Verhaltens gegenüber Vorgesetzten und Untergebenen in diese Kategorie der realen Definition von Autorität. Konnte er diesem Menschen Achtung, gar Respekt zollen? Einem Menschen, der um seines Vorteils willen gelegentlich sämtlichen Stolz und Würde außer Acht ließ, der geäußerte Meinungen gänzlich revidieren konnte, wenn sich diese als nicht konform mit den Ansichten seiner Dienstherren erwiesen. Der willig jede Laune seiner Oberen als Durchlaufposten an seinen Untergebenen weiterreichte. Vorbilder stellte er sich anders vor. Wie Vorbilder gestrickt sein sollten, das abstrakte Ideal einmal außer Acht lassend, wusste er nicht, er kannte ja nun, bei kritischer Betrachtung des vorhandenen Angebotes, keine mehr.
Der Mangel an präsenten Vorbildern oder Autoritäten im besten Sinn, bergen gewisse fundamentale Probleme in der Entwicklung eines jungen Menschen. Der Ideologie einer aufbegehrenden Generation, die alles Autoritäre prinzipiell ablehnte, konnte er theoretisch einiges abgewinnen, mit den idealisierten Vorbildern dieser Weltanschauung hatte er aber seine Probleme. Bei näherem Betrachten zeigten sie alle einen eklatanten Mangel auf, einen rücksichtslosen autoritären Charakter oder weltfremde, unrealistische Ideen. Sie waren allesamt höchstens als Gegenpol zu ihren ideologischen Pendants der Gegenseite zu verwenden.
Menschen, die sich selbstlos in den Dienst einer gerechten Sache stellen, sind rar und wenn sie näher betrachtet werden finden sich zahlreiche Leichen in ihren Kellern. Er dachte die Reihen von internationalen Persönlichkeiten durch, Nelson Mandela, Mahatma Gandhi oder Martin Luther King, der vor kurzem ermordet wurde. Gewaltlosigkeit hatte schon etwas beeindruckendes, aber auch etwas Demütiges an sich. Er fand keinen rechten Zugang zu dieser Philosophie.
Siegertypen, ehrlich, aufrecht, gerecht… er fühlte selbst, dass er ins Absurde abglitt. So schön beruhigend inspirierende Fantasie auch sein kann, einer Lösung brachte es ihn nicht näher.
Jesus als Vorbild, na ja, wenn seine Nachfolger nicht wären, spräche sicher einiges für diesen Typ. Nur dieser Begriff „christlich“ war im Laufe der Geschichte mit so vielen Schrammen und Beulen verunstaltet worden, dass man nicht mehr recht erkannte, für welche Moral dieser Begriff eigentlich stand.
Zu gut konnte er sich noch an den Religionsunterricht seiner Schulzeit erinnern. Er bekam in diesem Fach immer gute Noten, wahrscheinlich weil er nie störte und den Mund hielt. Wenn er ein „Kindlein“, das „Jesulein“ schön in Farbe malte, oder durch regelmäßigen Besuch der Gottesdienste dem Pfarrer auffiel, bekam er ein Fleißbildchen, so ein Scheiß!
Christlich, Kirche, Pfarrer, Vikar, Nonnen, Bischof Papst, nein danke. Das waren alles Begriffe, die negative Gefühle zuließen, sei es aus eigenem Erleben oder auch durch eigenes analysieren der Widersprüchlichkeit dieser Spezies. Außerdem war es absolut nicht zeitgemäß, seine politischen Denkstrukturen in einen Kontext zur christlichen Lehre zu stellen. Das war ihm zu kompliziert, es waren zu viele Differenzen vorhanden, die seine damaligen, intellektuellen Fähigkeiten überforderten.
So wurden die Fronten wenigstens nicht verwischt und wenn schon keine Vorbilder vorhanden schienen, dann wenigstens klar definierte Feindbilder. Diese betrachtete er recht unbekümmert und da sie seiner Meinung nach nicht zum Vorbild taugten, konnten sie, logischer Weise, als Gegner betrachtet werden. Der Einfachheit halber überprüfte er diese Denkoperation nicht explizit, das hätte nur Verwirrung gestiftet und die Sache verkompliziert.
Die Konsequenz seiner Klassifizierung verwirrte ihn zuletzt dann doch etwas, es stellte ein eklatantes Ungleichgewicht zwischen schwarz und weiß dar. Grautöne hatte er nicht berücksichtigt, wurden sie doch ebenfalls negativ bewertet. Die Menschheit schien sich, als Resümee dieser einfachen Analyse, überwiegend aus Arschlöchern zusammen zu setzen. Diese grundsätzliche und prägende Orientierung vollzog sich ohne präzises Hintergrundwissen von gesellschaftspolitischen oder sozialen Zusammenhängen. Das sogenannte Bauchgefühl brachte dies zu Wege, und rückwirkend betrachtet, war er gut beraten damit.
Nur zeigte sich diese Ausrichtung leider nicht richtungsstabil. Waren bis gestern ein Bundeskanzler Kurt Georg Kiesinger, ein Finanzminister Franz Josef Strauß, auf Grund ihrer früheren und späteren Verfehlungen, als Repräsentanten der Regierungsgewalt, klare Unpersonen, so verlangte der sozial- liberale Regierungswechsel zwangsweise ein Umdenken. Die Absichten des neuen Kanzlers Willy Brand machte eine klare Abgrenzung zu den Machthabern und deren Klassifizierung schwierig. Das Bekenntnis zum gesellschaftlichen Wandel, inneren Reformen, und letztendlich mehr Demokratie, ohne Scheu vor Experimenten. Das hörte sich fast so revolutionär an, wie die Thesen der APO, es erweckte zumindest Hoffnung.
Ob er diesen Bekenntnissen Glauben schenken konnte, wusste er nicht. Doch standen die Begriffe Freiheit, Reformen, mehr Demokratie und Wandel wie leuchtende Sterne am trüben Himmel deutscher Politik. Proklamiert von einer Person, die über die Macht verfügte, diese Ideen zu realisieren, das hörte sich doch gut an. Er beschloss, seine Antipathie gegenüber der Regierungsgewalt vorläufig auf Eis zu legen und abzuwarten, was an Veränderungen kommen würde.
Seine Sympathie für alles Gedankengut aus dem Lager der Außerparlamentarischen Opposition bestand unabhängig davon weiter, sowie auch das differenziertes Verhältnis zur Staatsmacht. So ganz traute er der Geschichte nicht, er glaubte nicht recht daran, dass allein visionäre Gedanken diesen Sumpf an Ignoranz und Gleichgültigkeit wirklich begehbar machen konnten.
Doch wenn daran auch Zweifel angebracht schienen, so war dieser neue Kanzler doch eine Lichtgestalt unter den zahlreichen Gestrigen, die der Politik und Gesellschaft ein so verlogenes Gesicht gaben.
Er befürchtete jedoch, dass diese alten Seilschaften in Politik und Verwaltung eine größere Dominanz besaßen, als nach außen sichtbar war. Auch schien das alte Gedankengut in der Reihenfolge Ordnung, Gehorsam, Recht noch in einer breiten Mehrheit gedanklich fest verankert zu sein. Freiheit war nachfolgend eingeordnet und dann meist als persönliche Freiheit definiert und selten als Freiheit der anderen, der Randgruppen oder anders artigen Menschen, akzeptiert.
Bestenfalls konnte man die Altvorderen noch als zerrissen bezeichnen. Ihrer alten ideologischen Heimat beraubt, bewegten sie sich stolpernd, mühevoll in die Zeit der ihnen aufgezwungenen Demokratie.
Demokratie, für die Älteren unter ihnen, eine Regierungsform voll Unsicherheit, Not, Elend und politischer Unruhen, die ihnen aus der Weimarer Republik in keiner guten Erinnerung geblieben war. Die Jüngeren der Vätergeneration, ausschließlich geprägt von einem totalitären System, kannten diese Form des politischen und gesellschaftlichen Zusammenlebens nicht. Sie alle beäugten das Geschehen, die Entwicklung, etwas skeptisch.
Sie wollten eine starke Führung, vielleicht sogar einen Führer, oder zumindest den Staat als starke Ordnungsmacht. Sie wollten Regeln, die ihnen ein weitgehend sorgloses, denk- und verantwortungsfreies Leben ermöglichten. Personen oder Gruppen, die diese Ideale in Frage stellten oder in ihren Augen ein Risiko darstellten, diffamierten sie ohne weiteres Nachdenken als abartig.
Egal, wo er zuhörte, sei es unter den Bauarbeitern, den Beamten und Angestellten der Behörde, der Familie und Verwandtschaft, selten fühlte er Offenheit und Toleranz. Überlegungen zu gesellschaftlichen Problemen waren in der Regel zielgerichtet auf Ordnung und Recht fixiert. Was nicht in dieses Raster passte wurde postwendend aussortiert.
Da gab es offizielle Abartigkeiten, die zeitweise sogar Vertretern politischer Parteien öffentlich propagierten, wie Kommunisten, langhaarige rebellische Jugendliche, langhaarige friedliebende Jugendliche, Musik, arbeitslose Faulenzer, missliebige Schauspielerinnen und Schauspieler, kritische Literaten usw.
Hinter vorgehaltener Hand war dieser Kreis noch ausladender. Italiener, die sie im Krieg angeblich verrieten, Widerstandskämpfer und emigrierte Schauspieler, Literaten, welche sie als Verräter oder vaterlandslose Gesellen bezeichneten , Geisteskranke, Behinderte und natürlich, nicht zu vergessen, hinter vorgehaltener Hand, die Juden.
Später noch die, in ihren Augen leider legalisierten, Schwulen und Lesben, Neger, Slawen und weitere Untermenschen, wie noch so vieles andere, was aus früherer Erziehung unauslöschliche Spuren in ihren Gehirnen hinterließ. Als Fazit konnte man feststellen, dass es nicht viel Neues oder Fremdes an Gedanken, Ideen und Menschen gab, das toleriert wurde.
Toleranz würde ja den Abschied von lieb gewonnenen Ansichten und Wertungen bedeuten und zudem die mühevolle Aufgabe, neben einer nur geringfügig vorhandenen rationalen Intelligenz auch sich der noch weniger vorhandenen, emotionalen Intelligenz zu bedienen. Woher nehmen und nicht stehlen? Soll sie doch der Teufel holen! Nun, man würde ja sehen, was die kommende Zeit so bringt. Einen Grund zu großem Optimismus sah er nicht. Es war für ihn auch nicht so sehr von Bedeutung, wie sich die Gesellschaft entwickelte, er fühlte sich als Beobachter und Kritiker, weniger als Akteur.
Ein pragmatischer Zug seines Charakters hielt ihn auf der Spur des beruflichen Weiterkommens. Die dazu notwendige Kooperation mit den ungeliebten Gestrigen war ein notwendiges Übel, doch sie hielten nun mal die Fäden in der Hand. Er war wegen seines Alters und seinen finanziellen Möglichkeiten von zu Hause abhängig. Ein gewaltsames Lösen aus diesem Umfeld erschien wenig sinnvoll und Erfolg versprechend. Vielleicht hatte er auch einfach nicht den Mut auszubrechen, war zu feige, oder so klug, nichts zu tun, was ihm keinen Nutzen brachte. So lief sein Leben seinen geregelten, langweiligen Gang. Die Abwechslungen durch die Schulbesuche in der großen Stadt, verloren in der Wiederholung ihren inspirativen Charakter.
Flexibel, wie man in dem Alter nun mal ist, wechselten die Interessen irgendwann von der Gesellschaftspolitik zum Saufen und den Mädchen. Was auch Sinn machte, da hier ein aktives Handeln möglich war. Die Gene für die Freuden der pubertierenden männlichen Jugend meldeten sich an und wurden sehr begrüßt. Es war sicher nicht das erste Mal, dass er in Kontakt mit Mädchen und Alkohol kam, nur eine solche Anziehungskraft beider Vergnügen war neu.
Bedingt durch seine Vorgeschichte war er wohl ein Spätstarter, mit dem dringenden Bedürfnis, alles in kürzester Zeit nachzuholen. Beginnend mit dem exzessiven Konsum von Alkohol, der einfacheren der Übungen. Bestellen, reinschütten, bezahlen und auskotzen, übergehend zu der etwas diffizileren Disziplin, der Annäherung an das andere Geschlecht. Da er wegen früherer, schlechter Erfahrungen etwas gehemmt war, verlangte dies von ihm immense Überwindung. Doch unter dem übermächtigen Druck erwachter Gene, meisterte er alsbald auch diese Hürde.
Die Mädchen gefielen ihm gut, sie faszinierten mit ihren Figuren, Gesichtern, ihrem Lachen und Schmollen, ihren sanften Stimmen, ihrem Duft. So hatte er sie noch nie empfunden. Gesehen und gekannt hat er schon viele, meistens mit einem faden Beigeschmack, den er durch ihre Ablehnung oder ihr Desinteresse an ihm, verspürte. Zudem trübte noch das unsäglich negative Image der Mutter und Schwester sein Frauenbild nachhaltig ein.
Dennoch begegnete er Frauen und Mädchen mit höflicher Achtung. Gleichberechtigung war keine Frage, wie auch die Wortwahl bei einer Unterhaltung. Mit Chauvinismus, in der ganzen Bandbreite seiner negativen Auswüchse, konnte er nicht aufwarten. Wenn er Ausdrucksweise und Verhalten seiner Kumpels betrachtete, kam er etwas ins Grübeln, ob seine Sicht die richtige war. Versuche, es ihnen gleich zu tun, wirkten bei ihm einstudiert und unnatürlich, sie waren ihm selbst peinlich. Doch anscheinend gehörte eine Prise natürlicher Chauvinismus zum Balzritual und wurde von den Mädchen bereitwillig in Kauf genommen, er bekam den Eindruck, sie erwarteten es sogar. Vielleicht die einzige, übrig gebliebene Darstellungsform männlicher Stärke eines Einzelnen in einer Gruppe von Bewerbern um die Gunst eines Weibchens.
Archaische Formen des Eignungstestes von Kandidaten mit Keule, Speer oder Schwert, waren ja in die Illegalität verbannt und nicht mehr mit derzeitig gültiger Rechtsprechung konform. Der Favorit sollte eben den Anschein erwecken, ein ganzer Kerl zu sein. Nur den Anschein zu erwecken, ist natürlich ein immenser Vorteil für jeden sprachbegabten, selbstbewussten Kandidaten und ein merklicher Nachteil für ihn, dem verkörperten Gegensatz dieser hilfreichen Vorzüge.
Doch es gab eine Lücke im Gefüge dieses Rituals. Um diese zu nutzen musste er nur seine Ansprüche an die Schönheit, die Form und Gestalt des Objekts der Begierde reduzieren. Dies erwies sich als sehr hilfreiche Eingebung. Diesen Ansatz weitergedacht führte zu einer bahnbrechenden Erkenntnis. Es war gar nicht notwendig seine Erwartungen oder Vorstellungen zu reduzieren, man musste nur seinen Blickwinkel verändern und schon sah man die weniger beachteten Mädchen aus einer ganz anderen Perspektive. Sie waren nicht weniger hübsch, sie waren nur bei weitem nicht so schillernd und blendend, wie die, die sich im Focus der pubertierenden männlichen Fantasie sonnten.
Ihre Attraktivität stach nicht beim ersten, anzüglich abschätzenden Blick ins Auge. Sie prostituierten sich nicht mit super kurzen Röcken, erregend figurbetonten Oberteilen, anzüglichem Lächeln aus übertrieben geschminkten Gesichtern, sie waren einfach nur da. Man musste den zweiten Blick bemühen, um ihren Reiz zu entdecken.
Es lohnte sich. Trotz seines ästhetischen Anspruchs an das Gesamtbild eines Mädchens, vermehrte sich die Zahl derjenigen, die er attraktiv fand, auf wundersame Weise. Außerdem entdeckte er einen bisher vernachlässigten Aspekt der Selektion, den Charakter. Nicht immer ein positives Attribut, doch in der Relation zu den Charakteren der umschwärmten Schönheiten, oft eine zusätzlich vorhandene, liebenswürdige Eigenschaft.
Die Tür in die Welt amouröser Beziehungen stand nun weit offen. Er konnte es oft nicht glauben mit welcher Leichtigkeit er Aufmerksamkeit erregte, Beachtung fand und Erfolg hatte, gerade er! Ob es bei den Mädchen aus Mangel an Bewerbern der forscheren Art war, oder ob sie wirklich ihn meinten, überdachte er nicht, das war nach all der Zeit der Entbehrung nicht wichtig. Wichtig war das Dazugehören, auf den Zug seiner Entwicklung aufzuspringen und nicht wie bisher als inaktiver Betrachter zu verharren.
Seine bisherige Lebensphilosophie war in diesem Bereich nicht mehr zu halten. Doch es gab eine Verknüpfung zwischen bewährter Zurückhaltung und offensiver Agitation, offensive Zurückhaltung. Was nichts anderes bedeutete, als seine verbliebene Unsicherheit als vornehme Zurückhaltung zu verkaufen. Interessiert aber introvertiert, das hob ihn anscheinend von der Masse balzender Jünglinge ab.
Das andere Geschlecht beachtete ihn, vielleicht nur als Alternative, diese Möglichkeit bedachte er nicht weiter, es spielte für ihn keine Rolle. Die Einstellung zu sich selbst, seinem Aussehen, seiner Attraktivität gedieh so weit, dass er sich selbst nun ein Stück weit akzeptierte. Kleine Kratzer in diesem Selbstimage bügelten sich von selbst aus. Ein neuer Lebensinhalt fand Einlass. Mädchen, Frauen, er verlangte nach ihrer Nähe, ihrer Zuneigung, ihren Körpern. Er, der frühere Loser, verbuchte unerwartete Erfolge, Selbstläufer ohne größere Mühe oder affiges Gebalze.
Die unendliche Vielfalt weiblicher Wesen, insbesondere die, die sich für ihn interessierten, brachten ihn alsbald zu einer bedenklichen Erkenntnis. Er konnte fast keiner Versuchung widerstehen. Süchtig nach der Bestätigung seines Egos, das wie ein trockener Schwamm eine Unmenge von immer neuen Erfolgen aufsog. Unersättlich war die Gier danach. Beziehungen mussten keine Offenbarung von tiefer Liebe oder erregendem Sex sein, allein die Anzahl stand als Maß für den Erfolg.
Getrieben von dieser Manie, fand er lange Zeit keine Ruhe in einer Beziehung. Der Reiz des Neuen war zu stark, als dass er ihm hätte widerstehen können oder gar widerstehen wollen. Ein neues Gesicht, ein verführerisches Lächeln, ein erregender Körper, Erwartungen und Hoffnungen, ein Feuerwerk von Fantasien und Träumen. Dagegen war bei lang dauernden Beziehungen doch nur deren Ende sicher und meist erst nach unerfreulichen Auseinandersetzungen Eine Beziehung diente eigentlich nur einem Zweck, seiner Bestätigung als Mann, was er damals auch immer darunter verstand.
Durch seinen sensiblen Charakter gestaltete sich das Ende einer Beziehung immer zu einer beschwerlichen Prozedur. Daher löste er sie passiv. Er bezeichnete das damals als genial, er zog sich einfach still und leise aus dem Leben eines Mädchens zurück und verschwand. So versuchte er, das seinem sensiblen Wesen abträgliche Stimmungstief einer unschönen Szene, zu ersparen.
Auch eine weitere Lebensweisheit zeigte sich ihm in jener Zeit: Komme immer drohenden, nicht abzuwendenden Niederlagen zuvor. Der Demütigung, die eine Beendigung der Beziehung, initiiert durch die andere Seite, mit sich brachte, beugte er nach einigen demoralisierenden Erlebnissen konsequent vor. Jede spürbare Disharmonie, ob nun gewichtig oder nicht, war Anlass genug, zur Vermeidung von eigenem Schaden an Leib und Seele, die Beziehung seinerseits in bewährter Manier zu beenden.
So schützte er den zarten Trieb seines neuen Selbstwertgefühles. Egoistisch, feige, das mag alles zutreffend sein, nur er würde alles tun um nicht nochmals in die unteren Sphären der Bedeutungslosigkeit seines Selbst abtauchen. Sicher hatte er ein schlechtes Gewissen, seine Sensibilität war nicht nur Ich – bezogen. Er mochte die Mädchen ja, respektierte sie, ging auf sie ein, ob er eine einmal wirklich geliebt hat, würde er jedoch bezweifeln. Das Gefühl der Liebe war damals, so wie er sie heute versteht, noch nicht in seinem Repertoire. Wie auch? Dazu fehlte ihm jegliche Erfahrung.
Er lehnt sich zurück, viele Tage waren inzwischen vergangen, seit er die Reise zu sich, zu dem, was ihn formte, begann. Wie oft hat er sich die Frage nach dem Sinn seiner Existenz gestellt. Es waren oft keine besonders sinnvollen, tief greifenden Überlegungen. Diese Fragen stellt sich wahrscheinlich jeder Mensch, besonders dann, wenn seine Lebensumstände psychische oder materielle Tiefpunkte erreichen.
Die Beantwortung dieser eigentlich existenziellen Frage erledigt sich meist von selbst, indem sie sich nach mehreren fruchtlosen Überlegungen nicht mehr stellt. Der fragende Mensch verlässt entweder irgendwann das Tal der Tränen oder er ertrinkt darin. Beide Möglichkeiten beenden in ihrer Konsequenz die Beschäftigung mit sich selbst.
Heute steht er an einem Wendepunkt, vor der Entscheidung, wohin sein Weg gehen soll und gibt damit seinem Leben einen neuen Sinn. Ein ruhiges, gutes Gefühl, in dieser scheinbar zeitlosen Zwischenwelt zu verharren, sicher in der Dauer begrenzt, doch im Moment ist dies ohne Bedeutung.
Jahrelang duldete er nur Fragmente seines früheren Lebens in seinem Bewusstsein, sich wohl bewusst um das Risiko einer eskalierenden Reflexion, auf seinen Gemütszustand. Die in jüngerer Zeit vorgekommenen Schwierigkeiten und Probleme glich er, oder es übernahm eine unbewusste, neurologische Funktion seines Gehirns, mit den Erkenntnissen der Vergangenheit ab, um in diesem Kontext zu einer Bewertung des Gestern und des Heute zu finden. Sicher in der Sache richtig und zutreffend, doch er hat nicht das Gefühl, dass dies ihm weiterhalf.
Wenn er von dem etwas nüchternen Bild und dem Resultat seiner bisherigen Erinnerung absieht, so rührt sich eine andere, konträre Erinnerung, ganz zaghaft, als würde sie sich für ihre Existenz genieren. Verschüttet zwischen dem Müll der dominanten, prägenden Erlebnisse, gab es sie doch, die schönen Begebenheiten in seinem früheren Leben. Bescheiden, im Hintergrund verborgen, eingeschüchtert durch die Mächtigkeit des nachteiligen Gesamtbildes.
Er erinnert sich an die Gerüche des Frühlings, an Blumenduft, eingelagert in einer lauen, frischen Frühlingsluft, die durch ein weit geöffnetes Fenster an einem Morgen in das Klassenzimmer strömte. Ein außergewöhnliches, tiefes Empfinden, in einer der sonst so gefürchteten Schulstunden. Eine Impression, die in ihrer Deutlichkeit nach fünfundvierzig Jahren verblüffend ist.
Auch der prägnante Geruch von frisch umgegrabener Erde, Erinnerung an eine Ferienarbeit, wo er mit Kartoffellesen bei Bauern der Umgebung sein Taschengeld aufbesserte. Damit verdiente er sich als Schüler sein erstes eigenes Geld, ein gutes Gefühl.
Dann die langen, heißen Sommer, Schüsseln voll mit Eis, welches er Sonntagmittag mit dem Fahrrad vom Konditor holen durfte. Diese Sommertage heizten sich manches Mal so auf, dass sich der Teer auf der Straße verflüssigte und an den Fahrradreifen und Schuhen haften blieb.
Nachmittage im Freibad, er spürt noch das Wassers und die kühle Feuchte der Luft, die von den Duschen vor den Schwimmbecken bis zum Liegeplatz zu fühlen war. Eigenartig riechende Umkleidekabinen, mit den ewig nassen Holzrosten am Boden. Dumpfer Lärm der Kinder vom Schwimmbecken, schmerzender Sonnenbrand auf der Haut.
Sonnenbaden, eine Leidenschaft, schon als Kind exzessiv betrieben, führte ihn einmal vom Schwimmbad über einen bedenklich blickenden Hausarzt, auf direktem Weg ins Krankenhaus. Das alles nur, weil er zusammen mit einem anderen Deppen ein Bräunungskonzept aus Südfrankreich auf der Grundlage von Olivenöl, ersatzweise übliches, im Haushalt vorhandenes Sonnenblumenöl, ausprobierte. Eine schmerzhafte Erkenntnis!
Zur Abkühlung solch hitziger Erinnerungen schweifen diese in die Winterzeit ab, wo sich in manchen Jahren der Schnee so hoch am Straßenrand auftürmte, dass er als kleiner Junge staunend vor dieser mächtig weißen Wand stand. Er fühlt auch noch die eiskalten, schmerzenden Hände und Füße, den Schnee, der unter den schwarzen, hohen Schnürschuhen knirschte und die klare, flimmernde Winterluft.
Seine ersten Skier bekam er im Alter von sechs Jahren, selbst gemacht von seinem Vater. Skifahren, das war etwas Besonderes, da gehörte er zu den Besten. Bei den Skirennen des Skivereins bezwangen ihn nur die Söhne reicher Eltern, die ihr Können aus dem Skiurlaub, den sie regelmäßig mit ihren Familien in den Bergen verbrachten, ausspielten.
Seine Skipisten dagegen waren ausschließlich die Hügel nahe seinem Heimatdorf, nicht steil, nicht spektakulär, doch sie waren täglich zu erreichen und es kostete nichts. Die Pisten präparierten die jungen Fahrer mit ihren Holzbrettern selbst. Es war nicht viel, doch genug und da sie alle nichts anderes kannten, gab es auch keinen Grund, unzufrieden zu sein. Ein schönes Gefühl, wenn sie dann gemeinsam am Abend, meist viel zu spät, mit roten Gesichtern und halb erfrorenen Füßen, die Skiern auf den Schultern, zum Dorf zurück liefen, und er gehörte dazu, anerkannt und respektiert.
Von solchen Eindrücken zehrte er als Kind, sie ließen ihn leben und entrissen ihn öfters einer aufkommenden Verzweiflung. Er will sich nicht entscheiden, ob er sich als Überlebenskünstler oder Kämpfer bezeichnen soll, doch ersteres erscheint ihm etwas treffender, um sich zu beschreiben. Eine Typisierung gäbe es doch, er war wie eine Weide, biegsam bei Wind und Sturm, nie brechend, öfters mit hängenden Zweigen und an schönen Tagen aufgerichtet und stolz. Zur vergleichenden Eiche taugte er nicht, deren Stärke und Kraft standen ihm nicht zur Verfügung, nicht als Kind und nicht als Jugendlicher.
Er lernte auf seine Chancen zu warten, warten bis für ihn die Zeit reif war. Sollten die anderen doch vorbeiziehen. Es machte keinen Sinn, in Kräfte raubenden Scharmützeln regelmäßig den Kürzeren zu ziehen. Später überholte er viele seiner Konkurrenten aus seinem Umfeld, bei ihm dauerte alles etwas länger. Die Zeit, insbesondere die Eile in der Zeit, in seiner individuellen Zeit, hat ihn nie zu hektischem Aktionismus veranlasst, warum auch? Es gibt eine verbindliche Zeitmessung auf physikalischer Grundlage und es gibt ein individuelles Zeitmaß, eine innere Uhr, die den Takt des Lebensrhythmus eines Menschen vorgibt. Es würde jeder gut daran tun, diesem Takt Beachtung zu schenken.
Die Gedanken stocken, sein Blick starrt durch die Glasscheibe des Fensters, hinaus auf die kahlen abgeernteten Felder, er folgt dem Wechselspiel von Licht und Schatten. Umständlich zündet er seine fast leere Pfeife wieder an, nur um festzustellen, dass da nichts mehr ist, was sich anzünden lässt. Der Vater. Er verweilt lieber noch etwas bei der nutzlosen Beschäftigung mit der leeren Pfeife. Ein Düsenjet überfliegt mit heulenden Triebwerken das Haus. Klassische Musik aus Haydens „Der Morgen“ verfehlt ihre Wirkung. Völlig unpassend, konträr zu seiner Stimmung, er fühlt nicht den erwachenden Tag, das Aufblühen des Lebens. Erfreulich ist das zweite Stück der CD, ein Orgelkonzert von J. S. Bach, es untermalt in vortrefflicher Weise seine trübsinnige Stimmung.
Sein Vater, wie erinnert man sich an einen Menschen, der in den ersten Erinnerungen nur als eine Person auftaucht, von der man außer einem Bild keine gefühlte Beziehung hat, ein Neutrum, weder gut noch schlecht.
Er stand frühmorgens um fünf Uhr auf, fuhr in die Arbeit, kehrte um halb sechs Uhr abends zurück, aß zu Abend, nahm seine Zeitung, setzte sich in eine Ecke und las, oder arbeitete noch im Haus, Tag für Tag, jahrzehntelang. Vor allen Dingen wollte der Vater seine Ruhe. Diese forderte er nicht offensiv ein, man spürte aber, was er wollte.
Manchmal beschäftigte er sich auch mit seinem Sohn, manchmal. Verschwommene Bruchstücke von Erinnerungen deuten sich an, lassen sich jedoch nicht zusammenfügen. Von einer Beziehung zwischen Vater und Sohn ist dabei aber wenig zu spüren. Der Mann war in sich gekehrt, mit sich und seinen Erinnerungen an die Vergangenheit, an Krieg und Gefangenschaft beschäftigt. Seiner Frau mit ihrer zänkischen, fordernden Art, war er nicht gewachsen.
Nachgiebig, um des Friedens willen, blieb er meist stumm. Keine Hilfe oder Stütze für den Sohn bei all den Ungerechtigkeiten der Mutter. Von einem prägenden, leitenden Vorbild eines Vaters für seinen Sohn, war er weit entfernt. Im Gegensatz zur Mutter ging aber keine körperliche Gewalt von ihm aus. Dies vermied er konsequent, nahm dafür gar einem offenen Streit mit der Mutter in Kauf, die einmal von ihm verlangte, den Sohn, nachträglich am Abend, für eine Bagatelle zu schlagen. Da war ein deutlicher Zorn in seiner ablehnenden Antwort zu spüren, ein Zorn, der sogar die Mutter verstummen ließ.
Einmal ließ er sich dann doch dazu hinreißen, und gab seinem Sohn eine Ohrfeige. Dieser platzierte seiner Schwester, aus niedrigen Beweggründen, einen doch recht großen Hammer mittig auf deren Stirn, im Zentrum des Lobus frontalis, besser bekannt als Frontallappens oder Stirnlappen. Da erwiesenermaßen eine Schädigung dieses wichtigen Teiles des menschlichen Gehirns verheerende Auswirkungen auf das Verhalten des Menschen haben kann, bekommt er bei näherer Betrachtung seiner Gewalttat fast ein schlechtes Gewissen. Sollte er etwa an der seltsamen Entwicklung seiner Schwester schuld sein?
Nein, beileibe nicht, es war eine nachvollziehbare, emotionale Kurzschlusshandlung eines Minderjährigen und nicht in Tötungsabsicht ausgeführt. Diese ewig heulende Nervensäge schaffte es doch tatsächlich, ihrem Vater etwas Gefühl zu entlocken und hatte ihn glatt ausgebootet, wenn dies bei so einem Vater- Sohn Verhältnis überhaupt möglich war. Man wird sich doch wehren dürfen!
Die Ohrfeige war nicht heftig, doch als Einzelaktion seines Vaters während einer ganzen Kindheit sehr einprägend. Nun, der Vater hatte sich der weiblichen Majorität gebeugt und der Tochter, als wichtigstes Kind der Familie, auch bei sich eine Vorrangstellung eingeräumt. Er kann heute seinen Vater verstehen, vielleicht wollte der einfach ausschließen, dass sich biblische Geschichten in der Gegenwart wiederholen.
Der Vater war keine dominante Persönlichkeit, keine Größe, an der man sich reiben oder messen konnte. Er war auch kein Schwächling, was seine Körperkräfte betraf. Ein Händedruck von ihm zauberte einem schon schmerzvolle Züge ins Gesicht. Als einmal bei einem Ausflug des Skivereins die Torstangen nicht in den Stauraum des Reisebusses passten, brach er sie vor den Augen der staunenden Zuschauer, mit einer verblüffenden Leichtigkeit, auf eine angemessene Größe ab. Da war der Sohn einmal stolz auf seinen Vater.
Es folgte bedauerlicherweise, lange Jahre, keine Wiederholung einer solchen Begebenheit. Nachdem er, wegen seiner Ehefrau, sein Engagement im örtlichen Skiverein aufgab, traf man ihn selten in Gesellschaft an. In einer Gaststätte war er nie zu finden, auch zu Hause trank er kaum einmal eine Flasche Bier. Manchmal meinte man, er wäre gar nicht da.
Dabei gab es Fotografien, die ihn als jungen Mann zeigten, lachend in Gesellschaft von Frauen und Freunden beim Skifahren, fröhlich, vital, unternehmungslustig. Ein Prachtbild von einem Mann. Was hatte diesen Mann gebrochen? Waren es die langen, leidvollen Jahre im Krieg und die anschließende Gefangenschaft in Russland? Darüber sprach er verhältnismäßig wenig, was nicht viel heißen will, da er überhaupt selten sprach. Vielleicht gab es Dinge über die er nicht sprechen konnte oder wollte?
Eine der wenigen Erzählungen handelte von einem russischen Soldaten, den er erschossen hat. Er tötete ihn und sah ihm dabei in die Augen. Bei dieser Erzählung, die sich im Laufe der Jahre mehrere Male wiederholte, wirkte er noch bedrückter als sonst. Brach in diesem Moment, als er diesen Menschen erschoss, das alles rechtfertigende Feindbild zusammen? Sah er einfach nur einen jungen Mann, wie er einer war, sah er die Angst in seinen Augen, in Augen, die in diesem Augenblick ahnten, niemals wieder Mutter, Vater, Frau oder Kinder zu sehen, ohne Abschied, ohne versöhnliche Worte oder Trost?.
Verfolgten ihn die verzweifelten Augen des Mannes, der wahrscheinlich so wenig wie er, dieses unsägliche Töten wollte? War die Bürde dieser Schuld zu schwer für diesen, in seiner Jugend lebenslustigen, starken Mann? Hat er sich mit diesem Schuss selbst auch getötet, nicht seinen Körper, sondern seine Seele?
Brachen ihn die langen Jahre der Gefangenschaft in Sibirien? Was musste er da erdulden, welches Leid sah er da. Wie knapp hat er dies alles überlebt, immer den Tod vor Augen. Die ständige Angst, die Heimat, das Elternhaus, Vater und Mutter niemals wieder zu sehen. Verscharrt in der Weite Sibiriens, wie ein Teil seiner Kameraden. Achtlos weggeworfenes menschliches Leben, bedeutungslos, ohne jeden Wert. Jeden Tag der Kampf ums Überleben, machtlos, nur um am nächsten Tag die gleiche Prozedur auf Neue zu erdulden, und am nächsten Tag, und am übernächsten Tag, monatelang, jahrelang.
Was hatten sie in diesem Land verloren? In einem Land in dessen Weite noch keine Nation und auch noch kein so großer Stratege oder Feldherr einen dauerhaften Sieg erringen konnte. Was erzählten sie ihnen für einen Unsinn von Untermenschen, Bolschewiken, einer den Herrenmenschen unterlegenen, minderwertigen Rasse. Sie hatte es ihnen gezeigt, diese minderwertige Rasse, ihnen, den besten Soldaten der Welt, den Arsch hatten sie ihnen versohlt, den Herrenmenschen.
Oder war alles ganz anders gewesen? Was bedrückte seinen Vater? Gab es Dinge in diesem Krieg, die er nicht erzählen konnte? War auch er an den Unmenschlichkeiten der Wehrmacht beteiligt, von denen zu dieser Zeit niemand sprach? Taten, für die er sich schämte, die durch nichts zu rechtfertigen und damit zu erklären waren. War auch er einer dieser willfährigen, entmenschlichten Mitläufer, die im nach hinein sich und ihre Taten selbst nicht mehr begriffen, die den Rest ihres Lebens mit dieser Schuld nun alleine leben mussten, denn wem sollten sie sich offenbaren, wer würde das verstehen?
Es war ja nicht so, dass er sich darum riss, Soldat zu werden, doch auch er wählte den großen Führer, bewunderte ihn, glaubte seinen Reden und Versprechungen und trug die Ideologien in der Woge der Begeisterung mit. Nun vegetierte er in diesem gottverdammten Land vor sich hin, verlassen vom großen Führer, der feige sich der Verantwortung, auch der Verantwortung für ihn, entzogen hatte. Verraten von den unzähligen Parteibonzen und Funktionären, die jede Verantwortung für dieses Debakel vehement abstritten und sich meist rechtzeitig in sichere Zonen absetzten. Alleingelassen mit seinem Schicksal, der Gnade oder Ungnade der Sieger ausgeliefert, rechtloses menschliches Leben, ganz so, wie das Großdeutsche Reich es vor kurzer Zeit noch selbst an den Menschen praktizierte. Wie übersteht man so einen tiefen Fall, so eine desolate Situation, ohne in tiefe Depression zu verfallen?
Man stellt sich einfach dumm, hält die vertrauten Feindbilder hoch und setzt die Sieger gedanklich ins Unrecht. Gedanken sind frei, sind manipulierbar und können Hass erzeugen, Hass als Basis zum Überleben. Hass ist eine der stärksten menschlichen Emotionen, setzt ungeahnte Kräfte im Kampf ums Überleben frei und bewahrt zudem weitgehend vor zerfressenden, selbst zerstörenden Schuldgefühlen.
Es ist jedoch eine etwas perfide Auslegung der Tatsachen notwendig, um diese Überlebensstrategie zu praktizieren. Schon allein die Erkenntnis, dass das Gegenüber, der so genannte Feind, ein gleich macht- und rechtloses Werkzeug eines Systems ist, wie man selbst, bereitet durchschnittlich intelligenten Menschen gedankliche Probleme. Sie waren oder sind doch alle eingepfercht in ein System, das schon einen Hauch von Menschlichkeit als Verrat ansah und entsprechend reagierte. Der verteufelte Feind, ein Abziehbild des eigenen Schicksals!
Ein Mann mit einer erwachenden Moral, der Erkenntnis oder besser der Ahnung, dem Unrecht ein weites Feld seiner Seele angedient zu haben, kann dabei schon zerbrechen. Was hätte alles passieren müssen um dieses Debakel nach der Rückkehr in die Heimat zu beseitigen? Wiedersehensfreude mit den Eltern, die Dankbarkeit überlebt zu haben, bestimmt schöne, auch gewaltige Gefühle, doch nicht mehr als ein Spritzer Wasser auf eine verbrannte Seele.
Reden wollten wohl viele der Heimkehrer über ihre Erlebnisse, doch die Gesellschaft mochte von dem Debakel nichts mehr hören und folglich auch nicht mehr darüber reden. Sie kamen ja nicht als Helden zurück, diese jammervollen Gestalten, geschlagen, gedemütigt. Keine Siegertypen, sie passten nicht recht in die Auffassung von „das waren doch nicht wir“, oder „lasst doch endlich die Vergangenheit ruhen“.
Sie fanden eine fremde Heimat vor, die von neuen Wertvorstellungen und ebensolchen politischen Machtverhältnissen geprägt war. Ihre alten Ideale hatten den Wert eines abgetretenen Schuhes. Die Erlebnisse aus dem Krieg konnten sie, höchstens selektiert, aufbereitet für die neue Moral, wiedergeben. Dazu mussten sie sich noch manchem vorwurfsvollen Blick von Menschen stellen, deren Sohn, Bruder oder Mann nicht wieder zurückkehrte. Sie bezahlten einen hohen Preis für den Größenwahn eines Despoten ihrer Gnaden.
Nun stand er da in seiner Heimat, seinem Elternhaus. Die Familie betrieb eine kleine Landwirtschaft als Nebenerwerb, sein Vater war Rentner und nicht mehr bei bester Gesundheit. Die Mutter schwer erkrankt, ihr Sterben war absehbar, sie lebte auch nur noch wenige Monate. Er, krank an Leib und Seele, doch die wirtschaftliche Situation der Familie erforderte zwingend und schnell seinen Beitrag,
Er fand dann kurz nach seiner Rückkehr eine Arbeit als Schreiner, in einer nahe liegenden Stadt, wo die Fabriken der Uhrenindustrie Arbeitskräfte benötigten.
Der Firma, die ihn damals einstellte, ist er sein ganzes weiteres Berufsleben treu geblieben. Berufliches Weiterkommen war für ihn nie von besonderem Interesse. In dieser Firma lernte er dann seine Frau kennen und durfte sie bald darauf, aus zwingendem Grunde, dem, der baldigen Niederkunft des ersten Kindes, ehelichen.
Dieses erste Kind war er, der Sohn. Ob es eine Heirat aus Liebe, aus Verantwortung oder ein Entgegenkommen gegenüber dieser Frau war, behielt er zeitlebens für sich. Die Aufmerksamkeit und Zuwendung, die die Eltern ihrem Sohn zukommen ließen, sowie die spürbare Distanz des Paares zueinander, würden jedoch einige Zweifel an einer Heirat aus Liebe zulassen. Er, der Sohn, verstand als Kind nicht, warum sich sein Vater so verhielt, warum er ihn nicht beschützte, ihm keine Zuneigung zeigte. Und obwohl er im Laufe der Zeit viele Erklärungen zu diesem Verhalten fand, kann er dem Vater keine Absolution erteilen.
Was in aller Welt kann er dafür, dass sich eine ganze Generation von Schwachköpfen verführen und missbrauchen ließ! Menschen, die ihr Gefühl, ihre Ratio von markigen Worten unsinniger Versprechen abkaufen ließen, um dann nach dem Zerplatzen all ihrer Illusionen und Werte, in einer Welt zwischen gestern und heute taumelnd, keine Kraft oder keine Courage mehr besaßen, ihren Kindern das zu geben, auf was diese ein Anrecht hatten, Liebe und Zuneigung.
Einzig sein Opa vermittelt ihm zuhause Wärme und Zuneigung. Ein damals schon alter Mann mit weißen, schütteren Haaren, hagerem, gebeugtem Körper und einem natürlich sanften Wesen. Er setzte sich zu ihm, hörte zu und tröstete ihn bei all seinem Kummer. Alles mit einer anrührenden Bedächtigkeit, nie hörte er von ihm ein böses Wort. Der einzige Mensch aus seiner Vergangenheit, den er wirklich vermisst.
Ein bescheidener Mann von außergewöhnlichem Charakter. Er stellte seine eigene Bedeutung, ohne den geringsten Verlust seiner Würde, bis zur schieren Unkenntlichkeit zurück, war sich nicht zu schade, nicht zu stolz, anderen seinen Platz zu überlassen, zur Seite zu treten, wenn der Weg zu eng wurde. Er, der erste und lange Zeit einzige Mann aus seinem Heimatdorf, einer bäuerlichen Gemeinschaft von ärmlichen Menschen, der den Mut aufbrachte, einen Beruf, in der damals aufkeimenden Uhrenindustrie zu Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts, zu erlernen. Er gestaltete und malte Zifferblätter von Uhren. Wunderschöne Handarbeiten, die viel Talent und handwerkliches Geschick erforderten.
Er weiß nicht mehr viel über diesen Mann, seine Geschichte ist mit ihm gestorben, er weiß nur das, was der Vater erzählte. Als Sohn eines dem Alkohol nicht abgeneigten Dorfbüttels, wuchs er in ärmlichsten Verhältnissen auf. Dem Makel seiner Geburt widersetzte er sich und begab sich nicht auf das charakterliche und soziale Niveau seines Vaters. Er erlernte schon zu Ende des neunzehnten Jahrhunderts, gegen viele Widerstände, den besagten Beruf,, heiratete, gründete eine Familie und erwarb ein bescheidenes Haus.
Ein einfaches Haus mit kleinen, niederen Zimmern, einem angebautem Stall und einer Scheune. Die Toilette war ein an der Außenseite zum Garten integrierter Bretterverschlag, mit einer kreisrund ausgeschnittenen Holzplatte über einer offenen Grube. So präsentierte sich das Haus noch als der Enkel die ersten vierzehn Lebensjahre dort verbrachte. Ein Badezimmer oder eine Waschküche war in dieser Art von Häusern nicht vorgesehen. Die gesamte hygienische Aktivität spielte sich in der kleinen Küche ab.
Die Bezeichnung Hygiene sollte im Konsens dieser Zeit gesehen werden, das heißt: im Wochenrhythmus baden, in einer Zinkwanne, die Samstagnachmittag in die Küche geschafft wurde. Das dafür erforderliche warme Wasser musste über einem Holzherd erhitzt werden, was wiederum die Erklärung dafür ist, dass dieses Badewasser gleich mehrere Personen nutzten.
Im Winter froren die Bettdecken in den eiskalten Schlafzimmern oft an, da sich die Räume nur mühsam und nach heutigem Verständnis, auch nur unzureichend erwärmen ließen. Es war ein sehr einfaches, bescheidenes Leben in diesem Haus. Dass es in der Erinnerung doch eher nostalgisch, verklärt erscheint, liegt sicher an der Vielfalt der Tiere, die den Rest des Anwesens belebten. Schweine, Ziegen, zwei Kühe, Hasen, Hühner und teilweise sogar ein paar Schafe drängten sich in Stall, Scheune und auf der Wiese hinter dem Haus. Ob diese Tierhaltung eine Passion des Opas war, oder ein Relikt aus einer Zeit, in der die Tiere zur Versorgung der Bewohner notwendig waren, er weiß es nicht. Die Anzahl der Tiere reduzierte sich mit dem Alter des Opas. Zum Schluss waren praktischer Weise nur noch die Fleisch- und Wurst- sowie die Eierlieferanten verblieben, also Schweine und Hühner.
Der Opa, er war schon über achtzig Jahre alt, starb unter furchtbaren Schmerzen zu Hause. Er litt ein Leben lang unter quälenden, chronischen Kopfschmerzen. Diese rührten von einem Schwall kochend heißes Wasser, das ihm als Kind über den Kopf geschüttet wurde. Dies Unglück geschah bei der damals üblichen Entsorgung von Abwasser. Küchenfenster auf und Abwasser raus auf die Straße.
Der alte Mann lag oft in seinem Zimmer und wimmerte vor Schmerzen. Schmerzen, die im fortgeschrittenen Alter nur noch durch die Einnahme von Morphium etwas gemildert wurden. Der Enkel schlich sich manches Mal in das abgedunkelte Zimmer, wenn er ihn wimmern hörte. Starr vor Entsetzen über das Leid des Opas stand er dann einige Zeit neben seinem Bett.. Er erinnert sich noch heute an seine kindliche Verzweiflung, wenn er an den Opa denkt.
Der alte Mann, er wollte doch niemandem zur Last fallen, weinte vor Schmerzen und aus Kummer über seinen Zustand. Er lag in einem kleinen Zimmer, auf einem alten Bett mit fast aufgerichtetem Oberkörper. Er bemerkte den Jungen nicht immer, der da wortlos stand, und darauf wartete, dass die Mutter kam und ihm die Medizin gab, die ihm die Schmerzen nahm und ihn einschlafen ließ.
Das letzte Bild, die letzte Erinnerung an seinen Opa, ist der Anblick des Toten mit hochgebundenem Unterkiefer. Hochgebunden mit einem zu großen weißen Tuch, welches das halbe Gesicht bedeckte und auf dem Kopf mit einer großen Schleife geschlossen war.
Der Opa wurde in dem Familiengrab, neben seiner Frau, bestattet. Das Totenbett mitsamt Matratzen und Decken verbrannte der Vater sofort, was sich später, wegen des immensen Wertes dieses Möbelstückes, als sehr strittig herausstellte. Damit war die sachliche Abwicklung einer Existenz beendet.
Es sollte noch an dieser Stelle, eine der wenigen, dem Sohn sichtbaren positiven Eigenschaften der Mutter erwähnt werden. Sie pflegte den Opa in einem gewissen Grade fürsorglich, er kann sich an keine missmutigen Worte erinnern, er glaubt, sie hat ihn wirklich geachtet, eine für sie doch schon außergewöhnliche Gefühlsregung, fand wenigstens er.
Peinliche Aversionen unter den verbliebenen Nachkommen, der Vater hatte noch zwei Geschwister, bestimmten nun fortan das Verhältnis, der im Dorf lebenden Verwandtschaft. Eine der Hauptakteurinnen verkörperte natürlich die Mutter, die andere Amazone seine Tante. Sie stritten um ein Nichts, keine wirklich materiellen oder auch ideellen Werte standen zur Aufteilung. Es waren vielmehr die unter dem Mantel der Zwangsharmonie verborgenen Antipathien, die nun an den Tag traten.
Die zwei Kontrahentinnen benötigten zu Beginn der dummen Feindseligkeiten nur die Erde über dem Grab. Die ersten Scharmützel begannen sie jedoch schon, nachdem gewiss war, dass der alte Mann nicht mehr lebte und nichts mehr von ihrem Gezanke mitbekam. Die Mitglieder der gegnerischen Familien wurden dann zwangsverpflichtet und mussten den Fahneneid auf die jeweilige Megäre und ihre dummen, engstirnigen An- und Absichten ablegen.
Der Krieg um das Nichts, er zählte zu den längeren der Familiengeschichte, dauerte so runde zehn Jahre. Anschließend herrschte weitere zehn Jahre eine etwas labile Waffenruhe, dann, mit der aufkommenden Altersweisheit oder der Müdigkeit der Kampfhennen, folgte eine friedliche Koexistenz der Familien. Dabei wurde das Gewesene einfach totgeschwiegen, das war auch besser so.
Für den Jungen, und er denkt auch für seinen Vater, brach mit der Streiterei ein Teil der eher dürftigen sozialen Kontakte weg, was vom Vater resignierend, vom Sohn mehr traurig hingenommen wurde, oder hingenommen werden musste. Es schmerzte ihn nicht so wegen der Tante. Der Onkel, zu dem eine nicht näher erklärbare Verbindung bestand, fehlte ihm auf irgendeine Weise. Als dieser Mann später starb, er selbst war damals schon so zwanzig Jahre, lag er lange weinend auf seinem Bett, so sehr schmerzte ihn der Verlust dieses Mannes, zu dem er jahrelang nie einen intensiven Kontakt hatte. Diese seltsame Verbundenheit ist ihm bis heute ein Mysterium geblieben.
Verbundenheit, ein konturloser Begriff, da er doch von den Menschen in ihrer Verschiedenheit ebenso unterschiedlich interpretiert und verstanden wird. Er fragt sich nachdenklich, wem er sich in seiner Kindheit und Jugendzeit, außer dem Opa und dem Onkel, jemals aus einem inneren Gefühl heraus, bewusst und ohne jeglichen existenziellen Zwang, verbunden fühlte. War er überhaupt einmal jemandem bewusst und frei verbunden, ohne praktische Notwendigkeit oder existenzielle Abhängigkeit?
Er lässt sie vor seinem Auge Revue passieren, die Personen und Gesichter jener Zeit. Es sieht nicht gut aus mit bejahenden Ergebnissen seiner Recherche. Verheerend schlecht wäre noch treffender formuliert. Taucht ein Gesicht auf, zerfällt es nach Momenten der kritischen Betrachtung, gleichgültig, wie die Person ihm gewogen war. War die wohlige Wärme einer Regung fühlbar, so glich er dieses Empfinden mit den Erfahrungen in ähnlichen Situationen ab. Das Risiko einer Fehlinterpretation stufte er dann meist, auf Grund von vergleichbaren, aber schlechten Erfahrungen, als zu groß ein und beendete die Suche.
Es war schlicht weg ein Mangel an verfügbarem Vertrauen zu sich und seiner menschlichen Umgebung vorhanden. Was ihn dazu animierte, sich mit der intimen Gesellschaft seines näheren Umfeldes, in rein theoretischer Art und Weise, sehr kritisch auseinander zu setzen und es danach in die Kategorie, “lebensnotwendiges Übel“ einzustufen. Er gewann seine Überzeugungen nicht aus dem Ergebnis seiner Bemühungen um Akzeptanz, die er mit dem Wissen eines Schülers, sowieso nicht nachvollziehen konnte, sondern aus den Erfahrungen seiner Kindheit.
So begegnete er den Menschen schon damals mit Distanz und verhaltener Ablehnung. Diese Erkenntnis ermöglichte sicherlich keine Aufarbeitung der überwiegend unerfreulichen Kindheit oder ein fruchtbares Erleben der Rekonvaleszenz in den nachfolgenden Jahren, doch als Basis für die Bewertung und Bewältigung kommender Widernisse erwies sie sich durchaus als zweckdienlich.
Seine Erinnerungen, stellt er nachdenklich fest, lassen oft eine Chronologie vermissen. Fast wirr, teilweise zusammenhanglos, tauchen sie in seinem Bewusstsein auf. Soll er den Versuch wagen, sie zu ordnen, zu verknüpfen, ihnen eine chronologische Logik zu verpassen?
Er hegt große Zweifel an der Umsetzbarkeit und auch Sinnhaftigkeit eines solchen Ansinnens. In dieser Reihenfolge, seien sie nach sachlicher oder emotioneller Wichtigkeit geordnet, sich aus diesem oder jenem Grunde wiederholend, hat er Zugang zu den Archiven seines Unterbewusstseins erhalten. Er findet, er sollte dies so akzeptieren und der Selbstzensur seiner Psyche vertrauen.
Sicher bleiben Fragen, sogar drängende Fragen aus dunklen Ahnungen verschwommener Bilder offen. Nur, wer fragt, sollte sich vor der Frage überlegen, ob er auch die Antwort erträgt. Eine Antwort, die unter Umständen wenig schmeichelhaft oder gar erschreckend sein kann. Er hätte kein gutes Gefühl dabei, den Geistern der Vergangenheit ungefiltert Eintritt in seine heutige labile Psyche zu gewähren.