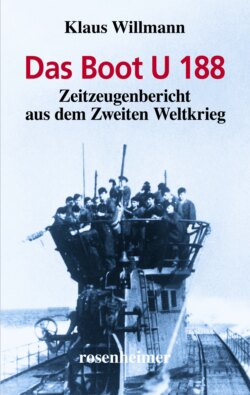Читать книгу Das Boot U 188 - Klaus Willmann - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеSchon seit Tagen umtoste uns die See. Unser Boot U 188 wurde wie ein Spielball durch die Wellen geschleudert und vermochte kaum noch Kurs zu halten. Hier im Nordatlantik sollten wir mit einigen anderen deutschen U-Booten zusammentreffen. Alle hatten Befehl, einen der von Kriegsschiffen stark bewachten Geleitzüge unserer Gegner anzugreifen, mit denen die Alliierten Kriegsmaterial aus den USA nach Europa beförderten.
Als Letzter kletterte ich, ausgerüstet mit meinem Öl- und Lederzeug, auf die Brücke, um die Brückenwache abzulösen. Das Heulen des Sturmes und das Tosen der graugrünen Wellen waren so laut, dass ich die Warnrufe der anderen kaum verstehen, sondern nur erraten konnte. Rasch befestigte ich den Karabinerhaken am Ende eines dünnen Stahlseiles in der Öse meines reißfesten Brustgurtes. Nun war ich fest mit dem brusthohen, unseren Turm umrahmenden Schanzkleid aus Stahl verbunden. Ohne diese Sicherung hätten uns die Brecher, die unablässig an unserem Boot zerrten und uns manchmal sogar überrollten, wie Strohhalme über Bord gespült.
So sehr sich U 188 auch gegen die aufgewühlte See stemmte – wir fühlten, dass wir kaum noch Fahrt machten. Und der Sturm wurde innerhalb der folgenden Stunde noch heftiger. Immer öfter vernahmen mein Nebenmann Rötters und ich die Warnrufe unseres Wachoffiziers Korn oder die von Steimer, die hinter uns durch ihre Gläser in Fahrtrichtung die See beobachteten: »Wahrschau!« Wir holten tief Luft, denn wir wussten, dass uns im nächsten Augenblick ein anrollender Brecher überspülen würde. Wir konnten beobachten, dass sich immer wieder schäumende, bis zu zehn Meter hohe Wellen auf uns zubewegten. Sie waren schneller als das Boot, begruben es von hinten, und jetzt musste jeweils einer von uns beiden laut und rechtzeitig warnen: »Wahrschau!« Die Beine wurden unter meinem Körper weggerissen. In der plötzlichen Dunkelheit wurden mir Sekunden zu Minuten, und meine klammen Hände in den durchnässten Handschuhen suchten krampfhaft nach dem Haltegriff des Schanzkleides. Dabei fühlte ich, wie das eiskalte Wasser in mein Ölzeug drang. Das zum Schutz gegen eindringendes Wasser um den Hals gewickelte Handtuch erwies sich als wirkungslos. Kein Faden an unseren Körpern blieb trocken.
Bei der Ablösung nach vier unendlich langen Stunden brannten unsere überanstrengten Augen, und wir taumelten – genau wie die Brückenwache vor uns – halb ertrunken und vor Kälte fast gefühllos hinab in die Zentrale. Durch das Turmluk, das Sprachrohr und auch den Dieselluftmast war ins Boot tonnenweise Wasser eingedrungen, das nun bedrohlich in der Bilge unter unseren Füßen schwappte. Die Lenzpumpen mussten pausenlos arbeiten, um es wieder hinauszubefördern.
Durch diese Wetterverhältnisse war Kaleu Lüdden gezwungen, sich zum Unterwassermarsch zu entschließen. Während wir tauchten, verwandelten sich die bisher heftigen Schlingerbewegungen des Bootes allmählich in sanftes Wiegen. Dabei stand ich im E-Raum (Elektroraum) und versuchte verzweifelt, mich aus meiner Schutzkleidung herauszuschälen. Einige Kameraden halfen mir schließlich und rieben mich mit Handtüchern trocken. Als ich bekleidet mit meinem blauen, dicken Rollkragenpullover, trockener Unterwäsche und Hose zusammen mit den anderen zur kleinen Kochstelle des Smuts eilte und dort einen großen Becher mit dampfendem Tee leerte, fühlte ich wohltuende Wärme meinen Körper durchströmen. Ich erholte mich rasch, und es überkam mich ein fast unwiderstehliches Schlafbedürfnis.
Zwischen dem Gewirr von Rohren dicht über meinem Kopf und dem Torpedo unter meiner Klappe (Liege) zwängte ich mich vom Längsflur aus in den schmalen Schlafplatz. Kurz bevor ich einschlief, stürmten Bilder und Erinnerungen aus nicht allzu fernen Tagen auf mich ein. Wie war es gekommen, dass ich jetzt hier in diesem U-Boot wie ein kleines Rädchen in einem Uhrwerk als Teil des Ganzen zu funktionieren hatte und dem Zeitgeschehen hilflos ausgeliefert war?
Am 9. September 1941, vierzehn Tage vor meinem achtzehnten Geburtstag, erhielt ich vom Wehrkreiskommando Rosenheim die Vorladung zur Musterung zugestellt. Es war ein kurzes Schreiben, auf dem selbstverständlich der Reichsadler mit dem Hakenkreuz prangte. Natürlich war auch ich wie alle meine gleichaltrigen Freunde und Bekannten in der Hitlerjugend gewesen, denn seit dem Jahr 1939 verpflichteten Durchführungsverordnungen zum Reichsjugendgesetz alle deutschen Jungen und Mädchen zur Mitgliedschaft in der HJ – der Hitlerjugend – oder beim Bund deutscher Mädchen. Es würde allerdings nicht der Wahrheit entsprechen, wenn ich heute behauptete, dass mir die Kameradschaft, das gemeinsame Singen an prasselnden Lagerfeuern oder die Wanderfahrten in Zeltlager, ganz einfach das Gefühl der Gemeinschaft keinen Spaß gemacht hätten. Jedoch sollte mir erst viel später bewusst werden, dass wir alle durch vormilitärische Geländespiele und Ähnliches zu unbedingtem Gehorsam erzogen wurden.
Während der kurzen Fahrt von Grafing nach Rosenheim – die Bahnstrecke von München nach Salzburg war damals schon elektrifiziert – dachte ich an die etwa dreihundert Arbeitsmänner beim RAD (Reichsarbeitsdienst), die ich schon oft beobachtet hatte, wenn sie auf der Wiese neben dem Urtelbach gleich hinter der Turnhalle in Grafing gedrillt wurden. Die Reichsarbeitsdienstler waren in drei großen, einfachen Baracken untergebracht, dort wo heute das Gymnasium steht. Natürlich war mir bekannt, dass die Arbeitsmänner nicht nur exerzierten, sondern hauptsächlich in unserem Umland Sumpfwiesen trockenlegten, einige Bäche begradigten und in anderen Lagern überall im Reichsgebiet nützliche Arbeiten verrichteten. An Arbeit war ich gewöhnt, denn auch ich arbeitete von früh bis spät, doch der Drill beim RAD wirkte abstoßend auf mich. Weder Gesänge wie »Es ist so schön Soldat zu sein« oder »Oh du schöner Westerwald« noch die schnurgeraden Marschkolonnen der braun Uniformierten oder ihre blank polierten Spaten konnten mich mit der von der Reichsführung gewünschten Begeisterung für diese staatliche Institution erfüllen. Ganz im Gegenteil; als mir der Altgeselle Lohhauser an meinem Arbeitsplatz, der Orgelbaufirma Siemann in München, nebenbei erzählte, dass sein Sohn sich freiwillig zur Kriegsmarine gemeldet hatte und deshalb nicht zum RAD musste, überlegte ich wochenlang mit wechselnden Ergebnissen, ob auch ich diesen Weg wählen sollte, um dem mir so unsympathischen RAD zu entgehen. Zudem sah ich in meinem erlernten Beruf als Orgelbauer damals wenig Zukunftschancen. So meldete ich mich freiwillig zur Kriegsmarine. Schon als Kind hatte ich von der Ferne geträumt, und Wasser hatte mich immer irgendwie angezogen. Außerdem gibt es, so dachte ich, auf einem Schiff keinen Kasernenhof, auf dem ich so gedrillt werden konnte wie diese bedauernswerten Reichsarbeitsdienstler. Solche und ähnliche Gedanken beschäftigten mich also, als ich im Zug nach Rosenheim saß.
In die klammheimliche Freude darüber, dem von mir so verabscheuten RAD entgangen zu sein, mischte sich jedoch auch ein bitterer Wermutstropfen: Von meinen gleichaltrigen Freunden und Bekannten fuhr keiner mit mir. Sie wurden alle in Wasserburg am Inn gemustert, wo das Heer seine Auswahl traf. Der größte Teil von ihnen würde wohl zu den Gebirgsjägern einberufen werden.
Das Gebäude, in dem sich das Wehrkreiskommando Rosenheim befand, war nicht weit von der Loretowiese, dem Volksfestplatz Rosenheims, entfernt. Dort stand ich eine Stunde später in einem geräumigen Untersuchungsraum zusammen mit zahlreichen jungen Männern nackt in einer Warteschlange. Es ging alles rasch vor sich. Einer nach dem anderen von uns wurde von einem Arzt flüchtig untersucht: Blutdruck messen, einige Kniebeugen, nochmals Blutdruck überprüfen, Herz und Lunge abhorchen, »Bücken!« (als ich dieser Aufforderung Folge leistete, hätte ich liebend gern einen fahren lassen), »Mund auf!« und Ähnliches. Nach etwa zwei Stunden war die Musterung vorbei. Natürlich wurde ich kv. (kriegsverwendungsfähig) geschrieben. Da ich mich nicht nur kerngesund fühlte, sondern es auch war, hatte ich nichts anderes erwartet.
Zwei Tage später feierte ich in Grafing zusammen mit allen anderen des Jahrgangs 1923 unsere Musterung. Am 22. Juni 1941 hatte »der Führer« den Angriff auf die Sowjetunion befohlen, und das deutsche Heer stürmte siegreich und anscheinend unaufhaltsam nach Osten. Sondermeldungen im Rundfunk berichteten beinahe täglich vom Landgewinn in Russland, von vernichteten Divisionen der »kommunistischen Untermenschen«, die angeblich unser Land hatten überfallen wollen und denen der deutsche Angriff zuvorgekommen war. Deutsche U-Boote versenkten eine große Zahl »feindlicher Schiffe« und schienen auf See unschlagbar zu sein. Frankreich war besiegt und von deutschen Truppen besetzt. Die deutsche Luftwaffe flog gegen England. Wir frisch Gemusterten fühlten uns irgendwie auserkoren, denn bald schon sollten auch wir zu denjenigen gehören, die zum Sieg beitrugen.
Nicht nur bei uns in der Marktgemeinde Grafing bei München trafen schon seit Beginn des Polenfeldzuges immer wieder Todesnachrichten ein; doch was bedeutete dies schon für uns? Die Reichspropaganda verkündete immer wieder eindringlich, dass es für einen deutschen Mann eine Ehre sei, für Führer, Volk und Vaterland zu sterben und dass Deutschland seine gefallenen Helden niemals vergessen würde. Außerdem dachte wohl jeder von uns: Weshalb sollte es denn gerade mich treffen? Mir wird schon nichts passieren!
Mein Vater hatte schon am 22. Juni, als die Offensive gegen Russland begann, meine Euphorie sehr gedämpft. Es war Abend, Mutter und meine drei Schwestern hatten sich schon zur Nachtruhe begeben, und wir beide saßen allein in der Küche unserer kleinen Wohnung in der Griesstraße. Vater legte einen aufgeschlagenen Atlas vor mich auf den Tisch und erinnerte mich an Napoleons Russland-Feldzug. »Bub! Ich will dich nicht entmutigen, aber dieser Österreicher hat nichts dazugelernt. Erst veranlasst er mit seinem Polenfeldzug die Engländer dazu, sich mit uns anzulegen. Ausgerechnet die Engländer mit ihren vielen Beziehungen und Besitzungen rund um den Erdball. Und jetzt auch noch dieses große Russland!? Das kann niemals gut gehen.«
Als ich ihn betroffen anblickte, legte er mir seinen Arm um die Schulter und fügte hinzu: »Ich kann dir das sagen, weil ich weiß, dass du mich nicht bei den Nazis anzeigen wirst und mich die Gestapo deshalb nicht abholen wird. Ich weiß auch, dass du bald Soldat bist. Dein Ziel aber sollte einzig und allein darin bestehen, wieder gesund nach Hause zu kommen.« Leise fügte er hinzu: »Vielleicht holen sie mich altes Frontschwein des Ersten Weltkrieges am Ende ja auch wieder, wenn ihr ›Menschenmaterial‹ knapper wird.«
Es war früher Nachmittag, als ich am Treffpunkt unserer Musterungsfeier vor dem Bahnhofsgebäude von Grafing die Hände meiner gleichaltrigen Schulkameraden und Freunde schüttelte. Dabei lachte und scherzte ich so unbekümmert wie sie und ließ mich trotz meiner heimlichen Bedenken von ihrer Siegeszuversicht anstecken. Fritz Meier trug eine kleine, auf einer Holzlatte befestigte weiße Kartontafel vor uns her, auf der mit großen Buchstaben »Jahrgang 1923« stand. So marschierten wir durch die Bahnhofstraße und drängten in die Gaststätte Grandauer am Marktplatz. Dort tranken wir das vom Wirt reichlich spendierte Freibier, und weil der Herbstabend sehr mild zu werden versprach, zogen wir bald darauf in den gegenüberliegenden Biergarten »Beim Wildbräu« um. Alle Feiernden wussten, dass sie zunächst beim RAD und anschließend bei den Gebirgsjägern oder anderen Waffengattungen der Wehrmacht ihren Dienst fürs Vaterland antreten mussten. Nur ich wartete auf meinen Einberufungsbefehl zur Kriegsmarine. Wir fühlten uns jedoch ausnahmslos als erwachsene Männer, wollten als solche ernst genommen werden und tranken auch hier im Biergarten unbeschwert das Freibier, das der Wirt und einige der Stammgäste auf unsere Tische stellten, die wir zu einer langen Tafel vor der Gaststätte zusammengeschoben hatten.
Nur ein sehr genauer Beobachter hätte unter uns laut lärmenden Zechern einige Gesichter entdecken können, die zurückhaltender und nachdenklich wirkten. Doch niemand wollte oder konnte im Abseits stehen, und so feierten alle lauthals mit.
Gegen 18 Uhr erklang lauter Gesang: »Es zittern die morschen Knochen der Welt vor dem großen Krieg. Wir haben den Schrecken gebrochen, für uns war’s ein großer Sieg.« Ein Fähnlein der HJ marschierte über den Marktplatz. Julius Scheuer sprang von der Sitzbank auf und lief zu dem schmucken Steingeländer, das den etwas erhöhten Biergarten zum Marktplatz hin in kleinem Halbrund umfriedete. Lachend beugte er sich über das granitgraue Geländer, seine kräftige Stimme übertönte den Gesang: »Was wollt denn ihr lausigen Pimpfe!? Ihr könnt doch nicht einmal richtig marschieren!« Schon stand Schorsch Sauer neben ihm und rief: »Singen müsst ihr auch noch lernen!« Max Kreitmeier stellte sich lachend neben die beiden und lärmte: »Mit euch kleinen Brennesseldatschern können wir den Krieg natürlich nicht gewinnen! Das müssen wohl wir erledigen, damit sich von euch keiner wehtut!«
Wir anderen erhoben uns und konnten gerade noch sehen, wie sich im letzten Glied der HJ-Jungen einer von ihnen halb umwendete, seine Zunge weit herausstreckte, sich bückte und – ohne dabei den Gleichschritt zu verlieren – mit einer Hand auf sein Hinterteil deutete. Alles brüllte vor Lachen. Julius Scheuer hatte sich neben mich auf die Bank gestellt, um besser sehen zu können. Mit der einen Hand stützte er sich auf meine Schulter und wischte sich mit dem Handrücken der anderen die Lachtränen von den Wangen. »Dieses kleine Bürschlein scheint Humor zu haben«, stellte Konrad Trindl anerkennend fest.
Wohl auch vom vielen Alkohol beflügelt, war nun vollends die Angeberei ausgebrochen, und alle riefen durcheinander: »Bis diese kleinen Marschierer einmal so weit sein werden wie wir, haben wir doch dem Feind längst gezeigt, wo der Bartl den Most holt!«
»Klar, wir werden siegen! Ihr könnt dann die Siegesmeldungen anhören!«
»Der Führer hat doch gesagt, dass der Russlandfeldzug bald siegreich beendet sein wird!« Ich dachte an meinen Vater und zog es vor zu schweigen. Da hörte ich vom anderen Ende der langen Bank: »Wir wollen uns doch nicht drücken, wenn andere längst schon an vorderster Front kämpfen!« Hans Weber saß mir gegenüber und rief zurück: »Schorsch! Wenn du mir verraten kannst, wie man sich vor dem Barras drückt, dann zahle ich dir eine Mass Bier!«
Schallendes Gelächter übertönte sekundenlang alles andere, bis Max Kreitmeier ärgerlich feststellte: »So ein Blödsinn! Als ob einer von uns sich vor seiner Einberufung drücken könnte! Jeder weiß doch, was mit einem Drückeberger geschieht! So einer wird doch ohne viel Federlesens an die Wand gestellt und als ehrloser Volksverräter und Feigling erschossen!«
Nicht nur ich zuckte erschrocken zusammen, als ein mir unbekannter Mann von einem der Nachbartische laut kommentierte: »Genauso ist es! Und so soll es auch bleiben! Mein Sohn ist schon längst in Russland! Beeilt euch also und helft ihm beim Siegen!«
Nur wenige Sekunden herrschte betroffenes Schweigen an unserem Tisch, und Hans Weber beeilte sich zu sagen: »Sie sehen doch, dass wir auf dem Weg sind!« Julius Scheuer beendete die heikle Situation, indem er abwinkte: »Hans! Lass diesen alten Krauterer doch sagen, was er will! Der kann uns doch alle!« Wir wandten uns ab und unterhielten uns weiter, unsere jugendliche Sorglosigkeit gewann wieder die Oberhand. Später am Abend, kurz vor der Polizeistunde, bat uns der Wirt in die Gaststube: »Drinnen könnt ihr so lange feiern, wie ihr wollt. So jung kommt ihr alle nicht mehr zusammen, und die Ortspolizei wird wegen der Sperrstunde heute sicher für unsere künftigen Vaterlandsverteidiger ein Auge zudrücken.«
Nur wenige verabschiedeten sich. Auch ich blieb, und als wir sehr spät und auf etwas unsicheren Beinen auf den Marktplatz hinaustraten, konnten wir über den Dächern Grafings schon die heraufdämmernde Morgenröte erahnen.
Am Abend des 28. September 1941, fünf Tage nach meinem achtzehnten Geburtstag, betrat ich mit sehr gemischten Gefühlen das Gelände einer Kaserne der Kriegsmarine. Es war von einem hohen Maschendrahtzaun umgeben und lag auf offenem Gelände, nicht weit von der Stadt Buxtehude entfernt. Der erste Eindruck meines zukünftigen Aufenthaltsorts war mehr als ernüchternd. Die sauberen, grauen Baracken erinnerten mich unangenehm an die des RAD zu Hause, und als mir ein mürrischer Maat in der Schreibstube den Weg zu meiner Stube beschrieb, fühlte ich mich nicht nur wegen der langen Anreise mit der Bahn wie gerädert. Als zwölfter und letzter Ankömmling in meiner Bude bekam ich natürlich nur noch das Bett, das vom einzigen Fenster in dem muffigen Raum am weitesten entfernt stand.
Am nächsten Morgen ging es los: Die schrillende Pfeife eines Maates riss uns aus dem Schlaf. Nach dem Frühsport – bei dem wir nur unsere noch saubere Unterwäsche trugen – und einem nicht gerade als üppig zu bezeichnenden Frühstück in der Kantinenbaracke wurden wir zum Appell auf dem weiträumigen Kasernenhof befohlen. Wir waren etwa 300 angehende Rekruten, denen ein Oberbootsmann in beeindruckender Lautstärke befahl, in drei gleich starken Gruppen anzutreten, und zwar in einem zu ihm hin geöffneten Viereck. Jetzt machte sich die vormilitärische Ausbildung der HJ bemerkbar, und nur einige Ausbilder, die von ihrer Wichtigkeit sehr überzeugt zu sein schienen, traten laut brüllend in Aktion, während sich die geforderten Dreierreihen verhältnismäßig rasch zu bilden begannen.
Ein tadellos uniformierter Oberleutnant zur See trat aus einer der Schreibstuben. Der Oberbootsmann ging ihm in strammer Haltung einige Schritte entgegen, grüßte und machte Meldung. Der Oberleutnant erklärte: »Sie werden nicht hier bei uns eingekleidet, sondern bei der für Sie zuständigen Ausbildungseinheit in Bergen op Zoom. In einigen Tagen geht ihr Transport nach Holland!« An dieser Stelle machte der Marineoffizier eine Kunstpause und blickte prüfend an unseren schnurgerade ausgerichteten Reihen entlang. »Bevor Sie uns hier wieder verlassen, müssen wir versuchen, aus Ihnen einigermaßen brauchbare Marinesoldaten zu machen! Der Führer erwartet von jedem unbedingten Gehorsam und vollen persönlichen Einsatz zur Verwirklichung unserer großen Ziele!«
In den folgenden Tagen fragte ich mich wieder und wieder, ob es richtig gewesen war, sich freiwillig zur Kriegsmarine zu melden. Wir wurden in Gruppen eingeteilt, und wildwütige Ausbilder der Kasernenstammmannschaft, Gefreite, Obergefreite, Maate, hetzten uns in unserer Zivilkleidung mit unbeschreiblicher Härte über den Kasernenhof: »Still gestanden!«
»Die Augen links!« Oder: »Volle Deckung!«
»Sprung auf! Marsch, marsch!« Jeden Abend waren wir damit beschäftigt, unsere zwangsläufig stark verschmutzten Anzüge zu reinigen und unsere verschwitzte Unterwäsche zu waschen. Dabei hofften wir, dass sie trotz der schon beginnenden feuchten Herbst-kühle bis zum nächsten Morgen wieder trocken würde. Wir schliefen oftmals nackt, denn keiner von uns hatte damit gerechnet, so lange Zeit auf seine Privatkleidung angewiesen zu sein. Jeden Tag war Stubenkontrolle, und wehe dem Unglücksraben, dessen Bett nicht vorschriftsmäßig gebaut war oder in dessen Spind der Unteroffizier vom Dienst ein Stäubchen fand. Einige von uns fingen an, nachts laut zu träumen, und ich hoffte inständig, es möge in Holland besser für uns werden.
Endlich, erst sieben Tage später, begleiteten uns die Ausbilder in für die Kriegsmarine reservierten Eisenbahnwaggons nach Holland und übergaben uns am Bahnhof in Bergen op Zoom einigen feldgrau uniformierten Marinesoldaten. Wir wussten natürlich längst: Ab heute begann unsere Infanterieausbildung, die drei Monate lang dauern sollte.
Herbstlich milde Sonnenstrahlen übergossen die holländische Tiefebene mit warmem Licht, als wir, das kleine Köfferchen wie befohlen in der rechten Hand, laut singend an den Wachen vorbei durch das Kasernentor marschierten. Die gepflegten rotbraunen Klinkerbauten der ehemals niederländischen Kaserne strahlten auch im Inneren vor Sauberkeit. So hatte ich mir eine Kaserne der Kriegsmarine vorgestellt, und ich atmete wohl nicht als Einziger erleichtert auf, als ich mit elf anderen Rekruten in die uns zugewiesene Stube trat.
Schon am folgenden Morgen wurden unsere wohl etwas überzogenen Erwartungen im Keim erstickt. Die »Kammerbullen« bewiesen bei unserer Einkleidung Routine und ließen kaum einen von uns mit Einwänden wie »diese Stiefel sind mir zu groß – oder diese Drillichjacke ist für mich zu klein« zu Wort kommen. Die Antworten lauteten fast durchwegs: »Tauschen Sie doch die Stiefel mit einem anderen, Sie Flasche!« Oder: »Die Jacke passt schon, Sie Muttersöhnchen. Ihr Bauch ist zu dick! Das wird sich aber bald ändern!« Nach kaum drei Stunden waren wir alle schon damit beschäftigt, unsere Spinde – noch etwas unbeholfen – nach Heeresdienstvorschrift einzuräumen. Ein Gefreiter des Stammpersonals lief durch den langen Flur, und als er die Tür unserer Stube aufstieß, brüllte er: »Zivilkleidung ist unverzüglich und in tadellosem Zustand in die mitgebrachten Koffer oder Kartons zu verpacken! Jedes Gepäckstück ist in gut leserlicher Schrift mit der jeweiligen Heimatanschrift zu versehen! Das geht aber zack, zack! Bis morgen kann sich keiner dazu Zeit lassen, auch wenn er schnell noch ein Brieflein an Mutter dazulegen möchte! Morgen werdet ihr auf unseren Führer Adolf Hitler, auf Volk und Vaterland vereidigt! Dann machen wir hier stramme Marinesoldaten aus euch verweichlichten Waschlappen!« Schon schlug der Gefreite die Tür wieder zu. Der Ostpreuße Heinz Lücker hatte seinen Spind neben meinem. Er blinzelte mir zu und murmelte leise: »Dieser kleine Angeber wird zwar irgendwann vor Wichtigkeit platzen, aber die Fische werden ihn kaum zu fressen bekommen. Diese Typen bleiben doch immer auf sicherem Land.« Schon in Buxtehude hatte ich mich hin und wieder darüber gewundert, wie offen und vertrauensvoll Heinz zu mir sprach, und auch ich erzählte ihm mehr als anderen.
Am nächsten Morgen waren wir mit unseren feldgrauen Uniformen, durchwegs blank polierten Stiefeln, den Knobelbechern, und Stahlhelmen in offenem Viereck zur Vereidigung angetreten. Schon am Nachmittag nach diesem feierlichen Treueschwur, den wir vor einem Korvettenkapitän, unserem Kompaniechef und einigen Marineoffizieren leisten mussten, entpuppten sich einige unserer Ausbilder als einfallsreiche Sadisten. Heinz Lücker und ich waren der gleichen Gruppe zugeteilt und schienen mit unserem Gruppenführer einen Glücksgriff getan zu haben. Bootsmann Maiwald schrie zwar genauso laut wie die anderen Ausbilder über den Kasernenhof, doch unter seiner rauen Schale glaubten wir schon am ersten Tag seinen gutmütigen, vielleicht sogar nachsichtigen Kern erkennen zu können. Wir schätzten, dass er etwa drei, vier Jahre älter als wir sein mochte. Das schwarze Verwundetenabzeichen, das Band des Eisernen Kreuzes auf seiner Brust und dazu sein leicht hinkender Gang verrieten uns, dass er schon im Einsatz gewesen sein musste, bevor er hier als Ausbilder gelandet war.
Doch auch unser Infanterie-Ausbilder hatte den Ausbildungsplan genau zu befolgen, denn Kapitänleutnant Wolters sah alles. Unseren unnachsichtig strengen Kompaniechef nannten wir schon nach wenigen Tagen den »Schrecken der Nordsee«, denn er hatte die unangenehme Angewohnheit, unvermutet bei irgendeiner der Gruppen zu erscheinen, dabei jeden Mann genau zu beobachten und hart durchzugreifen: »Wollen Sie nicht oder können Sie nicht? Nur keine Müdigkeit vortäuschen, sonst muss ich Sie persönlich so lange schleifen, bis Sie die Englein singen hören!«
Eines Tages hingen dunkle Herbstwolken über den Niederlanden, als wir den »Schrecken der Nordsee« wieder einmal auf dem Übungsgelände hinter den Kasernenblöcken umherstolzieren sahen. Ich ahnte Schlimmes, als ich ihn direkt auf unsere Gruppe zukommen sah. Wir übten gerade das korrekte Vorbeigehen an Vorgesetzten in strammer Haltung. Kaleu Wolters war nur noch wenige Meter von uns entfernt, als er schrie: »Alles hört auf mein Kommando!«
Schon nach wenigen Minuten fühlte ich, wie mir der Schweiß von der Stirn lief und in meinen Augen brannte. Wir mussten nämlich in unseren grauen Drillichanzügen mit angelegten Gasmasken und vorgehaltenen Karabinern durch das feuchte Herbstgras robben. Das hieß, eng an die Erde geschmiegt sich so rasch wie möglich vorwärts zu bewegen. Durch den Filter der Gasmaske bekam ich kaum genügend Luft und hörte unseren Kompaniechef: »Das geht schneller! Einige von euch lahmen Enten glauben wohl, sie seien hier in einem Erholungsheim! Sprung auf! Marsch, marsch! Das Atmen auf Kriegsschiffen kann viel anstrengender sein als hier. Lernt also besser jetzt schon, sparsam zu atmen!« Heinz Lücker erzählte mir später, dass »dieser Arsch« ihn beim Robben mit dem Stiefel nach unten gedrückt und dabei halblaut gefragt habe: »Sie wollen sich wohl einen Heimatschuss einhandeln, weil Sie Ihr Hinterteil so zielgerecht darbieten?« Nach einer halben Ewigkeit entfernte sich der »Schrecken der Nordsee« endlich, nachdem er einige von uns mit verächtlichen Blicken bedacht hatte. Ich glaubte, dass seine stahlblauen Augen länger auf mir ruhten als auf meinen Kameraden.
»Gasmasken ab!« Die Stimme von Bootsmann Maiwald klang wie eine Erlösung. Heinz Lücker stand neben mir, als wir unsere Gasmasken von den Gesichtern zerrten. Wütend blickte er dem Offizier nach und raunte mir dabei halblaut ins Ohr: »Jetzt will er wohl die Gruppe Schmidt mit seinem Charme beglücken. Glaubt denn diese wandelnde Vogelscheuche, wir müssen demnächst in England landen, um dort mit unseren Knobelbechern und Karabinern nach London zu marschieren?«
Noch bevor ich antworten konnte, bemerkte ich Bootsmann Maiwald, der dicht hinter uns stand und leise feststellte: »Das möchte ich überhört haben, Lücker.« Laut wandte er sich an uns alle, die wir – immer noch schwer atmend – damit beschäftigt waren, unsere Gasmasken in den länglich-runden Blechbehältern zu verstauen. »Ihr könnt einen Halbkreis bilden und euch setzen.« Dieser hochwillkommenen Anordnung wollte ich gerade Folge leisten, als mich ein Wink Maiwalds zurückhielt: »Herr Kaleu Wolters scheint Sie besonders in sein Vaterherz geschlossen zu haben. Ich soll Sie fragen, ob Sie sein Aufklarer werden möchten.« Für alle anderen unhörbar fügte er leise hinzu: »Wehe Ihnen, wenn Sie es wagen sollten, dieses großzügige Angebot abzulehnen. Das würde für Sie hier künftig die Hölle auf Erden bedeuten.« Wieder laut fragte er: »Was kann ich Herrn Kaleu melden?«
In Sekundenschnelle wog ich die mir entstehenden Vor- und Nachteile gegeneinander ab, die mir durch die unmittelbare Nähe zum »Schrecken der Nordsee« entstehen würden. Dann stand ich stramm und meldete: »Diese Aufgabe übernehme ich gerne, Herr Bootsmann!«
Maiwald nickte mir kurz zu: »Dies und nichts anderes wird von Ihnen erwartet, Matrose Staller.«
Als am folgenden Tag meine Kameraden abends nach dem üblichen Kasernendrill damit beschäftigt waren, sämtliche Stuben, die Flure, die Duschen und auch die Toiletten aufzuklaren (reinigen), bevor der UvD kam, um sie zu inspizieren, musste ich mich bei Kaleu Wolters melden. Insgeheim fragte ich mich, ob ich etwa künftigen Strafmaßnahmen durch meine Tätigkeit als Aufklarer des Chefs entgehen könnte. Es war nämlich schon mehrmals sehr schlecht um unsere Nachtruhe bestellt gewesen, wenn der UvD in unserer Stube Staub- oder Schmutzreste in irgendwelchen Ritzen gefunden hatte und uns deshalb stundenlang über den Kasernenhof gejagt hatte.
Den Rat Maiwalds befolgend, ging ich nun mit blank gewienerten Knobelbechern, tadellos gereinigten Fingernägeln und sauberem Drillichanzug in den ersten Stock des Kasernenblocks und klopfte mit unguten Erwartungen an die Tür des Zimmers, hinter der unser allgewaltiger »Schrecken der Nordsee« wohnte.
Die Tür wurde schwungvoll geöffnet; ich stand stramm, grüßte vorschriftsmäßig und meldete mich zur Stelle. Zu meiner Überraschung benahm sich der Chef so freundlich zu mir, wie ich ihn niemals zuvor gesehen hatte. Er bat mich höflich in sein Zimmer, zeigte mir seine in einem großen Schrank hängenden Uniformen und die zu ihrer Pflege vorgesehenen Kleiderbürsten, seine Stiefel, die eleganten Schuhe der Ausgehuniform und seine sonstigen persönlichen Gegenstände, denen ich in den nächsten beiden Monaten meine Aufmerksamkeit zu schenken hatte. Von Maiwald wusste ich, dass der Chef besonderen Wert auf blankes Schuhwerk legte, und kannte auch schon einige Besonderheiten meines Vorgesetzten, die ich unbedingt beachten sollte. Am Ende unserer infanteristischen Ausbildung in Holland war ich selbst überrascht, wie gut es mir gelungen war, den gestrengen »Schrecken der Nordsee« fast immer zufrieden zu stellen.
Einige Tage vor dem Weihnachtsfest des Jahres 1941 – dieser strenge Winter war auch in den Niederlanden ungewöhnlich kalt – wurden wir von einem Ärzteteam der Kriegsmarine sehr gründlich untersucht. Als einer der Letzten stand ich, nur mit meiner Unterhose bekleidet, in der mäßig beheizten Turnhalle der Kaserne vor dem Oberstabsarzt, der mir mit anerkennendem Kopfnicken einen Schein überreichte, auf dem ich als abschließende Bemerkung lesen konnte: »GFU«.
Vorschriftsmäßig stramm stehend fragte ich: »Bitte Herrn Oberstabsarzt fragen zu dürfen. Was bedeutet GFU?«
»Mann! Darauf können Sie stolz sein! Dieses Ergebnis steht nur bei sehr wenigen. Mit Ihrem seltsamen Beruf können Sie natürlich nicht in einem Maschinenraum oder an Elektromaschinen dienen. Aber für die seemännische Laufbahn auf einem U-Boot sind Sie gesundheitlich hervorragend geeignet. GFU bedeutet Geschützführer Unterseeboot!« Vor Schreck fiel mir nichts anderes ein: »Aber ich möchte doch über Wasser fahren. Dort unten bekomme ich ganz sicher Platzangst und gefährde dadurch andere. Ich halte mich für die U-Boot-Waffe für völlig ungeeignet.«
Die bisher zur Schau gestellte Freundlichkeit des Oberstabsarztes war wie weggeblasen: »Schweigen Sie!«, rief er laut und lenkte dadurch die Aufmerksamkeit aller Umstehenden auf uns. »Wo Sie für Führer, Volk und Vaterland eingesetzt werden, bestimmen nicht Sie! Für irgendwelche Sonderwünsche ist die Kriegsmarine nicht zuständig. Wir alle haben unsere Pflicht dort zu erfüllen, wo wir hingestellt werden! Wegtreten!«
Schon am folgenden Morgen wurden wir am Bahnhof in Bergen op Zoom erneut in einige Eisenbahnwaggons gesetzt. Keiner von uns hatte von der holländischen Stadt viel zu sehen bekommen, denn wegen eines Falls von Scharlach in einem der Kasernenblöcke war wochenlang für alle Ausgangssperre angeordnet worden. Und als jetzt unsere Waggons angekoppelt wurden, herrschte Schneetreiben, das sich wie ein undurchdringlicher weißer Vorhang vor alle Fenster legte, sodass wir wieder nichts sahen.
Während der zögerlichen Fahrt in östlicher Richtung klarte es auf, und gegen Abend rief einer der Matrosen: »Wir überqueren die Ems! Jungs, wir sind fast schon wieder zu Hause!«
Bald danach hielten wir. Wir waren in Leer in Ostfriesland. Innerhalb kürzester Zeit waren alle auf dem Bahnhofsvorplatz angetreten und marschierten singend hinter den blau uniformierten Maaten zum Durchgangslager der Kriegsmarine. Es bestand aus einigen umzäunten unscheinbaren Baracken und lag auf freiem Feld außerhalb der Stadt. Nach dem Abendessen wurden wir wie immer auf die Stuben verteilt. Heinz Lücker lag neben mir, und jeder mutmaßte bis spät in die Nacht: Wann und wo würden wir nun wohl endlich für den Feindeinsatz auf Schiffen ausgebildet? Ich war der Stubenälteste und kassierte daher gegen Mitternacht von einem Gefreiten eine üble Rüge, denn auch unsere Stube hätte gefälligst die Nachtruhe einzuhalten: »Euer lautes Geschwafel ist überall zu hören! Schluss damit!«
Am Morgen stampfte ein Maat mit lauter Trillerpfeife durch den Barackenflur und rief: »Jungs! Seid froh darüber, dass ihr hier bei uns so friedlich schlummern konntet. Unsere Landser holen sich zurzeit in Russland erfrorene Glieder. Alles raustreten! Nach dem Frühstück die grauen Klamotten in tadellosem Zustand abliefern! Ihr werdet neu eingekleidet!«
Am Mittag bewunderten wir uns in den schmucken blauen Ausgehuniformen gegenseitig. Endlich Ausgang! Endlich wieder freundliche Zivilisten sehen. Endlich wieder mit jungen Mädchen lachen und plaudern … In kleineren Gruppen drängten wir zum Lagertor. Zuvor jedoch wurde jeder von uns in einer Bude neben der Wachstube von ein paar grinsenden Bootsmännern und Maaten genau inspiziert. Ein großer, schlanker, etwa 22 oder 23 Jahre alter Maat mit einer hässlichen, frisch aussehenden roten Narbe am Kinn erklärte: »Bevor wir euch brünftige Hirsche auf die zivilisierte Menschheit loslassen können, müssen wir jeden von euch genau unter die Lupe nehmen. Anständig und vorschriftsmäßig zu grüßen habt ihr ja gelernt. Wir möchten auch in dieser Hinsicht keinerlei Klagen zu hören bekommen.«
Vor mir stand der in Wien beheimatete Franz Plaschok in der Warteschlange. Er lag mit uns in der Stube. Der Maat befahl: »Fingernägel vorzeigen! Schuhe ausziehen und Socken runter!« Dann begann der Maat laut zu schnuppern. »Nun seht euch diesen Kerl an! Die Duschen wurden extra für euch geheizt, und dieses Ferkel möchte mit Stinkefüßen Ausgang bekommen. Habt ihr schon mal so was gerochen?« Er blickte Plaschok vorwurfsvoll an. »Füße waschen und frische Socken anziehen! Heute wollen wir mal gnädig sein. Ihr Ausgangsschein bleibt hier bei mir liegen. Sie können später noch einmal bei mir vorsprechen – aber dann wie ein deutscher Matrose! Treten Sie ab!« Sofort wandte er sich an mich. »Kamm vorzeigen!« Wie alle anderen vor mir musste auch ich den Hosenlatz meiner Ausgehuniform öffnen und herunterklappen, damit meine Unterhose auf ihre Sauberkeit überprüft werden konnte. Anschließend war das jedem von uns überlassene Kondom vorzuzeigen. »Wir können euch doch unserer Stammkundschaft in der Stadt nicht schutzlos überlassen! Wehe demjenigen von euch, der sich irgendetwas einfängt! So etwas ist Wehrkraftzersetzung, und die wird bekanntlich strengstens geahndet! Dabei wird keiner froh. Deshalb also: unbedingte Sauberkeit und Hygiene in jeder Lebenslage!«
Zum dritten Kriegsweihnachtsfest im Marinedurchgangslager Leer bekam jede Stube einen äußerst dürftigen Weihnachtsbaum zugeteilt. Heinz Lücker erzählte uns, er habe auf einem seiner ausgedehnten Spaziergänge eine einsam gelegene Baumschule mit prachtvollen Tannenbäumchen entdeckt. »Dort hätten wir große Auswahl!« Sogleich stand der Entschluss unserer Stubenbesatzung fest: »Wenn wir schon nicht zu Hause feiern dürfen, weil diese Heinis immer noch nicht wissen, wohin Sie uns abkommandieren wollen, dann wollen wir wenigstens einen anständigen Baum haben!« Lücker meinte noch: »Wenn jemand dort draußen zugegen sein sollte, dann können wir ja zusammenlegen und uns ein Bäumchen kaufen!« Es war jedoch niemand in dieser Baumschule vorzufinden, und eine Stunde später beging ich als Stubenältester mit dem Absägen eines sehr sorgsam ausgewählten Tannenbäumchens den einzigen Diebstahl meiner jungen Jahre.
Am anderen Morgen riss ein Matrose aus einer Nachbarbaracke unsere Stubentür auf und warnte: »Die kommen gleich zu euch. Es wird ein gestohlener Weihnachtsbaum gesucht.« Blitzschnell riss Lücker das Tannenbäumchen aus dem Ständer und hastete damit aus der Stube: »Ich versteck’ das Ding im Nebenraum der Baracke in der Dachnische! Stellt ihr inzwischen das Fichtenbäumchen wieder an seinen Platz!« Rasch verschwand er und war im Handumdrehen wieder bei uns. »Die finden das Bäumchen niemals. Was ein anständiger ostpreußischer Gärtner versteckt hat, bleibt unentdeckt.« Horst Krause und ich waren gerade damit fertig geworden, das magere Fichtenbäumchen wieder auf dem Tisch zwischen den beiden Bettreihen unserer Stube zu platzieren, als auch schon die Tür aufgerissen wurde. Oberbootsmann Heinisch und ein Herr in grüner Lodenjoppe schauten forschend in unsere Stube. Wir standen alle stramm und blickten die beiden so fragend wie nur irgend möglich an. Ich jedenfalls war erleichtert, als sich der Bootsmann an seinen Begleiter wandte: »Nun, Herr Manser, das war die letzte der hier zurzeit belegten Stuben. Die anderen sind alle verschlossen. Unsere Matrosen sägen doch keine fremden Tannen um! Mir war dies vorher schon klar.«
Am 9. Januar 1942 betrat ich an der Seite von Heinz Lücker und vier anderen Kameraden aus Bergen op Zoom in Gotenhafen bei Danzig das Deck der »Wilhelm Gustloff«. Wir wussten alle, dass mit diesem Schiff der NS-Organisation »Kraft durch Freude« vor dem Krieg verdiente Volksgenossen in die Fjorde Norwegens, zu sehenswerten Küstengebieten Europas und in entferntere Gegenden gefahren waren. Jetzt diente es der 2. U-Boot-Lehrdivision als schwimmende Kaserne. Es erschien mir riesengroß.
Da ich als gelernter Orgelbauer keinen technischen Beruf hatte, war ich genau wie Lücker für die seemännische Laufbahn auf einem U-Boot vorgesehen. Wegen unseres selten guten Gesundheitszustandes und unserer ärztlich bestätigten ausgezeichneten Sehkraft sollten wir als Ausguck auf dem Turm und die anderen Aufgaben der Brückenwache ausgebildet und mit dem Gebrauch der Bordkanone vertraut gemacht werden. Es überraschte uns, dass wir auf einem der unteren Decks, knapp über der Wasserlinie, in einer Zweibett-Außenkabine untergebracht wurden. Hier wohnte unsere Ausbildungskompanie. Rasch und wie schon oftmals geübt, leerten wir unsere Seesäcke und ordneten unsere Klamotten genau nach Vorschrift in die Spinde. Lücker war kurz vor mir fertig, prüfte sein Werk mit kritischem Blick, beobachtete dann kurz mich und bemerkte anschließend zufrieden: »Toni, uns beide kann wohl auch hier kein UvD am Wickel kriegen! Hoffentlich ist nicht dieser unsympathische Maat, du weißt schon, dieses kantige Flachgesicht, das wir vorhin grüßen mussten, in unserer Kompanie.« Mir war dieser Mann auch aufgefallen, und ich musste Lücker zustimmen. Dann aber meinte ich: »Egal, Heinz. Vor allem ist gut, dass wir zwei hier zusammen sind. So können wir uns gemeinsam bemühen, gut durchzukommen.«
Einige Tage lang kam uns das Gewirr von Längsund Quergängen wie ein Labyrinth vor. Wir verwechselten mehrmals die Zwischendecks und fanden nicht ohne Schwierigkeiten zu den Unterrichtsräumen. Einmal mussten wir sogar unseren Speisesaal suchen.
Von nun an übten wir täglich beinahe bis zum Erbrechen, sichere Seemannsknoten in Rekordzeit zu knüpfen, lernten Leinen punktgenau zu werfen und mussten uns anhand zahlreicher Schautafeln die verschiedenartigen deutschen und gegnerischen Kriegsschiffe sowie ihre Bewaffnung und Kampfkraft einprägen. Auch Flugzeugtypen und ihre Reichweiten mussten wir auf Anhieb erkennen, wobei sich unsere Ausbilder nicht immer als geduldig erwiesen. Ebenso unermüdlich trainierten wir die visuelle Verständigung mittels Winkfähnchen oder Morselampen von Schiff zu Schiff, kurzum alles, was auf einem U-Boot-Turm erforderlich war. Auch hier auf der »Wilhelm Gustloff« war jeder Ausbilder ein König, und fast alle von ihnen bereiteten uns in einem überaus einprägsamen und rauen Umgangston auf das vor, was uns erwartete. »Auf einem U-Boot ist jedes Besatzungsmitglied auf das Können und die Zuverlässigkeit seiner Kameraden angewiesen. Ganz egal, an welcher Stelle des Bootes er eingesetzt ist!«
Morgens, jeden Tag pünktlich um sechs Uhr, riss uns die schrillende Trillerpfeife des UvD aus dem Schlaf: »Raus aus eurem Scheißkorb!« Sofort mussten wir alle in unseren knielangen weißen Nachthemden vor den Kojen strammstehen. Wehe dem Unglücksraben, dem dies nicht schnell genug gelang. »Verschlafenes Muttersöhnchen! 30 Liegestützen!« Vor allem das kantige Flachgesicht demonstrierte gerne seine Macht.
Lücker, das wusste ich schon aus Unterhaltungen in Bergen op Zoom, entstammte wie ich einer Familie, deren Angehörige man nicht gerade als überzeugte Nationalsozialisten bezeichnen konnte. Wir beide waren inzwischen enge Freunde geworden, die einander rückhaltlos vertrauten. Wenn wir nicht zu müde waren, flüsterten wir auch nach der befohlenen Nachtruhe, er aus der oberen und ich aus der unteren Koje, leise miteinander und tauschten zum Beispiel Kindheits- und Jugenderinnerungen aus. So erzählte ich ihm, dass ich im März 1932 als Neunjähriger mit meiner zwei Jahre jüngeren Schwester Lisa und zusammen mit meinem Vater im Auto von dessen SPD-Freund über Land gefahren war. Zwar war es wirklich keine Spazierfahrt gewesen, trotzdem hatten wir Kinder riesigen Spaß dabei, in den Dörfern SPD-Flugblätter gegen die Wahl Hitlers aus den Autofenstern zu werfen. Schon im Jahr darauf wurde mein Vater deshalb einige Zeit in sogenannte »Schutzhaft« genommen, und Lücker wusste, dass es mir unerklärlich war, wie mein Vater sich dazu hatte überreden lassen, als überzeugter Sozialdemokrat schließlich dennoch in die NSDAP einzutreten.
Von Heinz wusste ich, dass seine Eltern in Allenstein mit einer jüdischen Arztfamilie befreundet gewesen waren. Als diese Familie über Nacht plötzlich verschwunden war, bekam sein Vater, ein Katholik, wegen judenfreundlicher Äußerungen ganz ähnliche Schwierigkeiten, wie mein alter Herr sie erfahren hatte.
Dennoch glaubten wir beide, dass wir diesen Krieg gewinnen würden. Tägliche Erfolgsmeldungen, die nicht nur von der U-Boot-Waffe kamen, bestärkten uns in diesem Glauben und auch darin, dass wir den Krieg für gerechtfertigt hielten, denn der Friedensvertrag von Versailles, vielfach »Schandfrieden« genannt, konnte einfach nicht hingenommen werden. Solche und ähnliche Gedanken diskutierten wir oft, sobald wir ein wenig Zeit hatten.
Unnötige Schikanen unserer Ausbilder stießen uns beide gleichermaßen ab. Immer wieder kam es vor, dass trotz aller Sorgfalt einer der Kameraden seinen Spind nicht vorschriftsmäßig eingeräumt hatte. Der UvD, vor allem der allseits gefürchtete Bootsmaat Hansen, warf bei abendlichen Kontrollen so manches Mal den gesamten Inhalt eines Spindes auf den Boden. Der bedauernswerte »Übeltäter« musste dann sämtliche Gegenstände in Windeseile in seinen Seesack packen, ihn im Laufschritt an Oberdeck schaffen, dort entleeren und anschließend, selbstverständlich auch im Laufschritt, jedes Stück einzeln wieder herunterbringen und nach Vorschrift in seinen Spind räumen. Auf den Zwischendecks standen Beobachter der Stammmannschaft und beschimpften den Mann zusätzlich. Einige Rekruten brachen schon während dieses Dauerlaufes erschöpft zusammen. Uns allen fiel natürlich auf, dass bei so einem »Flaggeluzzi«, wie unsere Ausbilder diese Prozedur nannten, niemals ein Offizier zu sehen war. Lücker und ich waren peinlich darauf bedacht, dass unsere Spinde stets aussahen wie auf einem Reklamefoto der Kriegsmarine, und waren deshalb glücklicherweise nie betroffen.
Jeden Freitag musste unsere Kompanie, immer laut singend, an Land zu einem in der Nähe des Ankerplatzes unserer schwimmenden Kaserne errichteten Gebäude marschieren. Der schlechte Ruf, der diesem Ort vorausgeeilt war, bestätigte sich schon am ersten Freitag. Die raubeinigen Ausbilder dort bezeichneten uns mit schier unerschöpflichem Wortschatz als Muttersöhnchen, Schlappschwänze und was sonst auch immer.
Ich war nicht gerade wasserscheu, aber es kostete mich doch einige Überwindung, mich im Wasser des sogenannten Tauchtopfes bis zum etwa zehn Meter tiefen Grund absinken zu lassen. Zuvor mussten wir lernen, wie man den Dräger-Tauchretter fachgerecht umschnallt. Dabei handelte es sich um eine flache Schwimmweste, die mit einer integrierten Mini-Sauerstoffflasche sowie einer Nasenklemme und einem Mundstück versehen war. »Ihr wollt doch nicht ersaufen, wenn euer Boot verunglückt! Mit dem Tauchretter gibt es immer Hoffnung!«
Der Ausbilder schrie einen Kameraden an: »Sie Feigling sind ja immer noch hier oben im Trockenen! Ich habe Sie doch hier an der Sicherheitsleine! Wenn Ihnen dort unten bei den Haifischen unwohl werden sollte, dann ziehen Sie einfach. Aber wehe, wenn Sie versuchen sollten, mir etwas vorzuflunkern. Ich kann Sie zwar jederzeit wieder hochziehen, aber wenn Sie Unwohlsein nur vortäuschen, lasse ich Sie schleifen, bis Sie gern wieder gesund sind! Los, Bleigürtel anlegen, damit Sie runterkommen! Zuvor den Nasenklemmer des Drägers an Ihrem krummen Riechkolben befestigen, damit kein Wässerchen in Ihren Luxuskörper eindringen kann! Jetzt noch das Mundstück für die Sauerstoffzufuhr rein, ab mit Ihnen!« Einen anderen hörte ich brüllen: »Möchten Sie Langweiler sich etwa eine Sonderbehandlung verdienen? Wir können später mit Ihnen so lange strafexerzieren, bis Ihnen das Wasser im Arsch kocht!« Solche und ähnliche Sprüche hörte ich überall, und als ich an der Reihe war, zwang ich mich, rasch zu tauchen. Unten waren das Deck und der Turm eines U-Bootes nachgebildet. Ich hatte den Turm einmal zu umrunden, und weil mich der Bleigürtel unten hielt, musste ich trotz des aufwärts strebenden Tauchretters nach oben gezogen werden. An diesem Abend kamen Lücker und ich zu dem Schluss, dass der Tauchretter im Ernstfall wohl mehr ein psychologisches als ein real wirksames Rettungsmittel wäre. Und es gab weitere schlechte Nachrichten: Beide hatten wir aus Briefen unserer Mütter erfahren, dass auch unsere Väter einberufen worden waren; der Vater von Heinz zur Infanterie, meiner zu den Gebirgsjägern.
An anderen Freitagen wurde im Tauchtopf mit uns geübt, wie man aus der Zentrale eines nicht allzu tief auf Grund liegenden Bootes aussteigt. Dazu gingen wir innerhalb des Gebäudes drei Stockwerke nach unten. Dort öffnete man für uns ein Schott, das ist eine wasserdicht verschließbare und druckfeste Stahlluke zwischen den einzelnen Abteilungen eines Bootes, und wir befanden uns in einem engen Raum, der der Zentrale eines U-Bootes nachgebildet war. Natürlich waren wir in der zuvorkommenden Ausdrucksweise unserer Ausbilder bestens darauf vorbereitet, was jetzt auf uns zukam: Je drei Mann stellten sich mit ihren Tauchrettern rechts und links neben dem Luftsüll (ein vom zentralen Luk in die Zentrale reichendes Stahlrohr) in Bereitschaft. »Strengste Disziplin! Keiner darf drängeln. Wir lassen jetzt Wasser eindringen. Dabei wird die Luft komprimiert, und die Köpfe bleiben neben dem Luftsüll in der dort zusammengepressten Luft über Wasser. Erst wenn das Turmluk über euch aufspringt, könnt ihr schön einer nach dem anderen hier in dieses Rohr und dann nach oben tauchen! Also, keine Angst und unbedingt Nerven behalten! Ist schon tausendmal geübt! Auch Ihr werdet lernen, wie man aus einem verunglückten U-Boot aussteigen kann!« Ich fühlte meinen Herzschlag wie noch selten zuvor.
Als ich endlich aus der Luftblase unter dem Luftsüll hindurchtauchte und nach oben schwebte, fühlte ich mich mehr als nur erleichtert. Am darauf folgenden Freitag mussten wir ohne Tauchretter aussteigen. Zuvor jedoch wurde uns eingeschärft, beim Auftauchen mehrmals die Luft aus unseren Lungen zu pressen und uns dadurch den verschiedenen Druckverhältnissen anzupassen – zur Vermeidung innerer Verletzungen.
Die Samstage nannten wir Schleiftage. Man jagte uns im eiskalten Januar des Jahres 1942 in unseren dünnen Drillichanzügen mit Gepäck und Karabinern durch Eis und Schnee. Wir sollten auf diese Art so widerstandsfähig gemacht werden, wie man es auf einem U-Boot zu sein hatte. Am dritten dieser Schleiftage befahl Bootsmann Kruse plötzlich: »Gasmasken aufsetzen!« Dann mussten wir zehn Kilometer laufen. Beständig und nicht allzu schnell immer hinter Lücker laufend, passierte ich einige Streckenposten auf der mir endlos scheinenden Wegstrecke, kämpfte dabei gegen aufkeimende Übelkeit und erreichte endlich völlig erschöpft das Ziel. Dort wartete Kruse in seinem warmen Wintermantel auf uns, und ich riss mir, ohne seinen Befehl abzuwarten, wütend die Gasmaske vom Gesicht. Lücker und ich blickten beide staunend zu den uns folgenden Kameraden zurück, konnten vor Überanstrengung kein Wort sprechen und auch nicht verstehen, was Kruse uns zurief. Beide konnten wir kaum glauben, dass wir unter den Ersten am Ziel angelangt waren. Einige Kameraden waren auf der Strecke umgefallen und liegen geblieben. Nur unter Aufbietung unserer letzten Kräfte konnten wir sie an Bord der »Wilhelm Gustloff« zurückbringen.
Beim Abendessen im Speisesaal wurde gemunkelt, dass Kruse zu Kaleu Bornstein befohlen und wegen dieses Gewaltmarsches zur Rechenschaft gezogen worden sei. Für uns änderte das allerdings nichts, auch in den folgenden Wochen blieb Kruse einer der gefürchtetsten Schleifer.
Aber für mich gab es doch eine Veränderung. Anscheinend war mir von Bergen op Zoom ein gewisser Ruf vorausgeeilt, denn nach einer der vielen Unterrichtsstunden hielt mich unser Zugführer Leutnant Unverzagt zurück und fragte höflich, ob ich nicht hier auf der »Gustloff« sein Aufklarer werden möchte. Unverzagt kannten wir alle als einen ruhigen, besonnenen Offizier, und deshalb sagte ich ohne langes Besinnen sofort zu. Als Aufklarer war ich ja nicht unerfahren. Es überraschte mich allerdings, als mich Unverzagt schon am ersten Abend, an dem ich mich bei ihm meldete, wegen einer ganz anderen Sache ansprach: »Matrose Staller, ich habe gehört, dass Sie ein ganz passabler Geiger sein sollen und in München bei einen Jugendorchester spielten. Stimmt das?«
»Jawohl, Herr Leutnant!«
»Menschenskind, Staller, weshalb sagen Sie denn nichts! Ich muss das so nebenbei von einem Ihrer Kameraden erfahren! Einer unserer Geiger im Offizierskasino wurde überraschend auf ein Boot abkommandiert. Vorschlag: Statt mit den anderen aufzuklaren, spielen Sie künftig am Abend bei uns. Einverstanden?«
»Jawohl, Herr Leutnant!«
»Besitzen Sie eine Geige?«
»Jawohl, Herr Leutnant. Sie liegt jedoch zu Hause.«
»Matrose Staller, bitte schreiben Sie noch heute an Ihre Mutter, sie möge doch so freundlich sein, die Geige rasch zu schicken. Ich verbürge mich persönlich dafür, dass Ihr Instrument wieder unbeschadet zu Ihnen nach Hause zurückgesandt wird, falls auch Sie unvorhergesehen abkommandiert werden sollten und dies deshalb nicht selbst besorgen können. Einverstanden?«
»Jawohl, Herr Leutnant!«
Lücker freute sich mit mir und gestand freimütig, dass er es war, der mich heute unserem Zugführer als Musiker empfohlen hatte. Während der folgenden drei Monate entging ich durch meine Mitgliedschaft im Quartett des Offizierskasinos auf der »Wilhelm Gustloff« so mancher Abendschikane der Ausbilder. Mich wunderte immer wieder, dass unsere Offiziere diese vielen Strafmaßnahmen stillschweigend zu dulden schienen und sich unwissend gaben. Uns wurde zwar immer wieder klargemacht, dass wir als künftige U-Boot-Fahrer besonders hart ausgebildet werden mussten, aber dieses Flaggeluzzi und ähnlicher Unsinn hatten meines Erachtens damit nur wenig zu tun. Einmal hörte ich Bootsmaat Hansen: »Treppenlaufen vor dem Einschlafen macht hart, Sie Mädchen. Später auf Ihrem U-Boot werden Sie mir dafür dankbar sein!« Gegen derartige Willkürakte waren wir völlig wehrlos. Auch deshalb fühlte ich mich als von den Offizieren geachteter Musiker geradezu wohl und genoss auch hin und wieder ein gutes Glas Wein oder Sekt in der Offizierskantine.
Am Ende unseres dreimonatigen Aufenthalts auf dem ehemaligen KdF-Schiff wurden wir alle fast gleichzeitig in sämtliche Himmelsrichtungen verstreut. Mit ein paar Kameraden – Lücker und ich freuten uns, dass wir weiterhin zusammenbleiben konnten – fuhr ich nach Swinemünde zum Geschützführer-Lehrgang. Vor unserer Abreise schenkte mir Leutnant Unverzagt ein Exemplar des Buches »Wir hielten Narvik«. Als Widmung hatte er in seiner klaren Handschrift darin vermerkt: »Trotz allem Pech ein fröhlich Lied; nun Schicksal schlag nur zu. Wir werden seh’n, wer früher müd’, ich oder du. In Dankbarkeit Ihr Leutnant Unverzagt.« Ich sah den von mir sehr geschätzten Offizier an diesem Abend zum letzten Mal. Am 26. Juni 1944 wurde er mit seinem Boot U 719 westlich von Nordirland vom britischen Zerstörer »Bulldog« mit Wasserbomben versenkt.
In Swinemünde wurden wir auf dem Handelsdampfer »General Osario«, der im Hafen ankerte, in Vier-Mann-Kabinen eingewiesen. Lücker und ich gehörten derselben Fünfzehn-Mann-Gruppe an, und er wohnte in meiner Nachbarkabine. In den folgenden Tagen wurden wir theoretisch mit allen Einzelteilen, der Reichweite sowie der Handhabung und Pflege von 10,5-cm-Geschützen sowie kleineren Kanonen vertraut gemacht. Zudem konnte schon bald jeder von uns die an Bord mitgeführten Handfeuerwaffen wie Maschinengewehre oder Maschinenpistolen fast schon mit verbundenen Augen zerlegen und pflegen. Dies hielt jedoch unsere Schleifer nicht davon ab, uns weiterhin »hart zu machen«. Schon bei geringen Verstößen und noch vor unserer ersten Schießübung lernten einige von uns das Gewicht der Granaten sehr gut kennen; es waren nicht weniger als 45 Kilogramm. Eines Abends traf es auch mich.
Bootsmaat Birkdorn fühlte sich kurz vor dem Zapfenstreich von mir nicht zackig genug gegrüßt, als ich mit Lücker und einigen Kameraden aus der Stadt zurückkehrte. Zur Strafe musste ich mit einer Granate in meinen Armen »Häschen-Hüpf« spielen, das bedeutete, einmal das gesamte Oberdeck hüpfend zu umrunden, und zwar in der Hocke. Birkdorn ging langsam neben mir her und wurde nicht müde, mich mit bösen Bemerkungen zu überschütten. Als ich mich gegen Ende der Runde nur noch mit letzter Willensanstrengung aufrecht halten konnte, rief er: »Zentnerschwere Weiber stemmen, das könnt ihr! Aber so einen kleinen Liebesgruß an unsere Gegner umarmen, ist euch zu schwer! Möchten Sie jetzt etwa schlappmachen, Matrose Staller? Das rate ich Ihnen nicht! Ich müsste mir ansonsten die ganze Nacht für Sie Zeit nehmen! Dreimal dürfen Sie raten, wem von uns beiden dies schlechter bekommen würde!« Wütend biss ich meine Zähne zusammen. Endlich an der zuvor bestimmten Ziellinie angelangt, bemühte ich mich, die schwere Granate so leise wie möglich auf dem Deck abzulegen. Birkdorn ließ mich dabei keine Sekunde aus den Augen. Mehrere Kameraden waren vor mir bei dieser Prozedur schon umgekippt. Doch obwohl auch mir die Knie zitterten und ich schwer atmen musste, fühlte ich mich in diesem Augenblick stark.
Wir hatten an den Kanonen alle Bedienungsgriffe, das Zerlegen und Zusammenbauen sowie das Anvisieren von Zielen geradezu bis zum Erbrechen geübt, bevor wir erstmals auf verschiedenen kleinen Kanonenbooten auf die ruhige Ostsee hinausfuhren. Dort trafen wir einen Schlepper, der in gebührendem Abstand ein gelblich weißes Netz als Zielscheibe hinter sich herzog, das auf einem Holzkahn aufmontiert war. Unser Boot sollte den ersten Kanonenschuss auf diese Attrappe abgeben. Durch meine optische Visiereinrichtung zielend, gab ich die Werte an. Als ich das Kommando »Feuer frei!« hörte, mich im Ziel glaubte und auf den Abschussknauf schlug, krachte der Schuss. Staunend bemerkte ich, wie das kleine Boot den kräftigen Rückstoß der Kanone abfederte. Dann sah ich, dass gleichzeitig mit dem dröhnenden Knall etwa auf halber Strecke zwischen Schlepper und Ziel eine weiße Wasserfontäne in den grauen Wolkenhimmel spritzte.
Unser Gruppenführer Bootsmann Kerner stand hinter mir und begann sofort zu toben: »Wollt ihr wohl anständig zielen, ihr Saukerle?« Der etwa 30 Jahre alte Mann war ein altgedienter Marinesoldat, mittelgroß, untersetzt und wirkte grobschlächtig. Er brülle weiter: »Seid ihr denn total verrückt geworden? Ihr habt mit eurem ersten scharfen Schuss diesen unschuldigen Schlepper, den Stolz unserer Ostseeflotte, fast auf den Meeresgrund befördert!« Er stemmte beide Arme in seine breiten Hüften und konnte sich kaum wieder beruhigen. »Das wird ein böses Nachspiel für euch Schlappschwänze haben! Wiederholung! Diesmal aber anständig! Das ist ja zum Mäusemelken mit euch Schlumpschützen. Laden! Feuer frei!« Als ich dieses Mal mit meiner Hand auf den Abschussknauf schlug, wurde ein Treffer gemeldet, der unseren Gruppenführer allerdings auch nicht besänftigte.
Am Abend folgte die unvermeidliche und angekündigte »Sonderbehandlung« zur Strafe. Dann sanken wir Angehörigen der Kerner-Gruppe erschöpft in unsere Kojen. Nachts sah ich im Traum den Schlepper in Flammen stehen und schreckte aus dem Schlaf, als die Trillerpfeife des UvD durch die Gänge schrillte. Bootsmaat Müller wirkte an diesem Morgen irgendwie vergnügt, wir konnten uns kaum erklären, weshalb der ansonsten so bärbeißige Maat heute einen beinahe friedfertigen Eindruck machte.
Eine Stunde später wurde uns klar, was uns heute erwartete. Keiner hatte bisher dem kaum wahrnehmbaren leichten Schwanken unseres im Hafen fest vertäuten Mutterschiffes größere Bedeutung beigemessen. Jetzt befielen mich und wohl auch viele der anderen dunkle Vorahnungen, als wir auf Deck über die sturmgepeitschte Ostsee blicken konnten. Kerner trieb uns noch eiliger als sonst über die Gangway in das Kanonenboot, und kaum war der Letzte unserer Gruppe an Bord, da legten wir auch schon ab und nahmen Kurs auf die offene See. Breitbeinig stand ich an meinem Platz neben der Kanone am Bug, blickte hin und wieder in die angespannten Gesichter meiner Kameraden von der Bedienungsmannschaft und hielt mich an der Reling fest. Kaum hatten wir das ruhige Wasser des Hafenbeckens verlassen, da begann unsere Nussschale zu tanzen. Wenn der Bug sich senkte und sich gegen die aufgewühlte See stemmte, übersprühten uns immer wieder kalte Wasserschleier. Die dunkelgraue Wolkendecke über uns schien von unsichtbaren Händen ohne Unterlass in alle Himmelsrichtungen gezerrt zu werden. Dabei fühlte ich mich einmal ruckartig, dann wieder sanfter hochgehoben, um danach nach links, rechts, vorwärts oder auch nach hinten abzusinken. Immer fester umklammerte ich die Reling, fühlte, wie mir abwechselnd kalt oder heiß wurde und mir der Schweiß auf die Stirn trat. Ich war tief enttäuscht, als ich schon nach wenigen Minuten krampfhaft schluckend gegen meinen rebellierenden Magen ankämpfen musste. Ich dachte: »Beginnende Seekrankheit? Wie soll das auf einem U-Boot werden! Gleich muss ich mich übergeben! – Nein, Toni, dass darfst du auf keinen Fall!« Ich konzentrierte mich. Als ich jedoch Lücker einige Augenblicke später neben mir in seinem Mageninhalt auf den Planken liegen sah, überkam auch mich Brechreiz, und mein Frühstück drängte nach oben. Lücker jammerte: »Ich werde gleich sterben. Meine Glieder sind schon bleischwer. Kameraden, ich muss sterben!« Kerner stand mit weit gespreizten Beinen federnd neben uns, stieß Lücker mit seinen Schuhspitzen mehrmals in die Seiten und brüllte zornig: »Beherrschung, Mann! Stehen Sie endlich wieder auf!«
Der Kommandant des Bootes, Oberbootsmaat Kudowsky, ein älterer Mann mit grau melierten Schläfen, verließ nun seinen Platz auf der Brücke. Er blickte drohend und spöttisch in die Runde: »Nun seht euch diese Weichlinge an! Ihr wollt deutsche Matrosen sein?« Ein unbeschreiblich verächtlicher Blick traf den immer noch auf den Planken liegenden Lücker. »Sterben könnt ihr noch früh genug! Aber nicht hier auf meinem Boot! Ein deutscher Matrose hat sich an ruppigen Seegang zu gewöhnen. Das gilt für alle! Aufstehen! An die Kanone! Wir sind gleich am Ziel!« Oberbootsmaat Kudowsky nickte Kerner kurz auffordernd zu, wandte sich um und ging mit sicherem, breitbeinigem Seemannsgang über das wankende Deck zurück an seinen Platz. Kerner tobte indessen weiter: »Jetzt haben wir endlich einmal Verhältnisse wie auf einem U-Boot im Einsatz, und ihr müden Kerle versucht schlappzumachen! So etwas gibt’s doch nicht! So eine gute Gelegenheit zum Üben haben wir nicht alle Tage. Backbord voraus sehe ich schon immer wieder unser Ziel aus den Wellen auftauchen. – Laden! Feuer frei!«
Noch heute ist mir nicht klar, wie ich meine Übelkeit bezwingen konnte. Als wir nach zahlreichen Fehlschüssen und nur wenigen Treffern fast schon bei Dunkelheit endlich wieder längsseits unseres Mutterschiffes anlegten, wankte ich mit den anderen erschöpft an Deck. Staunend sah ich einige Kameraden, die miteinander lachten und scherzten und denen dieser Seegang offensichtlich nur wenig anhaben konnte. Im Gegenteil. Als ich und viele andere schon nach den ersten Essversuchen unsere Abendrationen von uns schoben, freuten sie sich ungeniert und verzehrten mit sichtlichem Wohlbehagen zusätzlich zu ihrem eigenen auch unseren Linseneintopf mit Würstchen.
Die von uns allen befürchtete Sonderbehandlung an diesem Abend unterblieb. Bevor ich endlich einschlafen konnte, bedrängten mich starke Zweifel, ob ich mich jemals an so starken Seegang würde gewöhnen können. Wir erholten uns zwar rasch wieder, doch waren wir deprimiert und sahen unserer Zukunft als Seeleute mit Bangen entgegen.
Auch am darauf folgenden Tag hielt der Sturm unvermindert an, und ich musste im Kanonenboot den ganzen Tag mit äußerster Willensanstrengung gegen den steten Brechreiz ankämpfen. Und tatsächlich: Es gelang mir, Neptun nicht opfern zu müssen.
In den letzten Julitagen des Jahres 1942 ging unser Geschützführerlehrgang zu Ende. Wir alle waren in unseren Ausgehuniformen an Deck angetreten. Von den markigen Abschiedsworten unseres Kompaniechefs ist mir kein Wort in Erinnerung geblieben. Jeder Kursteilnehmer erhielt seine Marschpapiere; ich selbst fuhr schon am nächsten Morgen mit der Reichsbahn nach Bremen.
Ich sah keinen der Kameraden je wieder. Gegen Ende des Krieges erfuhr ich, was aus Lücker geworden war: Er gehörte zu den Toten, die beim Verlust von U 257 am 21. Februar 1944 im Atlantik zu beklagen waren.