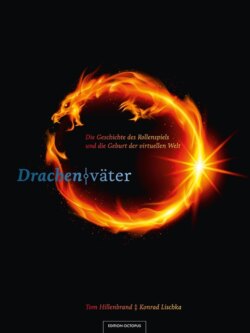Читать книгу Drachenväter - Konrad Lischka - Страница 9
ОглавлениеDie ersten Weltenbauer ¦
Wie die Reiche der Fantastik entstanden
Scan: Will Hart
Robert Howard ¦
Die Geburt von Sword & Sorcery
Die meisten Schriftsteller gehen ihrer Arbeit in aller Stille nach. Sonst können sie sich nicht auf die innere Stimme konzentrieren, die ihnen Wörter und Sätze eingibt.
Nicht so Robert Erwin Howard. Er schrie, während er schrieb.
Allein in einem Holzhaus in der texanischen Wüste sitzend, brüllte er die Sätze hinaus, während er sie in seine Underwood No. 3 drosch. Und was für Sätze das waren. Wenn man die Geschichten Robert E. Howards liest, kann man die Intensität des Schreibprozesses förmlich spüren. Seine Sätze sind „so energiegeladen, dass sie fast Funken schlagen“, wie es der Horrorautor Stephen King einmal formuliert hat. Eine Kostprobe:.
„Als er von der Mauer sprang, fällte seine Axt einen der Männer, mit abgetrennter Schulter stürzte er, und als er die Waffe wieder emporriss, zermalmte sie den Schädel eines anderen. Um ihn herum heulten die Schwerter, doch der Tod verpasste ihn um Haaresbreite. Der Cimmerier schien zu verschwimmen, so schnell bewegte er sich. Er war ein Tiger unter Tölpeln, er sprang, wich und wirbelte, ein nie stillstehendes Ziel, dessen Axt um ihn herum einen stählernen Kreis des Todes wob.“
Womit wir auch schon bei Howards berühmtester Figur wären: Conan, dem Cimmerier, besser bekannt als Conan, der Barbar. In seiner ersten Geschichte „The Phoenix on the Sword“ beschreibt ihn Howard folgendermaßen:
„Hither came Conan, the Cimmerian, black-haired, sullen-eyed, sword in hand, a thief, a reaver, a slayer, with gigantic melancholies and gigantic mirth, to tread the jeweled thrones of the Earth under his sandalled feet.“
Mit Aragorn oder Ivanhoe hat dieser Kerl nichts gemein. Er ist ein Barbar, kein Edelmann. Conan glaubt an den Gott Crom, der ihm die Kraft verleiht, sein Schwert zu führen, und sonst an nicht allzu viel. Seine Vorlieben sind eher schlichter Natur, wie er in „Queen of the Black Coast“ darlegt:
Conan the Adventurer: Ace-Taschenbuch von 1966. ¦ Scan: Ken Winter
„Conan Unchained“: Gary Gygax mochte den Film nicht, TSR ließ aber trotzdem spezielle AD&D-Abenteuer produzieren.
„I live, I burn with life, I love, I slay, and I am content.“
Conan ist eine Testosteronbombe. Feinde mäht der Akkordschlachter dank seiner (von Howard immer wieder erwähnten) „mächtigen Muskeln“ gnadenlos nieder. Als ihn seine Widersacher in „A Witch shall be born“ überwältigen und ans Kreuz schlagen, wird es zwar kurz eng für ihn. Doch als ein Geier dem malträtierten Helden die Augen auspicken will, beißt der Cimmerier ihm kurzerhand den Kopf ab.
Wunderschöne Frauen hat Conan, natürlich, in Serie. Meist sind es leicht bekleidete Püppchen mit milchfarbener Haut, smaragdgrünen Augen und barbarisch großen Brüsten. Eine tragende Rolle spielen sie nicht, sie sind nur Staffage. Aber diese Klischees tun der Faszination keinen Abbruch, im Gegenteil. „Conan ist der Held der Helden, jener verwegene Kämpfer, unzerstörbar und unwiderstehlich, der wir alle irgendwann einmal sein wollten“, so der Verleger John D. Clark.
Wohlwollend kann man über Conan sagen, dass er zwar ein Wilder ist, aber ein edler Wilder. Howard las viel, unter anderem Jack London „Ruf der Wildnis, Seewolf“, Rudyard Kipling „Dschungelbuch“ sowie Edgar Rice Burroughs „Tarzan“. Und so scheint es möglich, dass deren Figuren Conans Vorbilder waren. Der muskulöse Krieger raubt und plündert zwar, aber kaufen kann man ihn nicht. Er ist ein klassischer Abenteurer, einer, dem keiner sagt, wo es lang geht. Conan kämpft nicht für Gott, Krone oder Vaterland, sondern für sich selbst. Hätte Gandalf der Graue versucht, den Cimmerier mit einem Ring nach Mordor zu beordern, hätte ihn das mehr als nur seinen Zauselbart gekostet. Vermutlich hätte Conan den Ring in der nächsten Spelunke verhökert und den Erlös in die Schankmaid investiert.
„Savage Sword of Conan“: Die Comicreihe erschien von 1974 bis 1995 monatlich im Magazinformat.
Mehr als 75 Jahre nach seiner Geburt ist Conan heute eine der bekanntesten Figuren des Fantasygenres. Sofort denkt man bei seiner Erwähnung an muskelbepackte Schwertschwinger, um deren Beine sich leicht bekleidete Grazien ranken, an Arnold Schwarzenegger, an schlechte Power-Metal-Plattencover – und nicht zuletzt an Rollenspiele wie „Dungeons & Dragons“.
Davon ahnte der junge Mann, der in einer 900-Seelen-Gemeinde namens Cross Plains nächtens brüllend in die Tasten haute, freilich nichts. Robert E. Howard, einziger Sohn eines reisenden Arztes und einer an Tuberkulose erkrankten Frau, war kein Erfolgsautor, geschweige denn ein Schöngeist. Der am 22. Januar 1906 nahe Fort Worth geborene Schriftsteller war Zeit seines Lebens nie aus Texas herausgekommen. Und das Schreiben war für ihn nicht Lust, sondern Broterwerb. Howard war das, was die Amerikaner einen „Hack“ nennen: jemand, der für schnelles Geld Texte am Fließband produziert.
Für Romane und Novellen hat der Autor, der sich neben der Arbeit um seine schwer kranke Mutter kümmern muss, keine Zeit; stattdessen schreibt er für jene Groschenhefte, die sich während der Great Depression, der US-Wirtschaftskrise der zwanziger Jahre, enormer Popularität erfreuen. Sie tragen Titel wie „Weird Tales“, „Argosy“ oder „Amazing Stories“. In den Geschichten steht Action im Vordergrund, meist sind sie simpel gestrickt und laufen nur über ein paar Doppelseiten. Man nennt die Hefte „Pulps“, nach dem billigen Papier, auf dem sie gedruckt werden. In den Augen der meisten Menschen handelt es sich um Schund.
Für die Pulps schreibt Howard über 150 Geschichten. Boxgeschichten, Western, Erotik oder Seemannsabenteuer. Darunter sind auch viele Fantasyerzählungen. Keine epischen Weltenkriege à la „Herr der Ringe“, sondern schlichte Stories, in denen der Held in eine Festung eindringt, ein paar Monster umhaut und sich dann mit dem Schatz und der vollbusigen Prinzessin aus dem Staub macht. Es ist die Art von Geschichten, die man als Sword & Sorcery (Muskeln & Magie, gewissermaßen) bezeichnet.
„Weird Tales“: Juli 1936 (l.) mit Howards Kurzgeschichte „Red Nails“ posthum, Mai 1934 (r.) erste Conan-Geschichte auf dem Cover
November 1936, mit Robert Bloch neben Howard. ¦ Scan: Ken Winter
Genauer gesagt sind es die Sword & Sorcery-Geschichten. Denn als Howard die ersten zu Papier bringt, gibt es noch keine Fantasyliteratur, geschweige denn Subgenres wie High und Low Fantasy. Nur der Brite Lord Dunsany hatte schon etwas in der Art versucht, und viele hundert Kilometer weiter nördlich, in Rhode Island, schrieb Robert Howards Brieffreund Howard Phillips Lovecraft gruselige Fantastikgeschichten. Aber Fantasy in dem Sinne, wie wir sie heute kennen, ist ein Novum. Entsprechend gab es für das, was Howard tat, noch keinen Namen – das Etikett Sword & Sorcery kreierte erst 30 Jahre später Fritz Leiber in einer Debatte, die der britische Autor Michael Moorcock angestoßen hatte.
Besonders erstaunlich ist, dass Howard für seinen Helden eine komplette Welt erschaffi. Heute ist das im Fantasygenre gang und gäbe, damals war es revolutionär. Bevor er seinen Barbaren auf die Leser loslässt, verfasst der Schriftsteller ein Essay namens „The Hyborean Age“. Dieses hyperboreische Zeitalter verortet er darin 10.000 Jahre vor dem unsrigen. Der pseudoanthropologische Text erklärt, welche Volksstämme es gibt und welche Götter angebetet werden. Dazu zeichnet Howard zwei Karten.
Worms of the Earth: Conan-Sammelband von 1975. ¦ Scan: Uilke Komrij
Als H.P. Lovecraft von diesem Essay erfährt, ist er völlig aus dem Häuschen „Das ist großartiger Stoff“, schreibt er an einen Freund. „Er besitzt eine umfassende Vision (seiner Welt), in der die Entwicklung und das Zusammenspiel der Rassen und Nationen über lange Zeitabschnitte beleuchtet werden.“ Oft wird J. R. R. Tolkien als der erste Weltenbauer angesehen, weil er sein Mittelerde so unglaublich detailliert beschrieben hat, inklusive eigener Sprachen und Schriften. Der Oxford-Philologe Tolkien mag gründlicher gewesen sein als der Hack Howard. Aber dem Texaner gebührt eindeutig die Ehre, der Erste gewesen zu sein.
Als erster Fantasyautor skizziert Howard eine komplette Welt – mit Karte, Götter-Pantheon und fiktiver Geschichtsschreibung.
Howard schreibt und schreibt. Als er 1932 in „Weird Tales“ die erste Conan-Geschichte „The Phoenix on the Sword“ veröffentlicht, ist er 25 Jahre alt und befindet sich auf dem Höhepunkt seiner Schaffenskraft. Packend sind seine Geschichten und beachtlich in Anbetracht der Tatsache, dass er sie nach dem Tippen meist nur noch einmal durchsieht. Es folgen „The Scarlet Citadel“, „The Tower of the Elephant“ sowie 14 weitere Conan-Abenteuer. Danach schreibt Howard nur noch ein paar Westernstories, bevor er seinem Leben ein Ende setzt.
Robert E. Howard: 1934, zwei Jahre, bevor er sich mit 30 Jahren selbst tötete.
Denn Robert E. Howard ist kein glücklicher Mensch. Häufig launisch und verschwiegen, neigt er mitunter zu Wutausbrüchen. Vor denen haben selbst seine Freunde Angst, denn der Texaner ist ein Bulle von einem Mann. Als Teenager hat Howard begonnen, mit Gewichten zu trainieren und zu boxen, weil er wegen seiner schmalen Statur in der Schule oft Prügel bezog. Dank des Sports könne er, wie er seinem Vater erklärt, „einen Schurken, der mir über den Weg läuft, mit den bloßen Händen in Stücke reißen“. Freunden berichtet Howard von trunkenen Autofahrten ins Umland, von Schlägereien in abgelegenen Spelunken. Der Schriftsteller, so steht es in einer seiner Biographien, soll mitunter ohne erkennbaren Grund auf der Straße angehalten haben, um Schattenboxkämpfe mit imaginären Gegnern auszufechten.
Irgendetwas brodelt in Howard. Freunden gegenüber deutet er Mitte der dreißiger Jahre an, nur seine kranke Mutter halte ihn noch am Leben. Als Hester Howard im Sommer 1936 nach langem Siechtum ins Koma fällt, fragt ihr Sohn die Krankenschwester, ob seine Mutter je wieder erwachen werde. Diese verneint es. Darauftin geht Howard zu seiner Schreibmaschine, spannt ein Blatt ein und tippt einen Zweizeiler aus „House of Caesar“ von Violin Gavin:
All fled – all done, so lift me on the pyre; The feast is over and the lamps expire.
Es ist das Letzte, was Robert Erwin Howard schreibt. Danach steigt er in sein Auto, nimmt einen Revolver aus dem Handschuhfach und schießt sich eine Kugel durch den Kopf.
So kurz und entbehrungsreich Howards Leben war, so lang und vielfältig sollte das seines Helden Conan werden. Nach dem Tod des Schriftstellers veröffentlichte „Weird Tales“ noch ein paar Geschichten, danach geriet der schwarzhaarige Barbar mit den mächtigen Muskeln zunächst in Vergessenheit.
Doch Conan hatte treue Gefolgsleute. Unter ihnen war der Physiker und ScienceFiction-Fan John D. Clarke. Er hatte in den dreißiger Jahren eine Karte Hyperboreas entworfen und diese von Howard korrigieren lassen. Als der Kleinverlag Gnome Press die Conan-Geschichten in den Fünfzigern wieder auflegen will, stellt Clarke das Material zusammen. Conan lebt also weiter, wenn auch als Nischenprodukt. In den sechziger Jahren sortiert der Autor Lyon Sprague de Camp die Conan-Geschichten für den Lancer-Verlag nochmals neu und bringt sie in eine chronologische Reihenfolge. Anders als bei Gnome erscheinen die Bände nun, in den Jahren 1966 und 1967, erstmals in dem immer populärer werdenden Taschenbuchformat.
Eingefleischte Fans sollten später kritisieren, Sprague De Camp habe zu sehr an Howards Geschichten herumeditiert, gar eigene dazuerfunden. Aber aus Marketingsicht ist das, was er und Lancer tun, ein Geniestreich. Conan wird erstmals zu einer richtigen Marke aufgebaut. Die Bücher, deren Preis bei erschwinglichen 60 Cent liegt, bekommen eine einheitliche Nomenklatur („Conan the Adventurer“, „Conan the Wanderer“ etc.) und einheitliche Cover. Für diese engagiert der Verlag den damals noch unbekannten Comiczeichner Frank Frazetta. Er ist der ideale Mann für den Job: Frazetta zeichnet einen wilden, urtümliche Energie ausstrahlenden Krieger mit ausdefinierten Muskeln, der mit seinem mächtigen Schwert Monster niedermäht.
„The Second Book of Robert E. Howard“: Conan-Sammelband von 1977. ¦ Scan: Uilke Komrij
Viele kaufen das erste Buch nur wegen des Covers; von Conan haben sie zuvor noch nie etwas gehört, aber Frazettas Zeichnung beschreibt besser als jede Inhaltsangabe, was den Leser erwartet. Auch einem Spielefan aus Lake Geneva in Wisconsin fallen die Bücher in die Hände. Er heißt Gary Gygax, und er verschlingt sie alle. Später wird der Co-Erfinder des ersten Rollenspiels, „Dungeons & Dragons“, damit angeben, er habe alles gelesen, was Howard je geschrieben habe. Auch sein Kompagnon Dave Arneson liest einige der Lancer-Bände. Die Geschichten seien, wie er später trocken bemerkt, „alle ziemlich gleich“. Dennoch sind die ConanAbenteuer interessanterweise die einzige Quelle, welche die recht unterschiedlichen D&D-Erfinder später unabhängig voneinander angeben werden, wenn man sie nach ihren Inspirationsquellen fragt.
Gygax erklärte einmal, Howard sei für ihn erheblich wichtiger gewesen als Tolkien: „Ich habe mich durch seine Bücher gegähnt. (…) Hobbits sind mir immer noch total egal.“ Und auch der in Sachen Conan nicht ganz so enthusiastische Arneson erklärt 1995, das „Plündern, Rauben und Morden“ bei Conan und die Idee des „Monster bekämpfenden Helden“ habe ihn bei der Konzeption von D&D inspiriert. Andere Rollenspieldesigner nennen Conan ebenfalls als eine ihrer wichtigsten Quellen, etwa Ken St. Andre, der Erfinder von „Tunnels & Trolls“.
„The Book of Robert E. Howard“: Conan-Sammelband von 1976. ¦ Scan: Uilke Komrij
Der Barbar macht Schwarzenegger zum Weltstar.
Die Lancer-Edition beeinflusst zahllose weitere Nerds, die zur Zeit des Erscheinens Teenager sind. Sie wird der Durchbruch sowohl für Conan als auch für Frazetta. Letzterer sollte der Hauszeichner der Fantasyszene werden, sein Artwork ziert zahllose Rollenspiel- und Plattencover. Frazettas Gemälde „Death Dealer“, das einen schwer gerüsteten dunklen Ritter auf einem Schlachtross zeigt, ist so eine Art Che Guevara des Genres – jeder Fantasyfan kennt es, in den Siebzigern und Achtzigern verschönert es als Poster zahllose Jugendzimmer.
Denn nun ist Fantasy plötzlich in. Parallel zur Lancer-Edition verbreitet sich in den USA zu dieser Zeit die TaschenbuchRaubkopie eines anderen Fantasyromans: „Der Herr der Ringe“. „Jeder Hippie las den“, erinnert sich Werner Fuchs, Miterfinder von „Das Schwarze Auge“ und Doyen der deutschen Rollenspielszene. Selbst Menschen, die weder einen Hang zur Fantastik noch zum Spielen hatten, interessieren sich nun für Elfen und Zauberer. Fantasy-Kunstbände mit Drachen, muskulösen Helden und hübschen Mädchen in KettenhemdBikinis sind auf einmal im regulären Buchhandel erhältlich.
Davon profitiert auch der wilde Cimmerier. Conans Abenteuer werden immer wieder neu aufgelegt. Der Comicverlag Marvel (Fantastic Four, Spider-Man) bringt mehrere Serien heraus. Eine von ihnen, „The Savage Sword of Conan“, ist in den Siebzigern eine der populärsten der USA, sogar in kurzen Newspaperstrips taucht der Barbar auf.
Diese wachsenden Popularität kann nur einen logischen Endpunkt haben: Hollywood. Mitte der Siebziger schreibt Oliver Stone ein erstes Drehbuch. Produziert wird der Film nach einigen Verzögerungen dann von der Italienerin Raffaella De Laurentiis. Für die Hauptrolle engagiert man Arnold Schwarzenegger. Der Österreicher hat durch seine Bodybuilding-Dokumentation „Pumping Iron“ eine gewisse Popularität erlangt, als Schauspieler ist er hingegen noch nicht aufgefallen. Bei seiner bis zu diesem Zeitpunkt einzigen tragenden Rolle in „Hercules in New York“ (1970) hatte man Schwarzeneggers Stimme nach dem Dreh komplett nachsynchronisieren müssen, weil sein von steierischem Akzent durchsetztes Englisch völlig unverständlich war.
Das alles ändert sich 1982 mit dem Filmstart von „Conan the Barbarian“. Die Figur kommt der „Steirischen Eiche“ entgegen, denn sie hat wenig Text und teilt stattdessen kräftig aus. Einer Zählung zufolge mäht der Film-Conan im Schnitt alle zwei Minuten einen Gegner nieder (insgesamt sind es fast 60). Die Kritiken sind durchwachsen. Während Amerikas bekanntester Filmkritiker Roger Ebert das zweistündige Epos als „eine perfekte Phantasie für unzufriedene Teenager“ bezeichnet, nennt „Der Spiegel“ Conan einen „prähistorischen Komischmasch-Film“. Das „Time“-Magazin erklärt den Schwarzenegger-Streifen zu „einer Art psychopathischem Star Wars, dumm und stumpfsinnig.“
Der Film spielt dennoch alleine in den USA fast siebzig Millionen Dollar ein. Ein zweiter Teil namens „Conan the Destroyer“ folgt 1985. Schwarzenegger wird zum Weltstar und Conan viel mehr als ein Fantasyheld: Er ist spätestens seit den Verfilmungen (inzwischen gibt es diverse Remakes, das letzte von 2011) zu einer Ikone der Popkultur aufgestiegen und metzelt nun in derselben Liga wie Dracula oder Tarzan.
Niederländischer Conan: Die Übersetzung erschien 1975 in der Taschenbuchreihe Zwarte Beertjes. ¦ Scan: Uilke Komrij
Genau wie diese anderen ursprünglich der Literatur entstammenden Helden, hat der populäre Barbar für den Ruhm einen Preis zahlen müssen: Er ist nicht mehr er selbst. Der Popkultur-Conan hat nicht mehr viel mit der Urfigur zu tun, sondern ist zu ihrem Zerrbild geworden. Schwarzeneggers Conan der Barbar, der bis heute das Gesamtbild prägt, ist nämlich ein weitaus tumberer Geselle als Howards Conan der Cimmerier. Letzterer wird oft als Mann von raubkatzenhafter Schnelligkeit beschrieben; er geht nicht immer mit dem Kopf durch die Wand, sondern wendet mitunter auch Listen an. Folgt man den Archetypen Homers, dann ist Howards Conan eher ein Odysseus, die Hollywood-Variante hingegen ein wütend draufdreschender Achill.
Wie zu erwarten hassen viele der eingefleischten Fans die Filme deshalb mit jener Inbrunst, mit der nur wahre Nerds hassen können. Allen voran kippt Gary Gygax sein (stets reichlich vorhandenes) Vitriol über das Werk aus. Kurz nach dem Filmstart 1982 veröffentlicht er in der D&D-Hauszeitschrift „Dragon“ eine Rezension:
„‚Conan triffi die Blumenkinder des Set‘ wäre wohl der bessere Titel gewesen – falls es Ähnlichkeiten zwischen der cineastischen Version von Conan und jener Robert E. Howards gibt, so sind diese rein zufällig. Falls Sie den Howard’schen Conan respektieren, rate ich Ihnen, dem Kino fernzubleiben. Ansonsten steht Ihnen eine große Enttäuschung bevor.“
„Conan the Conqueror“: Diese von Sprague de Camp editierte Ausgabe des Romans erschien 1967.
„Conan The Usurper“: Ausgabe von 1967. ¦ Scans: Ken Winter
Gygax‘ Kritik ist ein wenig überzogen und unfair; der Schwarzenegger-Film ist weitaus besser als sein Ruf – vor allem wenn man bedenkt, was Hollywood dem Fantasygenre über die Jahre so alles angetan hat. Andererseits muss man dem D&D-Erfinder zugutehalten, dass er den Film nicht aus Boshaftigkeit, sondern aus enttäuschter Liebe hinrichtete, denn Gygax’ Begeisterung für Conan muss schier grenzenlos gewesen sein. Lange bevor er D&D entwarf, soll er ein Brettspiel entwickelt haben, das eine Karte Hyperboreas verwendete.1
In derselben „Dragon“-Ausgabe, in der sich Gygax über den Film erregte, setzte er Conan auch ein Denkmal. Er veröffentlichte einen Artikel, in dem er eine neue Charakterklasse für D&D beschrieb: „The Big, Bad Barbarian“. Mithilfe der Zusatzregeln konnten Millionen von Rollenspielern nun ihre eigene Version Conans spielen, und sie taten es mit Gusto.
Gesammelte Conan-Erzählungen: Die Erstausgabe erschien 1968 bei Lancer.
„Conan the Buccaneer“: Das einheitliche Aussehen trug zum Erfolg der Lancer-Serie bei.
Fritz Leiber ¦
Lankhmar und das erste Fantasyspiel
Es ist ein Treffen zweier Fantasy- und Rollenspielgenerationen, als der Autor Fritz Leiber 1976 auf der Gen Con zu „Dungeons & Dragons“-Spielern über seine Welt Newhon und ihre schlitzohrigen Helden spricht. Leiber ist da 66 Jahre alt, seine erste Fantasy-Kurzgeschichte hat er fast 40 Jahre zuvor veröffentlicht. Wegen der Figuren dieser ersten Kurzgeschichte („Two Sought Adventure“) verehren ihn die viele Jahre jüngeren Besucher der Gen Con: Fafhrd und der Graue Mausling, die Protagonisten der Kurzgeschichten und Romane Leibers, sind das Gegenstück zu den edlen, übermenschlich guten Helden etwa in Tolkiens „Herr der Ringe“. Fafhrd und sein kleiner, listiger Mitstreiter sind Abenteurer, Draufgänger, Spitzbuben mit schlechtem Leumund, aber dem Herzen am rechten Fleck. Sie trinken oft zu viel, verspielen ihr Geld, steigen Frauen nach und riskieren ungern ihr Leben, wenn nicht genügend Geld dabei herausspringt. In der Kurzgeschichte „Schicksalhafte Begegnung in Lankhmar“ zum Beispiel lassen sich der riesige Kämpfer Fafhrd und der klein gewachsene Graue Mausling mit Wein volllaufen, um einen gelungenen Raubüberfall zu feiern. Die Bitte ihrer Freundinnen um Hilfe ignorieren sie, bis es um die Ehre geht und man sie Feiglinge nennt. Das können die Prahlhänse nicht auf sich sitzen lassen.
Fafhrd und der Graue Mausling haben mit Conan mehr gemeinsam als mit Frodo oder Gandalf, aber eins unterscheidet sie von all diesen Fantasyhelden: Sie bringen die Leser zum Lachen. Fritz Leiber hatte die seltene Gabe, mitreißende Fantasygeschichten mit guten Gags zu schreiben. Er nimmt das Genre nicht zu ernst und lässt den Grauen Mausling über die Vorzüge der Zivilisation philosophieren, als er mit Fafhrd auf das Stadttor der Metropole Lankhmar zureitet und auf der Stadtmauer seine ungeduldigen, bewaffneten Gläubiger erblickt:
„In any case they know that after slaying us, they can pay themselves off from any treasure we may have and split the remainder. It’s the rational procedure, which all civilized men follow.“
Fritz Leiber: Im Oktober 1984 bei der Con Fantasy Faire im kalifornischen Fullerton. ¦ © Dik Daniels
„Civilization!“ the big man snorted. „I sometimes wonder –„
„– why you ever climbed south over the Trollstep Mountains and got your beard trimmed and discovered that there were girls without hair on their chests,“ the small man finished for him.1
Leiber ist mit diesen Geschichten berühmt geworden, er wird ein Star, gerade unter den ersten Rollenspielern. Und obwohl Leiber ein oder zwei Generationen älter ist als die meisten Rollenspieler, sucht er Kontakt zu diesen Fans. Leiber kommt Anfang 1976 als Ehrengast zu einer der ersten Rollenspieler-Conventions an der Westküste der USA, der DunDraCon im kalifornischen San Ramon. Und im September 1976 reist Leiber als Ehrengast zu Gary Gygax’ Gen Con. TSR-Mitarbeiter Robert Kuntz erinnert sich an die Ehre, Leiber bei diesem Rollenspielertreffen als Gast zu haben: „We didn’t have any formal guests before in the sense of a national author of that calibre.“ Auf einem Gruppenfoto von damals sieht man den Generationsunterschied deutlich: Leiber steht links, das rote Hemd in der Anzughose, einen Kugelschreiber in der Brusttasche, er trägt Hornbrille, hat das weiße Haar zurückgekämmt und lächelt gütig in die Kamera. Neben ihm stehen der fast 30 Jahre jüngere „Dungeons & Dragons“-Miterfinder Gary Gygax in einem wild gemusterten Hemd und der Weltenerfinder M.A.R. Barker (damals 46) im roten T-Shirt. Ebenfalls zu sehen sind die britischen Rollenspielimporteure Ian Livingstone (in kurzer Hose) und Steve Jackson, damals beide Mitte 20.
„Swords & Ice Magic“: Ausgabe von 1977. ¦ Scan: Cadwalader Ringgold
Eines haben die auf den ersten Blick sehr unterschiedlichen Männer auf diesem Foto gemeinsam: Sie sind begeistert von Sword & Sorcery-Geschichten, wie sie zuerst Robert Howard schrieb. Den Genrebegriff Sword & Sorcery hat Fritz Leiber vorgeschlagen. 1961 schrieb er in einem Brief an das Science-Fiction-Fanzine „Amra“ als Antwort auf die Frage, wie man denn nun Geschichten wie Howards Conan-Erzählungen kategorisieren sollte:
„I feel more certain than ever that this field should be called the sword-and-sorcery story. This accurately describes the points of culture-level and supernatural element and also immediately distinguishes it from the cloak-and-sword (historical adventure) story – and (quite incidentally) from the cloak-anddagger (international espionage) story too!“2
Leiber schrieb da schon seit Jahren solche Geschichten. Im Frühjahr 1961 erschien seine Novelle „Scylla‘s Daughter“, die Basis für „The Swords of Lankhmar“. In dem Text findet man eine Anspielung auf die Genredebatte. Zu Beginn der Geschichte, auf dem Weg zum Stadttor der Metropole Lankhmar, sieht der Graue Mausling auf einmal etwas klarer, wer ihn und seinen Freund da noch erwartet. Er wendet sich an Fafhrd:
Fritz Leiber und Harry Fischer: 1978 von Tim Kask für das Fanzine „Silver Eel“ gezeichnet. ¦ © Tim Kask
„Hey, I think our creditors and other haters have hired a third S besides swords and staves against us.“
„Sorcery?“3
Fafhrd und der Graue Mausling sind richtige Sword & Sorcery-Helden. Sie ziehen mit leeren Taschen in Lankhmar ein – alles verspielt, versoffen, verfeiert. Sie verdingen sich als Söldner gegen Bezahlung, übernehmen einen gut bezahlten, scheinbar lauen Job und freuen sich über ihr Glück, mit wenig Mühe viel verdienen zu können. So etwas muss man sich in Tolkiens Mittelerde vorstellen: Welcher der edlen Helden aus „Der Herr der Ringe“ würde so reden?
Der Graue Mausling und Fafhrd sind weder gut noch böse, weder schwarz noch weiß – genau wie ihre zweite Heimat, die Metropole Lankhmar, die offiziell vom Magistrat, tatsächlich aber von der organisierten Kriminalität regiert wird. Früher einmal sollen die Honoratioren dieser korrupten, vergnügungssüchtigen und sehr urbanen Stadt weiße Togen getragen haben, doch weil diese wegen der verschmutzten Luft so oft gewaschen werden mussten, sind nun schwarze Gewänder Pflicht.
Fafhrd und der Graue Mausling unterscheiden sich aber auch von Howards übermächtiger, muskelbepackter Testosteronbombe Conan. Leibers Helden sind ganz normale Menschen, die auf der Suche nach einem besseren Leben aus der Provinz fortgezogen sind und sich nun durchs Leben schlagen. Leiber schreibt in seinem Vorwort zu „The Swords of Lankhmar“, dass er zwei Fantasyhelden schaffen wollte, die „der menschlichen Natur besser entsprechen als übermenschliche Helden wie Conan“.4 In seinem Essay „Fafhrd and Me“ von 1963 wird Leiber deutlicher:
„Fafhrd and the Gray Mouser were born of the Bankrupt Thirties, and like true depression children, they didn’t earn a cent for years and years – five, to be exact. It was 1934. Five years earlier the market had crashed; the Wall Street chaps had jumped from their windows or lived for months and years in terror of red revolt by the applesellers and the bread-line men; one of them had gone haring off to lay the groundwork for Alcoholics Anonymous. And in 1934 prosperity still seemed acrumble to those of us who were around, despite the small beginnings of social security; in the next year Congress would vote the president four billion dollars for plain unemployment relief – the WPA, PWA, and such: a desperate bribe to desperate men. Midwestern bank robbers were folk heroes.“5
Charakterbögen: Der graue Mausling und Faflrd als AD&D-Charaktere in der TSR-Ausgabe der Lankhmar-Kampagnenwelt von 1988.
Gen Con 1976: Von links Fritz Leiber, Gary Gygax, M.A.R. Barker, Ian Livingstone, Rob Kuntz, vorne Steve Jackson. ¦ © Ian Livingstone
Fafhrd, der Graue Mausling und ihre Welt entstehen in Briefen zwischen Leiber und seinem besten Freund, Harry Fischer. Leiber hat als einer der ersten Autoren eine Welt ausgearbeitet, bevor er Geschichten schrieb, die dort spielten. Er ist einer der ersten Weltenschöpfer, auch wenn er bei weitem nicht so detailverliebt Sprachen, Epochen und Karten ausgearbeitet hat wie die Sprachwissenschaftler Tolkien (Mittelerde) oder Philip Barker (Tékumel). Leiber und Harry Otto Fischer lernen sich am College kennen, beide mögen Science-Fiction und schreiben einander viele Briefe. In der großen Wirtschaftskrise der Dreißigerjahre schlägt sich Leiber in New York als Aushilfspfarrer zweier Episkopalgemeinden durch, Fischer tourt mit einem Kasperletheater durchs Land und lebt ansonsten 1300 Kilometer westlich von New York in Louisville.
Einen der ersten Briefe an Fischer, in denen von Lankhmar die Rede ist, schreibt Fischer im September 1934 an Leiber. Darin skizziert er die Figuren:
„For all do fear the one known as the Gray Mouser. He walks with swagger ’mongst the bravos, though he’s but the stature of a child. His costume is all of gray, from gauntlets to boots and spurs of steel.” Fafhrd hingegen lache laut und sei “full seven feet in height. His eyes, wide-set, were proud and of fearless mien. His wrist between gauntlet and mail was white as milk and thick as a hero’s ankle. They met in the walled city of the Tuatha De Danann called Lankhmar, built on the edge of the Great Salt Marsh, and so the saga of the Gray Mouser and Fafhrd was begun.“6
Das liest sich ein wenig wie die Figurenbeschreibungen auf Charakterbögen von Rollenspielern. Und tatsächlich entwickeln Leiber und Fischer ihre Helden Fafhrd und den Grauen Mausling ganz ähnlich wie Rollenspieler Jahrzehnte später ihre Figuren – sie verkörpern sie, wenn auch in Briefen, in „fiction games“, wie Leiber sie nennt: „Fischer got me writing long letters and playing fiction games in the course of them.“7
Das erste Spiel beginnt so: Leiber antwortet auf Harry Fischers Brief über Fafhrd und den Grauen Mausling am 24. September 1934:
„Last night I walked down by devious paths to the sea. And there I sat beside a congeries of silver gas tanks in the light of a veiled moon. I crouched upon a bulkhead and the sea lapped subtly at the rocks about my feet. And it came to pass then that a low black craft slid into my range of vision. In the back rose the ominous frame of Fafhrd, clad all in black. Ever and anon he would chance their course when a whisper floated back from the bow, where the grays of the Mouser’s garments hung over the sea like a ghost’s. Through a strange scopic instrument he was peering into the sea – only I noted that the instrument made no ripples where it entered the deeps: it was not into our local waters that the instrument peered. There came a swirl of waters on that calm night as if a whirlpool that lay at right angles to the boat had seized it. I caught a glimpse of the Mouser fighting an indistinct creature that held eight swords in as many writhing arms. Immediately afterward the dark sea was empty.“
Bis Leiber seine erste Lankhmar-Kurzgeschichte veröffentlicht („Two Sought Adventure“, im August 1939 im Pulpmagazin „Unknown“), entwickelt er im Briefwechsel mit Harry Fischer die Welt weiter. Er zeichnet Karten, Ende 1936 zum Beispiel eine Skizze des Landes der Acht Städte nördlich von Lankhmar. Sein Sohn Justin Leiber erinnert sich: „Als ich klein war, haben meine Mutter und ich Fritz oft Fafhrd oder auch Faf genannt.“ Für Leiber waren Lankhmar und Fafhrd offensichtlich mehr als Figuren seiner Kurzgeschichten.
Leibers literarische Verdienste werden in der Fantasyszene schon zu seinen Lebzeiten (1910 – 1992) gewürdigt, auch wenn er nie den Erfolg Tolkiens hat. H. P. Lovecraft, der einige Monate vor seinem Tod 1937 in regem Briefwechsel mit Leiber steht (Leiber hatte ihm seine ersten Lankhmar-Geschichten geschickt), schreibt einem Freund, die Erzählungen seien ein „brillantes Stück phantastischer Vorstellungskraft“ und ein „sehr ungewöhnlicher Mythenzyklus“. Als Mitbegründer der sogenannten Low-Fantasy gilt Leiber schon in den sechziger Jahren.
Taschenbuch von 1968: Der Verlag Ace brachte mit dem neuen Format Fantasy in den Mainstream. ¦ Scan: Will Hart
Pulpmagazin „Fantastic“, Februar 1964: Neben Fritz Leiber veröffentlichte auch Philip K. Dick in dem Magazin. ¦ Scan: Cadwalader Ringgold
„Fantastic“, Mai 1964: Leibers Novelle „Adept’s Gambit“ war zuerst 1947 in diesem Blatt erschienen. ¦ Scan: Cadwalader Ringgold
Seine Geschichten und Helden etablieren dieses Genre, das nicht wie Tolkiens Werk vom Schicksal einer Welt, sondern von kleineren, persönlichen Geschichten und Nöten einzelner Protagonisten erzählt.
Leiber ist einer der großen Fantasyautoren, gerade weil er sich nie durch das Genre einschränken ließ. Seinen witzigen, bisweilen ironischen Heldengeschichten merkt man Leibers weiten literarischen Horizont an. Der belesene Sohn aus einer Schauspielerfamilie skizziert in Essays mit leichter Hand Parallelen seiner Schurken-Helden zu Peer Gynt, François Villon und Figuren in Flauberts Historienroman „Salambo“. Er lässt Regieanweisungen aus Shakespeare-Stücken als geflügelte Worte in Dialoge einfließen: „Alarums and excursions. Enter two Mingols“, sagt die etwas entrückt wirkende, von einem anderen Ort oder aus einer anderen Zeit stammende Dienerin in einer von Leibers Geschichten.
„The Big Time“, Ausgabe von 1961: Für die Science-Fiction-Novelle gewann Leiber 1958 den Hugo Award. ¦ Scan: Cadwalader Ringgold
Leibers Lankhmar, ist die erste detailliert ausgearbeitete Fantasystadt.
Überliefert ist ein Treffen mit Thomas Mann, den der 33-jährige Leiber in dessen Villa bei Hollywood besucht. Ein Hausmädchen öffnet die Tür, Leiber wird ins Arbeitszimmer geführt, wartet, während Mann mit seinem Sekretär über den Brief eines Lesers diskutiert. Leiber: „Jemand hatte die Benutzung von Gabeln in den Josephsromanen angezweifelt. Mann erklärte, dass es sich um lange Gabeln handelte, mit denen man Fleisch über dem Feuer briet, nicht um die kurzen, mit denen man heute isst.“ Leiber weiter: „War diese Szene arrangiert, um junge Schriftsteller damit zu beeindrucken, wie sorgfältig und durchdacht der berühmte Autor arbeitet? Falls ja: gute Idee!“ Die Partys im Hollywood der dreißiger Jahre dürften Leiber bei der Beschreibung der dekadenten Elite Lankhmars inspiriert haben. Er zieht rückblickend selbst diese Verbindung, schreibt über die
„real origins of the intrigue-ridden, pleasure-sated, sorcery-working, thief-ruled city of Lankhmar, its fat merchants and cut-throat rogues, its gilded courtesans and shrewd mountebanks, and its linkages to a certain city in our own world […] “8
und zitiert aus einem Brief von 1936, in dem er Harry Fischer von einer Party beim Schauspieler John Barrymore berichtet:
„This would be a fine place for you, Gray Mouser. Everyone and everything is so confused; in fact, there is so much of chaos out here, chaos built on fear, suspicion, too much and too little bureaucracy, that a person with a knowledge of the whims and pettishnesses of the blind god Azathoth would have the upper hand.”
Die Theatertruppe von Fritz Leiber, Anfang 1923: Der vierte von links ist Fritz Leiber Jr., in der Mitte sein Vater. ¦ Scan: Will Hart
Die „fiction games“ der beiden nehmen vielleicht deshalb so viel von den späteren Rollenspielen vorweg, weil Leiber aus einer Schauspielerfamilie kommt und ein begeisterter Spieler ist. Er spielt Anfang der Dreißiger in der Schachmannschaft der University of Chicago, gewinnt 1958 die Santa Monica Open.9 Leibers Sohn Justin erinnert sich: „Fritz hat immer gespielt, in den letzten 20 Jahren seines Lebens vor allem Backgammon, Anfang der Dreißiger Kriegsspiele.“
Und so entsteht vor den Kurzgeschichten und Romanen über Lankhmar und die Fantasywelt Nehwon ein Spiel, das bereits dort angesiedelt ist: Ende der dreißiger Jahre besuchen Fritz Leiber mit seiner Frau Jonquil Harry Fischer und dessen Frau in Louisville. Es wird vor Justin Leibers Geburt gewesen sein, 1937 oder früher vielleicht. Damals zeichnet Martha McElroy Fischer die seitdem kanonische Karte der Welt Nehwon, Leiber und Fischer entwickeln ein Spiel.
Das handschriftliche, undatierte Manuskript liegt mit Leibers Nachlass in der Uni-Bibliothek von Austin, Texas. Leibers und Fischers „Game of Lankhmar“ entsteht lange vor „Dungeons & Dragons“, und es nimmt eine wichtige Idee vorweg, wenn auch nicht die enorm erfolgreichen Spielmechanismen von D&D. Leiber entwirft in Anlehnung an Tabletops Regeln, mit denen Spieler statt Einheiten eine einzelne Figur durch eine Fantasywelt führen.
Taschenbuchausgaben von 1968. ¦ Scan: Will Hart
Sonderausgabe für Fritz Leiber: Das „Magazine of Fantasy and Science Fiction“, Juli 1969
Im „Game of Lankhmar“ treten zwei bis vier Spieler gegeneinander an. Ziel ist es, Festungen der Gegner zu erobern. Die Spielmechanik erinnert in vielen Punkten an Schach und Konfliktsimulationen. Die Spieler bewegen ihre Figuren über eine in Vielecke aufgeteilte Karte Nehwons. In den Regeln steht zum Beispiel: „Ein Soldat bewegt sich pro Zug ein Feld in jede Richtung, genauso wie der König beim Schach.“
Lankhmar als Kampagnenwelt: AD&D-Weltenband von 1988.
Das Besondere ist, dass die Spieler nicht Truppenteile, sondern individuelle Figuren bewegen: Jeder Spielstein ist ein Held, ein Soldat oder gar Fafhrd oder der Graue Mausling. Den Regeln fehlt die Komplexität späterer Rollenspielsysteme und Konfliktsimulationen – wenig Statistik, keine Tabellen, kaum Arbeit mit Wahrscheinlichkeiten, keine in Zahlen codierte Entwicklung der Figuren. Andererseits berücksichtigt das Spiel Details zu Transportmitteln (wie Booten, Pferden, Kamelen), Terrain (Wüste, Wasser, Marsch, Gebirge) und Waffen (Speer, Bogen, Schwert).
Während Leibers Kurzgeschichten von 1939 an regelmäßig in Fantasyzeitschriften erscheinen und später Romane folgen, dauert es fast 40 Jahre, bis das Lankhmar-Spiel 1976 veröffentlicht wurde. Der RollenspielVerlag TSR, seit 1974 mit dem Pen-&-Paper-Rollenspiel „Dungeons & Dragons“ erfolgreich, bringt es heraus. Die bevorstehende Veröffentlichung ist der Anlass für Leibers Besuch auf der eng mit TSR verbundenen Gen Con 1976. Leiber veröffentlicht auch einen Text in der Erstausgabe der TSR-Hauszeitschrift „Dragon“. In einem fiktiven Gespräch versucht er, Fafhrd und dem Grauen Mausling Wargames im Allgemeinen und das Lankhmar-Spiel im Besonderen zu erklären:
„I tried to explain to Fafhrd and the Gray Mouser about wargamers and the game of Lankhmar. ‚You mean they’re using our territory to fight in?‘ the Mouser demanded. ‚We ought to charge ‘em toll or tariff, ambushing those who refuse to pay.‘ I tried some more. ‚Oh, so they fight only with their minds?‘ Fafhrd said. That sounds sick to me. I keep my mind solely for enshrining the images of beautiful women.‘ ‚A sort of penny peep-show, eh?‘ the Mouser observed to him. ‚Frix and her tricks, et cetera.‘ ‚Say rather a temple,‘ Fafhrd replied decorously, with admirable self-control. ‚But about these wargamers or mind-fighters,‘ the Mouser said, turning back to me. ‚I’ll wager some of ‘em aren’t above using a real knife under the table, especially if the games goes against ‘em.‘ ‚A man could keep on playing a table game, though ham-strung,‘ Fafhrd put in. ‚Still, it would probably upset his judgment, don’t you think?‘ the Mouser pointed out to him. I kept on trying, explaining that the wargamers wanted to know about the geography and terrains of the World of Nehwon and which earth soldiers most resembled in weapons and tactics the warriors of the various chief lands of Lankhmar. (…) Better yet Quarmall, and not half as chilly‘, the Mouser (chimed) in eagerly. ‚A vasty underground world of many levels, a nation in the mines! There’s a Dungeon would send wargamers ape!‘ (They were referring to sub-worlds of Nehwon described in Swords Against Wizardry.)“10
„Fantastic“, Oktober 1962: Die Erstveröffentlichung von „The Unholy Grail“. ¦ Scan: Cadwalader Ringgold
Fritz Leiber: Am 26.2.1977 in Los Angeles in der Buchhandlung „A Change of Hobbit“
Fritz Leiber 1937 im Film „The Great Garrick“, in der Mitte Fritz Leiber, rechts sein Vater. ¦ Scans: Will Hart
Fritz Leiber 1936 im Film „Camille“ (2. v. l.)
Fritz Leiber 1978 bei einer Podiumsdiskussion über H.P. Lovecraft
Fritz Leiber 1970 als Schauspieler im Film „Equinox“
Gary Gygax nennt Leibers Geschichten über Jahrzehnte hinweg einen wichtigen Einfluss auf D&D. Im Vorwort der 1974 erschienenen ersten Ausgabe von „Dungeons & Dragons“ erwähnt Gygax ausdrücklich Leibers Geschichte als Vorbild für den Ton dieses Spiels:
„Those wargamers who … do not enjoy Fafhrd and the Gray Mouser pitting their swords against evil sorceries will not be likely to find DUNGEONS and DRAGONS to their taste.“11
Seitdem taucht Leibers Lankhmar immer wieder als Referenz in D&D-Werken auf. In Regelbüchern wie „Legends & Lore“ gibt es detaillierte Beschreibungen Nehwons, später veröffentlicht TSR Abenteuer und Boxen mit detaillierten Stadtplänen und Hintergrundinformationen zu Lankhmar für D&D-Spieler. In seiner offiziellen Literaturliste „Fantasy / Swords & Sorcery recommended reading from Gary Gygax“ führt der D&D-Miterfinder Geschichten Leibers auf.12
Neben solchen direkten Einflüssen dürften Fafhrd und der Graue Mausling vor allem indirekt auf „Dungeons & Dragons“ gewirkt haben. Diebe und Spitzbuben sind eine der ersten zusätzlichen Charakterklassen in D&D, sie tauchen 1976 in der D&D-Erweiterung „Greyhawk“ auf. Das Vorbild war sicherlich Leibers Grauer Mausling – der Dieb als durchaus spielbarer und manchmal sogar ehrbarer Abenteurer. Dass bei Dungeon Crawls Geld und Schätze ein sehr wichtiges Ziel (und eine Grundlage für die Bemessung des Erfolgs in Erfahrungspunkten) sind, dürfte auch Gygax‘ LeiberLektüre zu verdanken sein.
Leiber war von Rollenspielen angetan. Über die Gen Con schrieb er im September 1976 im US-Magazin „Datebook“. „Fantasy wargaming“ nennt er die Spiele, in denen „Spieler eine Abenteuergeschichte erleben und beeinflussen.“ Er habe „schöne Stunden damit verbracht, Regelbücher zu signieren und Fans durch das Gebiet von Lankhmar zu führen“. Leiber habe selbst nur selten Rollenspiele gespielt, erzählt sein Sohn Justin: „Aber er mochte das Konzept. Er war auch Anfang der Achtziger mit Harry noch auf einem Rollenspielertreffen.“
Merkwürdigerweise hat Leibers Welt nie als offizieller Hintergrund für ein Computerspiel gedient. Dabei prophezeit der Autor 1976 schon, dass Computerspiele wohl die Zukunft des Rollenspiels sein dürften. Nachdem Leiber Hypertext-Erfinder Ted Nelson getroffen hatte („er erzählte, dass in Zukunft Computer günstig genug werden könnten, dass Privatleute oder zumindest Spielclubs sich einen eigenen kaufen könnten“), schrieb er: „Sie haben bestimmt schon das Spiel Pong gesehen oder gespielt, ein computergesteuertes Tischtennis. Vielleicht wird im nächsten Jahr der Ball auf dem Bildschirm durch ein Labyrinth streifen und Ihre Spielfigur repräsentieren. Falls es so kommt, halten Sie nach einem roten Licht Ausschau – das wird mit hoher Wahrscheinlichkeit ein feuerspeiender Drache sein.“
Ausgabe von 1968: Damals hieß Fantasy noch „sword-and-sorcery science-fiction“ – den Begriff hatte Fritz Leiber 1961 geprägt. ¦ Scan: Cadwalader Ringgold
H. P. Lovecraft ¦
Ansteckender Horror
Die beiden Grandseigneurs der Fantasy, die wir in den vorherigen Kapiteln kennengelernt haben, waren – zumindest nach den Maßstäben des Durchschnittsbürgers – recht kauzige Gesellen. Wer jedoch Howard oder Leiber für Sonderlinge hält, hat sich augenscheinlich noch nie den Lebenslauf von Howard Phillips Lovecraft angeschaut. Dieser äußerst eigenbrötlerische Gentleman aus Neuengland erschuf einen der populärsten Weltentwürfe, ja eine ganze Kosmogonie des Schreckens. Lange als obskurer Schundschreiber geschmäht, gilt er inzwischen als vielleicht wichtigster Horrorautor des 20. Jahrhunderts und steht auf einer Stufe mit Edgar Allan Poe. Das ist deshalb so bemerkenswert, weil zu H. P. Lovecrafts Lebenszeit wenig darauf hindeutete, dass ihn sein Werk überdauern würde.
Lovecraft wird 1890 in Providence im US-Staat Rhode Island, geboren. Er ist ein blasses, kränkliches Kind, das unter der Obhut einer gluckenhaften Mutter und mehrerer Tanten zu einem blassen kränklichen Teenager heranwächst. Seinen Vater kannte er kaum; dieser war in eine Nervenheilanstalt eingewiesen worden, als Howard drei Jahre alt war, und verstarb dort wenig später.
Freunde besitzt der Bub keine, stattdessen vergräbt er sich in den Büchern seines Großvaters, schreibt Gedichte und gärtnert. Obwohl Lovecraft hochintelligent ist, beendet er nicht einmal die Highschool: Aus gesundheitlichen Gründen wird er frühzeitig entlassen. Später berichtet er, seine Nerven seien derart zerrüttet gewesen, dass ihm selbst Sitzen und Herumlaufen mühsam erschienen sei.
An was der junge Lovecraft leidet, lässt sich heute nicht mehr rekonstruieren. Ob es sich um eine körperliche oder psychische Krankheit handelte, weiß man nicht – es muss allerdings ein erhebliches Leiden gewesen sein, denn die auf den Zusammenbruch folgende Paralyse Lovecrafts dauert fast ein Jahrzehnt. Der arbeits- und mittellose junge Mann lebt während dieser Zeit weiterhin bei seiner Mutter. Selbst seinen Biografen bereitet es Schwierigkeiten zu erklären, was Lovecraft während dieser langen Periode eigentlich macht. Schreiben tut er kaum. Stattdessen scheint er vor allem zu lesen und zu brüten, während es in ihm kocht.
„Call of Cthulhu“-Rollenspiel: Britische Lizenzausgabe, erschienen 1983 bei Games Workshop.
Lovecraft-Ausgabe von 1976: Der auf Fantasy und SF spezialisierte US-Verlag Ballantine machte den Autor populär.
Denn H. P. Lovecraft ist ein Mann voller Hass. Er hasst das Leben, er hasst Essen, er hasst die Modernität. Der junge Mann kleidet sich in alten Gehröcken und geriert sich wie ein aristokratischer Gentleman aus einer frühen Poe-Erzählung, inklusive des affektierten Akzents. Lovecraft hasst die ganze Welt, doch am meisten von allen Dingen darin hasst er die Menschen: „Mein Hass auf die Menschentiere wächst sprunghaft, je mehr ich von dem Ungeziefer sehe.“
Am wenigsten mag Lovecraft jene ethnischen Gruppen (damals sprach man noch von Rassen), die nicht „nordisch“ sind. Er ist, wie viele Menschen des frühen 20. Jahrhunderts, von den Rassentheorien des Franzosen Arthur de Gobineau beeinflusst, die alle „nichtarischen“ Rassen für minderwertig erklärt. Slaven oder Juden bezeichnet der junge Lovecraft als „rattenartiges Gezücht aus dem Ghetto“. In seinen Schriftwechseln bekundet er Bewunderung für Mussolini und Hitler.
All das klingt nach einer Person, die man lieber nicht kennenlernen möchte. Tatsächlich aber beschreiben Lovecrafts Freunde und Bekannte ihn durchweg als einen äußerst liebenswürdigen Menschen, als höflich und hilfsbereit. Zu seinem späteren Freundeskreis gehören jüdische Künstler wie Samuel Loveman; seine spätere Frau Sonia Green war eine russische Jüdin. Statt für Hitler schwärmt Lovecraft in einer späteren Lebensphase für Theodore Roosevelt und sympathisiert mit sozialistischen Ideen.
Trotz dieser Wandlung lässt sich kaum wegdiskutieren, dass der Mann aus Providence für die Menschheit nicht allzu viel übrig hat, woran sich auch in späteren Jahren nichts ändert.
„Three Tales of Horror“: Illustrierte Lovecraft- Ausgabe von 1967, erschienen bei Arkham House. ¦ Scan: Tom Vincent
„Ich bin der Menschheit und der Welt so bestialisch müde, dass nichts mein Interesse wecken kann, außer es beinhaltet mehrere Morde pro Seite oder befasst sich mit unaussprechlichen und unbegreiflichen Schrecken, die aus dem äußeren Universum auf uns hinabgaffen.“
Eben diese unbegreiflichen Schrecken werden zu Lovecrafts literarischem Sujet. Der Kern seines Werks sind etwa zwei Dutzend Kurzgeschichten und Novellen, in denen es um die Großen Alten geht, Wesen, die einst über die Erde herrschten und so fremdartig, so schrecklich und so unwägbar sind, dass schon ihr bloßer Anblick einen Menschen in den Wahnsinn treiben kann. Auch ihre Namen sind nicht von dieser Welt: Shub-Niggurath, die Ziege mit den Tausend Jungen; Azathoth der blinde Idiotengott; und der Große Cthulhu, der in R’lyeh, der Stadt unter dem Meer, schläft und träumt, bis eines Tages die Sterne die richtige Konstellation aufweisen. „Ph‘nglui mglw‘naft Cthulhu R‘lyeh wgah‘nagl fttagn“, heißt das in der fiktiven Sprache der Großen Alten, die der Neuengländer immer wieder in seine Erzählungen einflicht.
In Lovecrafts Universum gibt es für die Menschheit wenig Hoffnung, eigentlich gar keine. Denn hinter der Fassade der Normalität lauern kosmische Schrecken wie die Großen Alten und ihre Anhänger, und es gilt als sicher, dass sie eines Tages wieder die Erde beherrschen werden. Menschen sind in Lovecrafts Welt lediglich ein Interludium. In den Augen eines Cthulhu sind sie kaum mehr als Ungeziefer, das er und die anderen Großen Alten nach ihrer Rückkehr achtlos zertreten werden. Es ist eine Kosmogonie, die zutiefst nihilistisch ist und einen zur Verzweiflung treiben kann.
Neben den Großen Alten schaffi Lovecraft weitere Elemente, die zu Markenzeichen dessen werden, was man heute als den Cthulhu-Mythos bezeichnet. Zum Beispiel okkulte Bücher: Während das Gros der Menschheit ahnungslos seinem Ende entgegengeht, sind in gewissen alten Folianten Hinweise auf die wahre Verfassung der Welt zu finden, etwa im fiktiven „Necronomicon“ des wahnsinnigen Arabers Abdul Alhazred. Lovecraft zitiert neben ausgedachten Grimoires wie diesem jedoch auch immer wieder tatsächlich existierende Bücher, um den Lesern den Eindruck zu vermitteln, dass an der Cthulhu-Sache vielleicht doch mehr dran sei. So schreibt er beispielsweise eine kurze „Geschichte des Necronomicons“, die wie ein wissenschaftlicher Eintrag verfasst ist. Darin heißt es, eines der wenigen verbliebenen Originale werde in der Widener Library der Universität Harvard auftewahrt. Als frühere Besitzer nennt er in seinen Text auch real existierende Personen wie John Dee, einen englischen Mystiker und Berater von Königin Elisabeth I. Dieser, so erklärt Lovecraft, habe im 17. Jahrhundert eine Übersetzung des „Necronomicon“ angefertigt.
Diese Tricks lassen seine eigentlich durch und durch fantastischen Erzählungen beunruhigend realistisch erscheinen. Was diesen Eindruck weiter verstärkt, ist der Umstand, dass andere Autoren Lovecrafts Pseudobibliographie zu erweitern und in ihren eigenen Büchern zu verwenden beginnen.
Wie konnte das passieren? Zwar verbringt der Neuengländer die meiste Zeit seines Lebens in Providence und meidet in der Regel andere Menschen – gleichzeitig jedoch ist er extrem gut vernetzt. Lovecraft ist ein fanatischer Briefeschreiber. Hätte er in unserer Zeit gelebt, wäre er möglicherweise einer jener Nerds oder Trolle geworden, die viel zu viel Zeit in Foren, auf Messageboards oder bei Facebook verbringen. Sein Biograph L. Sprague de Camp schätzt, die Hälfte seines Arbeitstags habe Lovecraft für das Bearbeiten von Korrespondenz verwendet: „Sie waren sein Substitut für ein Sozialleben.“
Etwa 100.000 Briefe schreibt er während seiner 47-jährigen Lebenszeit; allein mit dem Künstler Clark Ashton Smith wechselt er 40.000 Wörter pro Jahr, das entspricht einem Taschenbuch. Zu weiteren Autoren, mit denen Lovecraft regelmäßig korrespondiert, gehören neben Smith und Robert E. Howard auch Fritz Leiber, Robert Bloch („Psycho“) und Frank Belknap Long.
Diese Autoren helfen Lovecraft, den Cthulhu-Mythos populär zu machen. Vermutlich ist es nicht so, dass der scheue Schriftsteller, dessen Werke fast ausschließlich in dem Pulpmagazin „Weird Tales“ erschienen, sie darum bittet. Der literarische Zirkel, der sich um Lovecraft herum gebildet hatte, findet einfach großen Gefallen daran, sich neue Zauberbücher auszudenken: Robert Bloch ersinnt Ludvig Prinns „De Vermis Mysteriis“, Smith das „Liber Ivonis“. Diese fiktiven Bücher baut man wechselseitig in Geschichten ein: Howard erfindet für seine Geschichte „Children of the Night“ beispielsweise ein Buch mit dem (grammatikalisch falschen) deutschen Titel „Die Unaussprechlichen Kulten“ und schreibt, dessen Autor Friedrich Wilhelm von Junzt habe das „Necronomicon“ studiert. Im Gegenzug erwähnt Lovecraft die „Kulten“ in seinen Geschichten. Die Folge ist, dass schon zu Lovecrafts Lebzeiten viele Menschen glauben, das „Necronomicon“ und andere Grimoires seien reale Bücher.
„Dreams and Fancies“: HPL-Anthologie von 1963, bei Arkham House. ¦ Scan: Tom Vincent
Nach seinem Tod verwaiste Lovecrafts Werk, der Cthulhu-Mythos wurde eine Art Open-Source-Fantasywelt.
H. P. Lovecraft: Weltfremder Fantast aus Providence.
Als Lovecraft 1937 an Darmkrebs stirbt, hinterlässt er lediglich eine Handvoll Geschichten, davon vielleicht zwanzig, die dem Cthulhu-Mythos zugerechnet werden können. Er selbst hielt diesen Teil seines Werks für den schwächsten: „Es ist viel zu extravagant und melodramatisch, und ihm fehlt jede Subtilität.“
Vor allem seine literarischen Freunde, die später als „Lovecraftzirkel“ bezeichnet werden sollten, sehen das völlig anders. Sie sind vom Mythos derart fasziniert, dass viele von ihnen einen nicht unerheblichen Teil ihrer weiteren schriftstellerischen Karriere darauf verwenden, Lovecraft fortzuschreiben. Ob Long, Smith oder Derleth – sie alle emulieren ihr Vorbild, teilweise bis hin zur von altertümlichen Adjektiven durchsetzten Sprache und Lovecrafts bewusst vage gehaltenen Beschreibungen.
Der französische Autor Michel Houellebecq, der eine literarische Analyse über Lovecrafts Werk veröffentlicht hat, weist darauftin, wie ungewöhnlich dieser Vorgang ist. „Niemand ist je auf die Idee gekommen, Proust fortzuschreiben – Lovecraft schon.“ Der Amerikaner habe eine Gründungsmythologie geschaffen, so etwas habe es seit dem griechischen Poeten Homer nicht mehr gegeben.
Das klingt überspitzt, denn Homer war der vielleicht bedeutendste Dichter der Menschheitsgeschichte. Andererseits ist es in der Tat erstaunlich zu sehen, wie sehr sich der Cthulhu-Mythos verselbständigt und ausgebreitet hat. Anders als Leiber hat Lovecraft keine Karten gezeichnet, er hinterließ keine detaillierten Beschreibungen seiner Welt wie Howard. Dennoch gibt es inzwischen Hunderte von Cthulhu-Geschichten. Unter Horroautoren gehört es inzwischen fast zum guten Stil, an irgendeiner Stelle zumindest einmal das „Necronomicon“ einzubauen, ja selbst ein FeuilletonLiterat wie Christian Kracht rekurriert auf Lovecraft-Götter wie Azathoth.
Auch sonst ist Cthulhu überall: Das Irrenhaus bei „Batman“ heißt Arkham Asylum, nach der fiktiven Stadt, in der einige Lovecraft-Geschichten angesiedelt sind. Das „Necronomicon“ spielt die Hauptrolle in dem Horrorschocker „Tanz der Teufel“. Von Metallica gibt es einen Song namens „Call of Cthulhu“. Auch in der Zeichentrickserie „South Park“ sind die Großen Alten bereits aufgetaucht, und der Schweizer Künstler H. R. Giger schuf einen ganzen Bilderzyklus namens „Necronomicon“. Man kann mit Fug und Recht behaupten, dass Lovecrafts Welt inzwischen mindestens so wirkungsmächtig ist wie Mittelerde.
Aber warum? Der mesmerisierende Stil Lovecrafts kann die enorme Verbreitung seines Werks nur teilweise erklären. Auch der Umstand, dass seine materialistischnihilistische Weltsicht gut in unsere Zeit passt, ist nur ein Teil der Wahrheit. Besonders wichtig für Cthulhus globalen Siegeszug dürfte der Umstand gewesen sein, dass Lovecraft – ohne es zu wissen – die erste Open-Source-Fantasywelt der Geschichte schuf.
Scheuer Sonderling: HPL soll ein liebenswürdiger, hilfsbereiter Mensch gewesen sein – gleichzeitig schrieb er Hassgedichte auf Schwarze und Asiaten.
Lovecraft selbst hatte nie etwas dagegen, dass andere seine Ideen weiterspannen. Nach seinem Tod versucht sein Freund August Derleth, den Cthulhu-Mythos zu ordnen und zu kanonisieren. Dabei schert er sich wenig um bestehende Copyrights. Lovecraft selbst hatte ohnehin nie irgendwelche Begriffe schützen lassen, und auch seine Erben zeigen zunächst wenig Interesse an seinem Werk. Lange gilt als unklar, wer die Rechte an den veröffentlichten und unveröffentlichten Geschichten des Horrorautors hält. Folglich kann jeder eine Mythosgeschichte schreiben und publizieren, ohne befürchten zu müssen, dass ihm eine einstweilige Verfügung ins Haus flattert. Dadurch kann Lovecrafts monströse Welt immer weiter wachsen.
Viele Künstler und Autoren nennen den Mann aus Providence als eines ihrer wichtigsten Vorbilder, darunter Stephen King, Alan Moore, Neil Gaiman, Mike Mignola, John Carpenter und Guillermo Del Toro. Auch Gary Gygax unterstrich immer wieder, wie enorm wichtig Lovecraft für ihn gewesen sei. Im „Dungeon Masters Guide“ veröffentlichte er den Appendix N, eine Leseliste für Spielleiter. Insgesamt 28 Autoren führt Gygax dort auf, Lovecraft zählt zu den wichtigsten: „Den stärksten Einfluss auf AD&D hatten wohl Camp & Pratt, REH, Fritz Leiber, Jack Vance, HPL, und A. Merritt.“
Gygax war derart begeistert von den Großen Alten, dass er ihnen in dem AD&D-Quellenbuch „Deities & Demigods“ von 1980 sogar ein eigenes Kapitel widmete. Seitdem kannten Rollenspieler Cthulhus Rüstungsklasse (2), wussten, dass er 400 Trefferpunkte besitzt und außerdem dreißigmal pro Kampfrunde angreifen kann (mit einem zehnseitigen Schadenswürfel).
Verschiedene Lovecraft-Ausgaben (von Panther und Arkham House): So wirkungsmächtig wie kein zweiter Horrorautor. ¦ Scans: Tom Vincent
Zwar beschwerte sich kurz darauf der Chaosium-Verlag, der die Lizenz für ein Lovecraft-Rollenspiel namens „Call of Cthulhu“ erworben hatte, über die Rechteverletzung, und die Großen Alten wurden aus „Deities & Demigods“ getilgt. Dennoch dürften D&D sowie AD&D dem Cthulhu-Mythos unzählige neue Fans zugeführt haben; viele Spieler stießen vermutlich erst durch den Appendix N auf den damals noch recht obskuren Schriftsteller.
Und so wurde das spärliche Werk eines eigenbrötlerischen Schriftstellers zu einer der größten virtuellen Welten. Der Mythos ist so erfolgreich, dass er inzwischen Einfluss auf die reale Welt nimmt. Das „Necronomicon“ etwa begannen in den siebziger Jahren immer mehr Menschen für ein real existierendes Buch zu halten; genervte Bibliothekare mussten zahllosen Hobbyesoterikern versichern, dass es das Buch nicht gebe und man auch garantiert nirgendwo ein streng geheimes Exemplar des brandgefährlichen Grimoires weggeschlossen habe, wie Lovecraft in seinen Geschichten schrieb.
Scherzkekse sollen es einst geschaffi haben, eine Signaturkarte für das „Necronomicon“ in den Hauptindex der Universität Yale zu schmuggeln, worauftin sofort Dutzende Nutzer das Buch einsehen wollten. Einer derart hohen Nachfrage konnte die Realität natürlich nicht standhalten. Und so behauptete der bis dahin weitgehend unbekannte US-Verlag Schlangekraft Inc. im Jahr 1977, er habe unter höchst mysteriösen Umständen ein Manuskript erhalten, beim dem es sich um das sagenumwobene „Necronomicon“ handele. Kurz darauf lag das Schwarze Buch überall im gut sortierten Buchhandel aus. In den folgenden Jahren tauchten weitere „Necronomicons“ auf. Heute listet Amazon ein halbes Dutzend verschiedene Versionen.
Arkham-House-Ausgabe: Erschienen 1957. ¦ Scan: Tom Vincent
Quellenbuch für „Cthulhus Ruf“: Erschienen 1988 bei Hobby Products.
Cthulhu-Rollenspiele: Britische Lizenzausgabe bei Games Workshop von 1983, unten links 2007 bei Pegasus Press.
Karte der fiktiven HPL-Stadt Arkham: Aus der britischen „Call of Cthulhu“ – Lizenzausgabe von 1983.
Zeitgeschichte: Historischer Kontext zu den zwanziger Jahren im 2007 bei Pegasus erschienenen Cthulhu-Band.