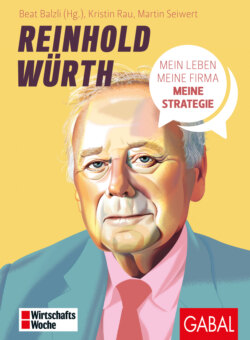Читать книгу Reinhold Würth - Kristin Rau - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеEhrgeiz, Arbeit und Luxus
Herr Würth, irgendwie sind Sie schwer zu fassen. Sie sind ein feinsinniger Kunstsammler. Aber Ihr Lieblingsfilm ist Vier Fäuste gegen Rio mit Bud Spencer und Terence Hill.
(Lacht.) Sie haben recht, ich habe eine gewisse Bandbreite.
Was gefällt Ihnen an diesem Western-Klamauk?
Mir gefällt daran die Situationskomik, das hat für mich Unterhaltungswert.
Mitarbeiter beschreiben Sie als sparsam und bescheiden. Andererseits besitzen Sie eine riesige Jacht, ein Schloss und einen eigenen Flugplatz. Wie passt das zusammen?
Jeder Mensch hat viele Facetten. Das sind für mich keine Widersprüche. Es sind verschiedene Aspekte menschlichen Lebens, meines Lebens.
Wer ist der bessere Unternehmer: ein fokussierter Mensch oder einer mit tausend Facetten?
Es ist besser, wenn man in der Lage ist, über den Tellerrand hinauszublicken und abzuwägen, statt stur einer bestimmten Einstellung zu folgen. Nehmen Sie das Beispiel Sparsamkeit. Unternehmer müssen auf der einen Seite sehr wohl wissen, wo Sparen angebracht ist. Auf der anderen Seite brauchen sie auch eine gewisse Großzügigkeit beim Geldausgeben, so die Investition denn vernünftig ist und etwas bewirkt.
Geld ausgeben kann jeder. Sparen ist schon schwieriger. Wie haben Sie sparen gelernt? Als Kriegskind?
Wenn ich meine Kindheit vergleiche mit der meiner Kinder oder Enkel, dann war das Umfeld natürlich ein völlig anderes. Sparsamkeit und Verzicht hat man damals definitiv gelernt. Das fing schon beim Essen an. Dieses gab es nur auf Lebensmittelmarken. Es gab keine Butter aufs Brot und nur mit Süßstoff gesüßte Marmelade. Ich habe als Kind bei der Freibank am Schlachthof in Künzelsau angestanden. Dort wurden Tiere verwertet, die eigentlich nicht zum Verzehr vorgesehen waren, also krankes oder altes Vieh. Was habe ich mich gefreut, wenn ich da mal ein Stück Fleisch oder Leber ergattert habe! Sparsamkeit war für mich selbstverständlich. Das habe ich beibehalten.
Na ja. Die Jacht, die eigenen Flugzeuge, ihr eigenes Sinfonieorchester …
Das Fliegen, das Bootfahren und die Musik sind eben meine Leidenschaften. Bei all der Arbeit ist es schon in Ordnung, wenn ich mir das gönne. Auf der anderen Seite habe ich früher, wenn es bergab ging, den Motor von meinem Auto abgeschaltet, um ein paar Pfennige beim Benzin zu sparen. Das ist für meine Enkel unvorstellbar. Die schütteln bei solchen Geschichten nur den Kopf.
Als der Zweite Weltkrieg zu Ende ging, waren Sie zehn Jahre alt. Welche Erinnerungen haben Sie an die Kindheit im Krieg?
Ich muss immer an meinen Vater denken, wie er mit einer Decke über dem Kopf Radio Beromünster angehört hat. Mein Vater war gegen Hitler. Wenn jemand mitbekommen hätte, wie er diese hitler-kritischen Sendungen hörte, dann hätte ihn das Kopf und Kragen gekostet. Das galt schon als Wehrkraftzersetzung. Ich muss sagen, die Hitler-Diktatur, die hat mich sehr geprägt.
Können Menschen meiner Generation überhaupt verstehen, wie es damals in Deutschland zuging?
Nein, sicherlich nicht. Wir leben heute in Frieden und Freiheit. Das ist schon seit einigen Generationen nun selbstverständlich. Eigentlich aber müssten die jungen Leute jeden Morgen erst mal minutenlang jubeln und Hurra schreien. Wir müssen uns daran erinnern, dass Frieden keine Selbstverständlichkeit ist. Wenn ich meinen Enkeln oder meinen Studenten erzähle, wie ich als Zehnjähriger fast von einem amerikanischen Jagdbomber totgeschossen wurde, dann werden sie sehr nachdenklich. Sie merken, dass wir heute in einem Schlaraffenland leben.
Nach der Armut in den Kriegsjahren kam das Wirtschaftswunder. Wie muss man Sie sich vorstellen in dieser Zeit?
Ich war eher zurückhaltend, aber sehr neugierig. Als ich so zwölf oder dreizehn Jahre alt war, war ich mal mit meinen Eltern im Schwarzwald und bin mit meiner Kamera losgezogen. Mich reizte, zu sehen, was ums nächste Eck war, wie es hinter dem nächsten Berg aussah oder wie der Fluss hinter der nächsten Biegung weiterfloss. Ich ging immer weiter und weiter und habe dabei alles mit meiner Kamera aufgenommen.
Also ehrgeizig, schon damals.
Ehrgeizig? Ich glaub schon, ein bisschen ehrgeizig bin ich. Sicher nicht übertrieben. Aber ich bin nicht gerne Dritter oder Vierter oder Fünfter. Haben Sie meine Smartwatch gesehen?
Ja, schon, aber was hat die mit Ehrgeiz zu tun?
Sie diszipliniert mich, vor allem was die Bewegung betrifft, indem sie meinen Ehrgeiz weckt. Ich habe da drei Ringe auf dem Display: Bewegung, Training, Aufstehen/Sitzen. Und ich versuche immer, alle drei Ringe vollzubekommen. Diesen Ehrgeiz habe ich. Denn wenn man sich gut bewegt, kriegt man von der Uhr sogar Orden verliehen. Die will ich schon gern haben. Und die Uhr sagt manchmal: Reinhold, das hast du heute gut gemacht, mach morgen so weiter.
Neugierig, ehrgeizig – da waren Sie sicher ein guter Schüler.
Nicht so sehr. Die Schule hat mir sogar richtig gestunken. Ich bin da wahnsinnig ungern hingegangen.
»Ich war immer schon sehr neugierig.
Mich reizte, zu sehen, was ums nächste Eck war,
wie es hinter dem nächsten Berg aussah.«
Reinhold Würth bei einer archäologischen Expedition in Syrien
Warum? Hätten Sie lieber was mit Ihren Freunden unternommen?
Nein, dafür blieb keine Zeit. Mein Vater hat direkt nach dem Krieg seine Schraubenhandlung eröffnet. Während die anderen Kinder in dem Fluss Kocher schwimmen waren, habe ich als Zehnjähriger meinem Vater geholfen. Schon vier Wochen nachdem die Amerikaner einmarschiert waren, bin ich mit ihm auf einem Kuhfuhrwerk 15 Kilometer kocherabwärts zu Arnold, unserem ersten Lieferanten, gefahren, um Schrauben abzuholen. Im Lager habe ich die Schrauben dann verpackt und mit einem kleinen Leiterwagen ausgeliefert.
Heute würde man das Kinderarbeit nennen.
Ja, wenn Sie so wollen. Aber es hat mir nicht geschadet.
Aber Ihr Vater ließ Ihnen keine Wahl. Sie mussten bei ihm im Unternehmen anfangen. Hätten Sie sich nicht für etwas anderes entschieden, wenn Sie hätten frei wählen können?
Ich hatte keine anderen Pläne. Das war damals auch nicht üblich. Was der Vater sagte, das wurde gemacht. Das war das Evangelium, sozusagen. Meine Mutter wollte, dass ich Schulmeister werde. Sie hat gesagt: Dann hast du einen sicheren Job, hast ein gutes Einkommen und musst nicht viel tun. Aber was der Vater gesagt hat, hat gegolten. Damals gab es nicht diese Unsicherheit wie heute bei den jungen Leuten: Was willst du denn machen? Ach, lass dir Zeit. Mach dir nur keinen Stress. Du findest schon etwas, was dir gefällt. Mein Vater hat gesagt: So wird es gemacht. Ende.
»Meine Mutter wollte, dass ich Schulmeister werde.
Sie hat gesagt: Dann hast du einen sicheren Job und musst nicht viel tun.«
Reinhold Würth (links) mit Bruder Klaus-Frieder, Mutter Alma und Vater Adolf
Und so haben Sie bei ihm eine Lehre zum Großhandelskaufmann angefangen.
Ja. Er hat mich mit 14 Jahren nach dem Ableisten der Pflichtschuljahre von der Schule genommen. Dafür bin ich ihm bis heute dankbar, denn er hat mich toll ausgebildet.
Haben Sie es wirklich nie bereut, dass Sie kein Abitur gemacht haben? Dass Sie nicht studieren konnten?
Das Leben war meine Universität.
Nach allem, was Sie erzählen, hatten Sie einen ziemlich strengen Vater.
Nein, dann ist das falsch rübergekommen. Mein Vater war vor allem ein lebensfroher Mensch. Er hat gerne ein Glas Wein getrunken und hatte permanent seine Zigarre an. Als er sich damals selbstständig gemacht hat, wollte er vor allem unabhängig sein und seiner Familie ein gutes Auskommen sichern. Das war ihm wichtig. Wir sind aber auch in Urlaub gefahren. Vor allem in eine Pension nach Schönmünzach im Schwarzwald und an die Ostsee. Auch schon vor dem Krieg.
Das Leben war meine Universität.
Wie, daran können Sie sich noch erinnern?
Ein wenig. Ich kenne es vor allem aus späteren Erzählungen. An ein Ereignis kann ich mich aber gut erinnern. Ich war wahrscheinlich vier Jahre alt oder so und wir waren gemeinsam an der Ostsee. Nivea hatte am Strand zu Werbezwecken Ritterhelme und Schilder aus Pappmaschee für Kinder verteilt. Das war ein Riesenspaß. Komisch, an was man sich manchmal so erinnert.
Nun ja, es war eine clevere Verkaufsaktion. Wundert mich nicht, dass das bei Ihnen hängen blieb.
Zwischen Klinkenangst und der Liebe zum Verkauf
Sie haben gerade von Ihrem Vater als Privatmann erzählt. Wie war er als Chef?
Er hat schon anerkannt, dass ich immer das gemacht habe, was er mir aufgetragen hat. Und wenn es mal nicht so ging, wie er sich das vorgestellt hat, dann gab es ab und zu eine hinter die Löffel. Im Großen und Ganzen habe ich ihn als fairen, vorbildlichen Chef in Erinnerung.
Was haben Sie von ihm gelernt?
Fleiß natürlich. Mein Vater hat immer schon mehr gemacht, als er musste, hat Eigeninitiative bewiesen.
Das würde wahrscheinlich jedes Unternehmen seinem Gründer bescheinigen.
Ja, aber bei ihm war das schon sehr ausgeprägt. Es gibt da eine sehr schöne Geschichte, die ich vom Hörensagen kenne. Nach der Weltwirtschaftskrise 1929 hat mein Vater zu seinem damaligen Chef gesagt: Ich fahre jetzt mal nach Berlin und verkaufe unsere Schrauben dort. Der Chef hat nur gelacht und gesagt: Die warten in Berlin ge-rade auf dich, damit du denen Schrauben verkaufst. Mein Vater hat es trotzdem versucht.
Und: Hat es funktioniert?
Ganz wunderbar hat es geklappt. Bis dahin hat kein anderer Schraubenhändler Kunden in der ganzen Nation bedient. Das war eine Innovation im Markt. Bis heute sind die meisten Schraubenhändler ausschließlich in einem Umkreis von 50 bis 100 Kilometer von ihrem Geschäftssitz tätig und fahren die Ware noch mit ihren Lastern beim Kunden vorbei. Aber 500 Kilometer weiter denkt kaum einer. So gibt es in Deutschland bis heute nur drei, vier wichtige Wettbewerber, die unser Konzept adaptiert haben. Den Anstoß dazu gab mein Vater mit seinem unverbrüchlichen Antrieb. Ich habe diese Expansion dann weiter vorangetrieben.
Fleiß ist also eine Eigenschaft, die Sie von Ihrem Vater haben. Was noch?
Berechenbarkeit. Mein Vater war immer ein sehr korrekter Kaufmann. Er stand für Kontinuität und Verlässlichkeit, sowohl gegenüber seinen Mitarbeitern als auch seinen Kunden. Er orientierte sich stets an seinen moralischen Vorstellungen und rückte von ihnen auch nicht ab. Auch nicht im Dritten Reich.
Das haben später viele Deutsche von sich behauptet, obwohl es nicht stimmte. Wie können Sie wissen, wie Ihr Vater es mit den Nazis hielt?
Er war nie mit den NS-Leuten verbandelt, war nie in der NSDAP. Deshalb haben die Amerikaner ihn auch als stellvertretenden Bürgermeister vorgeschlagen, nachdem sie hier einmarschiert waren.
Hat er es gemacht?
Nein, er hat abgelehnt. Er wollte lieber seine Firma aufziehen und unabhängig sein. Er war Verkäufer mit Leib und Seele.
Wann haben Sie bemerkt, dass auch Sie das Zeug zum Verkäufer haben?
Das kam eher so evolutionär. Am Anfang war es sicher anders. Wenn mein Vater mich mit 16 Jahren nach Düsseldorf oder Köln auf Verkaufstour geschickt hat, da war von dieser Leidenschaft noch überhaupt nichts zu spüren. Da hatte ich einfach Klinkenangst.
Klinkenangst? Was ist das denn?
Wenn Sie beim Kunden die Türklinke hinunterdrücken und nicht wissen, was Sie auf der anderen Seite erwartet. Werde ich gleich rausgeschmissen? Oder werde ich wohlwollend empfangen? Sind die Leute freundlich? Oder haben sie gerade keine Zeit? Das nennen wir Klinkenangst.
Für manchen wäre der Beruf des Verkäufers ein Graus. Warum lieben Sie ihn?
Ach, wissen Sie, es gibt keinen Beruf außer vielleicht dem eines praktischen Arztes, bei dem Sie so viele verschiedene Menschen treffen. Sie lernen alles kennen, was auf Gottes Boden herumrennt. Sanguiniker, Choleriker, Lügner, Bescheidene, Arrogante. Alles, was es gibt. Und dabei eignen Sie sich im Laufe der Jahre eine gute Menschenkenntnis an. Ich bilde mir jedenfalls ein: Wenn ich eine Stunde mit einem Menschen verbringe und mir anhöre, was da so rauskommt, kann ich recht gut einschätzen, was das für ein Mensch ist. Ein Angeber, ein Sympath, ein erfolgreicher Mensch … Daraus entwickelt sich natürlich auch ein gewisser Vorteil gegenüber einem Mitarbeiter, der das ganze Jahr nur vor seinem Computer hockt. Insofern ist das für mich eine unglaublich befriedigende Tätigkeit.
Als Verkäufer lernen Sie alles kennen,
was auf Gottes Boden herumrennt.
Wird man durch Menschenkenntnis zu einem besseren Verkäufer?
Natürlich muss man beim Verkaufen auch Menschen einzuschätzen wissen, auf sie eingehen, sie genau dort abholen, wo sie sich mental gerade befinden. Die Menschenkenntnis führt dazu, dass ein Verkäufer ganz besonders erfolgreich sein kann. Heute ist Würth allein in der Adolf Würth GmbH & Co. KG in Deutschland mit über 3000 Außendienstlern tätig. Weltweit sind es sogar über 33.000 Verkäufer. Die profitieren alle von meinen ersten Erfahrungen.
Inwiefern?
Ich habe dazu ein kleines Pamphlet geschrieben. Es heißt: »Wie werde ich ein guter Verkäufer bei Würth«. Das wurde mittlerweile in über zehn Sprachen übersetzt. Jeder junge Verkäufer und neue Außendienstmitarbeiter bekommt das. So bleibt was von meiner Erfahrung im Unternehmen.
Wie oft mussten Sie die Erfolgsrezepte schon umschreiben?
Gar nicht.
Es sind immer noch dieselben wie vor 65 Jahren? Die Verkaufswelt ändert sich doch rasant, zuletzt durch das Internet.
Natürlich sind es noch dieselben Regeln. Die gelten immer. Mit oder ohne Internet.
Was steht also in dem Buch?
Zum einen sind es eher allgemeine Erkenntnisse. Zum Beispiel, dass ein guter Verkäufer fleißig sein muss. Denn Erfolg besteht bekanntlich zu zehn Prozent aus Inspiration und zu 90 Prozent aus Transpiration. Das war schon immer so und das wird auch so bleiben. Zum anderen finden sich darin aber auch ganz praktische Tipps zur Arbeitskleidung oder zum Verkaufsgespräch. Zum Beispiel zeigt mir meine Erfahrung, dass ein aufgeschlagener Katalog meist schon ein halber Auftrag ist.
Katalog? Im Internetzeitalter funktioniert das aber nicht mehr so einfach.
Der Katalog ist bis heute eines unserer Verkaufsinstrumente.
Können Sie sich noch an Ihre erste große Verkaufstour erinnern?
Sicher. Schon während meiner Ausbildung schickte mich mein Vater für zwei Wochen nach Düsseldorf. Damals war ich 16 Jahre alt. Es war Winter, überall lagen Schnee und Matsch, ich hatte ständig nasse Füße. Ich wohnte im Hotel und machte mich jeden Morgen auf zum Verkaufen. Bis nach Wuppertal bin ich gefahren.
Die Regeln für den Verkauf gelten immer.
Mit oder ohne Internet.
Und: Waren Sie erfolgreich?
Ja, ich schloss viele Aufträge ab. Einer meiner ersten Kunden war der größte VW-Händler in Düsseldorf. Er orderte messingverchromte Nummernschildschrauben für Transporter. Er ist bis heute unser Kunde.
Bestimmt ein wichtiger Vertragsabschluss. Volkswagen war der Wirtschaftswunderkonzern schlechthin.
Das war natürlich nicht schlecht. Aber es ging nicht um VW, sondern die Autohändler allgemein. Damals sprossen Werkstätten und Händler der Autohersteller wie Pilze aus dem Boden. Da war es schon wichtig, Kontakt herzustellen und die Einkäufer von unseren Produkten zu überzeugen.
Nun schleppten Sie also all diese neuen Aufträge an. Wie reagierte Ihr Vater?
Mein Vater war keiner, der andere großartig gelobt hätte. Ich habe ihm ein schönes Bündel Aufträge für etwa 2000 D-Mark präsentiert und er hat das eher schweigend zur Kenntnis genommen. Erst Jahre später habe ich von meiner Mutter erfahren, dass mein Vater ihr schmunzelnd erzählt hätte, ich hätte gar keine schlechte Arbeit geleistet. Er war eben ein typischer Hohenloher. Die leben nach dem Motto: »›Nix gsagt‹ isch gnug globt!«
Hat Sie das als Junge geschmerzt?
Natürlich hätte ich mich über ein Lob von ihm gefreut. Aber so war er eben. Ich wusste schon, dass ich wichtig für ihn und den Betrieb war. Ich war sein Leibchauffeur. Wir unternahmen gemeinsam Verkaufsfahrten, etwa in die Schweiz, weil man da nur mit dem Auto hinkam.
Sie mussten fahren? Warum?
Mein Vater hatte keinen Führerschein. Deshalb durfte ich ihn schon mit 16 Jahren machen. Da musste ich beim Amtsarzt antanzen. Der hat dann geprüft, ob ich schon reif genug war, um ein Auto zu fahren. Das war ich.
»Mein Vater hatte keinen Führerschein.
Deshalb durfte ich ihn schon mit 16 Jahren machen
und mit meinem Vater Verkaufsfahrten unternehmen.«
Adolf und Alma Würth mit Sohn Klaus-Frieder und dem ersten Firmenwagen, einem 15 Jahre alten Opel Olympia. Am Fotoapparat: Reinhold Würth
Übernahme des Unternehmens
Nur drei Jahre später, nach dem plötzlichen Tod Ihres Vaters, mussten Sie nicht nur reif genug sein, um ein Auto zu lenken, sondern einen ganzen Betrieb. Hand aufs Herz, wovor hatten Sie am meisten Angst?
Ich hatte gar keine Zeit, Angst zu haben. Ich bin da einfach reingesprungen. Habe getan, was getan werden musste, um den Betrieb am Laufen zu halten. Der Bau des neuen Firmengebäudes war gerade in vollem Gange. Ich musste die Lagerbestände erweitern, um all unsere Kunden zufriedenzustellen. Nur sechs Tage nach Vaters Tod – kurz vor Weihnachten – habe ich eine größere Verkaufsreise ins Rheinland angetreten. Es musste weitergehen. Gerade zu Beginn habe ich mich stark daran orientiert, was mein Vater gemacht hat. Das habe ich fortgeführt.
Zukunftsängste kannte ich nicht. Ich habe einfach gemacht, weil ich musste.
Verklären Sie das nicht vielleicht im Rückblick? Sie müssen doch oft ans Scheitern gedacht haben.
Wie viele andere war auch ich in meiner Jugend eher unbedarft. Zukunftsängste kannte ich nicht. Ich habe einfach gemacht, weil ich musste. Mein jüngerer Bruder war damals gerade zehn Jahre alt und ich war über Nacht zum Ernährer der ganzen Familie geworden. Ich musste schlicht sehen, dass Geld in die Kasse kam. Zeit zum Grübeln war da nicht.
»Es gibt ja Menschen, die sehen jeden Tag die Welt untergehen, auch schon in ihrer Jugend.
So eine Denkweise ist mir völlig fremd.«
Reinhold Würth begann als Jugendlicher eine Lehre in der Schraubenhandlung des Vaters
Die Unbedarftheit war also ein Vorteil?
Natürlich. Es gibt ja Menschen, die sehen jeden Tag die Welt untergehen, auch schon in ihrer Jugend. Die sehen nur Probleme. So kann doch nichts Neues entstehen. So eine Denkweise ist mir völlig fremd.
Aus einem Zweimannbetrieb ist ein Weltkonzern mit über 77.000 Mitarbeitern geworden. Hatten Sie schon am Anfang das Ziel, etwas ganz Großes aus dem Erbe zu machen?
Nein, überhaupt nicht. Es ging nur darum, dass meine Mutter, mein Bruder und ich etwas zu essen hatten. Der Wunsch, das Unternehmen auszubauen und voranzukommen, war völlig sekundär. Das ist eigentlich bei jeder Leidenschaft ähnlich. Nehmen wir beispielsweise das Kunstsammeln. Das machen Sie am Anfang eher dilettantisch und hobbyhaft. Wenn Sie dann aber eine Weile in dem Metier drin sind, dann wird das zur Passion.
Wann haben Sie gemerkt: Unternehmer, Schraubenhändler, das ist das Richtige für mich?
Kann ich schwer sagen. Irgendwann, nach ein paar Jahren, habe ich gemerkt: Ich kann das. Und habe mich dann auch getraut, die Wege meines Vaters zu verlassen und größer zu denken.
Was waren in dieser Zeit die großen Herausforderungen?
Der Auf- und Ausbau unseres Außendienstes. 1956 bin ich 90.000 Kilometer mit meinem Mercedes durch Deutschland gefahren. Aber mir war auch klar, dass ich alleine den Umsatz nicht ins Unendliche steigern konnte. Also musste ich neue Verkäufer einstellen. Ich habe immer gesagt, 95 Prozent des Unternehmens sind der Außendienst. Alles andere macht nur fünf Prozent aus. Das wurde von den Innendienstlern natürlich mit Naserümpfen zur Kenntnis genommen. Aber ich habe das gut erklärt. Denn wenn die Verkäufer keine Aufträge bringen, dann können die anderen alle nach Hause gehen. Und deshalb ist es tatsächlich so, dass der Außendienst immer schon die Speerspitze des Unternehmens war und bis heute ist. Doch diese Verkäufer musste ich damals erst einmal finden und ausbilden.
»1956 bin ich 90.000 Kilometer mit meinem Mercedes durch Deutschland gefahren. Ich konnte den Umsatz nicht ins Unendliche steigern. Also musste ich Verkäufer einstellen.«
Die Hauptvertreter (sitzend), die Reinhold Würth (stehend) Mitte der 50er-Jahre einstellte
Wie sah eine solche Ausbildung aus?
Am Anfang war viel Learning by Doing. Nicht so wie heute mit all den Trainingsprogrammen. Ich habe schon 1958 ein Provisionsmodell eingeführt. Das hat zum einen die bereits angestellten Mitarbeiter angespornt und zum anderen potenzielle Verkäufer angelockt, weil sie verstanden haben: Wer bei Würth was leistet, verdient auch entsprechend. Im selben Jahr mussten wir erneut unsere Gebäude vergrößern.
Der Außendienst war immer schon die Speerspitze des Unternehmens und ist es bis heute.
Also nur sechs Jahre nach dem ersten Neubau.
Ja, genau. Die schnell steigenden Umsätze machten immer größere Lagerkapazitäten notwendig. Wir vergrößerten das Firmengebäude und begannen, auch selbst Schrauben herzustellen.
»Es wäre schon schön gewesen,
wenn der Vater noch hätte>sehen können,
was aus seiner Schraubenhandlung geworden ist.
Wer weiß, vielleicht sieht er es ja.«
Kistenchaos in Künzelsau – das junge Unternehmen war von der hohen Nachfrage oft überfordert
Ihre Expansionsstrategie ist aufgegangen. Würth ist heute Weltmarktführer für Befestigungs- und Montagematerial, macht jährlich mehr als 13 Milliarden Euro Umsatz. Finden Sie es schade, dass Sie Ihrem Vater nicht zeigen konnten, was Sie aus seiner kleinen Schraubenhandlung gemacht haben?
Es wäre schon schön gewesen, wenn der Vater das noch hätte sehen können. Wer weiß, vielleicht sieht er es ja. Ohne die tolle Lehre bei meinem Vater wäre ich sicherlich nicht halb so erfolgreich. Er hat mir viel mitgegeben: die Internationalisierung, weil wir ja schon zusammen in der Schweiz zum Verkaufen waren. Aber auch das kaufmännische Grundwissen und die Produktkenntnis habe ich von ihm. Dafür bin ich ihm heute noch dankbar.