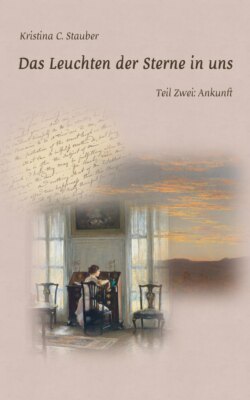Читать книгу Das Leuchten der Sterne in uns- Teil Zwei: Ankunft - Kristina C. Stauber - Страница 8
III.
Оглавление„Kommen Sie nur herein in die gute Stube!“
Ebenezer Washington saß im kühlen Halbdunkel des Pastorenhauses.
Die Haushälterin hatte sie hereingeführt und war dann wieder verschwunden.
Eleonore blieb unschlüssig in sicherer Entfernung zum Reverend stehen. Der saß in einem Schaukelstuhl, aufgeplusterte Kissen in seinem Rücken, und sah sie prüfend an.
Eleonore presste ihr Bündel an sich.
Sie hatten vereinbart, dass sie kurzfristig kommen würde, denn der Unterricht war in vollem Gange. Er würde erst unterbrochen werden, wenn die Erntezeit begann. Danach würde es noch eine kleine Einheit geben, bis der Schnee verhinderte, dass die Kinder von den umliegenden Gehöften nach Silver Springs kommen konnten.
Der Reverend machte eine einladende Handbewegung.
„Kommen Sie doch, Ms Williams, setzen Sie sich hier auf das Sofa. Sie wollen entschuldigen, dass ich nicht aufstehe, um Sie richtig zu begrüßen, aber meine Freundin hier…“
Er wies auf seinen Schoß, auf dem etwas lag, was sie aber im Halbdunkel nicht erkennen konnte, nachdem sie aus der flirrenden Hitze und gleißenden Helligkeit hereingetreten war. Also setzte sie sich auf die vorderste Kante des geschmacklos geblümten Möbels und sah den Reverend erwartungsvoll an.
„Sehen Sie nur!“, fuhr dieser fort und streichelte über den Gegenstand, den er auf dem Schoß hielt, den Eleonore langsam aber sicher, während sich ihre Augen an das dämmrige Licht gewöhnten, als weißes Fellbündel erkannte.
„Das ist Chastity. Sie ist eine sehr vornehme Hundedame! Bisher ist sie die Einzige, die mir an den Abenden Gesellschaft leistet.“
Er blickte auf und sah Eleonore direkt an, was ihr aber entging, denn sie starrte in einer Mischung aus Belustigung, dem Bemühen, nicht laut loszulachen und Verwunderung auf den Schoßhund. Während Washington dem Tier über den Rücken streichelte und dabei das Fell zwirbelte, fügte er beiläufig hinzu: „Aber vielleicht ändert sich das ja bald.“
Eine Pause entstand, in der man nur das Schnaufen des Hundes im Schlaf hörte und das Ticken der Standuhr, die im Durchgang zum vorderen Teil des Raumes stand, wo sich der Esstisch und ein Sekretär sowie ein dünn bestücktes Bücherregal befanden.
„Wollen Sie sie einmal streicheln?“, fragte Ebenezer Washington da unvermittelt. „Ihr Fell ist ganz weich! Ich bürste es jeden Abend.“ Beifall heischend sah er sie an.
Eleonore traute ihren Ohren nicht. Wieder musste sie sich auf die Lippe beißen, um nicht loszulachen. Was für ein merkwürdiger Kauz der fromme Mann doch war!
Sachlich zu bleiben war wohl die beste Lösung.
„Mr Washington, Sir. Wäre es wohl möglich, dass Mrs Robbins mir zeigt, wo ich wohnen werde? Ich bin ein wenig müde von der Fahrt hierher. Die Hitze, Sie verstehen?“
Sie fasste sich vage an die Stirn.
Washington schaute sie aus schmalen Augen an. „Aber natürlich. Wie unaufmerksam. Möchten Sie vielleicht noch eine Erfrischung vorher? Ein Sandwich? Ein Glas Limonade?“
Sie schüttelte den Kopf. „Danke. Das ist sehr freundlich von Ihnen. Aber ich möchte mich gerne einrichten und erfrischen.“
„Aber ja, Ms Williams!“
Er griff nach einer Klingel, die auf dem Tischchen neben ihm stand und läutete nach Mrs Robbins.
Der Hund wurde von dem Geräusch munter, sah auf, schüttelte sich und knurrte Eleonore dann an.
„Ja, das beruht auf Gegenseitigkeit, du Köter, du bist mir auch wenig sympathisch!“, schimpfte sie in ihren Gedanken, während sie erleichtert Mrs Robbins entgegensah, die entnervt aus der Küche angerauscht kam.
* * *
Ihre Unterkunft war einfach und klein. Es war ein ehemaliger Geräteschuppen, der sich am anderen Ende des Grundstücks vom Reverend befand. Er bestand aus nur einem Raum, eine Nische war mit einem kleinen Herd ausgestattet, der im Winter als Ofen dienen musste. Ansonsten stand unter dem Fenster ein Bett und gegenüber ein kleiner Tisch mit zwei alten Stühlen.
Das Grundstück lag am Ende des Dorfes und war somit großzügig bemessen.
In der Mitte zwischen ihrem neuen Zuhause und dem Haus des Reverends stand eine weitere Hütte, die als Schulgebäude diente.
Das Haus des Reverends war von den drei Gebäuden am nächsten am Dorf gelegen, der Rest des Geländes lag nach hinten heraus Richtung Wald. Eleonore registrierte erleichtert, dass die Entfernung zum Haupthaus nicht unerheblich war, obwohl beide auf demselben Grundstück standen.
So würde sie ihre Ruhe haben. Die Sorgen von Ruth waren ohnehin völlig unbegründet, aber so hatte sie einen Grund mehr, die Freundin zu beruhigen.
Die harschen Worte, die sie vor einigen Tagen verloren hatte, taten ihr noch immer leid.
Sie war froh, dass sie sich gleich wieder vertragen hatten.
Auch, dass Antonio und Manuel nicht nachtragend waren, nachdem sie ihnen von ihrem Entschluss berichtet hatte, nach Silver Springs zu gehen, um zu unterrichten, und das so kurzfristig.
Manuel hatte ein wenig genörgelt. Aber Antonio, in seiner Güte, die Eleonore über die letzten Jahre zu schätzen gelernt hatte, hatte sie nur wohlmeinend angeschaut. „Ich habe schon damit gerechnet, meine Liebe, dass es dich eines Tages von hier fort ziehen würde und du zu mehr berufen bist! Dass es so schnell sein würde, habe ich nicht geahnt. Aber ich will dich nicht unnötig hier festhalten. Wir haben ja alle nichts davon, wenn du nervös und zappelig deine Arbeit tust, in Gedanken aber schon weg bist.“
Manuel hatte eingeworfen: „Aber du hättest schon sagen können, was du vorhast! Dann hätten wir uns schon mal nach Ersatz umschauen können!“ Antonio hatte ihn scharf von der Seite angesehen und sich über das Kinnbärtchen gerieben, das er sich neuerdings stehen ließ.
„Sie ist sowieso nicht ohne weiteres ersetzbar, Manuel. Und die Ankunft von Ruth und Eleonore war eine Bereicherung für uns alle! Wir sollten dankbar sein, dass wir so viel Zeit mit ihnen teilen durften. Schau nur, wie jung sie noch sind. Es war klar, dass sie uns irgendwann verlassen würden“, hatte er weise gesprochen und Manuel kaum merklich die Hand getätschelt, eine der seltenen Gesten der Vertrautheit, welche die beiden vor anderen austauschten.
Eleonore hatte schlucken müssen. Womit hatte sie so viel Nachsicht und Verständnis verdient, nach alldem, was sie auf der Hope Ranch gefunden und gelernt hatte?
Doch nun fing ein neues Kapitel an. Während Eleonore ihr neues Zuhause in Augenschein nahm, und draußen im Hof die Hühner im Staub vor sich hin scharrten und gackerten, senkte sich die Junisonne über Silver Springs. Morgen würde sie den Unterricht aufnehmen. Morgen würde sie beginnen, den Kindern des County ihr Wissen zu vermitteln.
* * *
„Der Reverend hat aber gesagt, dass Frauen im Allgemeinen gar nicht wissen, was sie sagen. Sie lassen sich von ihren Gefühlen leiten und sind deshalb nicht ra… ralitio… rantio… rational!“
Der rothaarige Bub, dessen Name ihr schon wieder entfallen war, stand selbstzufrieden, dass er das schwierige Wort nun doch hatte wiederholen können, vor ihr.
Eleonore lugte in ihre Notizen.
„So,… Michael! Das hat der Reverend also gesagt?“
Eleonore wusste im ersten Moment gar nicht, was sie dem Rotzlöffel erwidern sollte.
„Und was genau, denkst du, verleitet den Reverend zu dieser These?“, fragte sie ihn schließlich.
Der Junge sah auf seine nackten, dreckigen Füße. Eleonore würde Mrs Robbins bitten müssen, darauf zu achten, dass die Kinder vernünftig gekleidet und mit sauberen Händen und Füßen in den Unterricht kämen.
Sie kritzelte sich schnell eine Notiz in ihr kleines Büchlein.
Es war der erste Tag, an dem sie selbst unterrichtete.
Es war noch früh, Ebenezer Washington hatte ihr den Morgen-Unterricht übertragen.
Das Prinzip der Schule war, dass die Kinder der umliegenden Höfe nur an den Wochenenden nach Hause fuhren, der Weg war für die meisten zu weit, um ihn täglich zurückzulegen. Einige Kinder kamen auch aus Silver Springs. Sie waren aber in der Unterzahl.
Somit übernachteten die Jungen in einem Raum auf der Rückseite des Schulgebäudes, die wenigen Mädchen waren in einem Anbau der Küche, in Reichweite von Mrs Robbins, untergebracht.
Eleonore hatte, nachdem der Reverend sie der Klasse vorgestellt hatte, alle Schüler gebeten, ihren Namen zu nennen und zu sagen, was sie bereits wussten und was ihre Interessen waren.
Und nun stieß sie unvermittelt bei diesem Jungen auf die erste Herausforderung.
Der wischte sich in aller Seelenruhe über den sommersprossigen Nasenrücken.
„Steht in der Bibel, hat er gesagt, der Reverend. Und was in der Bibel steht, stimmt! Oder glauben Sie das nicht?“, bohrte er trotzig.
Sie suchte fieberhaft nach einer Antwort, die dem Kind zeigen würde, dass es sich der Reverend eventuell ein wenig einfach machte mit dieser Behauptung. Aber sie wollte nicht gleich am ersten Tag Washingtons Autorität untergraben.
Sie seufzte.
„Nun, Michael. Wenn das so ist, dann kannst du mir doch sicher die Stellen heraussuchen, oder?“
Überrascht sah sie der Naseweis an.
„Du hast bis übermorgen Zeit. Abgemacht?“
Ohne auch noch seine Reaktion abzuwarten, wandte sie sich dem nächsten Kind zu, einem kleinen Mädchen, das sie voller Bewunderung ansah.
„Und wer bist du?“, fragte sie die Kleine freundlich und ermutigend.
„Ich bin die Nettie Miller.“ Das Mädchen musste hicksen, sie hatte einen Schluckauf. Wahrscheinlich war sie nervös. Eleonore ging das Herz auf. Sie wollte dem Mädchen helfen, weniger aufgeregt zu sein.
„Guten Tag, Nettie Miller“, sagte sie sanft, „es freut mich, deine Bekanntschaft zu machen! Was interessiert dich am meisten?“
Nettie drehte nervös ihren geflochtenen blonden Zopf zwischen den Fingern und steckte dann das Ende in den Mund, um daran zu kauen.
Dann nuschelte sie verschämt etwas Unverständliches.
Eleonore spürte, dass Nettie es nicht gewohnt war, vor einer so großen Runde zu sprechen und beließ es dabei. Sie würde sie später alleine befragen und ein besonderes Auge auf dieses kleine verschreckte Rehkitz haben.
* * *
„Nun, Ms Williams, wie läuft es denn so?“
Ebenezer Washington stand im Türrahmen. Sie konnte nur seine Umrisse sehen, denn die Sonne stand in seinem Rücken, so dass er wie ein schwarzer Schatten wirkte.
Die erste Woche war herum, die kleinen Schüler waren auf dem Weg nach Hause. Während sie unter der Woche im Ort blieben, fuhren sie alle gesammelt am Freitagmittag auf die Höfe zurück, um an den Wochenenden dort helfen zu können.
Eleonore hatte die paar Utensilien zusammengeräumt, die sie für den Unterricht verwendet hatte. Unter anderem lag die Bibel dort, aus der sie Michael die Stellen vorgelesen hatte, in denen gezeigt wurde, dass Frauen mitnichten irrationale und minderwertige Geschöpfe waren. Die Bibel war aufgeschlagen beim Buch der Richter, denn Eleonore hatte Michael und den anderen Kindern als letztes von Debora berichtet. „Du siehst also, Michael, schon in der Schrift wird von Frauen erzählt, die Berufe ausüben, welche denen der Männer gleichwertig sind. Pass also das nächste Mal auf, wenn du die Meinung anderer einfach nachsprichst, ohne dich informiert zu haben, was die Wahrheit ist. Das könnte schnell unangenehm werden.“
Sie hatte sich an alle gewandt, denn sie wollte den Bub nicht zu sehr vorführen, das würde ihn ihr nicht zum Freund machen.
„Das ist das Wichtigste, Kinder. Bevor ihr den Mund aufmacht: Denkt nach! Und macht euch eure eigenen Gedanken. Nicht alles, was man euch erzählt, stimmt notwendigerweise! Hinterfragt alles und wägt ab, bevor ihr euch eine Meinung bildet…“
Sie hatte ins Leere gestarrt, denn in diesem Moment hatte sie ganz kurz das Gefühl gehabt, ihr Vater stünde neben ihr, höre zu und wiege dann wohlwollend den Kopf.
Das Bild war so schnell verschwunden, wie es gekommen war, als Michaels Stimme zu hören gewesen war: „Aber Ms Williams!“
Eleonore hatte aufgesehen.
„Michael, wer etwas sagen möchte, hebt die Hand!“
Ungeduldig und etwas widerwillig hatte er den Finger hochgehoben. Sie hatte ihm zugenickt.
„Also, Ms Williams, wenn nicht alles stimmt, was die Leute sagen, wer sagt denn, dass Sie uns nicht Quatsch erzählen?“
Er hatte sie herausfordernd angesehen. Eleonore hatte bedächtig genickt. Kluges Kerlchen.
„Das ist ein berechtigter Einwand, Michael. Und zeigt mir, dass du nachdenkst. Sehr gut! Du kannst gerne prüfen, was ich sage. Und wenn dir etwas einfällt, was falsch ist oder dir merkwürdig erscheint, darfst du, dürft ihr alle, fragen. Dafür sind wir hier: Um zu lernen, wie man den Sachen auf den Grund geht.
Aber…“, und sie hatte den Finger mahnend erhoben, „…ihr spielt nach meinen Spielregeln. Das heißt, wer etwas zu sagen hat, hebt die Hand und wartet sittsam und höflich, bis er an der Reihe ist. Verstanden? Und nun verschwindet schon ins Wochenende!“
Als der Reverend nun hereinschaute, saß sie gerade am Schreibtisch und reflektierte die vergangenen Tage. Ihr Kopf brummte, aber auf eine angenehme Art, so als ob ihre Gehirnwindungen seit langem wieder voll beansprucht waren. Was tat diese Herausforderung gut! Auch wenn die meisten Kinder kaum Grundbildung mitbrachten, sie waren zumeist nicht auf den Kopf gefallen und es machte ihr Spaß, sich den Fragen und der Wissbegierde zu stellen.
Der Reverend kam nun ganz herein, so dass sie sein Gesicht sehen konnte. Wieder lag etwas Lauerndes darauf. Er trat an den Tisch, der als Pult diente und lugte in die aufgeschlagene Bibel. Als er die markierte Stelle sah, kräuselte er die Stirn, sagte aber nichts.
Eleonore hatte bereits überlegt, ob sie ihn einmal auf seinen Unterricht ansprechen sollte und den Unsinn, den er den Kindern beizubringen schien. Außer Michaels frecher Eingangsbemerkung war ihr schon an anderer Stelle aufgefallen, dass er vor den Schülern offensichtlich mit seinem Weltbild kaum hinterm Berg hielt und Eleonore kam das, was sie aus den Andeutungen oder Rückfragen an Schlüssen ziehen konnte, höchst bedenklich vor.
Sie wollte aber nicht den Unmut des Reverend provozieren, damit wäre niemandem gedient, und wer wusste schon, was die Kinder von ihm hatten und was sie von zu Hause mitbrachten. Sie würde behutsam vorgehen müssen.
Eleonore schickte sich an aufzustehen, um zurück in ihr Quartier zu laufen. Als sie einen knappen Gruß murmelnd am Reverend vorbeilief, fasste dieser sie plötzlich am Handgelenk. Die Berührung kam so unerwartet, dass sie zusammenzuckte. Sofort ließ er wieder los und fragte schnell: „Ms Williams, Mrs Robbins hat für morgen ein vorzügliches Mahl geplant. Erweisen Sie mir die Ehre und speisen Sie mit mir!“
Seine Frage klang wie ein Befehl. Froh, dass sie einen Grund hatte, nicht zu einer Notlüge greifen zu müssen, sah sie ihm direkt in die Augen. Sie sah dort wieder dieses merkwürdige Glühen. Er strich sich über das streng nach hinten geölte Haar. Sein Blick war überheblich.
„Reverend, Sir, das ist überaus freundlich, aber ich werde morgen von meinen Freunden erwartet.“
Um nicht allzu schroff zu klingen fügte sie noch „Ein anderes Mal gerne“ hinzu, wünschte aber im selben Moment, sie könne die Worte rückgängig machen.
* * *
Eleonore öffnete die Tür zum Gemischtwarenladen. Die Glocken über dem Eingang kündigten geräuschvoll die Ankunft der neuen Kundin an.
Eleonore sah sich um. Es war stickig und staubig in dem kleinen Laden, aber er war vollgestellt mit den herrlichsten Sachen. Sie würde vorsichtig sein müssen, dass sie nicht zu viel Geld ausgab, nun, da sie jederzeit einkaufen konnte. In der Zeit auf der Hope Ranch war sie selten nach Silver Springs gekommen. Umso mehr hatte sie ansparen können, auch wenn sie regelmäßig Geld nach England gesandt hatte.
Aber heute gab es eine gute Ausrede, um etwas auszugeben: Sie würde morgen mit Ruth, die Einkäufe zu erledigen hatte, zusammen nach Trädgård zurückfahren. Das war der Name, den Gunnar dem neuen Zuhause gegeben hatte. Es bedeutete „Garten“ in seiner Sprache. Nun wollte sie kleine Einstandsgeschenke für alle kaufen.
Sie strich vorsichtig über die Samtbänder und über das Gewebe eines Stoffballens, von dem eine Elle Stoff abgewickelt war. Wahrscheinlich war er eben einem Kunden gezeigt worden.
Eleonore überlegte: Im Winter hätte sie viel Zeit, vielleicht könnte sie sich ein schönes Kleid schneidern. Sie schalt sich gleich eitel, aber über kurz oder lang würde sie der Versuchung wohl nicht widerstehen können.
Manuel hatte sie immer geneckt, dass sie ihr Geld in bescheidener, ja fast geiziger Manier zusammen hielt. „Sparst wohl für die Aussteuer, was?“, hatte er sie gehänselt.
Sie schlenderte noch ein wenig verträumt durch den Laden.
Außer ihr gab es noch eine weitere Kundin, die sich im Gespräch mit der Ladenbesitzerin befand.
Letztere hob gerade die Stimme: „Also, Miss!“
Der Tonfall, in dem sie „Miss“ sagte, machte Eleonore stutzig, so dass sie aus ihren Gedanken aufsah.
Die Kundin hatte schätzungsweise Ruths Alter. Sie war unüblich herausgeputzt und es sah aus, als ob sie geschminkt sei.
Eleonore konnte kaum mehr als ihren Rücken sehen, aber die Person machte trotz der Aufmachung einen eher schüchternen Eindruck auf sie.
Sie sprach relativ leise. „Aber ich habe Ihnen doch fünf Münzen gegeben, bekomme ich da nicht drei zurück bei dem Stückpreis?“
Die Antwort der Ladenbesitzerin war umso lauter und deutlicher. „Wollen Sie unterstellen, dass ich meine Kunden betrüge, Miss?“
Wieder diese verächtliche Betonung.
„Ich mache den ganzen lieben Tag nichts anderes als zu rechnen und Geld herauszugeben, da beherrsche ich das ja wohl im Schlaf.“
Leiser und bedrohlicher setzte sie hinzu: „Ich müsste Sie und Ihre „Cousinen“ auch gar nicht bedienen, wissen Sie?“
Die Kundin sagte noch etwas, sehr leise, nahm dann ihre Einkäufe und wandte sich zum Gehen. Auf dem Weg nach draußen sah sie Eleonore. Diese lächelte ihr freundlich und aufmunternd zu, fast schon im Reflex, denn die Frau machte ein ganz betrübtes Gesicht, so dass Eleonore Mitleid bekam.
Unsicher lächelte die Frau zurück.
Kaum war die Tür hinter ihr zugefallen, zeterte die Verkäuferin: „Was glauben die, wer sie sind? Sollen froh sein, dass ich sie überhaupt bediene. Ziehen unseren Männern doch schon genug Geld aus der Tasche, da kommt es auf die paar Cent, die ich sie übervorteile, nun wirklich nicht an. Ich hol‘ mir doch bloß zurück, was mir zusteht, sozusagen!“
Sie machte einen zischenden, verächtlichen Laut und brummelte dann in sich hinein: „Merkt die doch eh nicht, als ob die rechnen könnte!“
Eleonores Anwesenheit war ihr wohl gar nicht bewusst.
Diese stand auch wie angewurzelt und völlig verblüfft hinter dem Stoffballen und wusste nicht so recht, wie sie sich verhalten sollte.
Die Entscheidung wurde ihr abgenommen, als die Verkäuferin vor sich hin schimpfend in den hinteren Teil des Ladens verschwand und gleichzeitig die Tür aufging und mehrere Personen hereinkamen, so dass Eleonore zwischen ihnen nicht weiter auffiel.
* * *
„Eleonore! Wie gut dich zu sehen!“
Ruth umarmte sie herzlich.
„Nett hast du es dir hier eingerichtet. Klein aber fein, was? Erzähl schon, wie ist es mit Reverend Ebenzer?“
Sie rieb sich die Hände in einer gekonnten Parodie Washingtons.
„Ach, später mehr. Wie geht es euch? Hallo, Lucas!“
Eleonore küsste dem Kleinen auf das Fäustchen, das dieser ihr entgegenreckte. Er gluckste vergnügt.
Es war Samstag, der Tag versprach, wieder heiß zu werden.
„Komm, beeilen wir uns. Ich bin extra früh los, damit wir vor der Hitze zurück sind. Hier drinnen ist es aber auch recht warm. Im Winter musst du die Wände mit Stoff abdichten, hier zieht es dann sicherlich.“ Spitzbübisch fügte Ruth hinzu: „Oder du wärmst dich dann bei Reverend Washington auf!“
Eleonore protestierte laut.
Gleich wurde Ruth wieder ernst: „Eleonore, ich wiederhole mich, ich weiß, aber nimm dich in Acht. Komm im Winter lieber zu uns, du hast gesagt, es findet dann ohnehin kein Unterricht statt?“
„Ruth, lass uns erst die Einkäufe erledigen. Wir haben danach noch genug Zeit, uns zu besprechen“, unterbrach Eleonore die Freundin. Sie zog Ruth hinaus in die Hitze des Tages und sie arbeiteten schnell die Liste ab.
Der Weg nach Trädgård war erfrischend, da es durch die großen schattenspendenden Bäume angenehm kühl blieb. Eleonore schloss die Augen und sog die würzige Luft ein. Mit geschlossenen Augen ließ sie sich eine Weile vom gleichmäßigen Schaukeln des Wagens einlullen. Sie hatte Lucas auf dem Arm und spürte den kleinen warmen Körper und wie er sich mit jedem Atemzuge bewegte. Ein ganz weiches Gefühl erfasste sie.
Ohne die Augen zu öffnen sagte sie zu Ruth: „Schon komisch, nicht? Da kommen wir aus solch großen, lärmigen Städten wie London und Liverpool, wohnen in New York, und dann, kaum hat man uns vier Jahre in diese Einöde verpflanzt, erscheint es wie eine Wohltat aus dem Dorf Silver Springs heraus in die Natur zu kommen.“
Sie lachten beide.
„Aber das erneute Stadtleben hat auch Vorteile. Manuel würde begeistert sein: Ich kann endlich mein Geld ausgeben!“
Ruth lachte wieder: „Eleonore, du bist herzig. Was würde ich ohne dich nur machen!“
Die zwei Tage bei den Freunden vergingen wie im Flug. Sie sprachen gar nicht mehr über Silver Springs und auch nicht viel über Eleonores neue Stelle, viel zu quirlig ging es hier zu, mit Sven, der Eleonore gleich in Beschlag nahm, und auch mit seinem kleinen Bruder, der die meiste Aufmerksamkeit auf sich zog.
Ruth hatte sich dagegen entschieden, Sven im Ort unterrichten zu lassen.
Sie versuchte vielmehr, Eleonore zu überreden, dass sie in der freien Zeit und im Winter den Unterricht auf Trädgård mit Sven fortsetzten würde.
„Da lernt er mehr als bei Washington.“
Viel weiter erörterten sie das Thema jedoch nicht.
Gunnar und Eleonore ritten am Sonntagabend zurück nach Silver Springs. Er setzte sie vor ihrer Hütte ab. Nachdem sie ihm die Zügel für das Pferd in die Hand gedrückt hatte und zum Abschied winkte, rief er über die Schulter auf Schwedisch zurück: „Pass auf dich auf, Eleonore. Du kannst jederzeit zu uns kommen, wenn etwas ist!“
Das waren für Gunnar ungewöhnlich offene Worte. Warum machten sich denn alle Sorgen um sie? Sie kam doch gut zurecht.
* * *
Trotzdem fiel ihr die Eingewöhnung in das Stadtleben nicht so leicht wie gehofft.
Wann immer sie unterrichtete, war sie glücklich. Auch wenn die Kinder nicht einfach waren und ihr immer wieder viel Kopfzerbrechen bereiteten, so war es doch genau das, was sie machen wollte. Sie merkte auch, dass ihre ruhige Art und die Ermutigung zum eigenständigen Denken die Kinder in den Bann zogen. Nach einer anfänglichen Verwirrtheit der Schüler über diese ungewohnte Behandlung schien Eleonores Ansatz erste Früchte zu tragen.
Sobald sie jedoch im Dorf unterwegs war, hatte sie stets das Gefühl, auf der Hut sein zu müssen.
Die Männer in Silver Springs waren raue Gesellen und sie wurde viel beäugt. Sie erklärte sich das damit, dass sie neu war und in solch einem Städtchen sicher jeder jeden kannte und sie somit auffallen musste.
Die Frauen erschienen ihr auch nicht besonders herzlich oder offen.
Insgesamt fühlte sie sich fremd, ohne dass sie genau hätte sagen können, warum.
Es war daher nur ein diffuses Gefühl und sie schob es auf die neuen Umstände und die Eingewöhnung. Sie hatte noch keine Bekanntschaften geschlossen und niemand schien besonders interessiert daran.
Ihre Abende verbrachte sie meist bei der Lektüre eines der Bücher, welche Ms Golding im Laufe der Zeit geschickt hatte. Eleonore hatte sich aus Brettern ein kleines Regal an einer der Wände gezimmert und sah voller Stolz auf die glatten Einbände ihrer Schätze.
Eine eigene kleine Bibliothek – bescheiden, sicher – aber im Lauf der Jahre war sie durchaus gewachsen.
An einem besonders heißen Abend, es war ein Samstag im Juli und der Hof lag still da, trat sie vor dem Zubettgehen noch einmal ins Freie, um etwas frischere Luft zu bekommen. Es war einfach zu stickig in der kleinen Hütte und sie hatte das Gefühl, dass ihr bei jeder noch so kleinen Bewegung der Schweiß ausbrach.
Der Himmel spannte sich samtblau und unendlich über das dunkel daliegende Land.
Die Bäume waren nur in Umrissen zu erkennen, die Luft war voll von Sommergerüchen und ein wahres Zirp-Konzert erfüllte die Nacht.
Staunend sah Eleonore nach oben, wo eine unvorstellbare Zahl an Sternen blinkte und funkelte. Sie kam sich unendlich klein und unbedeutend vor, als sie dieses Himmelsschauspiel auf sich wirken ließ. Ob ihre Lieben gerade auch in die Sterne sahen und an sie dachten? Wie viele Menschen vor ihr schon hier gestanden hatten, wie viele nach ihr kämen? Und immer würden die Sterne Bestand haben. Ihr wurde ganz schwindelig und sie richtete den Blick zurück auf die Erde.
Als sie über den Hof hinweg Ebenezer Washington erkannte, der im Fenster seines Wohnzimmers sichtbar wurde und nach draußen blickte, trat sie schnell aus dem Lichtviereck heraus, das durch ihre Tür nach draußen fiel.
Als sie dabei gegen etwas Weiches stieß, entfuhr ihr ein kleiner Schreckensschrei.
Eine leise Stimme meldete sich: „Aua!“
Eleonore versuchte zu erkennen, wer da vor ihrer Hütte kauerte, konnte aber nicht viel sehen.
„Wer ist da?“, erkundigte sie sich mit schlagendem Herzen. Die Stimme war die eines Kindes gewesen, aber der Schreck saß ihr in den Knochen.
„Pst, ich bin’s nur“, wisperte die Stimme schüchtern und verhalten. Nun konnte Eleonore Umrisse erkennen und Augen, die sie treuherzig ansahen. Dann machte sie einen blonden Zopf aus, dessen unteres Ende im Mund des Kindes steckte.
„Nettie Miller! Was machst du hier draußen um diese Uhrzeit?“
Die Kleine sah sie nur stumm aus großen Augen an, sagte aber nichts und drückte sich verschämt gegen die Wand des Schuppens.
Eleonore sah zum Haus des Pfarrers hinüber. Er war nicht mehr zu sehen, aber ihr erschien es sicherer, die Unterhaltung nicht im Freien fortzusetzen.
Sie streckte Nettie die Hand hin, die die Kleine zögerlich ergriff.
„Komm, Nettie, wir gehen einmal hinein und dann erzählst du mir in Ruhe, warum du hier bist. In Ordnung?“
Sie glaubte, das Mädchen nicken zu sehen.
Als Nettie zaghaft hinter ihr eingetreten war, schloss Eleonore behutsam die Tür hinter ihrem kleinen Gast.
„Komm, setz dich doch, Nettie.“
Eleonore machte sich am Ofen zu schaffen, in dem sie in den heißen Monaten jene Sachen lagerte, die kühl bleiben sollten, das gusseiserne Gerät hielt die Hitze einigermaßen fern.
Sie holte einen Krug mit Minzlimonade hervor, den sie angesetzt hatte, da er ein wenig Kühlung versprach, und schenkte Nettie einen großen Becher davon ein.
Dann setzte sie sich zu dem Kind, das vorsichtig auf der äußersten Stuhlkante Platz genommen hatte und dabei damenhaft die Hände im Schoß hielt.
„So, Nettie. Jetzt verrate mir doch einmal, warum du um diese Zeit im Dunkeln unterwegs bist, wo man doch eigentlich zu Hause sein und in seinem Bett selig schlummern sollte. Bist du keines der Ranchkinder? Deine Eltern machen sich sicherlich Sorgen, wenn ihre Nettie nicht in ihrem Bett liegt.“
Erwartungsvoll sah sie Nettie an.
Die senkte den Blick, nahm dann aber den Becher mit der Limonade und trank schlürfend einen großen Schluck, wobei sie Eleonore über den Becherrand hinweg ansah.
Eleonore seufzte. Es war spät und heiß und sie war müde.
„Nettie, so kommen wir nicht weiter. Schau, du gehörst in dein Bett und ich muss auch schlafen. Nun sag mir schon, wo du wohnst, dann sag ich dem Reverend Bescheid und wir bringen dich heim.“
Nettie sah sie entsetzt an und schüttelte den Kopf.
„Bist du weggelaufen? Ist etwas passiert?“
Nettie steckte wieder das Ende ihres Zopfes in den Mund.
Eleonore stand auf und ging zur Tür.
„Du lässt mir keine andere Wahl. Nun muss ich den Reverend fragen, wo du wohnst. Er hat sicherlich ein Verzeichnis von allen Elternhäusern?“
Nettie sprang auf und machte endlich den Mund auf: „Ms Williams, bitte nich‘. Ich sag‘ Ihnen auch, wo ich wohn‘. Aber den Reverend mag ich nich‘. Der schleicht immer ums Haus und schaut zu den Fenstern rein, wenn in den Gardinen ‘nen Schlitz is‘.“
Eleonore starrte das Kind entgeistert an.
„Wie bitte?“
Nettie musste über eine ausgeprägte Fantasie verfügen. Warum sollte der Reverend...? Ein ungutes Gefühl machte sich in ihrer Magengegend breit.
„Also gut, Nettie. Ich bring‘ dich allein heim. Du wohnst also hier in Silver Springs?“
Nettie nickte. Eleonore band sich schnell die Haare wieder hoch, zog die Schuhe an und legte ein Tuch um. Nicht, dass es kühl gewesen wäre, aber es würde ohnehin zu Tratschereien kommen, falls man sie um diese Zeit sähe, dann wollte sie doch wenigstens komplett bekleidet sein.
„So, dann sei schön leise, damit wir niemanden wecken, ja?“
Nettie führte sie zu ihrem Erstaunen nicht in das Dorf hinein, sondern nahm den Weg, der hinaus führte.
Es standen nur noch wenige Häuser hier und nur in großen Abständen.
Es war nicht besonders hell, der Mond war nicht voll.
Gerade als Eleonore Nettie vorschlagen wollte, umzudrehen und doch am Morgen zurück nach Hause zu gehen, zog diese sie an der Hand in Richtung des letzten Hauses am Ortsrand, welches zurückgesetzt von der Straße stand.
Eleonore schluckte. Selbst wenn sie nicht schon gewusst hätte, um welches Gebäude es sich hier handelte, so hätte sie es spätestens an der roten Laterne erkannt, die über der Eingangstür leuchtete.
Nettie zog sie zur Rückseite und klopfte wie selbstverständlich an. Die Tür öffnete sich einen Spalt und Eleonore bekam vor Schreck weiche Knie:
Ein bulliger Kerl, so breit wie hoch, muskelbepackt und mit Glatzkopf, starrte sie feindselig an.
Dann bellte er los: „Hau ab. Wenn du deinen Mann oder Bruder suchst: Der is‘ bestimmt nich‘ hier.“
Eleonore wich zurück. Der Mann hatte Nettie offensichtlich noch nicht gesehen. „Ich wollte gar nicht,… ich wollte doch nur…“, stotterte sie.
Unangenehme Erinnerungen an den Tag im Central Park stiegen in ihr auf.
„Was willst du? Bestimmt nicht nach Arbeit fragen, Fräulein, oder? Du willst doch irgendeinen Kunden nach Hause zerren.“
Da meldete sich piepsig Nettie zu Wort: „Horatio, hör auf zu meckern. Das ist Ms Williams. Sie hat mich herbegleitet, weil sie nämlich ‘ne Dame is‘.“
Die Gesichtszüge des Mannes wurden mit einem Mal weich, was ihm völlig unvermittelt einen freundlichen, ja fast naiven Gesichtsausdruck verlieh, so dass der edle Name nicht so recht passen wollte. Eleonore starrte unverhohlen auf das Schauspiel, das sich bot. Der Mann machte die Tür ganz auf, lugte um die Ecke und nahm dann die kleine Nettie in seine großen Arme.
„Nettie, Zuckerschnecke!“, nuschelte er. „Da bist du ja. Du sollst doch nicht immer ausbüchsen. Deine Mama wird doch sonst böse auf mich. Und dann werd‘ ich traurig. Und ich werd‘ auch traurig, wenn du ausbüchst und draußen passiert dir vielleicht was.“
An der Art, wie er sprach, erkannte Eleonore, dass er das Gemüt eines Kindes hatte, was im krassen Gegensatz zu seiner Statur stand.
Eleonore wollte gerade ansetzen, ein paar Fragen zu stellen, als ein Mann die Treppe heruntergepoltert kam, die man vom Hintereingang aus sah und die in einen großen Raum im vorderen Teil des Gebäudes führte, der scheinbar als eine Art Salon eingerichtet war. Vermutlich wurden dort die Gäste empfangen und Drinks ausgeschenkt. Eleonore trat in den Schatten zurück, damit man sie nicht sehen konnte. Wer wusste schon, wer alles in diesem Etablissement verkehrte.
Hinter dem Mann waren leichtere Schritte zu hören.
Nettie, die halb im Türrahmen stand, quiekte begeistert: „Mutti!“
Eleonore lugte vorsichtig um die Ecke, während Horatio das Kind am Arm zurückhielt: „He, Nettie, nich‘. Deine Mama arbeitet. Da haben kleine Madames wie du nichts zu melden.“
Eleonore sah, wie die Frau sehnsüchtig zu ihrer Tochter hinübersah und nur den Kopf schüttelte. Diese ließ die Schultern hängen und nahm wieder das Ende ihres Zopfes in den Mund. Eleonore wurde das Herz schwer.
Nettie war die Tochter einer Hure. Einer Hure, die wollte, dass ihr Kind unterrichtet wurde, damit die Kleine es einmal besser im Leben treffen würde als sie selbst.
Es war dieselbe Frau, die vor einiger Zeit im Laden von der Verkäuferin übervorteilt worden war…
In dieser Nacht fand Eleonore lange keinen Schlaf. Zuviel ging ihr durch den Kopf. Durch Nettie kamen Erinnerungen an Ada hoch. Eleonore betete stumm für die Seele des kleinen Mädchens aus London und die ihrer Mutter.
Sie würde alles in ihrer Macht stehende tun, dass Nettie eine gute Bildung bekam und bessere Chancen im Leben haben würde als ihre Mutter.
Und Eleonore würde, so gut es ging, dieses Geheimnis hüten. Wenn herauskäme, wer Netties Mutter war,… Sie wunderte sich darüber, wie die es überhaupt geschafft hatte, ihre Tochter anzumelden, ohne dass es weiter aufgefallen wäre, dass hier eine Hure,…
Der Reverend hätte doch sicherlich nicht das Kind einer Sünderin aufgenommen? Netties Worte klangen in ihrem Kopf nach: „Der schleicht immer ums Haus und schaut zu den Fenstern rein, wenn in den Gardinen 'nen Schlitz is‘.“
Jetzt war ihr auch klar, was er da hoffte zu sehen. Dabei wetterte er doch stets gegen jede Art von Sünde und Laster. Es schüttelte sie. Ruth hatte ganz recht mit ihrer Meinung über den Mann. Sie würde noch wachsamer sein!
Schließlich fiel sie in einen unruhigen Schlaf und träumte merkwürdige Dinge:
Reverend Washington hielt Gericht. Zu seiner Seite saß sein Schoßhund.
Der Name Chastity für das Tier war ein Witz – Eleonore hatte zufällig beobachtet, wie die vermeintlich keusche Hundedame bei nächster Gelegenheit eine streunende Hündin besprungen hatte. Es handelte sich bei Chastity also entgegen der Annahme des Reverends um einen räudigen Hund.
Hund und Herrchen in ihrem Traum bildeten einen scharfen Kontrast in weiß und schwarz.
Eleonore stand vor dem Richtertisch, Netties kleine Hand in ihrer. Der Reverend fällte sein Urteil: „Eleonore Williams, Sie werden verurteilt, weil Sie gelogen haben.
Die Überfahrt nach Amerika: Erschwindelt.
Die Gouvernantenausbildung: Erschwindelt und erlogen.
Ferner werden Sie für schuldig befunden, sich mit Gesindel und Sündern gleichgetan zu haben.
Das Schlimmste jedoch ist Ihr Eigensinn, in dem Sie meinen, Frauen hätten die gleichen Rechte und die gleichen geistigen Kapazitäten wie Männer.
Zur Strafe wirst du als mein Eheweib Gehorsam lernen.“
Der Ebenezer in ihrem Traum lachte schallend und ließ sich dann von seinem Hund die Hand abschlecken.
* * *
Am nächsten Morgen wachte Eleonore früh auf, schweißgebadet.
Es war Sonntag.
Der seltsame Traum geisterte ihr noch als unangenehmes Gespenst der Nacht im Kopf herum, nachdem sie sich mit dem schon lauwarmen Wasser, das sie sich am Abend vorher aus dem Brunnen geholt hatte, gewaschen hatte und hinüber ins Haus des Pastors ging, wo Mrs Robbins ihr mürrisch wie immer ein Frühstück hinschob.
Eleonore hatte aufgegeben, mit Mrs Robbins warm zu werden. Die Frau wollte offensichtlich nicht, dass man mit ihr sprach. Wenn sie das Bedürfnis hatte, sich mitzuteilen, dann völlig unvermittelt, und sie wünschte scheinbar nie, dass man irgendetwas erwiderte, sie brauchte nur hin und wieder ein Publikum.
So löffelte Eleonore schweigend ihren Haferbrei.
Sie würde, so hatte sie sich vorgenommen, heute ein wenig in den Wald hinaus spazieren, nicht zu weit vom Ort entfernt, aber doch so, dass sie die vergleichsweise kühle Frische, die unter den dunklen Wipfeln herrschte, ungestört mit einem Buch genießen konnte. Vielleicht würde sie etwas Papier zum Schreiben mitnehmen, um die letzten Briefe zu beantworten oder neue Unterrichtsstunden zu entwerfen.
Ob sie nach Nettie sehen sollte? Dann kam ihr aber der Gedanke, dass wahrscheinlich der Sonntag der einzige Tag war, den Mutter und Tochter miteinander verbringen konnten und sie nahm wieder Abstand von der Idee.
Gerade wollte sie sich erheben, als Reverend Washington die Küche betrat.
Er nickte ihr zu. Noch ganz unter dem Eindruck ihres Traumes, senkte sie schnell den Blick und grüßte.
„Ms Williams, welch erfrischender Anblick an diesem heißen Tag!“
Er sagte nichts weiter und so nickte sie ihm auch nur kurz zu und wollte sich dann an ihm vorbei nach draußen stehlen. Er stand mit dem Rücken zu ihr und blickte hinaus. Es blieb nur ein kleiner Raum zwischen ihm und dem Tisch, gerade breit genug, dass sie sich hindurch zwängen konnte, ohne dass es unschicklich geworden wäre.
Als sie sich jedoch an ihm vorbeischob, darauf bedacht, ihn ja nicht zu berühren, aber nah genug, um sein zurückgekämmtes pomadiertes Haar glänzen sehen zu können, drehte er sich herum, so dass sein Gesicht genau über ihrem zu schweben schien. Eleonore errötete und drückte sich so weit wie möglich von ihm weg, so dass sie die harte Tischkante im Gesäß spürte.
Washington musterte sie.
„Beten Sie auch hinreichend oft, Ms Williams? Ich mache mir ein wenig Sorgen um Ihr Seelenheil. Der Gottesdienst beginnt gleich, Ms Williams. Ich würde es begrüßen, Sie dort zu sehen. Sie haben doch als Lehrerin auch eine Vorbildfunktion hier in Silver Springs.“
Die Worte flossen ihm ölig von den Lippen, aber Eleonore hörte den strengen Unterton. Sie nahm sich zusammen. Wahrscheinlich hatte er Recht, sie sollte sich im Gottesdienst blicken lassen, auch um keinen Tratsch aufkommen zu lassen. Wer wusste schon, was die Leute sonst dachten?
Und mit der Krähe wollte sie es sich auch nicht verscherzen.
„Wie wahr, Reverend. Es ist höchste Zeit, dass ich den Gottesdienst besuche. Ich sollte trotz meiner Migräne, die mich manches Mal heimsucht, nicht so oft fernbleiben.“
Die Migräne war eine Ausrede, um zu entschuldigen, warum sie bisher noch nicht dort gewesen war.
So saß sie eine halbe Stunde später im Gottesdienst und ballte vor Zorn die Fäuste.
Was der Pastor von sich gab, war fürchterlich altmodisch und gespickt mit so vielen falschen Zusammenhängen und Aussagen. Der fromme Mann schien sich sein Weltbild zurechtzubiegen, wie es ihm gerade passte.
Eleonore sah sich verstohlen um.
Die Leute um sie herum schienen sich in keinster Weise an dem zu stören, was er predigte.
Der bescheidene Raum war nicht sehr voll: In einer Stadt, die zum überwiegenden Teil aus Minenarbeitern bestand, hatte ein Großteil der Menschen keinen Sinn oder keine Muße für die Andacht am frühen Morgen.
Eleonore sah die Ladenbesitzerin Mrs Bennet, die vor einiger Zeit Netties Mutter übervorteilt hatte. Sie saß mit frömmelnder Miene da und hing an Washingtons Lippen, als ob er persönlich gerade vom Berge Sinai herabgestiegen sei.
Ihr Mann saß neben ihr, den Kopf gesenkt, den Hut in der Hand, mit hängenden Schultern.
Mrs Robbins war ebenso dort. Bei sich dachte Eleonore gemein, dass der Reverend sie vermutlich dafür bezahlte, damit es in seiner Kirche nicht so leer bliebe.
Ein paar andere Gesichter erkannte sie, auch beim Betreten der Kirche hatte man ihr vereinzelt zugenickt. Eleonore hatte sich dabei aber nicht so sehr begrüßt oder willkommen geheißen gefühlt, sondern vielmehr skeptisch beäugt.
Sie straffte die Schultern. Sie war nicht abhängig von der Meinung dieser Menschen, sie wollte lediglich den Kindern etwas Vernünftiges beibringen.
Schließlich setzte sich Washington noch an das alte Klavier, ein völlig verstimmtes, abgewetztes Instrument, und klimperte mehr schlecht als recht ein Liedchen, dem Herrn zum Lob und Preis.
Es war schauerlich.
Als Eleonore endlich in die gleisende Mittagshitze hinaustreten konnte, war sie mehr als froh. Bloß weg hier, raus in den Wald, um Körper und Geist zu erfrischen.
* * *
Aber daraus wurde nichts. Reverend Washington vereitelte ihr zum zweiten Mal an diesem Tag den so schön zurechtgelegten Plan.
Als sie gerade aus ihrer kleinen Hütte herauskam, den Sonnenhut unterm Arm, einen kleinen Korb mit Buch, Schreibutensilien, Limonadenkrug und einigen Früchten in der Hand, lief Washington in langen Schritten über den Hof auf sie zu.
Sie konnte nicht mehr so tun, als ob sie ihn nicht gesehen hätte, es war zu offensichtlich, dass er zu ihr wollte. Sie blieb also im Schatten stehen und wartete.
Als er bei ihr angekommen war, zog er sein großes weißes Taschentuch aus der Tasche und wischte sich den Schweiß von der Stirn.
„Ms Williams!“ Es klang wie ein Zischen. Eleonore hatte sich schon daran gewöhnt, dass jedes Zusammentreffen mit der Krähe auf seine eigene Art merkwürdig war.
Schicksalsergeben erwiderte sie so höflich es ihr möglich war: „Reverend Washington! Eine… interessante Predigt.“
Für einen Moment blitzte ein Ausdruck über sein Gesicht, als wäre er wie ein kleiner Junge gelobt oder wie ein Hund getätschelt worden.
„Das freut mich, Ms Williams. Ich würde gerne… en detail…“, hier pausierte er aufmerksamkeitsheischend ob der vornehmen französischen Vokabel, „…mit Ihnen darüber sprechen und meine Gedanken, die mich bei der Predigt bewegten – ja ich möchte fast sagen, zu ihr bewegten – noch ein wenig fortführen. Kommen Sie doch mit und leisten Sie mir beim Essen Gesellschaft. Mrs Robbins hat einen Braten zubereitet.“
Eleonore wand sich innerlich. Die Aussicht auf Braten bei dieser Hitze und dann noch in Gesellschaft des frommen Mannes trieb ihr zusätzlich Schweiß auf die Stirn. Kurz dachte sie wehmütig an das schattige Plätzchen beim Bach im Wald, welches sie sich für heute ausgesucht hatte.
Es sollte wohl nicht sein...
Einen letzten Versuch unternahm sie doch: „Reverend, das ist sehr freundlich und ich fühle mich wirklich geehrt, dass Sie ihre Gedanken mit einer unwissenden und törichten Frau wie mir teilen wollen…“
Ihm entging der leichte Sarkasmus in ihrer Stimme, den sie sich nicht hatte verkneifen können, völlig. Er nickte nur eifrig, während sie fortfuhr: „…aber ich verspüre bei diesen Temperaturen wirklich keinen Hunger und ich wollte gerade etwas vor der Hitze flüchten.“
Ebenezer sah sie streng an. Wieder klang sein Ton mehr nach Befehl als nach Frage: „Aber Sie müssen doch etwas essen. Und Mrs Robbins wäre gekränkt. Was Ihren Spaziergang angeht: Ich begleite Sie gerne nach dem Essen.“
Und somit war das Schicksal ihres Sonntages besiegelt. Seufzend fügte sie sich, es schien kein Entrinnen zu geben.